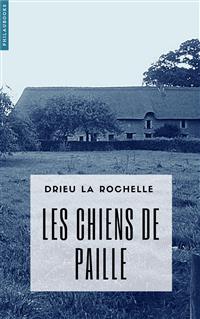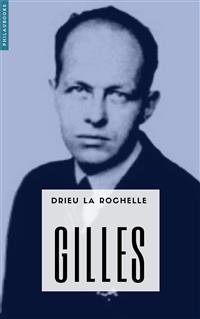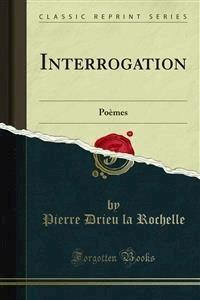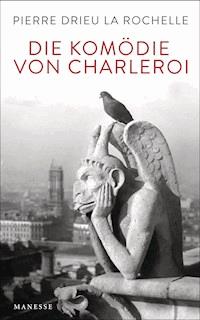
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manesse
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lebenshunger und Todessehnsucht, patriotische Gefühle und Desillusionierung: Pierre Drieu la Rochelles brillante Erzählungen spiegeln die innere Zerrissenheit des streitbaren Autors wider. Einer, der sich romantisch nach Heldentum sehnte, beschreibt hier die Absurdität des Ersten Weltkriegs und die schmerzliche Orientierungslosigkeit der Heimkehrer.
Madame Pragen, eine ehrgeizzerfressene Pariser Witwe, hat 1914 ihren schmächtigen Sohn in den Krieg geschickt, um einen Helden aus ihm zu machen. Er fiel in den ersten Tagen während eines bedeutungslosen Scharmützels im belgischen Charleroi. Im Jahr 1919 nutzt nun seine Mutter einen Besuch des Schlachtfelds, um sich vor den provinziellen Honoratioren der Stadt als Grande Dame zu inszenieren. In «Der Hund der Heiligen Schrift» brüstet sich ein junger Veteran mit Verdun. Doch in der Kinoreihe vor ihm sitzt ein ehemaliger Kamerad ...
Auf Anhieb fasziniert der flirrende Ton des Erzählers. Seine zynische Lässigkeit, sein stetiges Abtasten der Realitäten, die umso drastischer wirkende Überzeichnung einzelner Figuren: Diese Prosastücke bieten einen schillernden Rückblick auf das Schlüsselerlebnis einer irrlichternden Generation.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Einer, der sich romantisch nach Heldentum sehnte, beschreibt hier die Absurdität des Ersten Weltkriegs und die schmerzliche Orientierungslosigkeit der Heimkehrer.
«Bei Drieu la Rochelle findet sich die ganze Zerrissenheit der Epoche zwischen den Weltkriegen wieder, die labile Naturen von einer totalitären Ideologie zur anderen taumeln ließ.»
Tilman Krause, Die Welt
«In seinen besten Büchern ist Drieu kein ‹verruchter›, sondern ein begnadeter Schriftsteller gewesen.»
François Bondy
PIERRE DRIEU LA ROCHELLE (1893–1945) nahm am Ersten Weltkrieg teil. Danach führte er ein mondänes Leben als Romancier und Journalist. Zunächst stand er linken Idealen nahe, kollaborierte aber während des Vichy-Regimes mit den Nazis. 2012 wurde er in die Bibliothèque de la Pléiade aufgenommen.
PIERRE DRIEU LA ROCHELLE
Die Komödie von Charleroi
Erzählungen
Aus dem Französischen übersetztvon Andrea Spingler und Eva Moldenhauer
Nachwort von Thomas Laux
MANESSE VERLAG
ZÜRICH
DIE KOMÖDIE VON CHARLEROI
1
Madame Pragen beschloss, dass wir am 1. Juli nach Charleroi aufbrechen sollten. Als sie von dieser Reise zu sprechen begann, hatte ich einen anhaltenden Schrecken auf mich zukommen sehen. Doch da ich Madame Pragens Sekretär war, musste ich mich fügen.
Vor der Abreise verbrachte ich bei Coralie, meiner damaligen Geliebten, eine schlaflose Nacht, weil ich befürchtete, ich könnte morgens zu spät zum Bahnhof kommen. Ich brach eine Stunde zu früh auf. Coralie fand meine Eile verständlich, da die überaus reiche Madame Pragen ihr Respekt einflößte.
Ich ging vor dem Zug auf und ab und musste an den August 1914 und die ungeheuren Massen von Reservisten denken, die von Norden nach Osten oder von Osten nach Norden fuhren, ich weiß es nicht mehr, und die ich über diesen Bahnsteig, wo ich Wachsoldat war, wie einen Sturm hereinbrechen sah. Sie waren betrunken und sangen die «Marseillaise». Bestimmt waren es dieselben, die ich am 1. Mai auf der Place de la République dabei beobachtet hatte, wie sie die «Internationale» sangen. Männer lieben es, sich zu betrinken und zu singen; was sie singen, schert sie wenig, wenn es nur schön ist; und die unsterblichen Lieder sind immer schön. Ein Teil von mir berauschte sich an diesem dröhnenden Schauspiel, an diesem leichtfertigen Aufbruch, an diesem unbekümmerten Eifer. Würden ich und mein Pariser Regiment nicht auch morgen aufbrechen? Und dann würde gegrölt. Tatsächlich brachen wir am 4. August auf, und Claude Pragen war mit dabei.
Madame Pragen kam auf den Bahnsteig. O Gott! Der vorausgesehene Schrecken begann. Madame Pragen war in die Rolle einer Oberschwester geschlüpft, mit vollem Ordensschmuck. Ich sollte also acht Tage lang neben all diesen Farben herumlaufen, die auf mich abfärben würden. Wir schrieben das Jahr 1919.
Eitel und verstört kam sie an. Ihr blassblauer, kühler, unruhiger Blick suchte andere Blicke, und wenn er sie traf, irrte er hastig weiter. Sie ging rasch, wirkte aber angestrengt, war ein wenig gebeugt, ein wenig krummbeinig und umklammerte mit den knochigen Händen eine riesige, ziemlich dunkle, aber mit einem übergroßen Monogramm versehene Ledertasche.
Als sie mir mit ihrer affektierten Höflichkeit, die mich so demütigte, Guten Tag sagte, entblößte ihr spitzer Mund noch immer schöne, lange Zähne. Ihre Stimme war ramponiert wie ihr Gang; und doch war darin eine überraschende Energie zu spüren. Mit dem Seufzen, das sie seit vier Jahren zu ihrem Lebensinhalt machte, ließ sie sich in der Ecke nieder, die ich für sie eingerichtet hatte. Sie sah erfreut, dass noch zwei weitere Personen da waren, die sogleich sehr beeindruckt zu sein schienen; sie würde Zuhörer haben. Sie breitete Zeitungen, Briefe und Papiere um sich aus. Dann richtete sie ihre Lorgnette auf unsere Nachbarn, die dicke, wohlhabende Bürger waren, und sagte zu mir: «Wir kommen um 11.35 Uhr in Charleroi an; der Bürgermeister und Madame Warrin erwarten uns.»
Das verfehlte nicht seine Wirkung; das Ehepaar erbebte in seinem Fett und starrte sie mit unendlich ehrfürchtigen Augen an.
Als der Zug abgefahren war, las sie Briefe mit offiziellem Briefkopf noch einmal durch, die sie schon zehn Mal gelesen hatte und die sie offen auf dem Sitz liegen ließ, dann überflog sie den «Figaro» und den «Matin».
«Oh, Désiré reist nach Rouen. Er hatte mir nicht gesagt, dass er nach Rouen reist.»
«Nein.»
«Wie Désiré sich abmüht!»
Die Augen des Ehepaars schienen vor lauter Neugierde und Bewunderung zu schmerzen, denn Désiré Bonsieur war schon zehn Mal Minister gewesen.
Ein charakteristischer Wesenszug Madeleine Pragens war ihre Gier nach Öffentlichkeit. Sie musste selbst im Licht der Öffentlichkeit stehen oder an dem Licht teilhaben, in dem bekannte Persönlichkeiten standen. Zurzeit wurde dieses Bedürfnis befriedigt, da Désiré Bonsieur, einer der Größen des Bloc national1, zum elften Mal Minister geworden war.
Ich wusste, wie viel diese illustre Beziehung sie gekostet hatte. Denn wenn Bonsieur der Witwe Pragens auch in unerschütterlicher Freundschaft verbunden blieb, so hatte sie doch einst allerlei Aufwand treiben müssen, um die Frau jenes bemerkenswerten Geschäftsmanns zu werden. Es war nicht ganz einfach gewesen. Pragen war in die hübsche Madame Durfort verliebt und wollte nicht seine Cousine heiraten. Doch Madeleine Muller hatte ein bezwingendes Mittel gefunden; sie hatte so verbissen gefastet, so rasch abgenommen, dass Pragen, hart gegenüber den Männern, aber aus lauter Gutmütigkeit dumm gegenüber den Frauen, sich von der in Tränen aufgelösten Familie die blasse Ehrgeizige zuführen ließ. Und so war meine Chefin in den Windschatten Bonsieurs, des Busenfreunds von Pragen, gelangt, um sich nie wieder daraus zu lösen.
Während der ganzen Fahrt sprach Madame Pragen zu ihrem Publikum: Und sie sprach so gut, dass die Reisenden, die durch den Gang kamen, vor unserer Tür stehen blieben, angesteckt von der Aufregung, die dem Ehepaar die Luft abschnürte und beinahe zu einem zweifachen Stimmversagen führte, als sie endlich geruhte, die beiden anzusprechen, worauf sie brannte, seit wir das Abteil betreten hatten.
«Danke, Monsieur, aber ich habe genügend Platz. Bitte verzeihen Sie, aber ich bin recht schwach, und diese Reise ist eine ungemein schwere Prüfung für mich.»
Die schmeichlerischsten Laute sprudelten von den Lippen des Ehepaars.
In ihrer spröden Eitelkeit hatte diese Frau einen Sohn geboren. Wie kann man empfangen ohne Erregung? Schwanger sein ohne Leidenschaft? Eines Tages hat sie mich verblüfft, als sie mir sagte, sie habe Claude gestillt. Armer kleiner Claude: Er war ihr ganz dünn geraten, und doch hatte sie ihn schon sehr früh gedrängt, in die Fußstapfen Bonsieurs zu treten und eine Blitzkarriere zu machen. Seine Zartheit verleugnend, hatte sie gewollt, dass er Soldat wurde. Mit kaum fünfzig Jahren schien sie bereits nicht mehr zu wissen – doch bestimmt war es schon immer so gewesen –, dass sie Brüste, dass sie einen Unterleib besaß. Viel mehr als die schlechte Gesundheit zehrte eine Leere an ihr, jene Leere, die ihren Augen eine für mich zeitweise absolut unerträgliche Kälte verlieh.
Sie schloss die Augen. Das war nun ihre ewige Komödie. Obgleich wirklich müde, denn ihr Wille zerrte den durch Neurosen und Medikamente vorzeitig gealterten Körper stets zu viel umher, musste sie auf ihrem Gesicht jetzt eine moralische Tünche auffrischen, die allerdings die Schatten der Müdigkeit noch vertiefte.
Ihr Mann hatte sie vernachlässigt, doch bestimmt hatte sie niemals Liebhaber gehabt. Ihr Leben war voller Absichtserklärungen und Vorspiegelungen gewesen. Bei allen ging es um gesellschaftliche Geltungssucht. Zehn Jahre lang hatte sie vorgegeben, sich mit Archäologie zu beschäftigen, fünf Jahre lang hatte sie vorgegeben zu malen. Jetzt spielte sie die Krankenpflegerin. Zugleich hatte sie sich ihr Leben lang krank gestellt, um ihr Scheitern und Aufgeben zu rechtfertigen. Und selbst was sie tatsächlich tat, schien sie noch vorzutäuschen.
Ein langes mageres Gesicht mit etwas Charmantem, Kindlichem, Jungem in der Rundung der Wangen und einem eigensinnig vielsagenden, trügerischen und introvertierten Lächeln von abstrakter Eitelkeit.
«Sie sind gewiss Belgier?»
«Ja, Madame. Ja, Madame. Wir sind Wallonen, direkt aus Charleroi.»
«Ach, dorthin fahre ich – mit meinem Sekretär. Ich will das Grab meines Sohnes suchen, der in Ihrem Land gefallen ist, im August 1914.»
«Oh, Madame … Wir verstehen … Aber … Können wir …?»
«Vielen Dank. Monsieur Guillemotte wird sich selbst um mich kümmern, und Madame Warrin.»
Das Gesicht des Paars erstrahlte in vereinter Zufriedenheit.
«Oh, dann sind Sie in guten Händen. Wir dachten … Wir kannten nämlich …»
«Kennen Sie Madame Warrin persönlich?», fragte Madame Pragen und richtete streng ihre Lorgnette auf das Paar.
«Das heißt … meine Frau hat eine Cousine …»
«Meine Cousine ist Madame Warrins Schwägerin», stammelte die Dame errötend.
«Aha», murmelte Madame Pragen, die diese Referenz schicklich, aber ein wenig entlegen fand. «Übrigens», fuhr sie nach einer Pause fort und zeigte mit besitzergreifender Hand auf mich, «Monsieur war der Kamerad meines Sohnes Claude Pragen (um zu sehen, wie dieser Name wirkte, musterte sie wieder das Paar, dem seine Unwissenheit und gleichzeitig Scham anzumerken waren), er hat ihn sterben sehen, den armen Jungen, und wird mich auf die Schlachtfelder führen.»
Warum sagte sie die Schlachtfelder?
Trotz ihrer offen bekundeten Verachtung für diese Noizons oder Noizants – das hatte sie nicht genau verstanden – konnte Madame Pragen es nicht lassen, ein Gutteil der Fahrt mit ihnen zu sprechen. Ich konnte mich träumend in diesen Landschaften verlieren, an die ich mich so wenig erinnerte, obwohl ich sie zu Fuß durchquert hatte. Aber ich hatte sie mit befangenem Blick gesehen, der forschend ins Weite ging. Und die Müdigkeit oder vielmehr die Langeweile des Marschierens war mir von den Füßen und vom Kreuz bis hinauf in die Augen gestiegen. Nun, da ich sie bequem im Sitzen und mit dem ästhetischen Wohlgefallen eines in den Schoß des tiefsten Friedens Zurückgekehrten betrachtete, fragte ich mich im Übrigen, welchen Unterschied ich zwischen diesem Landstrich und vielen anderen hätte ausmachen können.
Ab und zu stellte Madame Pragen mir eine Frage, denn sie mochte es nicht, dass ich träumte, was ja tatsächlich ein zeitweises Aussetzen meines Diensteifers bedeutete. Ich antwortete so gut es ging; doch zum Glück lag ihr wenig an meiner Antwort. Sie wandte sich ab und fügte noch manches zu all dem hinzu, was sie den Noizons bereits von ihrem Ruhm und dem Ruhm ihrer Bekanntschaften enthüllt hatte.
Ohne dass sie viel dafürkonnte, unterstrich ihre Lorgnette die Schroffheit ihrer Neugier oder ihrer Gleichgültigkeit noch zusätzlich.
Endlich kamen wir an, und die augenblicklich vergessenen Noizons trösteten sich damit, dass sie auf dem Bahnsteig aus nächster Nähe eine denkwürdige Begrüßungsszene verfolgen durften. Ein wenig verblüfft stellte ich fest, dass Madame Pragen von Monsieur Guillemotte, Madame Warrin und anderen, die sie mitgebracht hatten, mit wahrhafter Ehrfurcht behandelt wurde. Denn sie hatte ihren Sohn hingegeben; sie hätte ihn sogar zum Abmarsch gedrängt, wäre er nicht selbst so entschlossen gewesen. Das also hatte sie, die enge Freundin eines Bonsieur, für Frankreich und Belgien getan. Und das war noch nicht alles. Hatte sie nicht ein belgisches Dorf adoptiert? Die Toten und die Lebenden kündeten gleichermaßen von ihrem Ruhm.
In den Augen Madame Warrins jedenfalls verkörperte Madame Pragen alles, was Pariser Vornehmheit sein mochte. Verkörperte sie das auch für mich? Ich war unschlüssig. Da wir gewohnt sind, eine gewisse Zartheit des Knochengerüsts mit Vornehmheit zu verwechseln, ließ ich mich von den dünnen Fingern meiner Chefin betören. Sie war sehr schlank gewesen, und sie war es noch fast genauso wie auf dem Porträt von Bonnat2. Es gab in diesem langen, recht schmalen Gesicht eine gewisse Anmut in der Entartung. Aber sie hatte große Füße und breite Zehen; und ihre ziemlich kleinen Ohren standen ab; und, recht besehen, waren ihre Finger zwar dünn, aber die Fingerknochen dick. Kurzum, hätte sie nicht die jüdischen Merkmale3 besessen – ihr Nacken war ein wenig servil, ihre Hüften ein wenig formlos –, wären ihr die geblieben, die man oft in den noblen Wohngegenden findet.
Wir wurden durch das trübselige Charleroi bis zu Madame Warrins Haus gebracht, wo Madame Pragen sich mit dem lebhaften Vergnügen einquartierte, das eine kleine Ersparnis ihr bereitete, mochte sie sonst auch verschwenderisch sein.
Bis zum nächsten Morgen langweilte ich mich gewaltig, denn Madame Pragen gab noch einmal auf größerer Bühne die Szene aus dem Zug zum Besten – eine Szene, die ich in Paris bereits hundert Mal erlebt hatte. Aber, werden Sie sagen, warum sind Sie Sekretär geworden, wenn Sie nicht das geduldige Gemüt eines Höflings haben? Nach Kriegsende und ohne meinen Sold war ich sehr froh, von heute auf morgen diese Stelle zu finden, die mir die Zeit verschaffte, eine andere zu suchen. Weil ich leider faul, wenig intrigant und ganz benommen war inmitten des zivilen Lebens, blieb ich da hängen.
Man sieht vieles um sich herum, man ist für tausend Dinge empfänglich; nichtsdestoweniger beherrscht die Langeweile das Gehirn, während darunter mechanisch die Beobachtungsgabe arbeitet. So konnte ich mich nicht besonders für das Schauspiel der unglaublichen Erregung begeistern, mit der Madame Warrin sich auf Madame Pragen stürzte. Langeweile der Provinz, die plötzlich über einen Hauch von Paris herfällt; Gefühle des Bedauerns, die sich in einem gewissen Alter beim Anblick einer beliebigen Person einstellen; Neid, der einen weniger lebendigen Körper vor einem reger scheinenden Körper ergreift, weil er von der Elektrizität des Reichtums und öffentlicher Aufmerksamkeit durchströmt ist – all das drückte sich auf dem fetten, glänzenden Gesicht Madame Warrins aus. Ein so beredtes Mienenspiel hätte mich erstaunen können. Denn wenn es bei ihr üblich war, wieso hatte es keinerlei Spur, keinerlei Runzel in diesem vollen, glatten Fleisch zurückgelassen?
Zum Abendessen kam eine ziemlich große Gesellschaft zusammen, obwohl Madame Pragen angeblich niemanden sehen wollte. Im Übrigen schienen mir die versammelten Honoratioren zwar bedeutend, aber gleichsam unter den fragwürdigsten ausgewählt zu sein. So war es immer, denn die Leute, die von Madame Pragen angezogen wurden, waren immer diejenigen, bei denen sie gefahrlos versuchen konnte, mit ihren unglaublich billigen Tricks Eindruck zu schinden. Stets zufrieden mit dieser mittelmäßigen Zuhörerschaft, schien sie zu verkennen, dass es auch eine andere, etwas kritischere hätte geben können.
Nach dem Essen machte ich mich aus dem Staub und ging ohne Erwartungen in einer Stadt spazieren, die mich an die tristesten und ältesten Industriestädte Englands erinnerte und deren einzige Sehenswürdigkeit ein paar von den Deutschen niedergebrannte Häuser waren.
II
Am nächsten Tag brachen wir schließlich auf zu den Schlachtfeldern, wie Madame Pragen zu sagen pflegte. Es lockte und ängstigte mich zugleich.
In Esquemont stiegen wir aus dem Wagen. Und auch da empfing uns wieder der Bürgermeister. Dieser Bürgermeister stand ebenso verdutzt vor Madame Pragen wie der andere; aber auf andere Weise, nicht mehr wie ein Bourgeois, sondern wie ein Bauer: weniger unterwürfig, aber staunender und von seinem Staunen überwältigt.
Ich erkannte das Dorf nicht wieder: Mein Regiment war in der Nacht vor der Schlacht durchmarschiert, um sich in einiger Entfernung niederzulassen, und der Rückzug hatte uns in eine andere Richtung geführt. Mein Gedächtnis war so schlecht, dass ich sogar den Namen vergessen hatte, der jedoch plötzlich eine dicke Schicht von Erinnerungen in mir aufrührte.
Der Bürgermeister ging mit uns zu Fuß querfeldein; die Orte, die uns interessierten, waren ziemlich weit entfernt. Er entschuldigte sich dafür, doch Madame Pragen, die sich im Dorf – diesem Dorf, dessen Patin sie war – bisher als diskrete und gute Schutzherrin geriert hatte, der es Freude machte, Wohltätigkeit zu üben, und die bereit war, mit jedermann zu reden, sprach auf einmal wieder mit ihrer gebrochenen Stimme.
«Ich marschiere gern. Mein armer Junge ist noch viel mehr marschiert.»
Ich betrachtete sie plötzlich mit neuem Interesse. War sie aufrichtig? Die Worte dieser Frau klangen stets gewollt. Ich hatte nicht an den Kummer geglaubt, den sie seit vier Jahren mit großem Aufwand zur Schau stellte. Dieser letzte Satz aber erschütterte mich; niemals hatte ich einen so theatralischen Ton von ihr gehört, doch spürte ich darin auch eine Anspannung, die mich überraschte. War es das Bemühen, zum Kummer durchzudringen? Oder im Gegenteil etwas Wahres, das immer da gewesen war und endlich unter den förmlichen Gewohnheiten zum Vorschein kam? Heute scheint es mir fast so, wenn ich bedenke, wie viele Leute nicht einmal im Schmerz Phantasie zeigen können. Sie täuschen uns mit Worten und Gesten, ja sogar Untertönen, die sie sich ausborgen müssen. Vielleicht leiden sie deswegen nicht weniger.
Ich beobachtete auch den Bürgermeister, um zu sehen, wie er sie beurteilte. Aber es war unmöglich, unter diesem dicken blonden, vor Ehrerbietung gekrümmten Schnurrbart irgendetwas zu erkennen.
Wir verließen den Feldweg und begaben uns auf einen Pfad. Und plötzlich, nach einer Anhöhe, kannte ich mich aus. Mit einem Schlag stand mir dieser Augusttag wieder klar vor Augen.
Ich stieß einen Schrei aus, und Madame Pragen sah mich an.
In ihrem Blick lag Groll. Schon manches Mal hatte ich dieses Gefühl aufkeimen sehen, doch in diesem Moment war es offensichtlich. Sie zürnte mir. Aber weshalb? Wahrscheinlich, weil ich noch lebte, während ihr Sohn, mein Kamerad, tot war. Ich verstand sie recht gut, denn bisweilen hatte ich schon eine Art Scham empfunden, als hätte ich die Tage, deren ich mich nun erfreute, den jungen Männern entrissen, die ich hier zurückgelassen hatte.
Die ich hier zurückgelassen hatte. Plötzlich dachte ich, dass jene, die ich auf diesem Feld hatte liegen sehen, jetzt darunter lagen. Sie waren hier geblieben, sie waren noch hier. Wir leben weiter von den alten Märchen, den kindlichsten Vorstellungen. Wie könnte es auch anders sein? Wir bekommen gar nichts anderes zu beißen, es sei denn, wir schalten unsere Phantasie aus – was unmöglich ist. Wie sollte ich mich nun wieder fangen, nachdem mein Geist sich schon dieser Neigung hingegeben hat? Wenn ihre Körper hier waren, waren auch ihre Seelen noch hier. Denn wo ein Körper ist, da ist eine Seele, liegt ein Duft oder ein schaler Geruch in der Luft. Und diese Seelen sind hungrig und frieren und leiden. Etwas schrecklich Lebendiges, schrecklich Gegenwärtiges stieg von diesem Feld auf. Auch mein Gedächtnis erwachte nämlich und ließ heißes Blut in meinem Kopf aufwallen; und das heiße Blut nährte dieses Unsichtbare, das so offensichtlich da war.
Doch wie überaus ungeniert hatte ich sie hier zurückgelassen.
«Sie erkennen den Ort wieder», sagte Madame Pragen mit erstickter Ironie zu mir.
«O ja!»
Ich musste mich zum Bürgermeister umdrehen, der mir nicht traute, der nicht recht glaubte, dass ich hier gewesen war, weil ich ziemlich schlecht gekleidet und Madame Pragen offenbar nicht gut auf mich zu sprechen war.
«Da ist die Backsteinmauer, da ist die Backsteinmauer.»
Ich sah alles, erkannte alles, wusste alles von dem Vorfall, doch als ich ihn schildern wollte, konnte ich nur stammeln und mit ausgestrecktem Arm auf das zeigen, was mich an jenem Tag so stark beeindruckt hatte und jetzt wieder so stark aufwühlte. Diese Backsteinmauer stand da, vor mir, in hundert, nein, zweihundert Meter Entfernung. Es war die Mauer, auf die wir wie die Wahnsinnigen geschossen hatten, die Mauer, auf der sich die Umrisse der Deutschen abgezeichnet hatten, die …
Doch plötzlich verstand ich nicht mehr. Wir, Madame Pragen, der Bürgermeister und ich, waren vom selben Ende des Schlachtfelds hergekommen, von dem aus ich, in der Mitte des Regiments, damals die Backsteinmauer gesehen hatte. Ohne nachzudenken, ließ ich sie da haltmachen, wo wir am frühen Vormittag in unseren dürftigen Schützengräben gelegen hatten. Damals war die Backsteinmauer weit, weit weg, und als wir zum Angriff übergingen, liefen wir sehr lange, um dann auf halbem Weg zusammenzubrechen – das ganze Regiment wie niedergemäht vom Feuer eines einzigen, aber völlig ausreichenden Maschinengewehrs. Doch jetzt war die Backsteinmauer ganz nah … Was mir groß, endlos vorgekommen war, war ganz klein, so wie wenn man als Mann an den Ort zurückkommt, wo man als Kind gespielt hat.
«Das ist die Backsteinmauer», wiederholte ich wie versteinert, eine sprechende Statue.
«Wie?», fragte Madame Pragen erregt. «Und wo war Claude?»
Die barsche, bissige Frage löste meine Erstarrung: Ich konnte auf Einzelheiten eingehen, die nach und nach greifbar wurden.
«Am Anfang war er hier …»
… Es war im Morgengrauen. Ich kehrte von der Feldwache zurück, von der anderen Seite des Waldes. Als mein Zug aus dem Wald heraustrat, aus dem nachher die Deutschen kamen (die Backsteinmauer befand sich auf halbem Weg zwischen dem Wald und den Schützengräben), sahen wir in der Ebene, wie sie es dann auch sehen sollten, in blau-roten Reihen unser ganzes Regiment daliegen. Jede der Reihen, als ahnte sie die Gefahr, wenn auch zu spät, versuchte sich zu verstecken, sich einzugraben. Jeder der Männer scharrte mit seiner Schaufel vor sich in der Erde. Es gab Wiesen und Stoppelfelder. Auf den Wiesen standen die von den belgischen Bauern zurückgelassenen Kühe, und auf den Feldern lag das erst vor Kurzem geschnittene Korn noch in Schwaden. Uns wurde warm ums Herz, als wir armseligen zwölf oder fünfzehn Mann nach unserer Nacht im Vorposten ein völlig verändertes Regiment vorfanden, das sich besorgt und ernsthaft bereit machte. Und wir wussten, dass es nicht mehr lange dauern würde, denn ein plötzlich am Waldrand auftauchender Chasseur d’Afrique4 rief uns zu, als er auf seinem Pferd herumwirbelte: «Da sind sie!» Doch als wir am Haus des Wildhüters vorbeikamen, nahmen wir uns die Zeit, den vergessenen Hund loszubinden und in der leeren Stube ein Glas Marmelade vom Tisch zu stehlen.
Am Himmel herrschte noch Stille.
In den Reihen bemerkte ich Claude, wie er, in der frisch aufgewühlten Erde kniend, den Zwicker auf der Nase, mit schwacher und ungeschickter Hand seine Schaufel hielt und seinem Burschen zusah, der für ihn arbeitete wie in der Kaserne und letzte Hand an das eigens für den jungen Bourgeois ausgehobene Loch legte.
«Ah», sagte er, als er mich sah.
«Sie sind da», antwortete ich.
Und er blieb mit offenem Mund auf dem Boden hocken, ganz blass, der Zwicker schief, erledigt. Er ließ mich vorbei, und wir haben vergessen, uns Guten Tag oder Auf Wiedersehen zu sagen …
«Er war hier!», rief Madame Pragen empört.
Sie empörte sich, als hätte sie begriffen, dass …
… Claudes Zug sehr schlecht platziert war, viel zu sichtbar auf dem Kamm eines dieser kleinen Hügel, die es hier so zahlreich gab.
Zu Madame Pragens allergrößter Empörung, und als ob es Absicht gewesen wäre, war mein Zug viel besser platziert worden als der von Claude, nämlich in einem Hohlweg. Man fühlte sich dort so gut aufgehoben, mochten die Kugeln doch kommen, dass Cozic, der Bretone, gar nicht mehr wegwollte und blieb, als wir uns längst anderswo befanden. Es war nicht weit vom Wald entfernt, denn der Wald vor uns, aus dem die Deutschen herausströmten, setzte sich zu unserer Linken und sogar noch ein wenig hinter uns fort. Unser Regiment lehnte sich an diesen Wald an – wenn man so sagen kann; aber rechts war es über eine flache Ebene verteilt, und die Deutschen näherten sich ihm, ebenfalls ungedeckt, entlang der Landstraße, die sich aus dem Wald kommend von Pappel zu Pappel auf einen Horizont von Runkelrüben zuschlängelte …
«Und wo waren Sie?»
«Da», gestand ich …
Madame Pragen sagte kein Wort, warf mir aber einen Blick zu, der bedeutete: «Ich wusste, dass ich Ihnen nicht trauen kann.»
Ich fuhr ruhig fort: «Er war da, und der Hauptmann war auch da.»
«Sein Hauptmann. Den habe ich oft genug in der Kaserne gesehen. Was für ein Dummkopf, er hätte sie woanders platzieren können.»
«Aber er war bei ihnen …»
… Der Hauptmann hatte von der Pike auf gedient. Er war ein dicker Bürokrat mit rundem Bauch auf kurzen, schwachen Beinen. Im hochroten Gesicht ein dünner, schmutziger Schnurrbart wie vom Schweifhaar eines Holzpferds. Er sollte im Oktober in den Ruhestand gehen, an diesem Morgen jedoch wirkte er nicht sehr zuversichtlich. Gleich von der ersten Salve wurde er niedergestreckt, alle viere in der Luft.
Einmal hatte ich um Ausgang gebeten, um eine Vorstellung der Ballets Russes5 zu besuchen: «Ach, Sie sind es, der Student. Nicht nötig, dass Sie ins Theater gehen. Ich gehe ja auch nicht hin …» Wie alle, die sich hochgedient hatten, hasste er die protegierten Bürgersöhnchen, die es in diesem Pariser Regiment dutzendweise gab.
«Genau hier habe ich Claude kurz gesehen, morgens, gegen halb sieben, sieben.»
«Und vorher, hatten Sie Claude da schon gesehen?»
«Am Tag zuvor, für einen Augenblick. Denn er hatte bereits gekämpft.»
«Und Sie?»
«Nein.»
Ich erklärte es ihr recht und schlecht. Als begünstigte die Natur meine kontemplative Neigung, war mein Zug dazu bestimmt worden, den Regimentskonvoi zu schützen (vor wem?). Sodass einige von uns weit zurückgeblieben waren, während ein Teil des Regiments bei Charleroi im Einsatz war – halbherzig übrigens, und er wurde sofort wieder aus dem Kampf abgezogen, ohne dass es Verluste gab.
… Es fügte sich, dass wir in erhöhter Position sehr lang auf der ziemlich menschenleeren Straße haltmachten.
Ich verspürte eine gewisse Befriedigung ob dieser Verzögerung, obwohl ich noch vor Kurzem in Paris meine Feuertaufe gar nicht mehr hatte erwarten können und mich zu den Tirailleurs algériens6 nach Marokko gemeldet hatte. Doch was mich befriedigte, war nicht so sehr, den Hieben zu entgehen, als noch einen Augenblick zu faulenzen und zu schauen.
Ich sah und runzelte die Stirn.
Von einem Hügel aus sah ich die französische Armee unter gelegentlichem Geschützfeuer in der Ebene liegen wie eine alte Anekdote, von der Zeit lange vergessen und plötzlich wieder hervorgeholt, um endgültig ausrangiert zu werden. Diese Armee, die überall ihre blau-roten Bänder ausbreitete, erinnerte an Schlachtengemälde aus den Jahren um 1850. Archaisch, kopflos, in flagranti bei Nachlässigkeit und Großsprecherei ertappt, vage versuchend, sich wichtig zu machen, nicht sehr selbstbewusst. Ich sah Generäle mit trauriger Miene, gefolgt von Kürassieren, die ihre Väter dazu bestimmt hatten, in irgendeinem Reichshoffen7 zu sterben. Gegenüber sah man nichts, die Deutschen gingen in der Natur auf; ich fand, diese Philosophie hatte ihr Gutes. Ich habe auch einen Artilleriekommandeur gesehen, in einem alten Kapuzenmantel über sein Pferd gebeugt, der seine Batterien bereits verloren hatte. Ich erinnerte mich an meine Lektüre Marguerittes8 und Zolas9. Es sah mir ganz nach einer überarbeiteten und erweiterten Neuauflage von 1870 aus. Ich erinnerte mich an den Pessimismus meines Großvaters, der die von der Niederlage bei Sedan10 angeheizte Pariser Kommune erlebt hatte; und die revanchistische Angeberei meines Vaters widerte mich an. Ich vergaß, dass ich den Fackelzügen Millerands und Poincarés gefolgt war.11
Gegen Abend stand ich am Rand dieser Straße, als jemand aus dem Regiment herüberkam. Es war Barbier, der Sekretär des Obersten. Er brachte dem Konvoi Befehle. Ich stürzte mich auf ihn.
«Nun?»
«Es sieht schlecht aus.»
«Aha, es sieht also schlecht aus.»
Dem Gedanken nachzuhängen, dass es schlecht aussah, war für mich ganz natürlich. Eine Sache des Charakters. Und außerdem hatte man mir immer schon, seit ich auf der Welt war, gesagt, dass es schlecht aussah für Frankreich.
Sergeant Gujan hatte bemerkt, was wir, die beiden Bourgeois, für Gesichter machten. Er hasste uns. Ein altes jakobinisches Misstrauen war sofort in ihm erwacht. Während ich mich entfernte, sagte ich noch einmal: «Es sieht schlecht aus.»
«Schweigen Sie gefälligst», sagte er scharf. «Wer hat mir bloß solche Typen zugeschanzt? Sie zittern ja schon.»
Ich war sehr erstaunt über diese Rüge. Doch dann drehte ich mich wie ein Fähnchen im Wind und gab dem Sergeanten recht. O ja, er kannte mich gut; er hatte mich den Winter über in der Kaserne der Rue de la Pépinière12 beobachten können: Ich war ein furchtsamer, drückebergerischer, pessimistischer Bourgeois.
ENDE DER LESEPROBE
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Titel der französischen Ausgabe:
«La Comédie de Charleroi» (1934)
Copyright © 2016 by Manesse Verlag, Zürich
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Diese Buchausgabe wurde von Greiner & Reichel in Köln
aus der Sabon Lt Pro gesetzt
Den Umschlag gestaltete Cornelia Niere in München, unter Verwendung eines Motivs von © BPK/RMN-Grand Palais/Estate Brassaï
ISBN 978-3-641-17220-6V001
www.manesse.ch