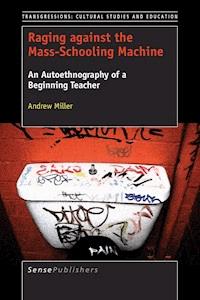Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der neue große historische Roman von Andrew Miller – „Millers Schreiben ist eine Quelle des Staunens und der Freude.“ Hilary Mantel
In einer Februarnacht 1809, zur Zeit der Napoleonischen Kriege, kehrt John Lacroix halb tot von einem Feldzug bei La Coruña nach England zurück. Er glaubt, das Schlimmste gesehen zu haben, was Menschen einander antun können.
Allmählich gewinnt Lacroix seine Gesundheit zurück. Um auch seinen Seelenfrieden wiederzugewinnen, macht er sich auf den Weg zu den Hebriden, jedoch ohne zu wissen, dass ihm zwei Männer nach dem Leben trachten. Nicht nur er, auch die Frau, in die er sich verliebt, ist in äußerster Gefahr.
"Die Korrektur der Vergangenheit" ist ein atemberaubender historischer Roman, ein vielschichtig fesselndes Historiengemälde, geschrieben in einer klaren, leuchtenden Prosa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 629
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Der neue große historische Roman von Andrew Miller — »Millers Schreiben ist eine Quelle des Staunens und der Freude.« Hilary MantelIn einer Februarnacht 1809, zur Zeit der Napoleonischen Kriege, kehrt John Lacroix halb tot von einem Feldzug bei La Coruña nach England zurück. Er glaubt, das Schlimmste gesehen zu haben, was Menschen einander antun können.Allmählich gewinnt Lacroix seine Gesundheit zurück. Um auch seinen Seelenfrieden wiederzugewinnen, macht er sich auf den Weg zu den Hebriden, jedoch ohne zu wissen, dass ihm zwei Männer nach dem Leben trachten. Nicht nur er, auch die Frau, in die er sich verliebt, ist in äußerster Gefahr.»Die Korrektur der Vergangenheit« ist ein atemberaubender historischer Roman, ein vielschichtig fesselndes Historiengemälde, geschrieben in einer klaren, leuchtenden Prosa.
Andrew Miller
Die Korrektur der Vergangenheit
Roman
Aus dem Englischen von Nikolaus Stingl
Paul Zsolnay Verlag
Für Bill Parish, Jim Hodges, Howard Allen und Maurice Osbourne. Allesamt geduldige Menschen. Salve!
Ich versuchte zu beten und meine Seele Gott zu befehlen, doch ich war so durcheinander, dass ich meine Gedanken nicht ordnen konnte. Ich glaube fast, ich war von Sinnen …
Thomas Howell, »71. Infanterieregiment«
… die einzige Kunst, die zu lernen sich lohnt, ohne dass sie sich jedoch jemals ganz meistern ließe, ist die Kunst, die Erde zu bewohnen.
Luigi Barzini
Eins
1
Der Wagen fuhr über regengepeitschte Feldwege, die Seiten mit Schlamm bespritzt, den die Räder in bogenförmigem Schwall nach hinten schleuderten. Vorgespannt waren zwei Pferde, und auf dem linken spähte der Postillon, ein etwa fünfzigjähriger Mann, unter seiner Hutkrempe hervor auf die Umrisse von Hecken und sich biegenden Bäumen. Irgendwo war ein Mond, aber er war beim besten Willen nicht auszumachen. Die Laterne am Wagen war schon vor einer Meile erloschen. Das letzte Licht, das er gesehen hatte, stammte von einer Kerze im Fenster eines Farmhauses, irgendein Farmer, der noch spät über seinen Büchern saß oder seine Gebete sprach.
»Ruhig, ruhig …«, rief er seinen Pferden zu. Der Schlamm war flüssiger Lehm. Mehr als einmal hatten die Tiere darin den Halt verloren. Wenn er hier abgeworfen würde! Abgeworfen würde und sich etwas bräche! Dann würden er und der arme Teufel im Wagen am nächsten Morgen von einer Stallmagd oder einem Kesselflicker entdeckt werden, tot, als wären sie unterwegs dem Teufel begegnet.
Oder war sein Fahrgast bereits tot? Im Swans war er von Dienern herausgetragen worden, die Augen geschlossen und verschattet, mit schlaff herabhängendem Kopf, und der Wirt hatte zugesehen wie jemand, der heilfroh ist, etwas Unangenehmes loszuwerden.
Er zügelte die Pferde und brachte sie zum Stehen. An dieser Stelle machte die Straße eine Biegung und fiel ab — er spürte es eher, als dass er es sah —, und während der Regen auf ihn eintrommelte, saß er da und überlegte, was am besten zu tun sei. Er könnte auf den Bock steigen und die Bremse betätigen, doch die Räder hatten keinerlei Bodenhaftung, und er verspürte wenig Lust, oben zu sitzen, wenn das Ding ins Rutschen kam. Nein, er würde es lieber zu Fuß im Schlamm probieren. Er stieg ab, stand in seinen steifen Postillonstiefeln da, ergriff das Kummet des Pferdes, auf dem er geritten war, und ging los.
Kannte er dieses Gefälle? Bei Tageslicht würde er es kennen, doch nun, während er vorwärtsschlich, leise auf das Pferd einredete und der Wagen auf seiner Achse schwankte, wurde er das Gefühl nicht los, dass er ins Meer hinabging und bald spüren würde, wie sich die Brandung an seinen Stiefeln brach. Das war natürlich Unsinn. Es gab hier kein Meer, auf hundert Meilen nicht, doch irgendwie begleitete selbst einen Postillon aus Somerset immer die Vorstellung vom Meer.
Sekundenlang löste sich der Mond aus den Wolken, und er sah, wie das Gefälle beschaffen war, sah Mondlicht auf dem wie eine Rah abstehenden Ast eines großen Baums, den er zu erkennen meinte. Nach weiteren zwanzig Schritt knickte die Straße scharf nach rechts und abermals nach unten ab. Er folgte dem Knick in mittlerweile etwas rascherem Gang. Der Regen ließ nach. Er schüttelte die Tropfen von seinem Hut, stieg weiter ab (so lange, dass ihm allmählich Zweifel kamen, ob das tatsächlich die Gefällstrecke war, für die er sie gehalten hatte), dann streifte er mit der ausgestreckten Hand einen Steinpfosten, der den Rand eines offenen Tors markierte. Er führte die Pferde hindurch auf die Einfahrt — oder vielmehr einen Hof, mit kleinen Steinen gepflastert, und dahinter die Schwärze und der Schieferschimmer eines großen, eckigen Hauses. Er ließ die Pferde stehen und stieg die drei flachen Stufen zur Eingangstür hinauf. Er tastete nach einem Türklopfer oder Glockenzug, fand weder das eine noch das andere und schlug mit der flachen, im durchweichten Leder eines Handschuhs steckenden Hand gegen die Tür. Fast sofort begann ein Hund zu bellen. Ein weiterer Hund, unten im Dorf, antwortete ihm. Er wartete. Eine Stimme, die einer Frau, brachte den Hund zum Schweigen. Als er still war, fragte sie: »Wer ist da? Was wollen Sie hier?«
Er sagte ihr, wer er war und was ihn herführte. Er war sich immer noch nicht sicher, dass er sich am richtigen Ort befand, dass dies die Adresse war, die er in seinem Handschuh bei sich trug.
»Warten Sie«, sagte sie, die Stimme von der Tür zwischen ihnen leicht verfremdet. Als sie zurückkehrte, hatte sie ein Licht bei sich, das er als gelben Schimmer in dem schmalen Fenster neben der Tür wahrnahm. Er trat zurück, um sich zu zeigen. Das Licht bewegte sich zur Seite, Riegel wurden zurückgezogen, und die Tür öffnete sich, vielleicht vom Regen aufgequollen — seit Tagen regnete es immer wieder — mit einem schabenden Geräusch. Mit hochgehaltener Lampe stand die Frau da. Nicht jung, nicht alt. Sie hatte sich eine Decke umgelegt, deren Ränder sie mit der freien Hand vor ihrer Brust zusammenhielt.
»Wo ist er?«, fragte sie und schaute links und rechts an dem Postillon vorbei.
»Im Wagen.«
»Warum kommt er nicht?«
»Man wird ihn herausheben müssen. Er ist hineingehoben worden.«
Sie bedachte das einen Moment lang, dann sagte sie: »Ich bin ganz allein hier.«
»Ich werde schon mit ihm fertig«, sagte er. »Jedenfalls glaube ich das.«
Er wandte sich von ihr ab und ging zum Wagen. Aus Höflichkeit klopfte er an das Schiebefenster, dann öffnete er die Tür, stellte sich auf den Tritt und beugte sich ins Wageninnere. Es roch nicht gut da drin, und zunächst war auch nicht ersichtlich, dass der Mann noch atmete.
»Ich bin so vorsichtig wie möglich«, sagte er. Er zog den Mann gerade so weit nach vorn, dass er ihm den Arm um den Rücken legen konnte. Den anderen Arm schob er ihm unter die Knie. Mit einem Ächzen hob er ihn an, trat rückwärts auf die Pflastersteine des Hofs und trug den Mann rasch ins Haus.
Die Frau schloss die Tür. »Gütiger Himmel«, sagte sie. »Können Sie ihn die Treppe hinauftragen?«
»Wenn Ihnen meine Stiefel nichts ausmachen«, sagte er.
Die Frau ging voran, das Lampenlicht strich über Gemälde von Pferden, Menschen, Landschaft. Hinter dem Postillon kam ein Hund, irgendeine Art von Jagdhund, mit langer Schnauze und schlanken Beinen. Der Postillon hörte das Tier nicht, so leise trat es auf.
Am oberen Treppenabsatz hielt er inne, um wieder zu Atem zu kommen, dann folgte er der Frau einen getäfelten Flur entlang bis zu einer getäfelten Tür und durch die Tür in eine Schlafkammer, in die Kühle eines Zimmers, das den ganzen Winter unbesucht und ungeheizt geblieben war.
»Dorthin«, sagte sie und wies mit dem Kinn auf das Bett. Und fügte dann, eher an sich selbst gerichtet, hinzu: »Wenn ich bloß Bescheid gewusst hätte. Wenn man mir bloß Bescheid gesagt hätte. Wenn man mir bloß irgendetwas gesagt hätte …«
Sie stand neben dem Postillon. Im Licht der Lampe schauten sie schweigend auf den auf dem Bett Liegenden hinab. Die Frau bewegte die Lampe an seinem Körper entlang. »Das sind nicht seine Kleider«, sagte sie.
»Ach nein?«
Ein brauner Zivilmantel, der einmal einem dickeren Mann gehört hatte. Eine Weste, die aussah wie aus einer Decke geschneidert. Graue Hosen, geflickt mit allem Möglichen, mit Flicken aus Leder, aus braunem Barchent und einem dunklen Stoff — rot? —, bei dem es sich um Wachstuch handeln könnte. Beide Füße waren mit Stoffstreifen umwickelt.
»Wo sind seine Stiefel?«, fragte sie.
»Er ist so, wie ich ihn vom Swans bekommen habe. Ohne Stiefel und ohne Hut.«
»Kein Gepäck?«
»Doch. Eine kleine Tasche. Unten im Wagen.«
Sie sah den Postillon an, nahm ihn zum ersten Mal richtig wahr. Er war nicht aus dem Dorf, auch nicht aus dem nächsten oder übernächsten, wenngleich sie ihn vielleicht schon einmal irgendwo seiner Arbeit hatte nachgehen sehen. Ein mageres Gesicht, gezeichnet vom Wetter und von den starken Getränken, die Männer in seinem Gewerbe brauchten und sich schmecken ließen. Aber es lag auch Wachheit darin und eine Freundlichkeit, die sie an den Prediger erinnerte, den sie vergangenes Jahr am Ende der Apfelernte am Haus hatte vorbeireiten sehen, einen von der neuen Sorte, die unter freiem Himmel zu Dienstboten und Berg- und Feldarbeitern sprachen. Sogar in Radstock.
»Der Wirt«, sagte der Postillon, »hat mir erzählt, er wäre tags zuvor von der Küste gekommen. Von Portsmouth.«
»Portsmouth?«
»Das hat er gesagt. Und dass auch Soldaten dagewesen wären, Rückkehrer aus Spanien, die einfach auf der Straße lagen, manche ohne Augen oder Beine.«
»Barmherziger Himmel«, sagte sie. »Aber doch wohl nicht die Offiziere?«
»Das hat er nicht gesagt.«
»Jedenfalls, das sind nicht seine Kleider«, sagte sie. »Ich kenne alle seine Kleider.«
»Sie führen hier wohl das Haus.«
»Ja«, sagte sie. »Ein leeres Haus.«
Sie nahm die Decke von den Schultern und breitete sie über den Mann. Sie trug ein Kleid aus verblichenem blauem Stoff, darunter das Weiß ihres Hemdes. Der Postillon musste bezahlt werden, und sie ging in die Spülküche hinunter, wo sie hinter den Braubottichen einen verschlossenen Kasten hatte. Sie brachte ihm die Münzen. Er bedankte sich und ging hinaus zum Wagen, um das Gepäck des Mannes, einen Tornister, zu holen.
»Sonst nichts?«, fragte sie.
»Nein«, sagte er.
Sie standen an der Tür. Die Nacht war mittlerweile windig, aber trocken, und wo die Wolken aufgerissen waren, sah man blanken Himmel mit funkelnden Sternen. Er wünschte ihr Glück. Sie nickte, schloss die Tür und schob die Riegel vor. Er ging zu seinen Pferden, kraulte ihnen die Stirn und führte sie zum Tor und auf die Straße.
»Seltsam«, sagte er dem neben ihm gehenden Pferd ins Ohr. »Seltsam, so eine Nacht, in der man einen sterbenden Soldaten in ein leeres Haus zurückbringt.«
Die Standuhr in der Halle zeigte kurz nach zwei Uhr morgens und trug an der Spitze eines gebogenen Metallstreifens das Gesicht eines träumenden Mondes. Die Frau schaute die Treppe hinauf (auf dem Teppich noch feucht die Schmutzspuren des Postillons), dann ging sie in die Küche. Das Feuer dort war ganz leicht wieder in Gang zu bringen. Sie hängte den Kessel darüber und trug dann eine Schütte glimmender Kohlen hinauf in das Zimmer, wo in völliger Dunkelheit der Mann lag. Sie kippte die Kohlen auf den Kaminrost und ging wieder nach unten, um Anmachholz, frische Kohle und zwei Kerzen zu holen. In das Zimmer zurückgekehrt, legte sie das Holz auf die glühenden Kohlen, entzündete an den Flammen die Kerzen und legte kleine Stücke frischer Kohle auf das Feuer. Bis das Zimmer richtig warm war, würde es Stunden dauern, aber der Feuerschein munterte sie auf, und sie eilte wieder nach unten in die Küche. Das Wasser im Kessel war heiß, sie füllte damit zur Hälfte einen irdenen Becher, fügte ein tüchtiges Maß Brandy hinzu, steckte einen Hornlöffel in ihre Schürzentasche. Der Hund war bei ihr, war ihr auf jedem Gang, ob hinauf oder hinab, gefolgt.
Sie setzte sich auf die Bettkante. Sie musste sich fassen, zu Atem kommen, begreifen, was die Nacht ihr gebracht hatte und vielleicht noch bringen mochte. Sie stopfte das Kissen unter die Schultern des Mannes, damit sein Kopf leicht angehoben wurde, füllte den Hornlöffel mit Brandy und Wasser, kostete selbst davon, um zu wissen, wie heiß es war, und träufelte ihm vorsichtig ein wenig zwischen die Lippen. Das meiste kleckerte ihm übers Kinn, aber etwas, ein paar Topfen, gelangte in seinen Mund.
Fast sofort schlug er die Augen auf. So, wie er sie anstarrte, war sie froh, als er die Augen wieder schloss. »Ich bin es, Nell«, sagte sie. Sie hatte keine Ahnung, ob er sie erkannt hatte, ob er richtig wach gewesen war. »Sie liegen in Ihrem eigenen Bett«, sagte sie. »Sie sind jetzt zu Hause.«
Sie flößte ihm mehr von der Mischung ein, bis es ihr schien, als verzöge er das Gesicht, dann steckte sie den Löffel wieder in die Schürzentasche. Sie beschäftigte sich eine Zeitlang mit dem Feuer, dann ging sie zurück in die Küche, um eine Schüssel mit warmem Wasser zu füllen. Sie würde ihn waschen müssen. Er stank. Krankenzimmergerüche, doch da war noch etwas anderes, als hätte er einen Dunst von Arbeitshaus mitgebracht. Bestimmt hatte er Läuse. Sie würde ein gutes Rasiermesser brauchen, denn Läuse wurde man am sichersten mit einer scharfen Klinge los. Sie fragte sich, ob er selbst ein Rasiermesser in dem Tornister hatte, doch der schien so wenig zu enthalten. Sie würde eines von seinem Vater heraussuchen. Bestimmt lag eines in irgendeiner Schublade in seinem früheren Zimmer. Kann ein unbenutztes Rasiermesser seine Schärfe einbüßen? Sie glaubte es nicht.
Sie wickelte seine Füße aus. Offenbar hatte er an den Fußsohlen fast keine Haut mehr. Sie musste den Stoff mit unendlicher Vorsicht ablösen, um nicht abzuziehen, was noch übrig war. Sie wusch ihm die Füße, tupfte sie trocken, holte dann ihre Nähschere und schnitt seine Hosenbeine auf. Sie glättete und tunkte ein, säuberte die sehr weiße Haut seiner Oberschenkel, säuberte ihn zwischen den Beinen, betupfte die etwas dunklere Haut seines Schwanzes (und dachte, dass das arme Ding etwas Hilfloses hatte, wie ein Gegenstand — ein Handschuh —, den man hingeworfen und vergessen hat).
Das Hemd, befand sie, war von allen Kleidungsstücken als einziges seins. Sie bildete sich ein, die Näharbeit — ihre eigene — zu erkennen, aber es war so verschmutzt, dass kein Schrubben mehr helfen würde, und sie schnitt es ebenfalls auf, ließ Stoffstreifen vor ihre Füße fallen, ein Haufen Lumpen, den sie im Küchenfeuer verbrennen würde, bis sie Asche und dann nichts mehr waren.
Sie wusch ihm die Brust. Er hatte gut zehn Pfund oder mehr abgenommen, aber es war immer noch die Brust eines Soldaten, und als sie ihm die flache Hand aufs Herz legte, spürte sie dessen Wärme und fürchtete zum ersten Mal, seit er ins Haus getragen worden war, nicht mehr um sein Leben.
Sein Gesicht wusch sie als Letztes. Die Ohrläppchen, die zarte Haut um die geschlossenen Augen, seine Stirn, seine Lippen. Backen- und Schnurrbart, die er bei seiner Abreise getragen hatte (mein Gott, das Stutzen und Einreiben mit Pomaden!), waren irgendwann abgeschabt worden, aber die letzte Rasur lag gut eine Woche zurück, und das Haar an seinem Kinn wirkte jünger als das auf seinem Kopf, enthielt keinerlei graue Strähnen. Sie lehnte sich etwas zurück, in der Hoffnung, im Gesicht des Mannes das des Knaben zu erkennen, das Gesicht, das sie gesehen hatte, als sie in die Dienste der Familie getreten war, doch sie konnte es nicht und wusste, dass, was auch immer ihm zwischen dem Tag seiner Abreise an jenem Junitag vergangenen Sommer und dieser Februarnacht widerfahren war, den letzten Rest seiner Jugend mit sich genommen hatte.
Sie holte eine zweite Decke und breitete sie über ihn. Die Wärme des Feuers kroch näher ans Bett heran, hatte es aber noch nicht erreicht. Der Hund lag ausgestreckt auf dem Läufer, den Bauch den Flammen zugewandt. Sie legte weitere Kohlen auf, löschte eine der Kerzen. Sie konnte den Rest der Nacht in dem Lehnstuhl am Kamin zubringen, aber sie hatte sich kaum gesetzt, da wurde sie wieder unruhig und ging ans Bett zurück. Sie hielt die Hand über seinen Mund, spürte das Kommen und Gehen seines Atems. War ihm leichter, ruhiger zumute? Es kam ihr so vor, als atmete er langsamer, und sie war sich nicht schlüssig, ob das gut oder schlecht war. Sobald Tom mit der Milch kam, würde sie ihn nach dem Arzt schicken. Sie konnte die Verantwortung nicht allein tragen. Und Ärzte waren nicht vollkommen nutzlos, jedenfalls nicht alle und nicht immer. Sie hatten ihre Kniffe.
Sie machte sich um ihn zu schaffen, zupfte seine Decken, seine Kissen zurecht und ermahnte sich dann, aufzuhören, es gut sein zu lassen. Wie sollte er denn schlafen, wenn sie ihn nicht in Ruhe ließ? Sie ging zu der alten Wäschetruhe gegenüber dem Fußende des Bettes. Dort hatte sie den Tornister abgestellt, und nun kam ihr zum ersten Mal der Gedanke, ihn sich näher anzusehen. Wie die Kleider, in denen er eingetroffen war, so war auch der Tornister nicht seiner. Offiziere hatten keine solchen Tornister. Der hier war für den Rücken eines einfachen Soldaten gedacht. Sie hatte solche Ranzen oft genug gesehen, wenn die Werbe-Detachements ins Dorf kamen, obwohl dieser so aussah, als hätte man ihn aus einem Feuer gerettet. Versengt, schmutzig. Schwarz von Teer oder Wagenschmiere, dem Schmutz der Welt. Und damit war er zurückgekommen? Damit und mit nichts anderem?
Sie hatte noch ein Bild — lebhaft, detailliert — seiner gesamten, auf dem Bett und dem halben Boden ausgebreiteten Ausstattung vor Augen. Was für Sachen! Und was das alles gekostet hatte! Allein die Stiefel waren auf über zwanzig Pfund gekommen. Sie hatte die Quittung unter dem Bett gefunden, sobald er aus dem Haus war — George Hoby, Schuhmacher, Piccadilly. Sechs Hemden, die sie selbst genäht hatte. Sechs schwarze Krawatten, zwölf Paar Halbstrümpfe aus Kammgarn, zwei Überhosen, vier weiße Westen. Ein blauer Überwurf — blau, wie man vielleicht von Blau träumt — mit einem pelzgefütterten Kragen, der, so hatte er ihr gesagt, aus einem Wolfsfell gefertigt war. Und dann noch alles andere — die Taschentücher, Kissenbezüge, zusätzlichen Manschetten, zusätzlichen Krägen, zusätzlichen Knöpfe. Nicht, dass alles davon neu gewesen wäre. Er hatte dem Regiment schon drei Jahre lang angehört, hatte sich im Herbst nach dem Tod seines Vaters sein Offizierspatent gekauft, aber er hatte zuvor noch nie im Feld gestanden, und er hatte großzügig Geld ausgegeben, das er vielleicht gar nicht besaß. Das Fernglas! Das Fernglas war neu! Er freute sich darüber, hatte es aus seinem Lederetui genommen und gesagt: »Komm mal her, Nell, komm ans Fenster«, hatte es ihr ans Auge gehalten, und nach einigem Herumspielen an der Linse hatte sie in Lebensgröße einen Farmer (sie kannte ihn) auf seiner Stute die Water Lane entlangzockeln, dabei vor sich hinplappern und sich am Hintern kratzen sehen, ohne die leiseste Ahnung, dass er beobachtet wurde. Beobachtete Gott uns ebenso? Und wenn, was hielt er dann wohl von uns, wo er doch alles sah?
Sie stellte den Tornister auf den Boden und setzte sich an seiner Stelle auf die Wäschetruhe. Sie löste die Riemen, zog sie durch die Schnallen, schlug die Klappe zurück. Sie hielt inne, dann griff sie hinein. Als Erstes zog sie einen Blechbecher heraus, verbeult und rauchgeschwärzt, als wäre er als kleines Kochgeschirr genutzt worden. Sie stellte ihn neben dem Tornister auf den Boden. Als Nächstes kam eine zwei Zoll lange Talgkerze, dann ein Striegel, ein Klappmesser mit abgebrochener Klinge und irgendein Klumpen, so groß wie eine Walnuss und ebenso hart, bei dem es sich, wie sie nach näherer Untersuchung befand, um Brot, sehr altes Brot handelte. Der Hund war ihr nach und nach immer näher gekommen. Sie hielt ihm den Klumpen vor die Nase. Er schnupperte daran, berührte ihn mit der Zungenspitze, blickte zu ihr auf. »Ja«, sagte sie, »das verbrennen wir auch.«
Als Letztes kam der Gegenstand, der dem Tornister sein Gewicht verliehen hatte. Ein Päckchen, eingeschlagen in das gleiche stumpfrote Wachstuch, das zum Flicken seiner Hosen verwendet worden war. Sie legte es sich auf den Schoß und schlug das Wachstuch sorgfältig auseinander, bis es ihr in roten Falten auf die Pantoffeln hing. Worum es sich handelte, erriet sie schon, bevor sie es sah. Glattes Holz, Stahl, eine Nase aus zerkratztem Messing am unteren Ende des Griffs. Allein dieses Ding, so schien es, war in etwa so zurückgekehrt, wie es das Haus verlassen hatte, das Holz schimmerte wie das Holz der Tische unten, in das sie (immer noch, obwohl kein Mensch jemals daran saß) Bienenwachs einarbeitete. Lag es am Wachs in dem Tuch? Hatte er sich deshalb dafür entschieden? Für eine Hülle, die nährte, was sie barg?
Ins Schloss war unterhalb des Hahns eine Krone eingeprägt und unterhalb der Krone ein G und ein weiterer Buchstabe, dessen sie sich nicht ganz sicher war. Zwischen den Backen des Hahns steckte kein Feuerstein. Sie hob das Ding. Es wog so schwer in ihrer Hand wie eine Bratpfanne. Sie hatte nie im Leben eine Schusswaffe abgefeuert, und angefasst hatte sie dergleichen nur, um es wegzuräumen, an den Vormittagen, an denen die Männer, nach Frühstück gierend, von der Entenjagd zurückgekommen waren und die Vogelflinten wie Spazierstöcke in der Halle an die Wand gelehnt hatten. Aber das hier war keine Jagdwaffe. Ihr Charakter war völlig anders.
In diesem Augenblick wurde ihr — ein kleiner Entsetzensschauer — bewusst, dass sie die Pistole aufs Bett gerichtet hielt, auf den Mann im Bett, und sie senkte sie rasch, legte sie wieder quer über ihre Knie und schüttelte den Kopf. Wie es wohl wäre, sie auf jemanden abzufeuern? Einem anderen Menschen eine wachteleigroße Kugel durch die Brust oder durch den Kopf zu jagen? War es das, wozu die schönen Kleider dienten? Die Stiefel, die pelzgefütterten Krägen? Sie ertappte sich bei der Hoffnung, dass er das nicht getan hatte. Dass er mit seinen Männern losgeritten war, exerziert und paradiert, aber niemals einen armen Fremdling mit diesem Ding ums Leben gebracht hatte.
Sie schlug es wieder in das Tuch ein, verstaute es am Boden des Tornisters, legte Becher, Striegel und Kerze zurück, erhob sich, klappte den Deckel der Wäschetruhe auf und verstaute den Tornister darin. Eine Dunkelheit, die eine andere verschluckte.
Der Arzt kam am Nachmittag. Stellenweise war der Schlamm auf der Straße einen Fuß tief. Die schwarzen Flanken des Pferdes starrten davon, und der Reitmantel des Arztes war bis zur Taille damit bespritzt. Endlich hatte es aufgehört zu regnen; er würde nicht den halben Tag in feuchten Kleidern umherziehen müssen. Schon im letzten Winter hatte er festgestellt, dass seine Gelenke steif wurden und zuweilen in beiden Knien und tief in seinen Hüften Schmerzen auftraten. Seine Frau rieb ihn mit demselben Mittel ein, das man auch für Pferde verwendete, bis sie beide wie Stallknechte stanken. Doch ein Arzt, der nicht reiten wollte, hatte besser eine vornehme Praxis in Bath oder in Hotwells. Hier draußen würde er verhungern.
Er erreichte den Hügelkamm oberhalb des Dorfes und schaute hinab in das Tal, wo die Felder von stehendem Wasser glänzten. Von hier aus konnte man meilenweit sehen: Ackerland, Wälder, ein Stück Fluss, braun zwischen lebhaft grünen Ufern. Und nun, da er das Dach der Kirche erspähte (grau und moosgrün wie ein Trittstein, mit dessen Hilfe man dieses wasserdurchtränkte Land durchqueren könnte), richtete er seine Gedanken auf seinen Patienten, den jungen Lacroix, der aus dem Krieg zurückgekehrt war.
Den Vater hatte er jahrelang behandelt — gegen Rheuma, Starrkrampf, Gicht. Hauptsächlich gegen Melancholie. Den Jungen und seine Schwestern hatte er gesehen oder gehört, ohne groß Notiz von ihnen zu nehmen, obgleich er sich erinnerte, nach dem jüngeren Mädchen geschaut zu haben, als es Scharlach gehabt hatte. Was die Mutter anging, so hatte er sie nie kennengelernt, und glaubte, dass sie nicht weit über ihr 25. Lebensjahr hinausgekommen war. Er hatte nur mit Lacroix zu tun gehabt (dem alten Lacroix, wie er ihn jetzt vielleicht nennen sollte), und sobald die medizinischen Fragen abgehandelt waren, hatten sie gern beieinandergesessen und sich über Landwirtschaft und Philosophie unterhalten, meist aber von ihren Sammlungen gesprochen, denn sie gehörten beide zu jenem Teil der Menschheit, der sammelt und hortet, was ihm Freude bereitet. Falter und Käfer der Doktor, dörfliche Musik und dörfliche Lieder Lacroix. Manchmal brachte er seinem Patienten zum Anschauen einen Käfer mit, etwas Schillerndes, Fingernagelgroßes, mitgeführt in einer alten Schnupftabakdose. Im Gegenzug schlug Lacroix eines seiner großformatigen Bücher auf, in denen er festhielt, was die alten Männer und Frauen des Kirchspiels ihm vorsangen. Er selbst besaß nur eine mittelmäßige Singstimme, doch der Arzt ermutigte ihn, und sei es nur, weil es nicht viel gibt, woran ein Mensch beim Singen sterben kann, und auch wenn er Tränen vergießt, so ist es besser, sie werden von Musik ausgelöst und hervorgelockt, als dass er dahockt und trockenen Auges zu Boden starrt.
Und jetzt würde er den Sohn aufsuchen und vielleicht etwas vom Krieg erfahren, Nachrichten, die die Zeitungen nicht brachten und wochenlang nicht bringen würden. Das ganze Land nährte sich von Gerüchten! Die Hälfte ganz versessen auf einen Kampf, während die andere Hälfte Frieden um fast jeden Preis wünschte. Aus Handlungsgehilfen und Lehrlingen bestehende Milizen unter dem Befehl eines jeden, der bereit war, die Uniformen zu kaufen. Längst hatte die Vorstellung, die Helden von Shepton Mallet könnten die Armee aufhalten, die bei Austerlitz die Österreicher und Russen zermalmt hatte, nichts durchweg Komisches mehr. Es gab Berichte von Hungersnot in den großen Städten, wie man sie seit einer Generation nicht mehr erlebt hatte. Und aus dem Norden des Landes kamen Geschichten von Männern, die sich wie Frauen kleideten und ebendie Stätten niederbrannten, die ihnen Beschäftigung gaben …
Er stieß dem Pferd die Absätze in die Seiten. »Hü, Ben«, sagte er. »Wir wollen hinunterreiten und unsere Guinee verdienen.«
Er konnte sich nicht an den Namen der Haushälterin erinnern, bis er die Treppe schon halb hinaufgestiegen war, dann fiel er ihm wieder ein, und er sagte: »So aus dem Schlaf gerissen zu werden, muss dir einen gehörigen Schrecken eingejagt haben, Nelly. Hat er überhaupt schon etwas gesagt?«
»Nein, nichts«, sagte sie. »Er hat ja kaum die Augen aufgeschlagen. Säße er aufrecht und würde reden, hätte ich nicht nach Ihnen geschickt.«
Das Zimmer, in das sie ihn führte, kannte er noch nicht. Schlicht, bequem, rechtwinkelig wie das Haus selbst, mit einer Tür auf der anderen Seite, die vermutlich in ein Ankleidezimmer führte. Ein großes Fenster, das nach Süden ging. Der Arzt stand mit der Haushälterin neben dem Bett.
»Er heißt John, nicht wahr?«
»Ja«, sagte sie.
»John? John? Ich bin Dr. Forbes. Ich bin gekommen, um nach Ihnen zu sehen … Hmm. Nihil dicit. Er liegt in Morpheus’ Armen. Er schläft tief und fest. Leicht errötet. Irgendein Fieber. Kein sehr hohes. Ich werde sein Herz abhören, Nelly.«
Am Morgen hatte die Haushälterin ihn mit Toms Hilfe in ein Nachthemd und unter die Bettdecke gesteckt. Nun schlug der Arzt die Decke zurück und löste die Bänder am Kragen des Hemdes. Aus seiner Tasche nahm er ein kurzes Hörrohr. Es bestand aus Blech, und er besaß es seit vielen Jahren.
Er lauschte fast eine halbe Minute lang, dann richtete er sich wieder auf, wobei er leicht zusammenzuckte und sich an den Rücken fasste. »Zuerst dachte ich, ich höre etwas. Irgendeine Obstruktion. Aber da ist nichts, ich glaube, es ist stark genug. Wie alt ist er?«
»Er ist in der Woche vor seiner Abreise 31 geworden.«
»Und das war wann?«
»Vergangenen Juni.«
»Und er war die ganze Zeit in Spanien oder Portugal?«
»Zuerst ist er zu seiner Schwester nach Bristol gefahren.«
»Ich dachte, sie hätte einen Farmer in Devonshire geheiratet. Oder war es Dorset?«
»Ich meine seine jüngere Schwester. Mrs. Lucy Swann. Ihr Mann hat irgendetwas mit den Schiffen zu tun.«
»Er fährt zur See?«
»Nein. Aber er hat mit ihnen zu tun. Mit den Schiffen und den Kapitänen.«
»Ein hübscher Name, Lucy Swann.« Der Arzt war ans Fußende des Bettes getreten. Er zog sich einen Stuhl heran und setzte sich, um die Füße des Mannes zu untersuchen. »Hat sie Kinder?«
»Sie hat Zwillinge. Die sind mittlerweile fünf, allerdings habe ich sie jetzt über ein Jahr lang nicht gesehen.«
»Und John hier war bei unserer Kavallerie?«
»Ja, das war er. Ist er wohl immer noch.« Sie nannte dem Arzt das Regiment. Sie hätte ihm, hätte sie gewollt, viele interessante Dinge über das Regiment erzählen können. Wie der Colonel hieß. Wie das Pferd des Colonels hieß.
»Wie es scheint«, sagte der Arzt und berührte Lacroix’ Füße mit einem kleinen Holzstöckchen, das er plötzlich in der Hand hielt, »ist unsere Kavallerie auch zu Fuß gegangen. Auf dem Rücken eines Pferdes bekommt man solche Verletzungen nicht. Hast du Schwefel im Haus? Ich schicke dir welchen. Setze eine Lösung mit warmem Wasser an und wasche damit dreimal täglich seine Füße. Hat er Stuhlgang gehabt?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Ich werde dir außerdem weiße Zimtrinde schicken. Sorge dafür, dass er sich so bald wie möglich aufsetzt. Ich mag es nicht, wenn ein Patient länger als nötig ausgestreckt daliegt.« Er begann, Lacroix’ Hals und Kehle abzutasten.
»Derjenige, der ihn hergebracht hat«, sagte die Haushälterin, »hat erzählt, in Portsmouth hätten Soldaten auf der Straße geschlafen. Ohne Obdach auf der Straße geschlafen. Manche hätten keine Augen oder Beine mehr gehabt.«
»Ach ja?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Das hat er gesagt.«
»Tja, wir müssen warten, bis John uns etwas erzählt. Sobald er dazu in der Lage ist. Dann wird es Neuigkeiten geben, Nelly, allerdings wohl nicht von der Sorte, die wir uns wünschen. Das hier« — er wies mit dem Kinn aufs Bett — »sieht so gar nicht nach Sieg aus.«
Er war fertig. Er schloss seine Tasche. Die Haushälterin ging mit ihm auf den Flur. Kurz bevor sie den oberen Treppenabsatz erreichten, blieb der Arzt vor einem Gemälde stehen, das neuer war als die anderen, eine Gestalt in eng anliegender blauer Jacke, eine Pelzmütze unter einem Arm, in der Hand des anderen Arms eine Schriftrolle. Brauner Backenbart, brauner Schnurrbart. Die Pose (im Hintergrund war eine Säule zu sehen und Laubwerk von der Art, wie junge Künstler es vermutlich auf den Akademien zu malen lernten) war träge, eigentlich nicht kriegerisch, fast zögernd, als enthielte die Schriftrolle unwillkommene Nachrichten. Unvermeidliche, aber unwillkommene.
»Sie lassen sich alle malen, bevor sie gehen«, sagte die Haushälterin. »Irgendein Mann kommt in die Kaserne und macht fünf die Woche. Wahrscheinlich tauscht er nur die Gesichter aus.«
Sie gingen miteinander die Treppe hinunter. In der Halle mattes Nachmittagslicht.
»Ich meine mich zu erinnern«, begann der Arzt, dem ganz ungewollt ein Bild vom Gesicht des alten Lacroix vor Augen getreten war, wie er ihn das letzte Mal, bei seinem letzten Besuch gesehen hatte, mit Kieferknochen, die so zerbrechlich wirkten wie die Körperteile eines Vogels, grauen Büscheln unrasierter Barthaare, geschlossenen Augen, die Lider groß und dunkel, »dass John einmal Musik studiert hat. Vor der Armee. Stimmt das, Nelly? Oder habe ich mir das bloß eingebildet?«
Jeden Tag badete sie seine Füße in der Schwefellösung. Außerdem bestrich sie seine Sohlen mit Honig, der, wie sie wusste, ein gutes Wundmittel war.
Durch den gespitzten Porzellanmund einer Krankentasse flößte sie ihm Brühe ein. Als er besser zurechtkam, gab sie ihm Schalen mit cremiger Milch aus dem halben Eimer, den Tom jeden Tag von den Feldmägden holte. Er sprach nur im Flüsterton. Einmal fragte er sie nach dem Wochentag — vielleicht hatte er das brüchige Schlagen der Kirchenglocke gehört. Ein andermal sagte er: »Ich will nicht, dass die Leute wissen, dass ich hier bin«, und weil sie ihn nicht aufregen wollte, versprach sie, es geheim zu halten, obgleich es die meisten im Dorf wohl schon wussten.
Er hatte gern den Hund bei sich. Mehr als einmal stand der Hund, wenn sie ins Zimmer kam, am Bett, und die Hand des offenbar schlafenden Mannes ruhte auf dem kurzen Schädelhaar des Tiers, das vollkommen stillstand.
Sie schickte nicht noch einmal nach dem Arzt. Sie glaubte nicht, dass sie ihn brauchte. Sie erwog, Tom zu bitten, dem Mann den Bart abzurasieren (immerhin konnte er Schafe scheren, da müsste es bei einem Mann ganz einfach gehen), doch am Ende tat sie es selbst, braune Löckchen schwammen im Schaum der Waschschüssel, bis sein Gesicht wieder so glatt und offen war wie in der Zeit, bevor er sich sein Offizierspatent gekauft hatte.
Sie leerte den Nachttopf. Sie schnitt ihm die Nägel.
Eine Woche verging. Das Wetter war kalt und klar. Neben den Säulen des Eingangstors standen Schneeglöckchen in dichten Büscheln. Inzwischen setzte er sich zum Essen auf und nahm feste Nahrung zu sich — Eier, Brot, kaltes Schweinefleisch in Scheiben. Schließlich — neun Tage nach seiner Ankunft im Haus — stieg er aus dem Bett, saß eine Zeitlang blass und atemlos da und sagte dann: »Ich brauche etwas zum Anziehen, Nell.«
Sie holte Sachen aus seinem Ankleidezimmer. Eine grauweiße Hose, eine Moleskin-Weste, einen gesteppten Hausmantel, der seinem Vater gehört hatte und von dem sie mit kleinen, lavendelgefüllten Leinensäckchen in den Taschen die Motten hatte fernhalten können. Er zog sich vor ihren Augen an und schwankte, als er in die Hose schlüpfte, sodass sie ihn stützen musste. Sie schob den Armsessel näher an den Kamin und holte später einen Klapptisch, einen alten Kartentisch, über den sie ein Tuch breitete und auf dem sie seine Mahlzeiten servierte. Sie plauderte mit ihm, stellte ihm harmlose Fragen — nach seiner Gesundheit, danach, was er essen wollte, wie er geschlafen hatte, ob es im Zimmer nachts kalt wurde. Eines Nachmittags stand sie hinter dem Armsessel und sagte seinen Namen, zuerst leise, dann lauter. Beim vierten Mal wandte er sich zu ihr um und blickte auf. Vielleicht wird es ja mit der Zeit besser, dachte sie. Vielleicht gewinnt er es ja zurück, wenn er wieder zu Kräften kommt.
Was die Neuigkeiten anging, die der Arzt erwartet hatte, so kamen sie nicht von John Lacroix, sondern von dem Bürstenverkäufer, einem fahrenden Händler, der wie ein fleißiges Insekt kreuz und quer durchs Land wuselte und schon seit Jahren ins Haus kam. Er erzählte der Haushälterin (während er seine Bürsten auf dem Küchentisch auslegte wie Stücke feinsten Porzellans), die Armee sei aus Spanien verjagt worden, es habe an einem Ort, dessen Name ihm gerade nicht einfalle, eine Schlacht gegeben, der britische General sei von einer Kanonenkugel getötet worden, die ihm die Schulter abgerissen habe. Was von der Armee übrig geblieben sei, und das sei wenig genug gewesen, ein kläglicher Rest, sei auf Schiffen geflohen, von denen allerdings mindestens eines, vielleicht auch noch andere, in einem Sturm gesunken sei.
Am folgenden Sonntag las ihnen der Pastor Teile aus seiner Zeitung vor. Es war ein düsterer Morgen, in der Kirche war es dunkel, und er hielt die Zeitung so dicht an die Kerzen in dem Leuchter hinter der Kanzel, dass sie fast mit Gewissheit Feuer fangen musste, wie sie es schon einmal — bei der Nachricht von Admiral Nelsons Tod — getan hatte, wo sie ihm aus den Händen geflogen und dann über der Gemeinde geschwebt hatte, ein kleiner Feuerengel, der schließlich neben dem Taufbecken gelandet und ausgetreten worden war.
Die Armee, las er vor, habe sich, den Feind hart auf den Fersen, über die Berge Nordspaniens zurückgezogen. Schnee, Eis, die Nahrungsmittel äußerst knapp. Die Spanier, in der Schlacht geschlagen und selbst in großer Not, hätten keinerlei Unterstützung gewähren können. An der Küste, bei der Hafenstadt La Coruña, habe die Armee eine verzweifelte Schlacht geschlagen, in welcher der tapfere Befehlshaber, Sir John Moore, verwundet und vom Feld getragen worden sei, ohne dass man ihn jedoch habe retten können. Dass so viele sich auf die bereitstehenden Transportschiffe hätten flüchten können, zeuge ebenso sehr von der Tapferkeit und Geschicklichkeit der britischen Waffen wie vom allergütigsten Walten der Vorsehung (»Mit Vorsehung«, sagte der Pastor und blickte zu ihnen auf, »meinen sie den Willen des Allmächtigen«). Es folgte eine Liste von Regimentern — die Haushälterin beugte sich in ihrer Bank vor und nickte, als dasjenige genannt wurde, auf das sie horchte. Die Toten waren nicht aufgeführt, nur der General selbst. Sie beteten für seine ewige Ruhe sowie für den König und seine Minister. Sie beteten, Gott möge sie nicht über das erträgliche Maß hinaus prüfen.
Über all das schwieg Lacroix. Er saß am Kamin. Er las Bücher, die er aus dem Arbeitszimmer seines Vaters holte, las sie oder blätterte flüchtig darin. Neben dem Armsessel entstand ein wachsender Stapel von ihnen. Sie wusste nicht, wovon sie handelten, aber sie freute sich, dass seine Füße so weit geheilt waren, dass er im Haus umhergehen konnte.
Eines Morgens bat er sie, mit ihm zu essen. Er wolle nicht allein essen. Er lächelte ihr zu — ihrer Erinnerung nach das erste Mal, dass sie ihn seit seiner Rückkehr hatte lächeln sehen —, und um zwei Uhr brachte sie Essen für sie beide nach oben, und sie saßen einander am Kartentisch gegenüber und aßen. Zuerst fand sie es unangenehm. Sie hatte seit seiner Kindheit, als man ihn und seine Schwestern manchmal zum Abendessen in die Küche geschickt hatte, nicht mehr mit ihm gegessen, aber nach und nach wurde es einfacher, und sie begann es zu genießen. Während der Mahlzeiten sagte er dies und das, aus irgendeinem persönlichen Gedankengang herausgelöste Bemerkungen. Einmal fragte er sie, ob sie jemals eine Feige gegessen habe, was nicht der Fall war. Sie wusste, dass der Herzog (dem das Dorf gehörte) in einem beheizten Zimmer seines Hauses einen Feigenbaum hatte, aber sie hatte noch nie eine gegessen und, außer auf einem Bild, auch noch nie eine gesehen.
»Wir haben sie vom Sattel aus gepflückt«, sagte er. »Uns im Vorbeireiten an die Bäume herangebeugt und sie gepflückt. Orangen auch.«
Als sie das nächste Mal zusammen aßen, fragte er sie, ob sie ihm eine Zeitung besorgen könne. Sie hatte sich schon gefragt, wann er eine solche Bitte äußern, wann er den Wunsch verspüren würde, über das Zimmer, das Haus hinauszublicken (ein Fernglas gab es jetzt nicht), und sie wusste, an wen sie sich wenden musste. Nicht an den Pastor, der sich wortreich über eine angebliche Störung auslassen würde, sondern an einen Farmer namens Nicholls, der sich als junger Mann selbst das Lesen beigebracht hatte und inzwischen über eine eigene bescheidene Bibliothek verfügte. Seine Farm lag eine Meile entfernt, und sie ging zu Fuß durch einen nach Schnee duftenden Wind. Als sie bei der Farm ankam, fand sie dort einen der Nicholls-Jungen vor, der mit einem Eimer mitten in einer Herde Schweine stand. Er wies mit dem Kinn aufs Haus, wo der Farmer es sich beim Tee an einem Tisch bequem gemacht hatte, der vielleicht einmal eine Tür gewesen war.
»Ich lese gerade«, sagte der Farmer und hielt einen Band hoch, der etwa so groß und so dick war wie ein Essapfel, »die Worte eines Mannes, der zu Fuß im ganzen Land herumkommt.«
»Dann weiß er bestimmt so einiges«, sagte die Haushälterin.
»Es könnte sein«, sagte der Farmer, »dass ein Mensch, der stillsteht, ganz genauso viel weiß, aber seine Stiefel weniger abnutzt. Die Welt geht durch ihn hindurch.«
Sie fragte ihn, ob er eine Zeitung habe, und er rief nach seiner Frau, um sie zu fragen, ob sie den Examiner gesehen habe, dann fand er ihn selbst unter einer schlafenden Katze. Als er der Haushälterin die Zeitung gab, war sie noch warm.
»Für John Lacroix, nehme ich an.«
»Ja«, sagte sie.
»Hat er genug vom Kämpfen?«, fragte der Farmer.
»Das weiß ich nicht«, sagte die Haushälterin. »Dazu hat er nichts gesagt.«
»Sehr viele junge Männer haben es mit dem Sterben sehr eilig«, sagte der Farmer. Sein mittlerer Sohn hatte das Handgeld genommen und diente in Amerika.
»Es gibt ebenso viele, die ihre Pflicht tun«, sagte die Haushälterin. Sie achtete den Farmer, aber sie fürchtete sich nicht vor ihm.
»Seltsame Pflicht, Menschen umzubringen, deren Namen man nicht einmal kennt.«
»Wäre es denn besser«, fragte die Haushälterin — es war tatsächlich eine Frage —, »ihre Namen zu kennen?«
»Ritter haben einander mit Namen gekannt. Ich habe früher jedermann auf dem Markt mit Namen gekannt. Inzwischen kenne ich allenfalls noch die Hälfte.«
»Du lebst in deinen Büchern«, sagte sie.
Er nickte und nahm das Buch wieder zur Hand, als hätte sie ihn daran erinnert. »Kann sein«, sagte er, während sie sich zum Gehen wandte, »dass er sich wieder der Musik widmet. John Lacroix. Ich finde, das hat zu ihm gepasst. Oder nicht? Die Musik?«
Als sie an die Zimmertür klopfte, kam keine Reaktion. Sie dachte, er habe sie vielleicht nicht gehört, und öffnete langsam die Tür. Er lag vollständig bekleidet auf dem Bett. Einen Moment lang war sie alarmiert; seine Haltung, das zur Seite gedrehte Gesicht, der quer übers Bett geworfene Arm hatten etwas Eigenartiges, doch im Nähertreten hörte sie das langsame Fließen seines Atems und beruhigte sich wieder. Sie wollte ihn zudecken, dachte jedoch, dass selbst eine leichte Berührung ihn vielleicht wecken würde. Sie ließ die Zeitung auf dem Tisch liegen, legte Kohlen nach (nahm, um keinen Lärm zu machen, die Brocken einzeln aus der Schütte), wischte sich die Finger an ihrer Schürze ab und verließ auf Zehenspitzen das Zimmer.
Als Nächstes sah sie ihn, als sie ihm sein Abendessen nach oben brachte. Es war eine Pastete, zubereitet aus zwei Fasanen, die die ganze Woche in der Kühle der Spülküche an einem Haken gehangen hatten. Er stand am Fenster. Die Zeitung lag aufgeschlagen auf dem Läufer neben dem Armsessel.
»Morgen gehe ich hinaus«, sagte er.
»Fühlen Sie sich denn kräftig genug?«, fragte sie, bemerkte dann, dass er sie gar nicht gehört hatte, und sagte: »Also sind Ihre Füße geheilt?«
Er zuckte mit den Schultern. Er wollte wissen, bei wem sie die Zeitung geholt hatte, und als sie es ihm sagte, wollte er wissen, was der Farmer gesagt hatte. Er kannte Nicholls und wusste, dass er ganz bestimmt etwas gesagt hatte.
»Er hat gefragt«, sagte die Haushälterin, »ob Sie vom Kämpfen genug haben.«
»Vom Kämpfen?« Einen Moment lang sah er so aus, als müsste er lachen. »Ich habe meinen Säbel verloren, Nell. Meine Uniform. Meine Stiefel.«
»Ja«, sagte sie und nickte, als leuchtete ihr das alles ein.
»Mein Pferd auch. Der arme Ruffian. Du erinnerst dich bestimmt an ihn.« Er drehte sich wieder dem Fenster zu und schaute hinaus. Sie glaubte nicht, dass er dort draußen etwas sehen konnte. Vielleicht ein Licht im Dorf oder den Schimmer eines Köhlerfeuers im Wald. Höchstwahrscheinlich sah er nur den Schatten seines eigenen Gesichts im Glas. »In La Coruña haben wir höchstens zwanzig eingeschifft. Für Pferde war der Krieg sehr hart, Nell.«
Sie wartete. Jetzt, dachte sie, ist er vielleicht so weit, dass er von allem spricht. Von Pferden, Männern, Schiffen. Von den Bergen, die sie überquert haben. Vom Tod des Generals. Von allem. Sie wartete, aber er sagte nichts mehr, sondern schaute nur weiter aus dem Fenster und ließ das Schweigen zwischen ihnen andauern, bis sie sich ihrer Neugier schämte und nur wünschte, er würde sich umdrehen, sich zu ihr setzen und essen.
Er brach sehr früh auf. Es war kaum hell. Von der Küche aus hörte sie seine Stiefel auf der Treppe und ein einziges freudiges Bellen des Hundes. Bis sie sich eine Haube aufgesetzt hatte, in ihre Pantoffeln geschlüpft war und die Halle erreicht hatte, war er schon draußen in der Einfahrt. Durch das schmale Fenster neben der Tür sah sie den Hund um ihn herumtanzen, während er sich seinen Schal enger zog und die Hutkrempe zurechtrückte. Er hatte einen Stock dabei, einen von zehn oder zwölf, die in einer Ecke der Halle an den Paneelen lehnten, Schwarzdorn und Esche. Sie klopfte an das Glas — sie würde ihm ein Frühstück mitgeben —, aber nur der Hund hörte sie, nicht der Mann, der aus ihrem Blickfeld in Richtung der Seitenpforte verschwand, die ihn durch den Garten und dann auf die Felder führen würde.
Er war schon über zwei Stunden fort, als Tom kam, Schnee auf den Schultern. Er hatte die Nacht bei den Hühnern verbracht und auf einen Fuchs gewartet, der nicht gekommen war. Sie machte Apfelmost für ihn heiß und gab ihm den Rest der Fasanenpastete. Sie erzählte ihm von dem Mann, dass er sich ohne einen Bissen in den Taschen auf den Weg gemacht habe, und das bei seinem ersten Gang außer Haus. Und jetzt schneie es auch noch!
»Aber was soll ihm denn zustoßen?«, sagte Tom. Sie zog ein Gesicht, und er sagte es noch einmal. »Was soll ihm denn zustoßen, Nell? Er kennt sich doch aus.«
Er trank seinen Apfelmost, aß die Pastete. Dass ihm das, was sie ihm gab, solche Freude machte, war schön zu sehen. Er war ihr Freund, unverheiratet, mehr oder weniger in ihrem Alter. Vor ein paar Jahren hatte es eine Zeit — eine Jahreszeit — gegeben, da hätte mehr daraus werden können, aber der Augenblick war verstrichen. Oder vielleicht auch nicht, nicht ganz. Sie dachte gern, dass eine vernünftige Frau im Lauf der Zeit wertvoller wurde. Und sie fühlte sich stark.
»Was will er denn mit sich anfangen, jetzt, wo er wieder da ist?«, fragte Tom.
»Er muss sein Leben wieder in die Hand nehmen«, sagte sie. Der Ausdruck war ihr in der vorigen Nacht oder der Nacht davor eingefallen. Jene Augenblicke, in denen Worte aus der Dunkelheit dringen. »Da ist das Haus. Das Land …«
»Oder was noch davon übrig ist«, sagte Tom. Er hatte ihr schon einmal in aller Deutlichkeit gesagt, was er davon hielt, Land zu verkaufen, um ein Offizierspatent und Kasinorechnungen bezahlen zu können.
»Vielleicht findet er ja eine Frau«, sagte sie.
»Eine Frau?«
»Warum denn nicht? Er ist nicht alt.«
»Da wäre die Witwe Simpson«, sagte Tom.
»Die ist knapp sechzig!«
»Dann wäre da noch die Witwe Coombes.«
»Es muss keine Witwe sein, Tom.«
Er nickte. Mit dem Zeigefinger stippte er die Krümel der Pastete auf. Inzwischen fiel der Schnee kräftiger, doch ohne Eile, streifte das Küchenfenster und setzte sich oben auf die Steinpfeiler und auf die Äste der Eschen entlang des Feldwegs.
»Hat er noch etwas von der Schlacht gesagt?«
»Von welcher Schlacht?«, fragte sie.
»Von der, in der der General gefallen ist.«
»Ich weiß ja nicht einmal, ob er an der Schlacht teilgenommen hat.«
»Nicht?«
»Ich weiß es nicht.«
»Irgendwas muss er ja wohl getan haben.«
»Sagst du«, sagte sie. Sie sah ihn an, ein Auge zugekniffen, wie eine Amsel einen Regenwurm ansieht. Sie grinsten einander an.
»Was sagt er denn überhaupt?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Er hat mich gefragt, ob ich schon einmal eine Feige gegessen habe.«
»Und, hast du?«
»Nein«, sagte sie.
»Hast du schon mal eine gesehen, Nell?«
»Was? Eine Feige?«
»Ja.«
»Wieso sollte ich denn eine Feige sehen wollen?« Inzwischen lachte sie, aufgekratzt.
»Also, ich habe schon mal eine gesehen«, sagte Tom. »Aber gegessen habe ich sie nicht.«
»Wer hat sie denn dann gegessen?«
»Briffit, glaube ich.«
»Briffit!« Einen Moment lang gab sie sich der Vorstellung hin, wie Briffit der Schweineschlachter eine Feige aß! Briffit mit der hässlichen Visage! Ihre Augen waren zusammengekniffen. Lachtränen liefen ihr über die Wangen. Jetzt könnte er mich küssen, dachte sie, und fertig. Dann wurde sie nüchtern und schlug die Augen auf. Sie schaute zum Fenster.
»Würdest du nach ihm suchen gehen, Tom, wenn er in einer Stunde noch nicht da ist?«
»Wenn du möchtest, gehe ich.«
»Er hat den Hund dabei.«
»Das ist gut.«
»Er hat gesagt, für Pferde wäre der Krieg sehr hart gewesen.«
»Für Pferde? Ja. Das glaube ich.«
Er kam zurück, bevor irgendwer nach ihm suchen musste. Die Kälte folgte ihm ins Haus, sein Gesicht war kreideweiß. Er zitterte leicht. Als sie sagte, sie werde ihm heiße Milch mit Brandy bringen, nickte er, stieg die Treppe hinauf, blieb auf halbem Weg stehen und ging dann weiter, wie mit dem letzten Quäntchen Kraft. Sie bereitete ihm das Getränk so rasch zu, dass sie sich dabei die Hand verbrühte. Im Zimmer saß er mit geschlossenen Augen in dem Armsessel. Der Hund sah selbstzufrieden aus. Sein Fell war schlammverkrustet. Er roch nach dem Fluss.
Sie weckte Lacroix und nötigte ihn, einen Schluck von dem Getränk zu nehmen. Dann zog sie ihm Gamaschen und Stiefel aus, schürte das Feuer und ließ ihn schlafen. Sie ging vors Haus und drückte ihre verbrühte Hand in den Schnee. Inzwischen herrschte nur noch leichter Schneefall. Ein paar Flocken setzten sich auf ihre Schultern, auf das Leinen ihrer Haube. Sie dachte an die Witwen, von denen Tom gesprochen hatte, besonders an die Witwe Coombes, die einen Anteil an einem Steinbruch besaß und nur ein Kind hatte, ein ungefähr zehn Jahre altes Mädchen, das kaum ein Wort sprach. Falls die beiden heirateten — und die Witwe Coombes hatte nichts Unangenehmes, überhaupt nichts —, würde das Haus wieder zum Leben erwachen. Sie würde für eine Familie kochen, und mit dem Geld der Witwe könnte man die Felder zurückkaufen. Besucher kämen, in den Fenstern würden Lichter brennen. Sonntags würden sie in die Kirche gehen und in ihrer alten Loge sitzen. Die Vorderseite der Loge zierte noch immer das Wappen der Lacroix, das mittlerweile allerdings so verblasst war, dass der Greif alles Mögliche sein konnte — ein Fuchs, ein Hase, ein auf den Hinterbeinen stehender Hase. Aber das ließe sich binnen eines Tages beheben — ein Tupfer Blau, ein Tupfer Gold. Dazu brauchte es nur die entsprechende Anweisung. Alles brauchte nur ein wenig Aufmerksamkeit, eine Belebung.
Aber fände die Witwe überhaupt Gefallen an ihm? Und hatte er überhaupt Interesse an einer Frau? Sie glaubte nicht, dass er früher viel mit Frauen zu tun gehabt hatte. Sie konnte sich nur an eine oder zwei erinnern, deren Namen man ihr gegenüber erwähnt hatte. Eine Amelia Soundso in Blandford, als er mit der Jagd dorthin geritten war. Eine Miss Catherine in Bath, mit der er zu den Konzerten gegangen war. Allerdings hatte es bestimmt auch andere gegeben, von denen sie nichts wusste. Schließlich war er Soldat gewesen, und es konnten ja nicht sämtliche Lieder irren.
Sie richtete sich auf, untersuchte ihre Hand, den rosa Halbmond der Verbrennung. Dann stand sie eine Zeitlang im eigenartigen grauen Schneelicht und betrachtete das weiche Durcheinander von Fußabdrücken an der Haustür.
Eine Woche lang schneite es immer wieder, fror ein paar Tage lang und begann dann zu tauen. Wo der Schnee schmolz, zeigten sich lebhafte grüne Triebe. Die Furchen im Fahrweg weichten wieder zu Schlamm auf.
Lacroix verließ sein Zimmer nun häufiger und erschreckte sie zuweilen, wenn er in Teilen des Hauses auftauchte, wo sie nicht mit ihm rechnete, in Durchgängen, die niemals mehr als nur einen Schimmer Tageslicht erblickten, im früheren Ankleidezimmer seiner Mutter (in dem es bitterkalt war), auf der Treppe zum Dachboden. Vom Dachboden aus konnte man, wenn man wollte, aufs Dach steigen, sich zwischen die Kamine setzen und meilenweit sehen.
An den meisten Tagen ging er mit dem Hund spazieren und hielt sich dabei — soviel sie wusste — stets an die querfeldein führenden Wege, wo er vielleicht einem Hirten, einem Waldarbeiter oder einem fahrenden Händler begegnen mochte, aber sonst niemandem, jedenfalls keiner Person von Stand.
Wenn sie mit einem Tablett vor seiner Tür stand, hörte sie ihn manchmal Selbstgespräche führen. Seine Taubheit ließ ihn lauter sprechen, und was sie hörte, erschreckte sie. Es war, als hätte er einen heimlichen Besucher, irgendeinen alten Intimus, dessen Gesellschaft nicht mehr willkommen war, der ihm zusetzte und mit seinem Schweigen die Oberhand über ihn gewann.
Einmal, als sie ins Zimmer kam, meinte sie, er habe geweint. Er hielt das Gesicht von ihr abgewandt, und sie sagte nichts. Es stand ihr nicht zu, ihn zu trösten, jedenfalls nicht direkt.
Körperlich dagegen war er weitgehend genesen. Der Körper hat seine eigenen Regeln. Seine alten Kleider begannen ihm wieder zu passen; sein Haar war nachgewachsen und fiel ihm bis auf die Schultern; der Schatten um seine Augen war größtenteils verschwunden. Wenn sie ihn zu seinen Spaziergängen aufbrechen sah, schritt er so kräftig aus, wie sie es von früher in Erinnerung hatte, oder jedenfalls annähernd so kräftig.
Ein Brief kam. Gerichtet an Captain John Lacroix Hochwohlgeb. Sie brachte ihn nach oben. Später meinte sie, einen Teil davon — eine verkohlte Ecke mit einem Tintenschnörkel — am Rand des Kaminrosts zu sehen. Er erwähnte ihn nicht. Sie fragte nicht nach. Irgendetwas, dachte sie, muss geschehen. So können wir nicht weitermachen. Könnte sie selbst schreiben, könnte sie vielleicht einer seiner Schwestern einen Brief schicken, Lucy, die, was Familienangelegenheiten betraf, das zartere Gewissen hatte. Aber sie konnte nicht schreiben, konnte nicht mehr als zehn, fünfzehn Wörter lesen. Und was sollte sie auch schreiben? Ihr Bruder ist zwar aus dem Krieg, in Wirklichkeit aber überhaupt nicht zurückgekehrt. Er ist zu Hause, weiß aber nicht mehr weiter. Es klänge wie der Brief einer Verrückten.
Die zweite Aprilwoche. Wie es schien, brauchte es nur einen einzigen Vormittag, um zu verabschieden, was vom Winter, vom reinen Winter, noch übrig war. Vielleicht brauchte es nicht mehr als eine Stunde. Die Haushälterin öffnete Fenster in Räumen, die sechs Monate in einem Zustand gleichsam betäubter, einwärtsgerichteter Beengung zugebracht hatten, Räume, wo noch im Januar Eisblumen die Innenseiten der Glasscheiben bedeckt hatten. Bei geöffneten Schieberahmen drang mit Macht die Außenwelt ein — kühle Luft mit einem Anflug von Wärme, das Lärmen der Krähen. Auf dem Rand eines Spiegels sonnte sich eine Fliege. Eine Hummel ließ sich erschöpft auf einer Fensterbank nieder.
Die Haushälterin begann, auf dem Küchenherd Wasser für einen Waschtag zu erhitzen. Sie würde die Sachen tagsüber einweichen, am Abend schrubben und ausspülen und am Morgen aufhängen. Sie ging nach oben, um seine Laken zu holen. Er kniete auf dem Boden, auf dem Läufer. Überall um ihn herum lagen die alten Liederbücher, die seinem Vater gehört hatten. Er blickte zu ihr auf, und einen Moment lang strahlte sein Gesicht wie das eines Jungen.
»Sie haben sie also hervorgeholt«, sagte sie. Die Luft im Zimmer war abgestanden. Nach dem Lüften der anderen Räume fiel ihr das auf. Sie trat ans Fenster, stemmte die Handballen unter die Querleiste und drückte, bis es sich rührte.
»Ich habe davon geträumt«, sagte er. »Vergangene Nacht. Und heute Morgen bin ich sie suchen gegangen.«
»Das war ein Frühlingstraum«, sagte sie. Sie war eine Frau vom Land, und deshalb wusste sie sehr wohl, wie wichtig Träume waren.
»Und sieh dir das an«, sagte er und hielt ihr eine gepresste Blume entgegen — ein zerzauster purpurroter Kopf, ein Stängel, der sich von Grün zu Grau verdunkelt hatte. Er hielt sie ganz sanft. Die Pflanze sah aus, als würde sie, wenn man sie anpustete, zu Staub zerfallen.
»Das ist Teufelsbiss«, sagte sie. »Die Kräuterkundigen verwenden es.«
»Ich hatte vergessen, dass er immer Blumen in Bücher gelegt hat. Ich habe Feuernelke, Kuckucksblume, Ochsenauge gefunden. Aber wie das heißt, habe ich vergessen.«
»Teufelsbiss«, wiederholte sie, etwas lauter.
Er nickte. »Ja«, sagte er, »aber es hat auch noch einen anderen Namen, glaube ich.«
Sie zog das Bett ab und nahm die Wäsche mit nach unten. Als sie eine Stunde später mit Mittagessen für sie beide zurückkam, kniete er immer noch inmitten der Bücher. Er ließ sie aufgeschlagen auf dem Boden liegen und setzte sich zu ihr an den Tisch. Das Mittagessen bestand aus einer Brühe mit dem letzten Rest des Kaminspecks. Sie tat ihm auf. Er aß seinen Teller leer und löffelte sich sofort noch mehr darauf, stippte Brotbrocken in den Saft. Die Bücher haben ihn verändert, dachte sie. Die Musik in den Büchern, die Erinnerung an seinen Vater. Sie sagte, es sei schön, ihn so gut essen zu sehen.
»Und trinken«, sagte er und füllte beide Becher mit Apfelmost. Den Most hatte sie im vorigen Herbst selbst gemacht, mit der alten Presse im Schuppen, während Wespen über den Trester krabbelten.
»Soldaten denken an nichts anderes«, sagte er. »Nur an Essen und Trinken. Fleisch und Bier.«
»Und was haben Sie gegessen«, fragte sie, »als Sie fort waren?«
»Alles mit Knoblauch und Öl. In Lissabon leben die Leute von gebratenem Fisch. Die ganze Stadt stinkt danach.«
»Gibt es dort auch Speck?«, fragte sie.
»Speck? Ja.« Er hielt inne.
Sie wartete. Sie hatte nicht gedacht, dass an der Frage nach Speck irgendetwas heikel sein könnte.
»Einmal habe ich gesehen«, sagte er, »wie Soldaten sich über eine Schweineherde hergemacht haben, auf die sie im Wald gestoßen sind. Sie waren derart rasend vor Hunger, dass sie Stücke von den noch lebenden Tieren abgeschnitten und das Fleisch dann auf Kesseldeckeln gebraten oder wohl eher kaum angesengt haben, ehe sie mit Essen anfingen.«
»Du meine Güte«, sagte sie. »Und war ihnen hinterher übel?«
»Das weiß ich nicht. Sie waren von der Infanterie. Wir waren auf dem Durchmarsch. Ich habe Halt gemacht und ihnen zugesehen. Anfangs war das noch amüsant.«
»Tja«, sagte sie, »ich hoffe, die Franzosen waren genauso hungrig.«
»Wer?«
»Die Franzosen. Dass sie auch hungrig waren.«
»Die Franzosen wurden unserer Meinung nach besser verpflegt. Jedenfalls glaubten das die Männer. Sie hofften immer, in einem Franzosentornister etwas zu finden.«
»Und wie sind sie an Franzosentornister gekommen?«, fragte sie und wusste die Antwort schon, ehe ihr die Frage über die Lippen gekommen war.
Den ganzen Nachmittag hatte sie ein Bild von Männern in roten Röcken vor Augen, die auf Schweine zurannten und auf sie einhackten. Sie hatte oft zugesehen, wie Briffit ein Schwein zerlegte, wusste, was für Geräusche das machte, wusste, wie das Blut floss. Aber die Männer im Wald … die schiere Wildheit des Vorgangs. Und es wunderte sie ein bisschen, dass sie sich das alles vorstellen konnte, als ob sie, eine Frau von dreiundvierzig in einem ordentlichen Kleid, mehr von solchen Dingen — Wildheit, Grausamkeit — wüsste, als sie vermutet hätte. Als ob das vielleicht für jeden galt.
Sie machte sich Sorgen, dass die neue Stimmung verdorben worden war, aber als sie an jenem Abend auf dem Stuhl in der Küche döste, hörte sie beim Aufwachen im Haus Musik. Die Klänge waren so leise, dass sie zunächst nicht sicher war, von welcher Seite des Schlafes sie kamen. Sie schlüpfte in ihre Pantoffeln und ging hinaus in die Halle. Der Hund folgte ihr und stand mit ihr am Fuß der Treppe. War da irgendetwas? Nichts. Also hatte sie es anscheinend wohl doch bloß geträumt. Doch nach einer halben Minute setzte die Musik wieder ein, ein kleiner Reel, stockend gespielt, Phrase für Phrase, wie ein dereinst auswendig beherrschtes, aber viele Jahre lang nicht mehr vergegenwärtigtes Gedicht.
Er wusste natürlich, wo die Geige zu finden war, nämlich dort, wo er selbst sie zurückgelassen hatte, unter dem Schreibtisch im Arbeitszimmer. Die Geige seines Vaters. Seine Geige, als er ganz versessen auf Musik gewesen war und einen Lehrer in Wells gehabt hatte, damals, als die jungen Männer mit Instrumenten unter den Armen ins Haus kamen und sich stundenlang zurückzogen, nicht viel aßen, aber sehr viel tranken und unentwegt spielten. Sie spielten sogar auf dem Dach, wenn sie in Stimmung waren, und dass keiner herunterfiel und sich das Genick brach, war ein Wunder. (Ein Jahr, nachdem sie zum letzten Mal gekommen waren, fand Tom, als er Schieferplatten ersetzte, eine Weinflasche voller Regenwasser.)
Bestimmt hatte die Geige gestimmt werden müssen, und während sie vom Fuß der Treppe aus zuhörte, war sie sich nicht sicher, ob alle Saiten so klangen, wie sie sollten, ob ihm das Stimmen wegen seines Gehörs, seiner geschädigten Ohren schwerfiel. Es musste wohl so sein, aber sie hatte zu ihrer Zeit genügend Dorfmusikanten spielen hören, die sich um nichts anderes als die Lautstärke ihres Spiels und den richtigen Takt für die Füße der Tänzer scherten. Ein bisschen zu hoch, ein bisschen zu tief, es war alles Musik.
Dann Stille, gefüllt vom Ticken der Uhr, von ihrem Atem und dem des Hundes. Dann kam die Musik wieder, nun selbstbewusster, freier. Seine Finger waren aufgewärmt, er entsann sich der alten Kniffe. Die Melodie war ihr so vertraut wie ihr eigenes Gesicht, und in der Halle, wo Mondlicht wie leuchtender Staub schwebte, setzte sie einen im Pantoffel steckenden Fuß zuerst mit der Zehenspitze, dann mit der Ferse auf, Zehenspitze, dann Ferse.
In der folgenden Woche spielte er tagsüber ein, zwei Stunden, und abends, wenn sie sich in der Küche niedergelassen hatte, oft noch einmal eine Stunde. Sie gewöhnte sich daran, ihn spielen zu hören, während sie ihrer Arbeit nachging. Tom kam lächelnd ins Haus und sagte, er habe es beim Gang übers hintere Feld gehört, und es habe ihn überkommen wie eine Erinnerung, wenn sie verstehe, was er meine. Sie bejahte.
»Dann ist also alles wieder, wie es war?«, fragte er. Zu Ehren der neuen Jahreszeit trug er neue Gamaschen, rote.
»Es sieht ganz danach aus«, sagte sie, obwohl sie es nicht glaubte. Sie war zu oft in der Gesellschaft des Mannes gewesen, um an irgendeine schlichte Wiederherstellung einfacherer Zeiten zu glauben. Sie würde sich weiter in Acht nehmen und wusste, dass Lacroix das ebenfalls tat, Musik hin oder her. Sie warteten auf irgendetwas, darauf, dass der Mond durch die Dachziegel krachte, dass der alte Lacroix sich aus dem Grab hervorwühlte, dass die Franzosen mit ihren Federbüschen und was nicht noch alles auf dem Hügelkamm auftauchten. Ihr Schlaf zerfaserte. Sie lauschte Eulen, dem Frühlingsregen, der im