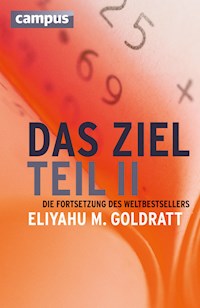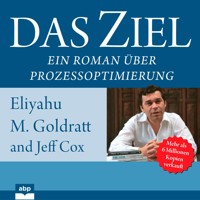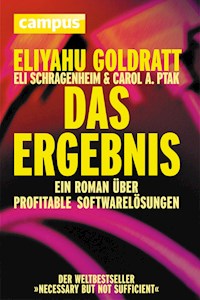Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2002
Für viele Mitarbeiter ist es das entscheidende Feld für ihren beruflichen Erfolg: das Projektmanagement. Trotz großen Bedarfs hat es in diesem Bereich seit etwa 50 Jahren keine wirklichen methodischen Neuerungen mehr gegeben. Das hat nun ein Ende: mit Eliyahu Goldratts Konzept der »Kritischen Kette«.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 399
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Eliyahu M. Goldratt
Die Kritische Kette
Das neue Konzept im Projektmanagement
Aus dem Englischen von Petra Pyka
Campus Verlag Frankfurt/New York
Über das Buch
Für viele Mitarbeiter ist es das entscheidende Feld für ihren beruflichen Erfolg: das Projektmanagement. Trotz großen Bedarfs hat es in diesem Bereich seit etwa 50 Jahren keine wirklichen methodischen Neuerungen mehr gegeben. Das hat nun ein Ende: mit Eliyahu Goldratts Konzept der »Kritischen Kette«.
Über den Autor
Dr. Eliyahu M. Goldratt (1948–2011) war Autor und Managementberater. Das von ihm gegründete Unternehmen berät weltweit agierende Firmen wie Ford, General Motors oder Boeing. Seine THEORY OF CONSTRAINTS ist eine der innovativsten Managementmethoden der letzten Jahrzehnte, seine Wirtschaftsromane sind internationale Bestseller.
Im Campus Verlag erschienen DAS ZIEL, DAS ZIEL TEIL II, DAS ERGEBNIS und DIE KRITISCHE KETTE.
Kapitel 1
»Die Vorstandssitzung wird hiermit vertagt«, verkündet Daniel Pullman, tonangebender Vorstandsvorsitzender und CEO von Genemodem. Die Gespräche der im Aufbruch begriffenen Direktoren summen durch das elegante Konferenzzimmer. Das letzte Quartal war das erfolgreichste in der Geschichte des Unternehmens. Die Direktoren wirken zufrieden, doch nicht übermäßig begeistert. Schließlich hatte man nichts anderes erwartet. Seit sechs Jahren ist jedes Quartal besser als das zurückliegende.
»Ich hätte dich gerne kurz gesprochen«, sagt Pullman zu Isaac Levy, während er sich lächelnd von externen Vorstandsmitgliedern verabschiedet. Als alle anderen den Raum verlassen haben, setzen sie sich.
»Hattest du bereits Gelegenheit, einen Blick in McAllens Abschlussbericht zu werfen?«, fragt Pullman.
Es war Levy gewesen, seines Zeichens geschäftsführender Vizepräsident und Leiter der Abteilung Technische Entwicklung, der darauf bestanden hatte, eine Consulting-Firma mit der Tiefenanalyse der Produktentwicklung von Genemodem zu beauftragen. Diese Analyse beschränkte sich jedoch nicht auf die technische Entwicklung. Sie bezog vielmehr alle Unternehmensprozesse ein, angefangen von der Entscheidungsfindung hinsichtlich der Merkmale eines neuen Modems über den Entwicklungsprozess bis hin zur ebenso bedeutsamen Übergabe des neuen Entwurfs an Produktion und Marketing.
Dabei hatte man sich bei Genemodem mitnichten auf seinen Lorbeeren ausgeruht. Die Einführung neuer Techniken, neuer Werkzeuge, ja selbst neuer Managementmethoden gehörte zum Tagesgeschäft. Nur so konnte man sich an der Spitze halten. Dennoch hatte Levy darauf bestanden, externe Fachleute hinzuzuziehen. »Sicher sind wir in vielen Dingen einfach betriebsblind«, hatte er behauptet. »Und so etwas kann nur ein Außenstehender erkennen.« Pullman hatte ihn in dieser Sache unterstützt, und auch sonst hatte es kaum Gegenstimmen gegeben.
Es war kein leichtes Unterfangen gewesen und hatte eine ganze Stange Geld gekostet, doch letzte Woche war ihnen schließlich der vierhundert Seiten starke Bericht vorgelegt worden.
»Meiner Ansicht nach haben sie wirklich gute Arbeit geleistet. Sie haben vieles aufgezeigt, was von uns übersehen wurde. Der Bericht ist sicher sein Geld wert, und vielleicht sogar mehr als das«, meint Levy.
»Ganz meine Meinung. Der Bericht enthält viele interessante Details. Aber viel mehr Gedanken mache ich mir um die Dinge, die er nicht enthält. Isaac, um wie viel könnten wir die Entwicklungszeit verkürzen, wenn wir alles umsetzen, was sie uns da vorschlagen?«
»Schwer zu sagen. Um 5 Prozent vielleicht? Möglicherweise auch weniger.«
»Schätze ich auch. Wir haben damit jeden konventionellen Ansatzpunkt abgehakt und, wie nicht anders zu erwarten, keine wirkliche Lösung gefunden.« Pullman steht auf. »Nun bleibt uns nur noch eines, Isaac. Der Think-Tank.«
»Das ist ein gewagter Versuch.« Levy erhebt sich ebenfalls.
»Sehr gewagt. Aber wir bewegen uns auf dünnem Eis.« Im Gehen fügt Pullman noch hinzu: »Und wir brauchen einen Ausweg. Dringend!«
Isaac Levy mustert die drei Jungmanager vor seinem Schreibtisch. Was er sieht, beeindruckt ihn nicht sonderlich. Sie sind zu neu im Geschäft. Sie sind zu jung und zu unerfahren für diese Aufgabe. Doch es war Pullmans Entscheidung.
»Isaac«, hatte er gesagt, »ein erfahrener Mann ist zu sehr geprägt von unserer Art, die Dinge anzugehen. Wenn überhaupt jemand Verbesserungsmöglichkeiten finden kann, dann nur ein junger Mensch. Jemand, der jung genug ist, um zu rebellieren, jung genug, um sich unseren Regeln zu widersetzen. Weißt du noch, wie jung und unerfahren wir beide waren, als wir angefangen haben? Wir haben jede Konvention gebrochen, und schau dir an, was wir geschafft haben!«
Isaac hatte sich den Hinweis verkniffen, dass sie es unter anderem geschafft hatten, mit ihrer ersten Firma Bankrott zu gehen.
»Sie kennen einander?«, fragt er die drei. »Warum stellen Sie sich nicht einfach kurz vor. Mark, machen Sie bitte den Anfang.«
»Ich bin Mark Kowalski. Ich komme aus der technischen Entwicklung.«
Mark ist zweiunddreißig, groß und kräftig und hat eine entsprechend volltönende Stimme. Er ist seit acht Jahren im Unternehmen und wurde kürzlich zum Projektleiter für das Modell A226 befördert. Er ist nicht unbedingt der rebellische Typ, der Pullman vorgeschwebt hatte. Und Levy ist nicht gerade glücklich darüber, die Entwicklung des A226 zu gefährden. Doch sie hatten einen guten Teamleiter gebraucht.
»Mark wird Ihr Team leiten«, ergänzt Levy. »Wir glauben, er ist aufgeschlossen genug, um mit konstruktiver Kritik umzugehen, qualifiziert und vernünftig genug, um unangebrachte Kritik abzuschmettern, und sympathisch genug, um harmonische Beziehungen zu gewährleisten. Sollten wir uns geirrt haben, dann machen Sie uns bitte darauf aufmerksam.«
Sie sind zu nervös, um zu lachen. Immerhin waren sie zum ersten Mal ins Büro des Vizepräsidenten gebeten worden. Levy signalisiert der jungen Frau, dass sie nun an der Reihe ist.
Sie folgt Marks Beispiel und sagt: »Ich bin Ruth Emerson. Ich komme vom Marketing.«
»Und was tun Sie dort?«, ermutigt Levy sie zu weiteren Ausführungen.
»Ich bin Markenmanagerin. Ich gehörte zu dem Team, das die Einführung des A106 geplant hat.«
Die beiden anderen sind beeindruckt. Das A106 ist der aktuelle Renner.
»Ruth ist ausgewählt worden, weil sie über ein ungewöhnlich hohes Maß an Integrität verfügt«, erklärt Levy. »Sie werden noch feststellen, dass es kaum eine Frage gibt, die sie nicht zu stellen wagt.«
»Ich bin Fred Romero«, meldet sich auf Levys auffordernden Blick hin das letzte Mitglied der Gruppe zu Wort. »Ich bin Erbsenzähler.«
»Nun, ganz so schlimm ist es nicht«, lacht Levy. »Fred ist unser Finanzrevoluzzer. Und gleichzeitig der meistgeschätzte Projektauditor, den wir haben. Sicher fragen Sie sich nun, warum ich Sie hergebeten habe?«
Mark und Ruth nicken. Fred wahrt seine undurchdringliche Miene.
»Von jetzt an sind Sie drei ein Think-Tank. Ihre Aufgabe ist es, eine Antwort zu finden auf die größte Bedrohung für die Zukunft unseres Unternehmens.«
Er schaut sie der Reihe nach durchdringend an und lässt sich Zeit dabei.
»Lassen Sie mich zunächst das Problem kurz umreißen.« Er steht auf, greift nach einem Textmarker und zeichnet eine Kurve auf die weiße Tafel. »Erkennen Sie diese Kurve?«
[Bild vergrößern]
»Sie finden sie in jedem Lehrbuch. Sie beschreibt die Lebensdauer eines Produkts. Bei der Markteinführung des Produkts steigen die Umsätze, um sich dann irgendwo einzupendeln. Das Produkt erreicht seine Reifephase und veraltet schließlich. Trifft das Ihres Wissens auf unsere Produkte so zu?«
Seine drei Zuhörer halten das für eine rhetorische Frage, bis er nachhakt. »Nun?«
»In unserem Fall sieht die Grafik eher aus wie ein Dreieck«, äußert Mark. »Noch bevor wir ein neues Modem auf dem Markt etabliert haben, ist es bereits veraltet, weil wir ein noch neueres nachschieben.«
»Und das ist falsch?«, fragt Levy.
»Das habe ich nicht gesagt«, versichert Mark eilig.
»Wenn wir das neue Modem nicht herausbringen«, kommt ihm Ruth zu Hilfe, »dann tut es die Konkurrenz. Das aktuelle Modem wird also auf jeden Fall veralten. Der Unterschied besteht lediglich darin, ob wir auch noch Marktanteile verlieren.«
»Richtig. Der heftige Konkurrenzkampf auf dem Markt zwingt uns, etwa alle sechs Monate eine neue Modem-Generation zu lancieren.«
Sie nicken einträchtig.
»So, und jetzt möchte ich Ihnen etwas erläutern, was Ihnen vielleicht nicht so gegenwärtig ist. Die Aktien unseres Unternehmens werden an der Wall Street zu 62 Dollar und 48 Cent gehandelt. So stand es jedenfalls gestern in der Zeitung. Dieser hohe Kurs ist aber weder durch die Vermögenswerte des Unternehmens noch durch seinen Gewinn gerechtfertigt. Er basiert in erster Linie auf den Erwartungen der Aktionäre, dass unser Unternehmen auch in Zukunft weiter wachsen und Gewinne abwerfen wird. Und diese Erwartungen sind nicht unbegründet, wie unsere eindrucksvolle Erfolgsgeschichte belegt. Ist Ihnen jedoch klar, wie wackelig dieses Konstrukt in Wirklichkeit ist?«
Es kommt keine Antwort. Also fährt Levy fort. »Ein Fehlschlag, ein minderwertiges Produkt oder die Lancierung eines guten Produkts drei Monate nach der Konkurrenz, und was wären die Folgen? Ruth?«
»Das wäre eine Katastrophe. Wir würden beträchtliche Marktanteile verlieren.«
»Ach, wo sind bloß die Zeiten geblieben«, seufzt Levy, »als es noch so etwas wie Kundentreue gab?« Und dann setzt er in ernsterem Ton hinzu: »Ein Fehlschlag, und unsere Aktien stürzen in den Keller. Der Schaden für die Aktionäre wäre immens. Und sollten wir uns gar zwei Aussetzer in Folge leisten, dann hätten wir womöglich gar kein Unternehmen mehr, für das wir arbeiten könnten.«
An dieser Stelle pausiert er. Die drei Jungmanager blicken von einem zum anderen.
»Unsere Produkte haben eine sehr kurze Lebensdauer. Sie liegt momentan bei etwa sechs Monaten, und alles spricht dafür, dass sie noch schrumpfen wird. Unsere Produktentwicklungszeit liegt jedoch trotz aller Anstrengungen bei rund zwei Jahren. Sehen Sie, wo unser Problem liegt?« Wieder macht er eine Pause.
Dann spricht er aus, was sie denken. »Eine Entwicklungszeit von zwei Jahren, wo wir doch alle sechs Monate die Früchte dieser Entwicklung präsentieren müssen – das kann nur eines bedeuten: Die Frage ist nicht, ob ein Fehlschlag kommt. Die Frage ist, wann er kommt. Und denken Sie daran, wir können uns nicht einen einzigen Fehlschlag erlauben.«
Sie sitzen schweigend da und versuchen zu verdauen, was ihnen eben vorgesetzt wurde. Wieder ist es Levy, der das Schweigen bricht: »Ihre Aufgabe ist nun, einen Weg zu finden, wie wir die Entwicklungszeit drastisch verkürzen können. Wir sind schon seit Jahren auf der Suche nach einer solchen Möglichkeit, bis jetzt jedoch ohne Erfolg. Sie sind unsere letzte Hoffnung. Sie müssen uns eine Lösung liefern!«
»Aber wie?« Mark ist ganz rot angelaufen.
»Nun, genau das ist das Problem, Mark. Wir wissen es nicht. Das sollen Sie uns sagen.«
»Mit welcher Unterstützung können wir rechnen?«, fragt er verzweifelt.
»Sie werden sich weiterhin um das A226 kümmern. Dieses Projekt ist Ihr Versuchsobjekt. Zu Ihrer Unterstützung können Sie anfordern, wen Sie wollen. Ruth und Fred, Sie sind von allen sonstigen Pflichten entbunden. Wenn Sie außer Haus gehen wollen, Konferenzen besuchen oder sich vielleicht für ein formelles MBA-Programm für Führungskräfte einschreiben wollen, dann sagen Sie es einfach. Ihr Budget ist unbegrenzt.«
»Wem erstatten wir Bericht?«
»Direkt an mich, und ich erwarte, dass Sie mich regelmäßig über Ihre Fortschritte informieren.«
»Wie viel Zeit haben wir?«
»Das A226 soll in 16 Monaten auf den Markt kommen. Ich rechne damit, dass es zu oder noch vor diesem Termin fertig wird. Im Übrigen gilt für alle Mitglieder des Think-Tank, dass Ihnen ein hübsches Aktienpaket winkt, wenn Sie eine brauchbare Lösung finden.«
»Wie hübsch?« Es ist Fred, der sich die Frage nicht verkneifen kann.
»Zehntausend Stück für jeden«, entgegnet Levy. »Viel Glück!«
Draußen vor der Tür sagt Mark: »Glück können wir brauchen. Unsere Chancen stehen sicher nicht besser als auf sechs Richtige im Lotto.«
»Nun, die Belohnung ist ja praktisch ein Lottogewinn«, meint Ruth. »Zehntausend Aktien sind ein Vermögen wert. Damit sind wir auf dem besten Weg zur ersten Million.«
»Schön wär’s.«
Kapitel 2
Ich greife nach dem Memo und lese es zum hundertsten Mal.
Lieber Rick,
Sie sollen im Rahmen des MBA-Studiengangs für Führungskräfte einen Kurs übernehmen.
Welchen, müssen wir noch besprechen.
Passt Ihnen Montag, 14 Uhr?
Jim
Nur drei Sätze, aber was sie bedeuten …, was sie bedeuten …
Ich bin Dozent an einer betriebswirtschaftlichen Fakultät. Doch jetzt stehe ich nicht mehr auf der untersten Stufe der akademischen Leiter. Vor einem Jahr wurde ich vom Stadium des Fußabtreters, also vom wissenschaftlichen Mitarbeiter, auf die halbwegs respektable Stufe des Assistenten befördert. Angesichts der verschwindend geringen Zahl akademischer Schriften, die ich veröffentlicht habe, war das ein richtiges Wunder. Andererseits auch wieder nicht, wenn man meinen Ruf als Ausnahmeerscheinung in der Lehre in Betracht zieht. Es kostet viel Arbeit, jede Veranstaltung zu einer Lernerfahrung zu machen, doch es zahlt sich aus. Meine Kurse sind stets als Erste ausgebucht.
Und hier, schwarz auf weiß, ist der endgültige Beweis. Nur drei Sätze. Diesmal lese ich das Memo laut:
»Sie sollen im Rahmen des MBA-Studiengangs für Führungskräfte einen Kurs übernehmen.«
Die Worte klingen wie eine Sinfonie. Kein Wunder. Wenn ich für das MBA-Programm für Führungskräfte eingeplant bin, heißt das, dass man mir im nächsten Jahr einen unbefristeten Vertrag geben wird. Und die unbefristete Übernahme ist das Nonplusultra. Damit hat man ausgesorgt. Dann kann man praktisch tun und lassen, was man will, sie werden einen nicht mehr los. Dann ist man mit von der Partie. Der Job ist einem sicher.
Und Sicherheit brauche ich ganz dringend. Und meine Frau erst. Wie jeder, der die akademische Laufbahn einschlägt, bin ich »befristet eingestellt« worden – quasi auf Bewährung. Die einzigen Menschen, die offiziell »Bewährung« bekommen, sind meines Wissens Straftäter. Und eben akademische Nachwuchskräfte. Der Unterschied ist nur, dass die Bewährungsfristen für Akademiker länger sind. Ich hatte fünf Jahre bekommen, um mich als guter Dozent zu bewähren. Fünf Jahre, um den übrigen Mitgliedern der Fakultät meine Teamfähigkeit zu beweisen.
»Passt Ihnen Montag, 14 Uhr?«
Jim, mein Bester, das passt mir auf jeden Fall.
Vierzehn Uhr. Die Zeit bis dahin kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Ich beschließe, ein Stück spazieren zu gehen. Draußen ist es kalt. Es sind dreißig Zentimeter Neuschnee gefallen, doch der Himmel ist wolkenlos, und die Sonne strahlt. Es ist kurz vor eins.
Das erste Mal, als ich mich um eine unbefristete Stelle bewarb, habe ich die Sache versiebt. Fünf Jahre, und alles umsonst. Es war an einer guten Universität gewesen, größer und renommierter als die, an der ich jetzt arbeite. Aber ich hatte ja den Mund nicht halten können. Die Unzulänglichkeit unserer Lehrbücher anzuprangern oder zu betonen, dass wir dazu da seien, unsere Studenten zu unterrichten, und nicht nur dazu, sie den Lehrstoff büffeln zu lassen, ist eine Sache. Die Publikationen von Kollegen zu kritisieren, eine ganz andere. Insbesondere, wenn es sich dabei um höherrangige Kollegen handelt.
Man sagt, der Kluge lernt aus seinen Fehlern, der Weise aus den Fehlern anderer. Nun, ich bin nicht weise. Ich war es nie, aber immerhin bin ich klug. Wenn ich mir die Finger verbrenne, und das nicht zum ersten Mal, dann lerne ich meine Lektion. Das war damals eine üble Geschichte, doch vorbei ist vorbei. Und diesmal wird alles anders, nur darauf kommt es an. Diesmal werde ich es schaffen. Und zwar ganz nach oben.
Außer mir ist niemand unterwegs. Jedenfalls niemand, der ziellos umherläuft. Obwohl die Wege nicht überall eisfrei sind, legen die Leute ein ordentliches Tempo vor. Der Wind ist wohl zu ungemütlich. Aber mir ist nicht kalt.
Das Leben ist schön. Einen befristeten Assistentenvertrag habe ich bereits, und nun ist mir auch die Festanstellung sicher. Der nächste Schritt ist der zur ordentlichen Professur und dann zum Lehrstuhlinhaber. Darüber gibt es nichts. Ein Lehrstuhl bedeutet, dass man mehr Zeit für die Forschung hat. Dann gehört man zur Elite. Mit einem Gehalt von über 100000 Dollar im Jahr.
So viel Geld sprengt mein Vorstellungsvermögen. Halb so viel, und ich wäre zufrieden. Nach Jahren als Doktorand mit einem Stipendium von 12 000 Dollar im Jahr und zu vielen Jahren, die ich von einem Gehalt als wissenschaftlicher Mitarbeiter leben musste … Verdammt, dagegen ist sogar ein High-School-Lehrer Großverdiener.
Ich reibe mir die eisige Nasenspitze. Wenn ich aber weiterhin so wenig veröffentliche, werde ich es nie zum Professor bringen. Wenn man ein guter Dozent ist und keinen Ärger macht, dann reicht das vielleicht zur Festanstellung, doch eine Professur steht auf einem ganz anderen Blatt. Publizieren oder man ist weg vom Fenster, so einfach ist das – ob es mir passt oder nicht.
Und es passt mir ganz und gar nicht, denn meine Ideen lassen sich einfach nicht zu brauchbaren Artikeln verarbeiten. Ich frage mich, wie das die anderen machen. Ich weiß nicht, wo sie all die kleinen Fallbeispiele hernehmen, die man durch ausreichende Anwendung von mathematischen Modellen zu publikationsfähigen Texten trimmen kann. Mir liegt das nicht. Ich bin bodenständiger und befasse mich lieber mit praktischen Dingen. Und außerdem wird mir jetzt doch kalt. Ich gehe also lieber zurück.
Ich frage mich, welchen Kurs Jim für mich ins Auge gefasst hat. Er hat zwar geschrieben, dass er das mit mir besprechen will, doch im Grunde ist es mir gleichgültig. So oder so wird die Vorbereitung eine ganze Menge Zeit in Anspruch nehmen. Die Lehrtätigkeit in einem MBA-Programm für Führungskräfte ist nicht vergleichbar mit der in einem normalen MBA-Studiengang, schon gar nicht im Grundstudium. Die Studenten, die ein MBA-Programm für Führungskräfte absolvieren, studieren nebenberuflich. In Wirklichkeit sind sie viel beschäftigte Manager, die alle 14 Tage einmal samstags die Schulbank drücken.
Meine Schritte werden länger. Das liegt nicht etwa am hohen Adrenalinspiegel, sondern schlicht daran, dass ich inzwischen erbärmlich friere. Manager zu unterrichten wird eine ganz neue Erfahrung für mich sein. Sie werden bestimmt nicht fraglos akzeptieren, was ich sage, nur weil es aus einem Lehrbuch stammt. Ich werde mich auf die realen Probleme einstellen müssen, denen sie im Alltag gegenüberstehen. Vielleicht ist das gar nicht schlecht. Vielleicht bekomme ich dadurch ein paar Anregungen für Forschung … und Publikationen.
Doch Anregungen genügen nicht. Ich kann nicht im Vakuum forschen, jedenfalls nicht so, wie ich mir das vorstelle. Aber wenn ich es richtig anstelle, dann kann ich vielleicht über meine neuen Studenten Kontakte zu Firmen aufbauen. Das könnte funktionieren.
Ich bin an meinem Gebäude angelangt. Eine Tasse Kakao wird mir helfen, wieder aufzutauen. Also gehe ich zum Automaten. Es ist zehn vor zwei. Ich beeile mich besser.
»Ja, gern«, entgegne ich auf Jims Frage, ob ich eine Tasse Kaffee möchte, und lasse mich auf seine auffordernde Geste hin auf einem seiner ächzenden, unbequemen Polsterstühle nieder.
»Zwei Tassen Kaffee, bitte«, sagt er zu seiner massigen Sekretärin Miriam und nimmt selbst auf dem Sofa Platz.
Statussymbole sind wichtig an Universitäten, und Jim hat ein Büro, das seiner Position entspricht. Es ist ein großes Eckzimmer. Nun, vielleicht stimmt das nicht ganz. Vielleicht sind Statussymbole nicht an jeder Universität so wichtig, doch für den Dekan unserer betriebswirtschaftlichen Fakultät sind sie es auf jeden Fall. Unser Dekan vergegenwärtigt uns stets, welcher der wichtigste Fachbereich ist. Und er hat ja nicht ganz Unrecht. An der betriebswirtschaftlichen Fakultät sind mittlerweile über sechstausend Studenten eingeschrieben – fast die Hälfte der gesamten Studentenzahl. Der ordentliche Professor Jim Wilson leitet den prestigeträchtigsten Studiengang des Fachbereichs, das MBA-Programm für Führungskräfte. Kein Wunder also, dass Jim so nobel residiert. Ich wünschte nur, er hätte einen besseren Geschmack, was Möbel anbelangt. Obwohl, wenn man bedenkt, wie wenig Wert Jim auf materielle Dinge legt – vielleicht hat ja auch Miriam die Möbel ausgesucht. Ja, das könnte hinkommen.
»Herzlichen Dank für die Chance«, sage ich ernsthaft. »Ich werde Sie nicht enttäuschen.«
»Das hoffe ich doch«, lächelt er. Das Lächeln erstirbt. »Genau darüber wollte ich auch mit Ihnen sprechen, Richard.«
Ich beuge mich vor. Wenn Jim mich Richard nennt, dann ist die Lage ernst.
»Wie Sie wissen, gibt es genug ältere Bewerber, die diese Lehrveranstaltungen gerne übernehmen würden, Richard. Wissen Sie, warum ich mich für Sie entschieden habe?«
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Jim mich schon gut leiden konnte, bevor er mein Doktorvater wurde. Ich werde es ihm nie vergessen, dass er mir den Posten hier verschafft hat, als ich mich um eine zweite Chance in der akademischen Welt bemühte.
»Ich habe Sie wegen Ihres einzigartigen Unterrichtsstils ausgewählt«, erklärt er.
»Die Lehre durch offene Diskussion?«, frage ich erstaunt zurück.
»Genau«, sagt er kategorisch. »Ich gelange mehr und mehr zu der Überzeugung, dass diese Art der Lehre die einzig angebrachte für dieses Programm ist. Die Studierenden bringen die entsprechende Praxiserfahrung mit. Offene Debatten, eine Gruppe dazu anzuleiten, selbst Know-how zu entwickeln, so sollte der Unterricht aussehen. Und ich habe nicht so viele Dozenten, die so unterrichten wollen und können.«
Jetzt begreife ich, doch gleichzeitig bekomme ich Angst. »Aber, Jim«, protestiere ich, »es ist eine Sache, so etwas mit normalen Studenten durchzuziehen. Ich bin nicht sicher, ob ich das auch mit gestandenen Managern kann.«
»Wieso nicht? Was ist daran anders?«
»Nun, was mir dabei Magenschmerzen bereitet, ist der Umstand, dass ich sie kaum anleiten kann. Mein theoretisches Wissen wird im Vergleich zu ihren praktischen Kenntnissen unzulänglich sein«, sage ich ehrlich.
»Machen Sie sich darüber keine Gedanken«, meint Jim unerbittlich.
»Aber …«
»Hören Sie mal, Rick, bei diesen Leuten kommt es vor allen Dingen darauf an, zugeben zu können, wenn Sie etwas nicht wissen. Die zahlen einen Haufen Geld für ihre Ausbildung – viel mehr als normale Studenten. Sie haben Kontakte zum Dekan und sogar zum Präsidenten, und sie lassen sich kein X für ein U vormachen.«
Ich frage mich allmählich, ob ich der Sache gewachsen bin. Vielleicht ist diese Geschichte mein Untergang.
Offensichtlich sieht mir Jim an, was ich denke, denn er versucht mich aufzubauen. »Wie viele Jahre kennen wir uns jetzt, Rick? Hm? Ich weiß, dass Sie es schaffen können, ehrlich mit den Leuten umzugehen. Und Sie haben mir immer wieder gezeigt, dass Sie viel mehr können, als Sie sich zutrauen. Arbeiten Sie einfach mit Ihren üblichen Methoden. Ich bin sicher, dass Sie damit Erfolg haben werden.«
Ich habe ohnehin keine Wahl. Also sage ich tapfer: »Ich werde mein Bestes tun.«
»Gut.« Jim wirkt zufrieden. »Dann müssen wir nur noch entscheiden, welchen der Kurse Sie übernehmen werden.« Er geht zur Tür und fragt beiläufig: »Haben Sie sich darüber schon Gedanken gemacht? Miriam, wo bleibt denn unser Kaffee?«
Er verschwindet im Vorzimmer. Eine Minute später trägt er ein Tablett herein.
»Jim, erinnern Sie sich noch, welche Warnung Sie mir mit auf den Weg gegeben haben, als ich mit meiner Doktorarbeit anfing?«
»Oh, das waren so viele.« Er grinst und reicht mir eine Tasse. »Auf welche spielen Sie an?«
»Mir nicht mehr zuzumuten, als ich verkraften kann«, helfe ich seinem Gedächtnis nach. »Nicht mehr davon zu träumen, die Welt zu verändern, sondern stattdessen ein Thema in Angriff zu nehmen, das ich auch zu Ende bringen kann.«
»Oh ja, ich erinnere mich jetzt. Kein schlechter Rat. Insbesondere für einen Doktoranden.«
Ich nehme einen Schluck Kaffee. »Wann ist denn die richtige Zeit für Träume?«, frage ich.
Er mustert mich prüfend. »Das muss die Midlife-Crisis sein!«, verkündet er dann seine Diagnose. »Was hat denn das mit der Frage zu tun, welchen Kurs Sie übernehmen wollen?«
Ich entscheide mich dafür, mit einer Gegenfrage zu antworten. »Wird sich der Kurs, den ich im Rahmen dieses MBA-Programms übernehme, nicht auf die Schwerpunkte meiner Forschungsarbeit auswirken?«
Er überlegt. »Möglicherweise«, räumt er ein. Als ich nichts erwidere, grinst er. »Verstehe. Sie wollen also etwas Bahnbrechendes erreichen. Sie wollen, dass Ihre Forschungsarbeit zum Maßstab für den gesamten Bereich wird.«
Ich nicke.
Er mustert mich noch eingehender. »Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass die einzige Möglichkeit, Sie von dieser fixen Idee zu befreien, darin besteht, Ihnen Gelegenheit zu geben, sich daran auszuprobieren. In welchem Fachgebiet wollen Sie denn Ihren herausragenden Beitrag einbringen, Dr. Silver?«
»Ich weiß nicht«, gestehe ich und ignoriere seinen Sarkasmus. »Auf einem Gebiet, über das man noch nicht genug weiß.«
»Nun, das trifft so ziemlich auf jedes betriebswirtschaftliche Teilgebiet zu«, stellt er trocken fest.
»Ich meine …« Ich suche die richtigen Worte. »Ein Bereich, in dem das bestehende Know-how offensichtlich keine befriedigenden Antworten liefert.«
»Ob eine Antwort befriedigend ist oder nicht, ist Ansichtssache.« Jim denkt nach. »Beschreiben Sie mir doch einmal möglichst genau, was Sie nicht wollen. Vielleicht bringt uns das weiter.«
»Ich will keiner Mode nachlaufen«, sage ich fest. »Und ich will auch kein Fachgebiet, in dem sich bereits zu viele Forscher engagieren.«
»Klingt vernünftig. Weiter!«
»Ich stelle mir einen Bereich vor, in dem wirklich Not am Mann ist«, wiederhole ich. »Ein Fachgebiet, in dem es schon seit geraumer Zeit keinen nennenswerten Fortschritt gegeben hat.«
»Gut«, sagt er und wartet darauf, dass ich endlich klar sage, welcher Kurs mir vorschwebt. Das Problem ist nur, ich weiß es wirklich nicht. Wie peinlich!
»Projektmanagement«, sagt Jim langsam. »Darauf passt Ihre Beschreibung wie angegossen. Wenn Sie einen Bereich suchen, der im Argen liegt, dann ist Projektmanagement erste Wahl. Und hier hat es meiner Ansicht nach schon seit ungefähr vierzig Jahren nichts Neues mehr gegeben.«
»Aber Jim, das ist doch Ihr Kurs.«
»Wie wahr, wie wahr.« Nun spricht er zur Zimmerdecke hinauf. »Außerdem habe ich im Rahmen dieses Kurses interessante Forschungsarbeiten initiiert. Recht interessante Forschungsarbeiten.«
»Vielleicht könnte ich Sie dabei unterstützen? Sie wissen doch, in Bibliotheken wühlen kann ich gut, und ich schreibe auch ganz anständig.«
»Stimmt schon.« Sein Blick klebt immer noch an der Decke.
»Jim, übertragen Sie mir diesen Kurs für ein Jahr. Nur für ein Jahr! Ich werde Sie nach Kräften bei Ihrer Forschungsarbeit unterstützen. Ich bin bereit, den ganzen lästigen Kleinkram zu übernehmen.«
Jetzt schaut er auf den Tisch, und seine nächsten Worte gelten mehr ihm selbst als mir: »Ich würde mich natürlich gern auf meine Produktionssysteme konzentrieren. In diesem Bereich ist in letzter Zeit so viel passiert. Das wäre eine gute Vorarbeit für ein nettes Lehrbuch.« Nun blickt er mich direkt an. »Was nun das Projektmanagement und die damit verbundene Forschungsarbeit angeht, wie stellen Sie sich das denn im Einzelnen vor?«
Kapitel 3
Sie ist über einen Meter achtzig groß und schlank. Elegant gekleidet, eine Spur zu elegant beinahe. Bei jeder Gelegenheit. Sie ist nicht im landläufigen Sinne schön, doch eine auffallende Erscheinung. Wenn man sie sieht, denkt man unvermittelt an edle Seide. Vielleicht, weil sie nie die Stimme hebt, vielleicht auch wegen ihres leichten Südstaatenakzents. Doch das ist ein flüchtiger Eindruck, der nur kurz von der unübersehbaren Tatsache ablenken kann, dass sie knallhart ist.
Sie ist intelligent, ehrgeizig und eine Meisterin der Manipulation. Und sie stellt sich als B. J. von Braun vor. So steht es auch auf ihrem Briefkopf. Es geht das Gerücht, der erste Buchstabe stünde für Brunhilde. Allerdings hat noch nie jemand gewagt, nachzufragen. Ihr Briefkopf enthält außerdem die Bezeichnung Universitätspräsidentin. Die gekrönte, unumstrittene Königin. Einen König gibt es nicht, jedenfalls nicht für den Moment.
Es ist Sommer in Washington, und die Stadt glüht vor Hitze. Auch nach Sonnenuntergang ist es noch heiß. Nicht so jedoch in dem Restaurant, wo das formelle Diner der Universitätspräsidenten stattfindet.
B. J. sitzt zwischen Bernard Goldsmith und Alistair Franklin. Es war nicht besonders schwierig gewesen, diese beiden an ihre Seite zu bekommen. Beide sind kluge Köpfe, berufserfahren und seit langem miteinander bekannt. Und, wichtiger noch, beide haben große betriebswirtschaftliche Fakultäten an ihren Hochschulen.
»Wie sieht es bei euch mit der Einschreibung für Betriebswirtschaft aus?«, fragt B. J. im leichten Gesprächston.
»Könnte besser sein«, entgegnet Alistair beiläufig.
Doch bevor B. J. diese vage Antwort hinterfragen kann, nimmt ihr Bernard die Mühe ab. »Willst du damit sagen, dass du, wie wir anderen auch, den Eindruck hast, dass der Run nachlässt?«
Diese Eigenschaft bewundert sie an Bernard: Er bringt die Sache auf den Punkt, ohne dabei aggressiv zu wirken. An Alistair schätzt sie dagegen, dass er keine Antwort schuldig bleibt.
»Es ist noch zu früh, um das zu sagen«, entgegnet er. »Aber womöglich hast du Recht. Dieses Jahr werden wir wohl nicht so viele Absagen verschicken.«
Bernard nickt. »Wir nehmen so ungefähr jeden, der seinen Namen schreiben kann. Jedenfalls hoffen wir das. Wie sieht es bei dir aus, B. J.?«
Nach seinem Tonfall zu urteilen ist Bernard ebenso besorgt darüber wie sie selbst.
»Genauso, fürchte ich.«
In Gedanken versunken widmet sie sich wieder ihrem Caesar-Salat. Es ist also nicht nur in ihrem Fachbereich so. Eine Nachricht, die einerseits gut, doch andererseits besorgniserregend ist.
Alistar spricht aus, was sie alle denken. »Die letzten zehn Jahre waren eine tolle Zeit für uns. Die Nachfrage der Unternehmen nach Leuten mit MBA-Abschluss ist kontinuierlich gewachsen, und entsprechend auch die Nachfrage nach Studienplätzen. Wir hatten gar nicht die Kapazität, alle Interessenten aufzunehmen. Kein Wunder also, dass die Bewerber Schlange standen und uns förmlich die Türen einrannten.« Er nimmt einen Schluck Rotwein. Sie warten darauf, dass er fortfährt, doch es kommt nichts mehr.
Bernard nimmt den Faden auf. »Ist das, was wir jetzt erleben, schlicht die Folge davon, dass es den Universitäten gelungen ist, genügend Kapazitäten zu schaffen?«
»Vermutlich.« Alistairs Blick ist auf sein Glas geheftet. »Doch ganz so einfach ist es nicht. Ihr wisst ja, wie Systeme normalerweise reagieren, nämlich entweder zu heftig oder nicht stark genug. Ich fürchte, der drastische Rückgang bei den überzähligen Studienbewerbern zeigt, dass wir überreagiert haben.«
»Angesichts der Wachstumsraten, mit denen die betriebswirtschaftlichen Fakultäten im ganzen Land ausgebaut werden, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir vor leeren Stühlen stehen«, pflichtet Bernard bei.
Es hat sich gelohnt, hierher zu kommen. B. J. ist zufrieden. Auch mit der Wahl ihrer Tischherren. »Wir haben also nicht genügend Bewerber, weil unsere betriebswirtschaftlichen Fakultäten mehr Studienplätze bieten, als junge Menschen Manager werden wollen?«, fragt sie mit ihrer sanften Stimme.
»Gut möglich«, kann Alistair noch antworten, bevor der Ober den nächsten Gang aufträgt.
»Das hieße, dass wir gut daran täten, den gegenwärtigen hektischen Ausbau unserer Business-Schools zu bremsen. Zumindest bis es uns gelingt, wieder mehr junge Leute für eine betriebswirtschaftliche Karriere zu begeistern«, schließt Bernard nachdenklich.
Alistair wartet mit seinem Kommentar, bis der übereifrige Ober endlich das Feld räumt. »Es könnte viel schlimmer sein.«
»Was wollen Sie damit sagen?«, fragt Stanley von der anderen Seite des Tisches. Offensichtlich interessieren sich auch andere Präsidenten für das Thema.
»Es könnte sein, dass wir nicht mehr genug Bewerber haben, weil der Markt bereits übersättigt ist und es sich herumgesprochen hat, dass ein MBA-Abschluss keine Garantie für einen gut bezahlten Job mehr ist.«
»Wenn das so wäre«, denkt Bernard laut, »dann ist es mit einem langsameren Ausbau unserer betriebswirtschaftlichen Fakultäten nicht getan. Dann bestünde das Problem darin, sie möglichst reibungslos zu verkleinern. Keine leichte Aufgabe.«
B. J. konzentriert sich auf den Fleischgang und wägt ab, was Bernard gerade gesagt hat. In Wahrheit hat er ihre ureigensten Befürchtungen in Worte gefasst, doch aus seinem Munde klingen sie fragwürdig. So schlimm kann es doch unmöglich sein …
»Wenn ich so darüber nachdenke«, bricht Bernard das Schweigen, »dann könnten wir doch auch die Nachfrage ankurbeln. Wir bräuchten lediglich ein Gesetz, dass jede Aktiengesellschaft zwingt, nur Manager zu beschäftigen, die einen MBA-Abschluss haben. Als gesetzlich geforderte Qualifikation wie bei Ärzten, Wirtschaftsprüfern oder Rechtsanwälten.«
»Nicht so schnell«, wendet Stanley ein. »Meiner Meinung nach sollten wir an eine gesetzliche Lösung gar nicht denken. Das widerspricht dem kapitalistischen Grundgedanken. Und es ist auch nicht praktikabel. Wie sollte man das denn durchsetzen? Außerdem glaube ich nicht, dass das Thema schon spruchreif ist. Die Immatrikulationen an unserer betriebswirtschaftlichen Fakultät haben in diesem Jahr noch zugelegt.«
»Ich habe mit unseren Kollegen in Harvard und am MIT gesprochen. Auch sie sehen noch keine Anzeichen für einen Rückgang«, wirft Alistair ein.
»Das haben sie nie, und sie werden es auch nicht«, bemerkt Bernard nicht ohne Neid. Er stochert in seinem Stück Fleisch herum und schiebt es zur Seite. »Die Listen von Anwärtern sind dort in allen Fachbereichen ellenlang. Und das ist vermutlich noch untertrieben. Ich habe mir sagen lassen, dass man dort nur jeden fünften Bewerber berücksichtigen kann. Angesichts der Preise, die sie verlangen, ist das direkt ein Hohn.«
»Wieso?«, fragt Jerry Preston. Inzwischen sind alle anderen Gespräche versiegt. Jeder wartet gebannt auf Bernards Antwort. Er lässt sich Zeit, genießt es, im Mittelpunkt zu stehen. In aller Ruhe trinkt er einen Schluck Rotwein und tupft sich die Lippen mit der weißen Leinenserviette.
»Sie wollen wissen, wieso? Das kann ich Ihnen sagen. Schauen Sie sich mal deren Lehrplan für BWL an. Sie unterrichten mehr oder weniger den gleichen Stoff wie wir. Vielleicht sind ihre Professoren die besseren Forscher, doch ich bezweifle, dass sie bessere Lehrer sind. Der einzige Unterschied zwischen uns und ihnen besteht darin, dass ein Abschluss an einer Eliteuniversität so viel wert ist wie eine Lizenz zum Stehlen. Der Unterschied liegt nicht in der Substanz, sondern einzig im Renommee.«
»Das genügt ja wohl auch«, stellt Stanley lakonisch fest. »Im Übrigen gibt es doch noch einen Unterschied – sie haben die besseren Studenten. Bei diesen Unis bewerben sich die Besten aus dem ganzen Land, und, wie Sie ganz richtig festgestellt haben, daraus können sie sich dann noch die Creme de la Creme herauspicken.«
»Wie ich schon sagte, da geht es nicht um die Substanz, sondern nur ums Renommee.« Bernard diskutiert nicht, er lässt lediglich Dampf ab.
Vielleicht stehen die Business-Schools wirklich vor der Krise, denkt B. J. im Stillen. Möglicherweise hat Stanley Recht, und die Krise zeichnet sich erst am Horizont ab. Doch nur die prestigeträchtigsten Universitäten sind immun. Alle Übrigen sind in Gefahr.
»Wie kommt man denn zu so einem Renommee?«, fragt Jerry.
»Ganz einfach«, erwidert Bernard sarkastisch. »Man gründet eine Universität und kümmert sich zweihundert Jahre lang hingebungsvoll um seine Absolventen.« Er blickt herausfordernd in die Runde. Doch Stanley lässt sich nicht einschüchtern.
»Das allein ist es nicht. Wir alle wissen, dass sie immer wieder auch durch intellektuelle Leistungen landesweit Furore machen. Es ist ihnen gelungen, eine Gruppe herausragender Wissenschaftler zu sammeln, deren bahnbrechende Erkenntnisse ihren Fachbereichen einen festen Platz auf der Landkarte sichern.«
Alistair schüttelt missbilligend den Kopf. B. J. weiß genau, warum. Einer kleinen Universität wie der ihren oder der von Alistair ist es unmöglich, Wissenschaftler dieses Kalibers anzulocken. Solche Ausnahmeerscheinungen suchen sich Universitäten, die bereits einen Ruf haben, und das mit Erfolg. Außerdem sind die hohen Gehälter, die hier im Spiel sind, für kleinere Institute schlicht unbezahlbar.
Vielleicht könnte sie aber auf die Begabungen ihrer vorhandenen Mitarbeiter an der Business-School zurückgreifen? Sie in irgendeiner Weise unterstützen oder fördern … Nur wie? Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich ausgerechnet an ihrer betriebswirtschaftlichen Fakultät ein unerkannter Feynman, ein zukünftiges Idol der amerikanischen Wissenschaft verbirgt?
Kapitel 4
Ich schaue mich um. Es sind viel mehr Leute im Hörsaal, als ich erwartet hatte. Fast 30, doch das stört mich nicht. Ich habe schon vor Gruppen gesprochen, die viermal so groß waren, und ich bin gut vorbereitet. Den ganzen Sommer über habe ich geackert und so ziemlich alles gelesen, was ich in die Finger bekommen konnte. Ich habe mit einer ganzen Reihe von Leuten gesprochen, die viel Erfahrung mit Projektmanagement haben, viel mehr Erfahrung als diese Nachwuchsmanager hier. Ich glaube, ich bin gut gewappnet, auch gegen Fangfragen. Zumindest abschmettern sollte ich sie können.
Sie suchen sich ihre Plätze. Ruhe kehrt ein. Sieht aus, als sollte ich langsam anfangen.
Wie üblich ist die erste Reihe fast leer. Der Letzte, der zu sprechen aufhört, sitzt ganz hinten. Gut. Er ist groß und etwa in meinem Alter. Sicher kein Sensibelchen. »Wie heißen Sie?«, frage ich und deute auf ihn.
Ich habe mich nicht getäuscht. Er versucht gar nicht erst, so zu tun, als sei er nicht gemeint. »Mark Kowalski«, entgegnet er mit sonorer Stimme.
»Warum haben Sie diesen Kurs belegt?«, frage ich ganz direkt. Eines ist sicher, jetzt genieße ich uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Mein Unterrichtsstil ist neu für sie. Von einem Dozenten wird eben allgemein erwartet, dass er doziert, nicht, dass er kommuniziert. Die eine Hälfte der Anwesenden schaut auf mich, die andere auf ihn. Der eine oder andere schmunzelt.
»Ich bin Projektleiter«, entgegnet er.
Als ich dazu nichts sage, schiebt er nach: »Ich arbeite für ein Unternehmen, das Modems produziert. Ich leite eines der Entwicklungsteams.«
Ich schaue ihn weiter stumm an, doch er fügt nichts hinzu. Die Situation wird allmählich unbehaglich. Da sage ich endlich: »Sie haben meine Frage nicht beantwortet.«
Ich schaue mich um. Alle weichen meinem Blick aus. Niemand will das nächste Opfer sein. Ich wende mich wieder an Mark. »Haben Sie irgendwelche Probleme beim Management Ihres Projekts?«
»Eigentlich nicht«, entgegnet er.
»Warum haben Sie sich dann zur Teilnahme an diesem Kurs in Projektmanagement entschlossen?«
Jetzt grinst er. »Nun, vermutlich habe ich doch das eine oder andere Problem«, räumt er ein.
»Könnten Sie das etwas näher ausführen?«
»Na ja, ich habe dieses Projekt nicht ins Leben gerufen, und mein Vorgänger hat ein paar wilde Versprechungen gemacht, die meiner Ansicht nach leider unrealistisch sind.«
»Zum Beispiel?«, bohre ich weiter.
»Zum Beispiel hinsichtlich der Erwartungen zur Leistung unseres neuen Modems und hinsichtlich der Entwicklungszeit.«
Manche der Teilnehmer lächeln verständnisvoll.
»Und Sie glauben nun«, sage ich und schaue ihn dabei durchdringend an, »dass Sie in diesem Kurs lernen werden, wie man Wunder vollbringt?«
»Das wäre schön«, gesteht er verlegen.
»Warum haben Sie sich also für diesen Kurs entschieden?«, wiederhole ich meine Frage.
»Sehen Sie«, sagt er, »ich bin Projektmanager. Ich will einen MBA- Abschluss. Und dies ist ein Kurs in Projektmanagement, nicht wahr?«
»Ah! Sie haben diesen Kurs also belegt, weil der Titel Ihrer Berufsbezeichnung ähnelt?«
Er gibt keine Antwort. Was soll er auch sagen? Es ist an der Zeit, ihn vom Haken zu lassen.
»Kann mir denn sonst jemand sagen, warum er oder sie diesen Kurs gewählt hat?«, frage ich in die Runde.
Niemand meldet sich. Vielleicht habe ich sie zu sehr eingeschüchtert.
»Als ich Student war«, erzähle ich ihnen, »habe ich mir die Kurse von Dozenten ausgesucht, die dafür bekannt waren, nur wenig Hausarbeiten aufzugeben. Ich fürchte, ich gehöre nicht zu dieser Sorte.«
Das lockert die Atmosphäre ein wenig, doch nicht sehr.
»Hören Sie«, fahre ich fort, »wir wissen alle, dass Sie hier sind, weil Sie diesen Abschluss haben wollen. Ein solches Stück Papier wird Ihnen den Aufstieg in der Unternehmenshierarchie erleichtern. Ich hoffe aber, dass Sie noch mehr wollen. Ich hoffe, Sie wollen hier etwas lernen, das Ihnen hilft, Ihre Arbeit besser zu machen.«
Allgemeines Kopfnicken.
»Sie müssen sich zwischen zwei Alternativen entscheiden. Die eine ist, dass ich hier auf dem Podium stehe und das ganze Semester lang Vorträge halte. Ich kann Ihnen alle möglichen Optimierungsmethoden um die Ohren schlagen und die kompliziertesten heuristischen Algorithmen erläutern. Es wird schwer zu verstehen sein, noch schwerer anzuwenden und, das garantiere ich Ihnen, es wird Sie nicht einen Millimeter voranbringen.
Stattdessen können wir aber auch die Köpfe zusammenstecken und auf der Grundlage Ihrer Erfahrungen und des Know-hows aus Büchern und Artikeln herauszufinden versuchen, wie man Projekte besser managt. Nun, was ist Ihnen lieber?«
Da fällt die Wahl nicht schwer.
Ganz hinten hebt Mark die Hand. »Was sollte ich denn nun von diesem Kurs erwarten?«
Gute Frage. Kein schlechter Mann. »Mark, Sie haben uns erzählt, dass Sie bei Ihrem Projekt Probleme haben. Ich meine, dieser Kurs sollte Ihnen dabei helfen, mit diesen Problemen besser fertig zu werden.«
»Das passt mir gut«, entgegnet er.
Ich wende mich an die Gruppe und lege los. »Sie dürfen voraussetzen, dass ich gut Bescheid weiß über alles, was in Büchern und Artikeln steht. Nun müssen wir herausfinden, wie es um Ihren Erfahrungshorizont im Projektmanagement bestellt ist. Ist noch jemand außer Mark so eng mit einem Projekt befasst?«
Ein schlaksiger, rothaariger junger Mann in der dritten Reihe hebt die Hand. »Mein Name ist Ted und ich arbeite bei einem Bauunternehmen. Alles, was wir tun, ist ein Projekt.«
»Wie lange arbeiten Sie schon dort?«, frage ich.
»Sechs Jahre.«
»Hervorragend!«, sage ich. »Noch jemand?«
Zu meiner Überraschung meldet sich keiner mehr. Ich werde von einer blonden Frau gerettet, die alleine in der ersten Reihe sitzt.
Zögernd fragt sie: »Könnten Sie bitte definieren, was Sie unter einem Projekt verstehen?«
Im Kopf wäge ich kurz vier Definitionen ab, die ich in Büchern gelesen habe. Sie erscheinen mir allesamt zu hochgestochen. Wer kann sich schon etwas vorstellen unter einer Definition wie »eine Reihe von Aktivitäten, die auf die Erreichung eines bestimmten Ziels ausgerichtet sind und einen eindeutigen Ausgangspunkt, eine Mitte und ein Ende haben.« Wenn ich diesen Kurs praxisnah gestalten und auf den beruflichen Alltag der Teilnehmer zuschneiden will, zitiere ich besser keine dieser entweder stark vereinfachten oder viel zu komplizierten Definitionen. Statt zu definieren, beschreibe ich lieber. Ich sage: »Hatten Sie an Ihrem Arbeitsplatz schon einmal mit einer komplexen Initiative zu tun, deren Management es erforderte, dass jeder ein Bild von dem entwerfen musste, was er tun sollte?«
»Mir ist nicht ganz klar, was Sie damit meinen«, entgegnet sie.
»Ein Blockdiagramm mit verschiedenen Schritten, die unternommen werden müssen, um das Ziel zu erreichen. Aus dem zu ersehen ist, welche Schritte nacheinander und welche parallel zueinander erfolgen sollten. Oder auch Zeitdiagramme, die zeigen, wann jeder Schritt beginnt und wann er endet. Wenn Sie schon einmal eine Situation erlebt haben, in der solche Charts verwendet wurden, dann hatten Sie es definitiv mit einem Projekt zu tun.«
»Aha«, sagt sie.
»Und, haben Sie mit Projekten zu tun?«, frage ich.
»Nach Ihrer Definition ja«, entgegnet sie. »Ich bin Markenmanagerin, und wir verbringen viel Zeit damit, solche Charts zu erstellen, bevor wir ein neues Produkt lancieren.«
»Und Sie heißen?«
»Ruth Emerson.«
Ihr Beispiel macht Schule. Bald ist klar, dass jeder irgendwie mit Projekten zu tun hat. Manche arbeiten sogar in einer reinen Projektumgebung, wie Mark in der Produktentwicklung, der rothaarige Ted in der Bauwirtschaft oder Charlie, der ein Hawaii-Hemd trägt und uns erzählt, dass er aus der Programmiersparte kommt.
Manche kommen teilweise mit Projekten in Berührung, manche führen selbst welche durch – etwa Ruth im Marketing, Fred, der Buchhalter, der auch schon Projektaudits gemacht hat, und Brian, der für die Expansion seiner Fabrik zuständig ist. Positiv ist, dass sie zusammen ein breites Spektrum an Projektumgebungen abdecken. Das ist jedoch gleichzeitig auch gefährlich. Wenn es mir nicht gelingt, ihre Aufmerksamkeit auf die Aspekte zu lenken, die all ihre Projekte gemeinsam haben, werden wir uns heillos verzetteln.
Deshalb will ich auch nicht wissen, welcher Art die spezifischen Projekte sind. Stattdessen frage ich: »Der Kanaltunnel, was wissen Sie darüber?«
Rotschopf Ted antwortet als Erster: »Das ist doch der Eisenbahntunnel zwischen England und Frankreich?« Auf meine Bestätigung fährt er fort: »Ich habe gelesen, dass dabei das Budget stark überschritten wurde.«
»In Milliardenhöhe«, präzisiert Fred in bester Buchhaltermanier.
»Die Probleme waren so groß«, erzählt Ted, der nun richtig warm wird, »dass man sogar darüber nachdachte, die ehrgeizige Originalplanung abzuspecken.«
Um die Diskussion anzukurbeln, frage ich in die Runde: »Was wissen Sie sonst noch darüber?«
Ruth in der ersten Reihe fühlt sich angesprochen. »Ich habe im Fernsehen gesehen, wie die Tunnelröhren eröffnet wurden. Die Königin höchstpersönlich hat sie eingeweiht. Die Eröffnung erfolgte mit mehrmonatiger Verspätung, und es fuhr immer noch kein Zug.«
»Ein klassisches Beispiel«, fasse ich zusammen, »für ein Projekt, bei dem sowohl Terminplanung als auch Budget gesprengt wurden.«
Ich liefere ihnen ein weiteres bekanntes Beispiel: die Bohrinseln in der Nordsee. Diese Bohrinseln sind riesige Fabriken, die 300 Meter über dem Grund eines der stürmischsten Meere der Welt gebaut werden. Von jeder Plattform aus werden nicht eine, sondern viele Ölquellen angebohrt. Es wird in Winkeln von bis zu 57 Grad gebohrt, um noch 3 Kilometer unter der Oberfläche Öl zu fördern. Dieses Öl muss dann von Sand befreit werden, bevor es durch Rohre zum Festland gepumpt werden kann. Kein Wunder also, dass jedes dieser Mammutprojekte ein Volumen von knapp 4 Milliarden Dollar hat. Man sollte annehmen, dass es nach dem Bau mehrerer dieser Riesenbabys klare Konzepte gäbe. Doch das ist nicht der Fall. Es heißt, sie würden ein solches Projekt minutiös planen, dann die Ergebnisse mal vier nehmen und beten.
»Nun«, sage ich zu meinem Kurs, »beten allein genügt offensichtlich nicht. Anfang der neunziger Jahre musste die Führungsspitze der norwegischen Ölgesellschaft StatOil zurücktreten, weil bei einem solchen Projekt die Kosten explodierten.«
»Sie sehen also, Mark«, füge ich augenzwinkernd hinzu, »Sie sind nicht der Einzige, dessen Projekte nicht fristgerecht stehen. Zumindest haben Sie kein Haushaltsproblem.«
»Oh doch, das habe ich schon«, ruft er und erklärt dann: »Der Projektmanager, der als mein Vorgänger so vollmundige Versprechungen gemacht hat, ist jetzt mein Vorgesetzter. Er ist fest entschlossen, sein Gesicht zu wahren, und hat mich daher gezwungen, mehr Leute einzustellen und teure Subunternehmer anzuheuern. Wir werden das Budget auf jeden Fall überschreiten, es ist nur noch nicht sicher, um wie viel.«
»Noch eine Frage: Wer wird dafür verantwortlich gemacht werden?«, setze ich hinzu.
»Er wohl kaum, fürchte ich. Wie ich meinen Chef kenne, wird es mir in die Schuhe geschoben.«
»Und was werden Sie dagegen tun?«, fragt Charlie, der Softwaremanager, ehrlich besorgt.
»Nichts«, sagt Mark leichthin. »In der technischen Entwicklung gerät jedes Projekt terminlich und finanziell in den Rückstand. Außerdem – wenn es eng wird, müssen wir eben notfalls die vorgegebenen Spezifikationen für das Projekt nach unten korrigieren.«
Um diesen letzten, doch wichtigen Punkt zu betonen, frage ich: »Kommt das oft vor?«
»Öfter, als uns lieb ist«, entgegnet er.
»Kennt sonst noch irgendjemand ein Projekt, bei dem aufgrund zeitlicher und finanzieller Zwänge hinsichtlich der ursprünglichen Vorgaben Kompromisse gemacht wurden?«
»Ich weiß nicht, ob man das als Kompromiss hinsichtlich der ursprünglichen Vorgaben bezeichnen kann«, meint Brian, »doch als unser neues Büro mit nur viermonatiger Verspätung bezugsfertig war, zogen wir ein, um festzustellen, dass wir keine Schreibtische hatten und die Klimaanlage nicht funktionierte.«
Bevor ich etwas dazu sagen kann, behauptet Charlie im Brustton der Überzeugung: »Jeder weiß, dass kein Projekt fristgerecht fertig wird und dabei im Etat bleibt. Wenn doch, dann wurden hundertprozentig inhaltliche Kompromisse gemacht. Ganz besonders in der Systemprogrammierung und beim Produktdesign.«
»Das muss nicht unbedingt so sein«, sage ich. »Gelegentlich gibt es Projekte in der technischen Entwicklung, die weit vor der Zeit zum Abschluss gelangen – zu geringeren Kosten und in besserer Qualität als vorgesehen.«
Alle, die in diesem Bereich Erfahrung haben, also etwa die Hälfte der Anwesenden, zweifeln diese waghalsige These an.
»Anfang der fünfziger Jahre«, fahre ich fort, »brüsteten sich die Russen mit der erfolgreichen Entwicklung einer eigenen Atombombe. Das war ein ziemlicher Schock. Die Vereinigten Staaten beschlossen daraufhin, dass man dringend eine Möglichkeit finden musste, zu überwachen, was die Russen in ihren weitläufigen asiatischen Gebieten anstellten.«
»Das war der Auslöser für das Weltraumsatellitenprogramm«, mutmaßt einer der Kursteilnehmer.
Ich muss ihn enttäuschen. »Ich fürchte, zur damaligen Zeit gab es Satelliten höchstens in Science-Fiction-Büchern. Doch die Düsenflugzeugtechnik machte rasante Fortschritte. Ein namhafter Ingenieur, Clarence »Kelly« L. Johnson, schlug vor, ein Flugzeug zu bauen, das durch seine große Flughöhe von Kampfflugzeugen nicht erreicht werden konnte. Wissen Sie, wie lange es dauert, ein neues Flugzeug zu entwickeln? Von der Idee bis zum militärischen Einsatz, meine ich?«
»Über zehn Jahre«, behauptet Brian überzeugt. »Ich war bei der Air Force.«
»Damit sind Sie noch lange kein Experte«, stichelt Ted.
»Normalerweise dauert es über zehn Jahre«, bestätige ich Brians Aussage. »Die U-2 jedoch wurde in erstaunlich kurzer Zeit entwickelt. Bereits acht Monate nach dem Start des Projekts flog sie über Russland und brachte Fotos mit.«
»Bis 1960, als Francis Gary Powers abgeschossen wurde«, beweist Brian seine Detailkenntnis.
Alle sind beeindruckt. Ein wenig von Brian, hauptsächlich aber von den Leistungen des Teams, das die U-2 gebaut hatte. Der Einzige, der skeptisch wirkt, ist Fred, unser Buchhalter.
Ich schaue ihn an und hebe eine Augenbraue. Das reicht, um ihn aus der Reserve zu locken.
»Sie haben uns zwei Beispiele dafür gegeben, was ein Riesenschlamassel ist. Können Sie uns noch weitere liefern?«
»Kein Problem«, lächle ich breit. »Wie viele hätten Sie denn gern?«
»Sie haben auch ein Beispiel für einen großen Erfolg angeführt. Gibt es davon ebenfalls noch mehr?«
»Ich fürchte nein«, gestehe ich verlegen.
»Das habe ich mir gedacht«, erwidert Fred unverblümt.
Der gute Fred hat mir damit die ideale Gelegenheit geliefert, sie zu der von mir anvisierten Schlussfolgerung hinzuführen. Doch neugierig frage ich: »Wie sind Sie denn zu dieser Vermutung gekommen?«
»Das sagt mir meine Erfahrung.« Und die schildert er im Anschluss ausführlich. »Ich habe in drei Großunternehmen im Finanzmanagement gearbeitet. Ich habe mehr Audits für neu entwickelte Produkte durchgeführt, als mir lieb ist. Und wie jeder Projektauditor bin ich ein Stück weit Zyniker. Es sind mir zwar schon Projekte untergekommen, die das ursprünglich veranschlagte Budget nicht überschritten haben, doch das war die Ausnahme.«
»So oder ähnlich ist die Situation auch in der technischen Entwicklung«, bestätige ich. »Verhält es sich bei den Programmierern sehr viel anders, Charlie?«
»In der Programmierbranche heißt es, dass grundsätzlich jedem Projekt die Zeit ausgeht. Das Einzige, was einem nicht ausgehen darf, sind die Ausreden.«
Ich stimme in das allgemeine Gelächter ein. Als es abebbt, meint Brian: »Bei der Air Force haben wir die Endtermine immer eingehalten.« Drei Sekunden später schiebt er nach: »Was aber nicht heißen soll, dass wir den ersten für das Projekt festgelegten Termin eingehalten hätten. Meist auch den zweiten nicht.«
Als ich wieder zu Wort komme, zeige ich auf Ted. »Wie sieht es in der Bauwirtschaft aus? Dort gibt es schließlich nicht so viele inhaltliche Unwägbarkeiten.«