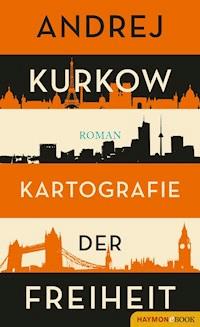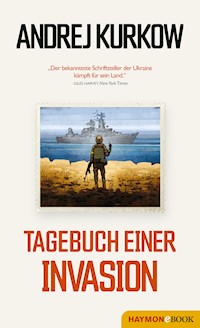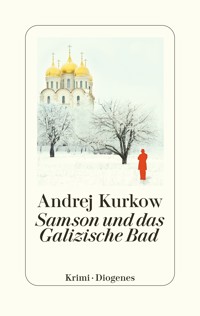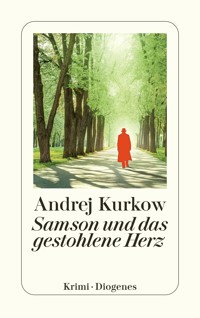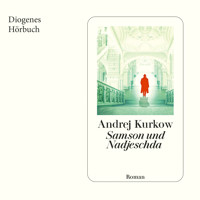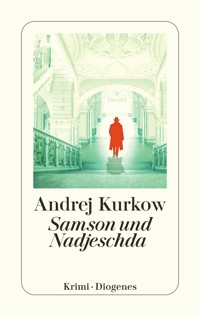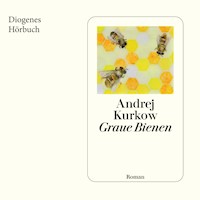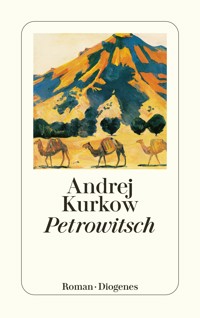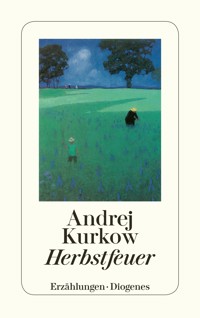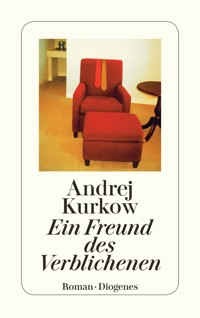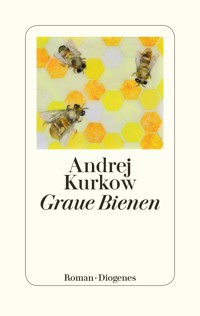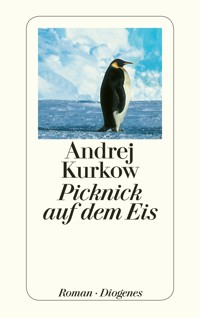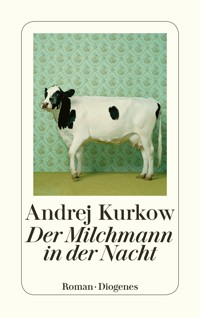Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Geografie eines einzelnen Schusses
- Sprache: Deutsch
Skurril und leichtfüßig: Das Finale von Andrej Kurkows Panorama einer magisch-fantastischen Sowjetunion. Ein Held in geheimer Mission, ein sprachbegabter Papagei, ein Lenins schwermütiger Sekretär Volkskontrolleur Pawel Dobrynin wurde einst von der Dorfgemeinschaft als einziger ehrlicher Bauer des Dorfes auserkoren, eine große Aufgabe für den Aufbau des Sowjetlandes zu erfüllen. Nun lebt er in der Stadt Krasnoretschensk. Doch dann wird er an einen abgeschiedenen Ort in den Bergen abkommandiert, wo er von nun an die Herstellung künstlicher Meteoriten überwacht, die der Sowjetunion die uneingeschränkte Macht in der Welt sichern sollen. Der ehemalige Schuldirektor Banow hingegen lebt mit Lenin, dem Kremlträumer, auf den Kremlwiesen ein spartanisches Leben zwischen Laubhütte und Lagerfeuer. Sein Tagwerk besteht in der Beantwortung eintreffender Briefe an Lenin und in Gesprächen mit dem Sowjetrevolutionär. Und Kusma, der Papagei, der immerzu Gedichte aufsagt? Der fliegt in Jalta einem Literaturwissenschaftler im Schriftstellerheim zu. In den Texten, die der Wissenschaftler auf Tonband aufzeichnet, glaubt er, die Handschrift eines unbekannten Dichters entdeckt zu haben. Ein Roman voll Witz und Atmosphäre – und der Abschluss einer grandiosen Trilogie Währenddessen befinden sich eine Pistolenkugel und ein Engel weiterhin in einem aufreibenden Wettlauf gegen die Zeit: Sie jagen den Gerechten, den wahren Helden. Die Pistolenkugel trachtet ihm nach dem Leben, doch der Engel möchte ihn mit ins Paradies nehmen. Wer erreicht sein Ziel zuerst? – "Die Kugel auf dem Weg zum Helden" ist ein Roman voller Witz, Absurditäten, Atmosphäre und unerwarteter Wendungen. Andrej Kurkow erzählt von den Aufbaujahre nach dem Krieg in einer fantastischen Sowjetunion, von geplatzten Träumen, unbeugsamen Menschen, enttäuschtem Fortschrittsglauben, unhinterfragten Heldenmythen – und von ganz großen Abenteuern. "Lange Zeit war die Sowjetmentalität für mich ein rätselhaftes Phänomen. Das änderte sich erst mit dem Verfassen der Trilogie. Ich habe diese drei Romane mit dem ehrlichen Russen Dobrynin, dessen Name so viel bedeutet wie 'der Gutes leistet', geschrieben, um die sowjetische Geschichte und die sowjetische Mentalität zu verstehen. Längst nicht alle Begebenheiten in dem Buch sind Fiktion. Genauer gesagt ist alles Fiktive darin die logische Fortsetzung der sowjetischen Wirklichkeit." Aus dem Russischen von Claudia Dathe ***************** Die Trilogie "Geografie eines einzelnen Schusses" • Der wahrhaftige Volkskontrolleur • Der unbeugsame Papagei • Die Kugel auf dem Weg zum Helden
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andrej Kurkow
Die Kugel auf dem Weg zum Helden
Roman
Aus dem Russischen von Claudia Dathe
Liebe Leserinnen und Leser!
Alle Helden meiner fantastischen Sowjet-Trilogie – darunter der Volkskontrolleur Pawel Dobrynin mit seinem unersetzlichen Gehilfen Dmitrij Waplachow, der Papagei Kusma mit seinem Halter Mark Iwanow, die fleißigen und überehrlichen Bewohner und Angestellten des Moskauer Kreml, der Engel, der aus dem Paradies in die Sowjetunion geflohen ist, der Schuldirektor Wassilij Banow, der nicht nur in Erfahrung gebracht hat, dass Lenin noch am Leben ist, sondern sich sogar mit ihm angefreundet hat und zu ihm auf die Kremlwiesen gezogen ist –, sie alle, so hoffe ich, sind Ihnen genauso ans Herz gewachsen wie mir.
Sie haben über viele lange Wintermonate hinweg Pawel Dobrynin im wilden sowjetischen Norden begleitet, der auf eine geologische Expedition gestoßen war, die Gold suchen sollte. Was die Geologen fanden, war jedoch kein Gold, sondern Fleisch von urzeitlichen Mammuts. Das Fleisch erwies sich schließlich für das Land nützlicher als Gold, da inzwischen der Zweite Weltkrieg ausgebrochen war und die gegen den Faschismus kämpfenden Soldaten an der Front versorgt werden mussten.
Mit dem Papagei Kusma und seinem Halter Mark Iwanow haben Sie verschiedene Frontorte besucht, an denen der Papagei in den Feuerpausen vor den Soldaten der Roten Armee auftrat und ihren Kampfgeist mit patriotischen Gedichten zu heben versuchte. Während eines dieser Auftritte wurde der Papagei bei einem Angriff von einem Granatsplitter getroffen und infolgedessen in die Tierklinik des Kreml für sowjetische Heldentiere eingeliefert.
Nach erfolgreicher Behandlung setzten Kusma und sein Halter die Auftritte fort, nun allerdings im Hinterland. In einer Vorstellung leistete sich Kusma einen politisch riskanten Versprecher und kam in den Gulag. Sein Halter und treuer Freund Mark Iwanow wollte ihn nicht allein lassen und folgte ihm ins Gefängnis, wo er mit einer für ihn völlig neuen Wirklichkeit konfrontiert wurde, von deren Existenz er bis dahin nichts wusste. Aber auch dort lernen Mark und der Papagei zu überleben.
Der Engel, die Dorflehrerin Katja – in die sich der Engel verliebt hat und die seine Gefühle erwidern würde unter der Bedingung, dass der Engel sagt, es gebe keinen Gott – und all die geflohenen Bauern, die mit dem Engel das Neue Gelobte Land aufbauen, haben vom Krieg nichts mitbekommen. Denn sie haben sich eine parallele Wirklichkeit errichtet, in die man aus der sowjetischen Realität fliehen kann. Aber die Siedler des Neuen Gelobten Landes selbst sind es, die der Errichtung des Paradieses im Wege stehen, weil sie solche wichtigen Begriffe wie »Gerechtigkeit« und »Glück« falsch verstehen.
In diesem Band nun ändert sich vieles: Wird es für unsere Helden gut ausgehen?
Geboren wurde ich in der Sowjetunion, dem mystischsten Land der Welt, und hier habe ich auch den Großteil meines Lebens verbracht. Noch vor ein paar Jahren schien es mir, als hätte die Sowjetunion aufgehört zu existieren, und damals hielt ich es für wichtig, die einzigartigen Facetten dieses politischen und sozialen Experiments für die Nachwelt festzuhalten, eines Experiments, aus dem eine neue Gesellschaft von lauter ehrlichen und fleißigen Menschen entstehen sollte, in der weder Nationalität noch andere Kategorien eine Rolle spielen sollten, getrennt von der übrigen Welt durch den Eisernen Vorhang und getragen von der Vision des »Kommunismus in einem Land«. Heute können wir beobachten, dass in der ukrainischen Nachbarschaft, im riesigen Russland, das alte gescheiterte Gefüge allmählich durch etwas Neues ersetzt wird. Etwas, das die Sowjetvergangenheit zurückholen will.
Lange Zeit war die Sowjetmentalität für mich ein rätselhaftes Phänomen. Das änderte sich erst mit dem Verfassen der Trilogie. Ich habe diese drei Romane mit dem ehrlichen Russen Dobrynin, dessen Name so viel bedeutet wie »der Gutes leistet«, geschrieben, um die sowjetische Geschichte und die sowjetische Mentalität zu verstehen. Längst nicht alle Begebenheiten in dem Buch sind Fiktion. Genauer gesagt ist alles Fiktive darin die logische Fortsetzung der sowjetischen Wirklichkeit. Dazu gehört zum Beispiel die Suworow-Militärakademie, in die häufig Waisenkinder aufgenommen wurden, um sie zu Patrioten zu erziehen, die allzeit bereit waren, ihr Leben nicht nur für die Heimat, sondern auch für sinnlose und verbrecherische Vorhaben zu opfern. Dazu gehören auch sowjetische Helden wie Oleg Koshewoi und Soja Kosmodemjanskaja, Ikonen der sowjetischen Ideologie, denen es nachzueifern galt. Sie sind im Zweiten Weltkrieg während der Besatzung im Kampf gegen die Faschisten ums Leben gekommen. Zwar sind die genauen Umstände ihres Todes nicht bekannt, aber unter Abertausenden von Gefallenen wurden sie und einige andere als Vorbilder für kommende Sowjethelden in kommenden Kriegen erwählt.
Dazu gehört aber auch die Mutter Heimat, die ihre Augen und Ohren überall hat. Sie war der sowjetische Gott, der Jesus und die Mutter Gottes ersetzte und zum wichtigsten »heidnischen« Denkmal des Landes wurde. In jeder größeren Stadt stand eine Mutter Heimat, noch heute überragt sie Städte wie Wolgograd, das frühere Stalingrad, und auch Kiew. Aber während die Mutter Heimat in Kiew längst kein Gott mehr ist, wird ihr in Wolgograd und anderen Städten Russlands weiterhin geopfert.
Die ersten Millionen von Opfern wurden der Mutter Heimat gebracht, als es noch keine Denkmäler für sie gab. So starben Hunderttausende sowjetischer Gefangener an Hunger und Krankheiten beim Bau des Belomorkanal, des Weißmeer-Ostsee-Kanals. Auch in den Gulags, von denen sich viele in Sibirien und Kasachstan, so etwa in Kustanaj und Karaganda, befanden, kamen Millionen unschuldiger, deportierter Menschen zu Tode.
Noch immer gibt es in den ehemals sowjetischen Gebieten Teile der Bevölkerung, die stolz auf die sowjetische Vergangenheit sind, ihre Stalin-Porträts unter der Couch hervorziehen, ihre Wohnungen damit schmücken oder sie auf Demonstrationen zeigen. Das Sowjetische ist noch nicht Geschichte. Aber um die Geschichte der Sowjetunion dreht sich mein Roman. Er thematisiert den früheren Stolz, die Mentalität, die Vorgeschichte, die auch echte Genies hervorbrachte, wie etwa den Mechaniker und Erfinder Iwan Kulibin (1735–1818). Er erfand viele nützliche mechanische Geräte, von denen allerdings kein einziges gebaut wurde, da der Zarenhof die Finanzierung ablehnte. Stattdessen finanzierte der russische Hof Kulibin den Bau von mechanischen Spielfiguren und Uhren.
Sie, meine lieben Leserinnen und Leser, wissen indessen, dass Sie es hier nicht mit einem historischen Roman zu tun haben, sondern in erster Linie mit einem Märchen, in dem das »sowjetische Gute« gegen das »sowjetische Böse« kämpft und manchmal siegt, in dem das Gute überwiegt, in dem die Welt reich, bunt und verlockend ist, auch wenn überall Gefahren lauern. Lassen Sie sich also ein auf den dritten und letzten Teil der Trilogie! Im Ernstfall stehe ich Ihnen zur Seite. Und nicht nur ich, sondern auch meine Übersetzerin Claudia Dathe, die nicht vor den Stolpersteinen der sowjetischen Geschichte und der russisch-sowjetischen literarischen Traditionen, die ich im Roman verschiedentlich parodiere, zurückgeschreckt ist.
Nicht zuletzt sei meinem Verleger Markus Hatzer gedankt, dessen Verdienst es ist, dass diese Romantrilogie, an der ich neun Jahre geschrieben habe und die ich für eines meiner besten Werke halte, den Weg zu Ihnen gefunden hat.
Andrej Kurkow
Kapitel 1
Die Zeit ist – wie auch die Kugel – rund und hat keine scharfen Kanten. Sie ist klar und natürlich, wie auch die Kugel kreist sie um den Erdball und fliegt tags als klare Luft, nachts als undurchdringliche Schicht an der Erdoberfläche dahin.
Die Zeit läuft gemächlich. Ohne Eile. Weiter und weiter. Nur die Kugel, die die Zeit ein ums andere Mal einholt, mit ihr und doch um ein Vielfaches schneller fliegt, nur die Kugel drängt voran, hin zu ihrem Ziel. Zu ihrem sehnlichsten Traum – zum Körper des Helden –, um in ihn einzudringen und dort steckenzubleiben, zu erkalten und die Restwärme des gerinnenden Blutes aufzunehmen, sich darin einzuhüllen und zum künstlichen Dotter eines gestockten toten Eis zu werden, in das sich jeder Körper verwandelt, der sein Leben ausgehaucht hat.
Nach dem Krieg sind die Nächte dunkler geworden, dunkler und verlassener. Kaum jemand tritt bei Schlaflosigkeit vor die Tür, um zu rauchen, sodass der Lichtpunkt einer Zigarette aufglimmt. Wie ein Falter wird die Kugel von einem solchen Lichtpunkt angezogen. Aber der Erfolg bleibt ihr versagt. Als würden die wahren Helden nachts nicht rauchen!
Wer ist eigentlich dieser wahre Held, nach dem der desertierte Ex-Engel die Kugel auf die Suche geschickt hat? Der Engel hat einfach die Hand ausgestreckt, ein paar Worte verloren und ist seiner Wege gezogen. Und der Kugel bleibt nun nichts anderes übrig, als bei Regen, bei Schnee, bei Matsch, kurz gesagt bei Wind und Wetter zu fliegen und einen Helden zu finden! Gäbe es Helden in Hülle und Fülle, wäre das für die Kugel nicht weiter schwierig. Aber entweder sind alle Helden schon von anderen Kugeln getroffen worden, oder es hat sie nie gegeben. Woran es auch liegen mag, die Kugel fliegt weiter und weiter. Und die Zeit bleibt zurück. Die vergangene Zeit. Die zukünftige steht noch aus. Aber was soll die Kugel mit der Zukunft? Die Kugel zielt ja nicht auf das Leben! Strebt nicht ins All wie die heldenhaften Kosmonauten.
Der anbrechende Tag überzieht die noch schlummernde Erde mit Morgenstrahlen. Die Hähne krähen in einem fort. Ihr Krähen bricht in den Luftraum über den Dörfern und Städten ein und treibt den Staub an, den die aufgehende Sonne mit ihren Strahlen nur sichtbar macht, wenn sie frisch und morgenklar scheint und noch nicht glüht wie das Feuer in einem Hochofen.
Der erste Traktor fährt aufs Feld, sein Motor heult auf, als wollte er den Hahnenschrei verlängern, und ergänzt so das Klangbild der erwachenden Erde. Das Tor quietscht und an den Brunnen scheppern die Blecheimer. Der Pilot in seinem Fluggerät schlägt Schneisen in das fügsame Himmelsgewebe.
Und zwischendrin, zwischen dem Flugzeug und der erwachenden Erde, auf der sich allerlei kleine Teilchen bewegen, fliegt die Kugel. Weiter hinunter möchte sie nicht, weil sie sich da unten keinen Sieg erhofft. Und nach oben zieht es sie nicht, denn bei ihren gelegentlichen Versuchen, die Eisenhaut eines Flugzeugs zu durchstoßen und den dahinter verborgenen Menschen zu treffen, hat sie schon mehrfach Schaden genommen.
Der Militärflieger vollführt plötzlich ein Flugkunststück, das Fass, und streift die Kugel beinahe mit seiner Tragfläche. Sie entkommt nur knapp und rast vor dem Flugzeug davon, stürzt zur Erde hinab. Unten auf der Erde ist es weniger aufregend. Und das Leben ist kaum geschützt. Aber wie sie in dieser Schutzlosigkeit den einen Helden finden sollte, blieb für die Kugel ein Rätsel.
Kapitel 2
Der Winter im Neuen Gelobten Land war klirrend kalt. Nachts heulten Schneestürme um die Menschenställe, und wenn die Bewohner auch tatsächlich eingeschlafen waren, zitterten sie doch im Schlaf und erwachten ein ums andere Mal vom eigenen Zittern.
Selbst tagsüber gingen sie ohne Not nicht vor die Tür. Hätten sie in einer Senke gelebt, wären die Stürme vielleicht milder ausgefallen und die Windböen hätten weniger an ihren hölzernen Behausungen gezerrt. Aber da oben auf dem Hügel, dem Himmel zu, hatte der Wind so viel Raum und Kraft, dass er spielend einige, vielleicht sogar alle Häuschen im Neuen Gelobten Land umpusten konnte. Davor hatten die Bewohner große Angst.
Der Engel wollte sich nach der Nacht aufwärmen und setzte sich an den nächstgelegenen Ofen. Dort saßen bereits Bäuerinnen, Bauern und frühere Rotarmisten, in Gedanken versunken, und wärmten sich. Ab und zu seufzte jemand, und alle anderen stimmten in das Seufzen ein.
Der Holzvorrat nahm zusehends ab, weswegen der bucklige Buchführer verfügt hatte, sparsam anzuheizen, später nachzulegen und nicht gleich ein Feuer für den ganzen Tag zu machen.
Der Engel saß da und dachte an seine Freunde, mit denen er sich gern unterhielt und die er zwei Wochen nicht gesehen hatte. Es waren tatsächlich schon zwei Wochen vergangen, seit er Sachar, den Ofensetzer, und den einhändigen Pjotr zum letzten Mal besucht hatte. Er sehnte sich nach einem Treffen, nach einer Unterhaltung über dieses und jenes und nach einem leckeren Stück Rauchfleisch. Bei dieser Vorstellung entfuhr dem Engel ein tiefer Seufzer. Weitere Seufzer waren die Antwort. Der Engel lauschte auf den Schneesturm. Das Heulen schien schwächer geworden zu sein. Er stand auf und legte das Ohr an die Tür. Dann öffnete er sie einen Spalt breit und spähte mit einem Auge hinaus. Draußen war es funkelweiß, die Luft war eisig und messerscharf, sie zwickte in die Wange. Der Engel schloss die Tür und überlegte. Dann lieh er sich von einem Bauern einen Pelz und verließ den Menschenstall.
Die Kälte brannte im Gesicht, aber der Engel fand es erfrischend. Er lief den Hügel hinab, auf Sachars Haus zu. Unter seinen Füßen knirschte der Schnee, und auch die Luft schien zu knirschen.
Unten angekommen, klopfte er ans Fenster. Kaum hatten sich die drei an den Tisch gesetzt und das Fleisch angeschnitten, hob der Sturm von neuem an.
»Halb so schlimm«, sagte Sachar, »du kannst hier bleiben, solange der Sturm tobt. Bei uns ist es doch sicher wärmer als bei euch im Menschenstall, oder?«
»Ja«, sagte der Engel.
Draußen heulte der Sturm, drinnen unterhielten sich der Engel, Pjotr und Sachar und aßen Rauchfleisch. Das Fleisch war fester als sonst, es stammte aus den Vorräten. Wegen des Wetters war Sachar kein frisches Fleisch geliefert worden, die Räucherkammer hatte er trotzdem ordentlich geheizt, denn sein Holzvorrat war üppig, zudem war er an die Wärme gewöhnt und mochte sich nicht umstellen, auch wenn’s vielleicht Verschwendung war.
Schnell brach die Dunkelheit herein und Sachar zündete eine Kerze an.
»Hör mal, Engel«, fragte Pjotr, »wofür braucht man eigentlich den Winter? Wozu ist er gut?«
‚Ja, wozu eigentlich?‘, überlegte der Engel. ‚Wenn der Winter zu etwas gut wäre, müsste es ihn doch auch im Paradies geben. Aber dort ist immer Sommer.‘
»Ich weiß es nicht«, gestand der Engel nach einigem Nachdenken.
»Aber ich weiß es«, sagte Sachar. »Um die Menschen vom Bösen abzuhalten.«
»Und wie kann der Winter die Menschen vom Bösen abhalten?«, wollte Pjotr wissen.
»Durch die Kälte«, sagte Sachar. »Jemand plant eine böse Tat, führt sie aber nicht aus, weil er bei Eis und Schnee nicht vor die Tür will.«
Der Engel dachte über die Worte des Ofensetzers nach und die Ausführungen leuchteten ihm ein. So ließ sich auch erklären, warum es im Paradies keinen Winter gab, denn da dort keiner dem anderen etwas Böses wollte, musste auch niemand vom Bösen abgehalten werden. Also war der Winter überflüssig.
Sie redeten noch lange und gingen dann schlafen.
Am Morgen wurden sie von einem Klopfen am Fenster geweckt.
»Eh, Sachar, ist der Engel zufällig hier?«, fragte jemand.
Sachar und der Engel standen auf. Gingen zum Fenster. Versuchten zu erkennen, wer da nach dem Engel fragte, aber die Eisblumen verstellten den Blick. Draußen war es still, der Nachtsturm hatte sich offenbar gelegt.
Sachar entriegelte die Tür. Rot vor Frost stürzte der bucklige Buchführer in die Diele.
»Ist der Engel bei dir?«, fragte er noch einmal, nachdem er verschnauft hatte.
»Ja, er ist hier«, antwortete Sachar. »Und was willst du von ihm?«
»Archipka-Stepan liegt im Sterben, er hat mich nach dem Engel geschickt, er will ihn noch einmal sehen.«
»Oh Gott«, entfuhr es Sachar, »wieso stirbt der denn? Ist etwas passiert?«
»Nein«, antwortete der Bucklige. »Er stirbt freiwillig. Aus Wehmut, hat er gesagt.«
Schnell warf sich der Engel den tags zuvor geliehenen Pelz über und trat auf den Hof hinaus. Der Bucklige folgte ihm.
»Ich komme gleich nach«, rief Sachar.
Archipka-Stepan lag, zugedeckt mit mehreren Mänteln und Pelzen, auf einer Pritsche in der hintersten Ecke des Menschenstalls. Es war derselbe Stall, in dem auch der Engel wohnte. Um ihn herum saßen und hockten die Siedler, schwiegen und schauten Archipka ein ums andere Mal bekümmert an.
Der Engel trat schüchtern näher, stellte sich ans Kopfende und fing den trüben, aber freudigen Blick des Sterbenden auf.
»Da bist du also«, sagte Archipka-Stepan leise. »Setz dich hier hin.«
Der Engel nahm auf der Schlafbank Platz.
»Hast du gehört? Ich will sterben«, sagte Archipka-Stepan mit schwacher Stimme.
»Warum?«, fragte der Engel.
»Ach, alles ist öde. Mein Leben hat keinen Sinn«, gestand Archipka-Stepan. »Ich hab so viele Jahre auf dem Buckel, jetzt reicht’s! Was ich dich fragen wollte: Wie ist es denn da so, im Paradies?«
»Schön ist es da«, flüsterte der Engel. »Warm. Es gibt helles Mischbrot, das schmeckt wunderbar.«
Archipka-Stepan leckte sich seine rissigen Lippen.
»Komm ich denn ins Paradies?«
Der Engel dachte nach. Eigentlich müsste Archipka ins Paradies kommen, er hatte schließlich niemandem etwas zuleide getan, im Gegenteil: Er hatte die Menschen, die sich nach einem besseren Leben sehnten, persönlich hierhergeführt und hatte dieses neue Leben mit ihnen aufgebaut. Mit der Zeit war er allerdings schwermütig geworden und hatte eigentlich nichts mehr angepackt, sondern nur noch auf seiner Pritsche gelegen oder im Sommer im Gras gesessen und Trübsal geblasen.
»Also was ist, komm ich rein?«, wiederholte Archipka-Stepan seine Frage.
»Wahrscheinlich schon«, sagte der Engel und nickte.
Archipka-Stepan lächelte. Sein Gesicht war bläulich-gelb, das Lächeln spannte die vor Schwermut rissige Haut. Der Engel erschrak, als er Archipka-Stepan ansah, er fürchtete, die Haut würde der Spannung nicht standhalten und aufplatzen.
»Willst du vielleicht ein bisschen Milch?«, fragte eine Bäuerin wimmernd und beugte sich über den Sterbenden.
Archipka-Stepan schüttelte den Kopf, dann schloss er die Augen.
Gegen Abend starb er tatsächlich. Aus dem zweiten Menschenstall kamen die Leute herbei, um in Stille Abschied zu nehmen. Sie schwiegen. In den Ecken schluchzten leise die Weiber und hielten sich die Münder zu, damit ihr Schmerz nicht nach außen drang.
Der bucklige Buchführer ging zu seiner Schlafbank und holte das dicke Inventarbuch und einen Stift unter der Matratze hervor. Er musste lange blättern, bis er das Einwohnerverzeichnis des Neuen Gelobten Landes fand. Er suchte Archipka-Stepan und strich seinen Namen sauber durch. Dann blätterte er weiter und schrieb auf einer neuen Seite mit großen runden Buchstaben Totenverzeichnis des Neuen Gelobten Landes, darunter setzte er eine dicke Eins und trug unter dieser Eins Archipka-Stepan ein, woraufhin er das Buch zuklappte und es wieder unter seiner Matratze verstaute.
Die ganze Nacht hindurch lag der Tote auf seiner Pritsche, am nächsten Morgen hielt der bucklige Buchführer eine Versammlung ab, auf der beschlossen wurde, Archipka-Stepan im Frühjahr zu beerdigen und ihn bis dahin draußen aufzubewahren, wo ihn der Frost einstweilen konservieren würde. Gegen Ende der Versammlung bat der Buchführer Demid Polubotkin, an der Pritsche des Verstorbenen ein getragenes Volkslied zu singen. Demid wollte sich zwar weigern, traute sich aber nicht. Er war gleichfalls traurig und schwermütig. Und so stimmte er Unsterbliche Opfer an.
Sogleich erhoben sich alle und neigten die Köpfe. Auch der Engel erhob sich. Er schaute sich um und sein Blick fiel auf den Sohn des Buchführers, Buckelchen Wasja, der sich an seinen Vater geschmiegt hatte. Der Engel suchte Wasjas Mutter, doch er entdeckte sie nirgends, konnte sich auch nur noch vage, vielleicht überhaupt nicht mehr an ihr Gesicht erinnern.
Nach dem Lied wurde Archipka-Stepan hinausgetragen und bei der Winterküche abgelegt, zwischen der Wand und dem Hackklotz, auf dem Holz und manchmal auch Fleisch gehackt wurde.
Die Luft war eiskalt und klar, am Horizont zog dunkel der nächste Schneesturm auf.
Kapitel 3
Die Bürotür des Gefängnisdirektors flog auf, Jurez kam ohne anzuklopfen herein. Er trat an den Tisch und nickte im Vorübergehen Wolodja, Krutschonyjs kleinem Sohn, zu. Jurez setzte sich auf einen Hocker, der am Boden festgenagelt war.
Krutschonyj blickte ihn erwartungsvoll an.
»Und, Bürger Jurezkij«, brach der Gefängnisdirektor schließlich das Schweigen, ehe Jurez auf seinen fragenden Blick antworten konnte. »Haben Sie Neuigkeiten für mich?«
»Selbstverständlich«, sagte Jurez mit einem listigen Lächeln. »Aber das kostet …«
Krutschonyj bückte sich und holte aus dem untersten Fach seines Schreibtischs eine Wurst und mehrere Päckchen Zigaretten hervor. Legte alles auf den Tisch, sah den Häftling Jurezkij an, konnte aber zu seiner Verwunderung auf dessen Gesicht keine Freude entdecken. Verdutzt kniff Krutschonyj die Augen zusammen.
»Was ist, reicht Ihnen das nicht?«, fragte er.
»Nein«, antwortete Jurez gelassen.
»Was wollen Sie denn?«
Jurez machte absichtlich eine Pause von anderthalb, zwei Minuten. Dann seufzte er tief.
»Bürger Direktor«, sagte er, »ich riskiere doch Kopf und Kragen, wenn ich Ihnen das alles erzähle, und Sie lassen mich in dieser Viererzelle sitzen!«
»Aber Sie haben schon sechstausend Rubel angespart, ist das etwa nichts?«
»Und was habe ich davon, wenn ich hopsgehe?«, fragte Jurez zu Recht.
»Was wollen Sie denn dann?«
»Dass Sie den Künstler kaltmachen.«
»Den Künstler? Den mit dem Papagei?«
»Ja, den.«
»Was zum Teufel hast du denn gegen den?« Krutschonyj konnte seine Verwunderung nicht verbergen.
Jurez schielte auf den Jungen, der in der Ecke an einem Tisch saß.
»Keine Angst, der hält die Klappe«, sagte der Gefängnisdirektor.
»Na ja, also«, sagte Jurez bereits weniger forsch, »also wenn der weg wäre, könnte ich in seine Zelle umziehen … Und dann könnte ich mit dem Papagei … So habe ich mir das gedacht …«
»Und was hast du für Neuigkeiten?«
»Vorbereitung auf einen Gruppenausbruch.« Jurez lächelte, er wusste, was diese Information wert war.
Krutschonyj starrte gedankenverloren auf die Wurst, die auf dem Tisch lag. Angewidert schob er sie zurück in die Schublade. Jurez, der Angst hatte, der Direktor könnte mit den Zigaretten ebenso verfahren, griff sich die Päckchen und verteilte sie in seiner Wattejacke.
»Dieser Künstler wird irgendwie vom ZK protegiert. Da ist mal ein Brief gekommen, dass wir seine Haftbedingungen verbessern sollen … Also kaltmachen können wir den nicht.«
»Und wenn man ihn in ein anderes Lager oder ein anderes Gefängnis bringt?«, schlug Jurez vor.
»Ist nicht so einfach«, antwortete Krutschonyj. »Dafür brauchen wir einen Grund, und die Verwaltung muss auch mitspielen.«
»Lass ihn doch frei, Papa!«, kam es aus der Zimmerecke, Krutschonyj und Jurez drehten sich ruckartig zu dem Jungen um.
»Wenn du dich noch mal einmischst, ist dein Platz ab sofort nicht mehr hier, sondern zu Hause!«, blaffte der Vater drohend.
Jurez kam ins Grübeln.
»Vielleicht könnte man ihn rausschmeißen und den Papagei hierbehalten?«
»Bist du verrückt? Rausschmeißen? Wie stellst du dir das vor?«
»Na, zum Beispiel wegen ausgezeichneter Führung vorzeitig entlassen«, sagte Jurez. »Ich hab hier einen Fluchtversuch von dreizehn Mann …«, fügte er hinzu und tippte sich mit dem Zeigefinger an die Schläfe. »Überleg’s dir, Direktor! Wenn die dir entwischen, bist du selbst dran!«
Krutschonyj dachte nach. Lange und gründlich. Ein gelungener Fluchtversuch wäre in der Tat das Ende seiner Karriere, ein verhinderter Ausbruch hingegen brachte vielleicht eine Beförderung, zumindest aber eine Auszeichnung …
»Wenn’s wegen ausgezeichneter Führung nicht geht, dann entlass ihn doch wegen schlechter Gesundheit, wenn das sogar schon vom ZK gekommen ist«, sagte Jurez.
»Wegen schlechter Gesundheit, da bleibt hier keiner übrig!«, brummte der Direktor.
»Ach? Und was ist mit dir?«, piesackte ihn Jurez.
Krutschonyj schwieg.
»Gut«, sagte er schließlich, »ich überleg’s mir.«
Dann holte er ein Blatt Papier und einen Stift heraus und legte beides vor Jurez hin.
»Los, schreib über den Fluchtversuch«, sagte er.
»Wenn du’s dir überlegt hast, schreibe ich!«, verkündete Jurez entschlossen. »Ich bin doch kein Schriftsteller, dass ich einfach so drauflos schreibe«, weigerte er sich, der im Gefängnis schon fast verlernt hatte, wie man schrieb.
»Ach, zum Teufel mit dir«, rief Krutschonyj verärgert. »Los, hau ab, mach einen kleinen Gang durchs Gefängnis und komm in einer halben Stunde wieder!«
Munteren Schrittes mit einem Lied auf den Lippen verließ Jurez das Büro des Direktors.
***
Noch am selben Tag kam der Gefängnisarzt zu Mark und Kusma in die Zelle. Ein kleiner, grauhaariger, älterer Mann in einem geflickten weißen Kittel.
»Guten Tag«, sprach er Mark an, »na, was haben Sie denn für Beschwerden?«
Mark war völlig perplex, diese Frage hatte er am allerwenigsten erwartet. Dann bekam er Panik, dass die kostbare Zeit, die ihm für seine Antwort zur Verfügung stand, ungenutzt verstreichen könnte, also setzte er sich auf seine Pritsche und zählte dem Arzt seine sämtlichen gesundheitlichen Beschwerden auf. Ausführlich erzählte er von seinem Lungensplitter, von den fünf Jahren, in denen er eine schwarze Augenbinde tragen musste, und von seinem lahmen Bein, in dem bei feuchtem Wetter der Schmerz wühlte.
Der Alte nickte und notierte etwas in einem dicken blauen Heft.
»Ist das alles?«, fragte er Mark, als dieser geendet hatte.
»Ja«, antwortete der Künstler schwer atmend, »reicht das denn nicht?«
»Ganz im Gegenteil! Das ist eigentlich viel zu viel«, sagte der Arzt. »Wie halten Sie das nur aus? Ist Ihr Vogel auch krank?«
»Ich glaube nicht«, antwortete Mark. »Der Gefängnisdirektor hat mir ein Stück Stoff versprochen, da werde ich Kusma für den Winter etwas nähen …«
»Aha«, sagte der Arzt mit einem verständnisvollen Nicken. »Na, dann gestatten Sie, dass ich mich zurückziehe.«
Der Anstaltsarzt entfernte sich übertrieben höflich, ließ leise die Tür einschnappen und verriegelte sie.
Genau eine halbe Stunde später schaute Jurez vorbei. Seine Augen strahlten. Er trat an die Liege und lachte übers ganze Gesicht. Warf Kusma einen wohlwollenden Blick zu. Musterte Mark und sagte:
»Hör mal, Künstler, sieht ganz so aus, als würdest du bald rauskommen … wegen deiner Gesundheit …«
»Was?«, platzte Mark heraus. »Wie, wann? Bald?«
»Mach langsam, sonst kriegst du vor lauter Freude noch einen Herzschlag!«, versuchte Jurez Mark zu beruhigen. »Vielleicht stimmt’s auch gar nicht … Ich hab’s nur so mit halbem Ohr gehört, als ich am Büro vom Direktor vorbeigekommen bin …«
»Danke, Jurez! Danke«, schluchzte Mark.
Seine Hände zitterten.
Jurez warf einen Blick auf den Bücherstapel, der vor der Liege aufgeschichtet war.
»Und bring bloß die Bücher zurück, bevor sie dich rauslassen, manche vergessen das vor lauter Freude. Und kaum dass sie draußen sind, müssen sie noch mal für drei Jahre in den Knast, weil sie Bücher geklaut haben.«
Erschrocken sah Mark die Bücher an. Und nickte.
»Gleich … Ich warte nur kurz auf den Aufseher und …«
»Das war ein Witz, Mann!«, sagte Jurez und lachte los. »Mach’s gut, ich hab noch was vor, Knysch aus der 45 hat Geburtstag.«
Die Tür ging wieder zu und der Riegel schob sich in die gusseiserne Nut.
Mark stapelte seine Bücher sorgfältig und legte sie aufs Bett. Dann setzte er sich daneben, rieb sich die Hände und dachte an die Freiheit. Und dass sie genau zum rechten Zeitpunkt kam. Sommer, Wärme, Vogelgezwitscher.
Die angenehmen Gedanken machten Mark Appetit, und um den Hunger zu stillen, wickelte er ein Stück ehrlich erarbeiteten Specks aus, führte es zum Mund und schlug die Zähne hinein. Biss ein Stück ab, kaute und sah plötzlich direkt neben der Bissstelle Blutspritzer. Wieder Zahnfleischbluten, dachte er, aber er nahm es nicht weiter tragisch.
Kapitel 4
Klaras Brief war auf März datiert.
Banow öffnete den Umschlag nicht sofort. Er dachte an den Frühling. Schaute sich um.
Der Kremlträumer Ekwa-Pyris saß auch hier, am ewigen Feuer. Saß da und bewegte lautlos die Lippen. Er war heute ganz niedergeschlagen, denn zum ersten Mal seit Monaten war weder ein Päckchen noch ein Paket für ihn gekommen.
Der Frühling hatte auch auf den Kremlwiesen Einzug gehalten. Hier und da schaute die Erde durch den Schnee. Auf dem immer schneefreien Ring um das Feuer spross frisches Grün.
Banow seufzte und öffnete den Umschlag.
Die vertraute kleine Schrift flimmerte vor seinen Augen, Banow atmete erleichtert auf. Er hatte zwar noch nicht mit der Lektüre des Briefes begonnen, aber etwas sagte ihm, dass Klara alles verstanden hatte, und obwohl der Brief wie immer mit den Worten Sehr geehrter Ekwa-Pyris begann, war er doch eigentlich an ihn gerichtet.
Sehr geehrter Ekwa-Pyris!, las Banow, vielen Dank für Ihren Brief. Ich freue mich sehr, dass es Ihnen gut geht, dass Sie wohlauf sind und neue wissenschaftliche Arbeiten in Angriff nehmen wollen. Ich habe viel über Sie und Ihre Artikel nachgedacht. Ich bin in die Schule in der Dajew-Gasse gegangen. Darüber werde ich Ihnen später noch ausführlicher berichten. Vor einigen Monaten habe ich eine schwere Zeit durchgemacht. Mehrmals sind die Miliz und andere Leute zu mir in die Wohnung gekommen. Sie haben meinen Freund, den Schuldirektor, gesucht. Ihren Behauptungen zufolge soll er ein Flugzeug nach Tuschino entführt haben und ins Ausland geflohen sein. Sie haben eine Hausdurchsuchung gemacht, seine ganzen Bücher und Papiere beschlagnahmt, dann sind sie noch einmal wiedergekommen und haben gefragt, ob vielleicht Briefe oder Informationen von ihm gekommen seien. Kurz darauf hat mich eine weitere traurige Nachricht aus Jakutsk erreicht. Dieses Schreiben lege ich dem Brief bei. Ich denke, Sie werden meine Gefühle verstehen.
An den Tagen, an denen es mir schwer ums Herz ist, nehme ich Ihre Bücher zur Hand, und wenn ich sie lese, gewinne ich Abstand und vergesse alle meine Sorgen und Ängste.
Bitte schreiben Sie mir
Hochachtungsvoll, Klara Roid
»Alles klar«, flüsterte Banow erfreut.
Er schaute sogleich in den Umschlag und suchte das im Brief erwähnte Schreiben.
Fand ein graues Quadrat mit einem maschinengeschriebenen Text. Ungefähr so groß wie eine Postkarte.
Er nahm es in die Hand.
Sehr geehrte Genossin Roid. Wir möchten Sie davon in Kenntnis setzen, dass Ihr Sohn Robert Roid bei einer Übung der Suworow-Schüler die Trainingsalpen überquert hat und dabei tragisch ums Leben gekommen ist. Er wurde auf dem Spezialfriedhof Nummer 159 im Gebiet Jakutsk beigesetzt. Weitere Unterlagen zum tragisch verunglückten R. Roid fertigen Sie bitte im 9. Wehrkommando der Stadt Moskau unter Vorlage dieses Schreibens aus.
Banows Freude verkehrte sich augenblicklich in Kälte, er ließ die graue »Ansichtskarte« auf die Knie sinken, schloss das oberste Häkchen an seinem Mantel und klappte den Kragen hoch, obwohl weder Wind wehte noch Schnee fiel und der Tag sonnig zu werden versprach.
‚Robert ist tot‘, dachte er, und ein Zittern überkam ihn. ‚Arme Klara.‘
Sein Blick fiel auf das Lagerfeuer, das der alte Mann nun schon seit vielen Jahren in Gang hielt.
‚Die ewige Flamme‘, dachte Banow. ‚Die ewige Flamme als Gedenken an Robert …‘
»Und, was steht da in den Briefen?«, ertönte die Stimme des Kremlträumers. »Was Interessantes?«
Banow drehte sich zu dem Alten um. Der frühere Schuldirektor hatte Tränen in den Augen.
Der Kremlträumer registrierte die Verfassung seines Sekretärs, richtete sich auf, streckte seinen kurzen Arm aus und ließ sich Klaras Brief geben.
Er rückte näher ans Feuer und bewegte beim Lesen lautlos die Lippen.
Banow folgte dem Alten mit teilnahmslosem Blick.
Das Gesicht des Kremlträumers spiegelte zunächst lebhaftes Interesse, doch nach und nach wandelte sich das Interesse in Besorgnis. Er las auch den grauen Zettel über Roberts Tod.
»Na so was«, sagte er gedehnt. »In schweren Stunden greift sie zu meinen Arbeiten … Sie muss eine Antwort bekommen, auf der Stelle!«
Banow seufzte, legte sich die Schreibunterlage auf die Knie, holte ein Blatt Papier und einen Stift hervor und wollte Klara antworten.
»Nein, Wassilij Wassiljewitsch, diesen Brief beantworte ich selbst!«, verkündete der Alte entschlossen. »Her mit dem ganzen Zeug!« Und er zeigte auf die Schreibutensilien, die Banow vorbereitet hatte.
Banow hatte noch nie gesehen, dass der Alte sich einer Sache so lange und ausdauernd widmete.
Ekwa-Pyris schrieb ein ganzes Blatt in seiner zierlichen Handschrift voll, las es durch, schüttelte unzufrieden den Kopf, zerknüllte das Papier und warf es ins Feuer. Und begann von neuem. Nun war er offenbar zufrieden und schrieb und schrieb, bis der Soldat Wasja mit dem dreistöckigen Henkelmann kam. Da erst setzte der Alte einen Punkt, unterschrieb schwungvoll und versah den Umschlag mit Klaras Adresse. Dann klebte er ihn zu und legte ihn zusammen mit der Schreibunterlage vorsichtig im Schnee ab.
Sie aßen schweigend zu Mittag.
Der Soldat versuchte die ganze Zeit, den Kremlträumer in ein Gespräch zu verwickeln. Er fragte ihn nach seinen Jahren in der Emigration und nach seinem Leben im Ausland. Aber der Alte wimmelte ihn mit Satzfetzen ab, die wie Schüsse klangen, erläuterte nichts und ignorierte die Fragen, die der Soldat gestellt hatte.
Schließlich schwieg Wasja und saß einfach da, bis das Mittagessen beendet und die Fruchtsuppe ausgetrunken war.
»Mein Herzchen«, sprach der Kremlträumer den Soldaten an. »Ich wollte dich um etwas Wichtiges bitten …«
Wasja, den das fehlgeschlagene Gespräch missmutig gemacht hatte, war sofort hellwach.
»Erinnerst du dich noch, wie ich dir von der Konspiration erzählt habe?«
»Selbstverständlich.«
»Erinnerst du dich genau?«
»Ja.«
»Ich möchte, dass du diesen Brief nach oben bringst und ihn in einen gewöhnlichen Briefkasten wirfst. Aber pass auf, dass dir keiner den Brief abnimmt und ihn liest«, sagte der Alte. »Alles klar?«
»Ja, natürlich«, platzte der Soldat erfreut heraus.
»Was machst du, wenn du in Gefahr gerätst?«
»Ich esse den Brief samt Umschlag auf«, antwortete der Soldat.
»Richtig.« Der Kremlträumer lächelte, nahm den zugeklebten Brief von der Schreibunterlage und vertraute ihn dem Soldaten an.
Der Soldat schob sich den Brief unter die Achsel. Sammelte die Blechschüsseln ein, stapelte sie ins Gestell und verabschiedete sich – immer noch lächelnd – von Banow und dem Alten.
»Ein prächtiger junger Mann wächst da heran!«, sagte der Kremlträumer und schaute dem Soldaten nach. Er rieb sich die Hände, um sich zu wärmen oder weil er gute Laune hatte.
Kapitel 5
Von Kindheit an mischt der Tod im Leben eines Menschen mit.
Ein Staubkorn. Winter. Ein Spinnennetz, das die toten Fliegen und die lebendige Spinne im Wind wiegt. Ein Knochen, der über die Straße rollt. Verdorrte Bäume und gehauenes Gras.
Der Tod hat viele Gesichter, er verfolgt den Menschen nicht, weich und lautlos kommt er daher, begleitet den Menschen überallhin, streut seine Spuren, wo sie nicht zu übersehen sind.
Ein unverständiges Kind macht seine ersten Schritte und steht plötzlich vor einem Vögelchen, das aus dem Nest gefallen ist. Das Kind betrachtet das bläuliche Vogeljunge, aber den Tod sieht es nicht.
Den Stolzen und Starken begegnet der Tod erst später. Er möchte, dass sie an ihn denken, dafür muss er auf sich aufmerksam machen. Da stirbt plötzlich der geliebte Hund. Dann das geliebte Pferd.
Dann der beste Freund, und schließlich ist der Moment gekommen, in dem selbst der Stärkste und Stolzeste an den eigenen Tod denkt.
Aber nicht nur der Tod begleitet den Menschen überallhin. An seiner Seite, immer einen Schritt voraus, läuft lautlos und unhörbar ein anderes flüchtiges Etwas, die Liebe. Sie bewegt sich und hinterlässt keine sichtbaren Spuren, sie zergeht in der Luft und strömt mit ihr in die menschlichen Lungen und in das menschliche Blut. Und jemand, der die Liebe eingeatmet hat, denkt dann beim Tod seines engsten Freundes an diesen und nicht an den eigenen Tod. Er denkt nicht an sich, sondern an die anderen Toten, trauert um sie und liebt sie weiter. Und nicht mal im Sterben denkt er an sich.
Eine noch nie dagewesene Hitze, die über Krasnoretschensk und seiner Umgebung lag, hatte das Gras längst verdorren lassen. Der Fluss Krasnaja war ausgetrocknet und hatte die darunter liegende rote Erde freigegeben. Das Vogelgezwitscher war verstummt. Selbst der Wind verbreitete eine brennende Trockenheit.
Trotz der unbarmherzigen Natur lebte und arbeitete die Stadt mit vollem Einsatz. Sie erfüllte und übererfüllte die Pläne, tagsüber heizte sie sich unter den Sonnenstrahlen auf, nachts erholte sie sich von der Gluthitze, kühlte ab und träumte vom Regen.
Die Stadt wuchs, ihr Röhrengeflecht breitete sich nach allen Seiten aus wie die Wurzeln einer mächtigen Eiche.
Die Stadt lebte und arbeitete, sie atmete die Zeit ein und aus.
***
Pawel Dobrynin saß in seinem Büro und wartete auf den Einbruch der Dunkelheit. Sein Arbeitstag war schon lange vorüber. Außer ihm war um diese Zeit nur noch der bewaffnete Wachdienst im Haus – vier Männer in Dobrynins Alter, vier Offiziere a. D., die in ihrem Leben viel gesehen und viel gekämpft hatten. Sie waren das Licht im Büro des Volkskontrolleurs gewohnt. Und seine allabendliche Anwesenheit. Ab und zu kamen sie bei ihm vorbei. Tranken Tee und redeten. Sie kannten Dobrynin als einen von ihrem Schlag: streng, gestählt und über jeden Zweifel erhaben.
An diesem Abend jedoch kamen sie nicht, und Dobrynin war das ganz recht.
Er fühlte sich im Büro wohler als zu Hause in seiner Wohnung, wo noch immer das unbezogene Bett von Dmitrij Waplachow stand. Manchmal übernachtete Dobrynin auch im Büro, für diesen Fall hatte er in den untersten Fächern seines Bücherschranks zwei Decken deponiert. Auch seinen alten Tornister mit den zwei angebissenen Zwiebacken aus der fernen Vorkriegszeit und seinen Revolver, das Geschenk vom Genossen Twerin, hatte er hier. Seine Bücher hatte Dobrynin ebenfalls nach und nach in die Fabrik geschafft, sie füllten jetzt einen Großteil seines Bücherschranks.
Langsam senkte sich die Dämmerung auf Krasnoretschensk, und Dobrynin trat aus seinem Büro. Er holte sich aus der Abstellkammer einen Eimer und ließ Wasser ein.
»Kommst du noch mal wieder?«, rief ihm einer vom bewaffneten Wachdienst an der Pforte zu.
Dobrynin blieb stehen und stellte den Eimer ab.
»Vielleicht«, sagte er nachdenklich.
Es war still und kühl.
Fünfzehn Minuten später war Dobrynin in der Allee des Ruhms angekommen.
Eigentlich gab es die Allee noch gar nicht, erst vor kurzem war im Zentrum, dort, wo man die alten Häuser abgerissen hatte, mit dem Bau begonnen worden.
Bislang standen hier nur vier kleine Birken, sie bildeten ein Quadrat, in dessen Mitte Dmitrij Waplachow begraben lag. Die Birken waren kümmerlich, von der Sonne ausgedorrt.
Dobrynin goss sie, dann hockte er sich vor das Grab seines Freundes.
In der Stadt war es so still wie nachts auf einem Dorffriedhof.
Limonow, der Direktor der Spiritusfabrik, hatte Dobrynin neulich erzählt, man wolle hier demnächst für Waplachow ein schönes, großes Denkmal errichten. Eine neue Straße war bereits nach ihm benannt. In der standen bislang nur zwei Häuser.
‚Gut, dass sie die Birken gepflanzt haben‘, dachte der Volkskontrolleur zum wiederholten Mal. ‚Schließlich war Dmitrij ein echter Russe.‘
Dobrynin hörte Schritte und drehte sich um.
Er erblickte eine Frau mit einem Blumenstrauß. In der Dunkelheit konnte er ihr Gesicht nicht erkennen. Sie trat ans Grab, verneigte sich und stand ein paar Minuten mit gesenktem Kopf da. Dann legte sie die Blumen auf den Grabhügel und ging weg.
Dobrynin schaute ihr nach.
‚Vielleicht die Mutter des geretteten Kindes?‘, dachte er.
Er blickte auf die Blumen.
Wieder umfing ihn die Stille der abendlichen Stadt. Dobrynin dachte: ‚Wie schön wäre es, Hundegebell zu hören und das Zwicken der Kälte auf der Haut zu spüren, das Vergangene mit all den Hunden und Menschen, die entweder schon gestorben oder auch schon in die Jahre gekommen waren, für einen Moment heraufziehen und verweilen zu sehen und keine Angst zu empfinden. Eigentlich bin ich ja noch nicht alt‘, dachte Dobrynin. ‚Alt bin ich noch nicht, sondern erschöpft von der pausenlosen Arbeit.‘
Er stand auf, nahm den leeren Eimer und sah sich um.
‚Und wohin jetzt?‘, dachte er.
Von der Allee des Ruhms bis zu seiner und Dmitrijs Wohnung war es nur ein Katzensprung, ganze fünf Minuten. Widerwillig schlug er den Weg nach Hause ein.
Bevor er die Wohnung betrat, schaute er in den Postkasten. Zog einen Brief heraus und öffnete die Tür.
Drinnen war es stickig. Er schaltete in der Küche das Licht ein, öffnete das Fenster und setzte sich mit dem Brief an den Tisch.
Balabinsk 18, Krasnoarmejskaja Straße 5, Wohnung 7, Dmitrij Waplachow.
Mehrere Male las er die Adresse. Die Handschrift war sauber und rund.
Er schaute auf den Absender und schürzte traurig die Lippen.
Wie sehr hatte Dmitrij auf diesen Brief, ja, auf das kleinste Zeichen von Tanja Seliwanowa gewartet! Jetzt war es gekommen. Zwei Monate nach seinem Tod!
Dobrynin drehte den Brief hin und her und starrte ihn an.
Die Glühbirne in der Küche brannte durch und verlosch zischend, Dunkelheit flutete herein.
Tastend, mit dem Brief in der Hand, ging Dobrynin in den Flur, blieb stehen und schmiegte sich an die Wand. Hielt ein Weilchen inne, ging ins Wohnzimmer und machte Licht. Setzte sich aufs Bett. Seufzte.
In seinen Händen zitterte der Brief.
Dobrynin ließ sich Zeit, dann öffnete er den Umschlag und zog eine vierfach gefaltete Heftseite hervor, die in derselben sauberen und runden Handschrift beschrieben war.
Lieber Dmitrij!
Vielen Dank für Ihre beiden Briefe und das Foto. Es steht jetzt gerahmt auf meinem Nachttisch im Wohnheim. Sie sehen auf dem Foto ganz natürlich aus, und ich denke oft daran, wie Sie und Ihr Freund mich mit Tee bewirtet haben.
Unsere Brigade ist vor zwei Tagen mit der Roten Wanderfahne für hervorragende Leistungen in der Aktivistenbewegung ausgezeichnet worden. Wir arbeiten nicht mehr dort, wo unsere Schule war, sondern in einem neuen, hellen Gebäude. Sassonowa ist noch immer unsere Chefin. Sie wollte nicht wieder als Direktorin zurück an die Schule.
Ich muss mich jetzt schlafen legen, damit ich morgen wieder mit frischen Kräften an die Arbeit gehen kann. Deswegen komme ich zum Ende. Bitte grüßen Sie Ihren Freund von mir. Schreiben Sie mehr über sich und über Ihre Arbeit.
Hochachtungsvoll, ich umarme Sie
Tanja Seliwanowa
Als Dobrynin den Brief zu Ende gelesen hatte, schaltete er das Licht aus und legte sich gleich in seinen Sachen schlafen.
Am nächsten Morgen war er schon vor sechs wach. Er wusch sich und setzte sich an den Küchentisch, um Tanja Seliwanowa einen Brief zu schreiben. Er war fest entschlossen.
Eigentlich hatte er nicht lange genug geschlafen, aber ihn überkam plötzlich eine Entschiedenheit, die ihn selbst erstaunte. Er blickte auf den Federhalter, der in seiner Hand kein bisschen zitterte. Tauchte die Feder ins Tintenfass, zog den Bogen Papier näher zu sich heran und schrieb:
Sehr geehrte Tanja Seliwanowa, liebe Genossin Tanja!
Ich, Pawel, Freund und Weggefährte von Dmitrij Waplachow, mit dem ich mehr als zwanzig Jahre zusammen gelebt und gearbeitet habe, schreibe Dir diesen Brief. Vor kurzem ist Dmitrij tragisch verunglückt … Hier setzte Dobrynin die Feder ab und überlegte, ob er den tragischen Tod genauer beschreiben sollte. Plötzlich wurde ihm bewusst, dass er, wenn er ins Detail gehen wollte, auch über die Fabrik würde schreiben müssen, und das war verboten, denn Krasnoretschensk war nicht umsonst eine geschlossene Stadt und hieß im Volksmund Balabinsk 18. Und so setzte Dobrynin seinen Brief wie folgt fort: Er starb den Heldentod, als er einem Kind das Leben rettete. Das Kind lebt, aber mein Freund Dmitrij Waplachow ist umgekommen. Er hat sehr auf Post von Dir gewartet, erst heute ist sie eingetroffen. Als sein bester Freund weiß ich, dass er oft an Dich gedacht hat. Entschuldige, Genossin Tanja, wenn ich das jetzt so schreibe, ich glaube, er hat Dich geliebt. Er wurde im Stadtzentrum in der Allee des Ruhms beigesetzt. Komm her, wenn Du kannst. Dann zeige ich Dir sein Grab. Leider ist Krasnoretschensk eine geschlossene Stadt. Ich versuche Dir zu helfen, dass Du herkommen kannst. Dmitrij hat viel an Dich gedacht. Du musst jetzt für Dich und für ihn mit arbeiten. Ich werde ebenfalls für zwei arbeiten.
Schreib mehr über Deine Arbeit. Hochachtungsvoll, Dmitrijs engster Freund
Pawel Dobrynin
Gleich darauf schrieb der Volkskontrolleur einen weiteren kurzen Brief. Nach Sarsk, an Major Sokolow. Er bat den Major um Unterstützung, damit Tanja Seliwanowa nach Balabinsk 18 kommen könne. Er schrieb auch über den Tod von Waplachow und darüber, dass er nunmehr allein lebte. Trotz allem geriet der Brief kurz, und Dobrynin dachte, in einem kurzen Brief liege weniger Achtung und Liebe als in einem längeren. Dennoch fügte er nichts hinzu und schickte auf dem Weg in die Fabrik beide Briefe ab. Eine Woche später kam von Sokolow aus Sarsk eine Antwort. Die Antwort war noch kürzer als Dobrynins Brief:
Lieber Pawel!
Über den Tod von Genossen Waplachow bin ich im Bilde. Mein herzlichstes Beileid.
Halt Dich tapfer! Ich versuche, Tanja Seliwanowa zu helfen. Beste Grüße.
Oberst Sokolow
‚So ist das also!‘, dachte der Volkskontrolleur. ‚Er ist Oberst, und ich habe ihn als Major angeschrieben. Ein Glück, dass er mir das nicht übel genommen hat.‘
Es blieb heiß, und Dobrynin goss weiterhin Abend für Abend die kümmerlichen Birken am Grab seines Freundes. Und Abend für Abend sah er neue Blumensträuße. Er freute sich darüber, zeigte es doch, dass Dmitrij nicht vergessen war, dass die Bewohner von Krasnoretschensk ihren Helden nicht vergaßen. Und dank der Fürsorge des Volkskontrolleurs erholten sich die Birken allmählich und trieben frische Blätter.
Der Sommer ging seinem Ende entgegen, aber die Hitze hielt unvermindert an.
Kapitel 6
Zwei Monate waren ins Land gegangen, aber Mark war immer noch nicht entlassen worden. Schon längst hatte er die Bücher in die Bibliothek zurückgebracht und keine weiteren ausgeliehen, weil er fürchtete, er würde es nicht mehr schaffen, sie zu lesen. Die Zeit verging und alles nahm seinen gewohnten Lauf. Wie gewohnt kam Jurez hin und wieder mit Freunden vorbei, um dem Papagei zuzuhören. Wie gewohnt brachten die Freunde als Bezahlung eine Kleinigkeit zu essen mit, jetzt behielt Jurez den größten Teil der Honorare, manchmal sogar alles, für sich.
In diesen zwei Monaten lernte Kusma ein weiteres Dutzend Knastverse, Mark begriff sie endlich und verstand allmählich, worüber sich die Knackis unterhielten. Mitunter kam ihm der Spruch in den Sinn: »Je mehr Sprachen ein Mensch kennt, desto mehr Kulturen er sein eigen nennt.« Das klang merkwürdig, war dem Sinn nach aber durchaus verständlich.
Eines Morgens kam der befreundete Wärter in Marks Zelle, mit dem er sich immer über Bücher unterhielt. Der Wärter trug Mark eine mündliche Rezension des Romans Das Friedenspfand vor, den der ukrainische Autor Wadim Sobko verfasst hatte. Aber der Wärter war niedergeschlagen und mit seinen Gedanken nicht bei der Literatur.
»Gleich wirst du abgeholt, mein lieber Mark«, sagte er mit gebrochener Stimme. »Hab ich gerade gehört. Ich wollte mich ja für dich einsetzen, aber da hätten sie mir beinahe …«
Dem Künstler lief eine Gänsehaut über den Rücken.
»Abgeholt? Warum denn?«, fragte Mark erschrocken.
»Weil du freikommst«, presste der Wärter mit Mühe hervor.
»Weil ich freikomme?«, flüsterte Mark und konnte die gedrückte Stimmung des Wärters nicht verstehen. »Aber das ist doch toll …«
»Toll?«, flüsterte nun seinerseits der Wärter ungläubig. »Für dich vielleicht. Und was wird aus mir?«
Im Nu war jeder Schreck verflogen, und der helle Glaube an die lichte Zukunft kehrte zu Mark zurück.
Der Wärter holte unterdessen einen Zettel aus seiner Uniformjacke und hielt ihn Mark hin.
»Was ist das? Deine Adresse?«, fragte Mark und drehte das viereckige Stück Papier hin und her.
»Die Gefängnisadresse«, antwortete der Wärter. »Falls sie dich noch mal verknacken, lass dich wieder hierherschicken. Der Direktor hat gesagt, du hättest gute Beziehungen zum ZK, dann lässt sich das doch sicher einrichten.«
Mark versprach es.
»Na dann«, sagte der Wärter seufzend. »Pack deine Sachen und warte.«
Der Wärter ging weg. Mark sah sich um.
»Was denn für Sachen?«, fragte er sich und schaute unter die Liege.
Alles in der Zelle gehörte dem Gefängnis, und Mark vergriff sich nicht an fremdem Eigentum.
Interessiert beobachtete Kusma seinen Besitzer, wie der in den ausgreifenden Schritten eines freien Menschen die Zelle durchmaß.
Dann öffnete sich aufs Neue die Tür. Zwei Wärter und der Gefängnisdirektor Krutschonyj standen auf der Schwelle.
»Sind Sie fertig?«, fragte der Gefängnisdirektor.
»Ja«, antwortete Mark und rückte die Brille mit den dicken Gläsern zurecht.
»Dann kommen Sie!«
Mark nahm Kusmas Käfig und ging zur Tür.
»Der Vogel bleibt hier«, sagte Krutschonyj streng.
»Wie?«, rief Mark, »was soll das heißen: bleibt hier? Wo denn?«
»Hier im Gefängnis«, erwiderte der Gefängnisdirektor gelassen. »Die Amnestie erstreckt sich nur auf Sie. Aus gesundheitlichen Gründen. Der Vogel hat keine Beschwerden geäußert, also bleibt er hier und sitzt seine Strafe bis zum Ende ab.«
Mark machte ein paar Schritte zurück, blieb stehen und hielt den Käfig mit der rechten Hand fest umklammert.
»Verlassen Sie die Zelle«, donnerte Krutschonyj.
»Nein, gestatten Sie, dass ich dann auch …«
»Dass Sie auch – was?«
»Meine Strafe auch bis zum Ende absitze. Ohne den Vogel bin ich verloren, ein Schmarotzer, ein Nichts.«
»Völlig durchgeknallt«, sagte Krutschonyj kopfschüttelnd, »der wird uns noch hier im Gefängnis verrecken … Los, nehmt ihm den Käfig ab und befördert ihn nach draußen!«, befahl der Direktor den Wärtern. »Und denkt an den Koffer! Der muss auch mit! Los, aber dalli!«
Krutschonyj stapfte mit seinen schweren Stiefeln durch den Gefängnisflur davon.
Die Wärter stürzten sich auf den Künstler, nahmen ihm den Käfig ab, drehten ihm die Arme auf den Rücken, führten ihn durch die Gefängnisflure nach draußen und ließen ihn erst hinter dem schweren Metalltor los, das Freiheit und Haft voneinander schied.
Erschöpft vom inneren Kampf, sank Mark zu Boden. Da saß er nun auf dem sonnenwarmen Pflaster direkt vor dem Gefängnistor. In seinen Augen glitzerten Tränen.
Plötzlich ging das Tor ein zweites Mal auf, und neben ihm landete sein Köfferchen mit den üblichen Gastspielutensilien.
‚Nein und nochmals nein, ich bleibe hier‘, dachte Mark stur, ‚ich rühre mich nicht vom Fleck, bis sie Kusma freilassen.‘
Gegen Abend kam Krutschonyj mit seinem Sohn heraus. Als der Direktor den Künstler vor dem Gefängnis sitzen sah, blieb er stehen und schaute ihn mit einer gewissen Sympathie, ja sogar bedauernd an.
»Nun fahren Sie doch nach Hause, Genosse Iwanow!«
»Ich bleibe hier so lange sitzen, bis Sie meinen Vogel freilassen«, trillerte Mark schrill los.
Die Miene des Gefängnisdirektors veränderte sich.
»Lass doch den Vogel frei, Papa«, bat Wolodja seinen Vater.
»Misch dich nicht ein«, fauchte der Vater. Dann wandte er sich an Mark: »Und wenn ich dem Vogel die Freiheit schenke, lassen Sie ihn dann fliegen?«
»Wie bitte?« Diese merkwürdige Frage hatte Mark nicht verstanden. »Was haben Sie gesagt?«
»Im Grunde Ihres Herzens sind Sie auch ein Gefängniswärter, Genosse Iwanow! Das ganze Leben lang sperren Sie den armen Vogel in diesem Käfig ein. Nicht einmal in der Zelle haben Sie ihn frei herumfliegen lassen, obwohl Ihre Zelle verglichen mit dem Käfig doch immerhin … Und da sagen Sie zu mir: Lassen Sie den Vogel frei! Ich würde den Vogel auch ohne Sie entlassen und ihm die Freiheit schenken, aber er ist nun mal nach sowjetischem Recht wegen eines schweren Verbrechens verurteilt worden. Haben Sie mich verstanden?«
Mark seufzte tief und starrte aufs Pflaster.
»Wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf: Fahren Sie nach Hause«, sagte Krutschonyj schließlich und zerrte seinen Sohn weg.
Der Kleine drehte sich noch einige Male um und schaute interessiert und mitleidig nach dem Onkel, der vor dem Gefängnistor sitzen geblieben war.
»Ohne Kusma mache ich keinen Schritt!«, rief Mark stur und starrte weiter auf das Pflaster.
Schon am nächsten Tag allerdings wurde der hungrige Künstler, der sich über Nacht auch noch eine Erkältung zugezogen hatte, gefesselt und in einen Zug nach Moskau gesetzt.
Die Wärter, die Mark zum Bahnhof begleitet hatten, wiesen den Schaffner an, ihm die Nahrung persönlich einzuflößen und die Fesseln erst kurz vor Moskau abzunehmen.
Es lag sich ausgesprochen unbequem mit gefesselten Händen und Füßen auf der untersten Pritsche. Mit großer Mühe drehte sich Mark hin und wieder von einer Seite auf die andere. Er hätte gern aus dem Fenster geschaut, aber in seinem Abteil war niemand außer ihm, und so hatte er niemanden, den er bitten konnte, ihn wenigstens für einen kurzen Moment anzuheben, damit sein wunder Blick irgendein schönes Bild aus der vorbeiziehenden Landschaft, ein reizvolles Eckchen seiner teuren Heimat erhaschen konnte.
Sobald er an seinen Papagei dachte, den er im Gefängnis zurücklassen hatte müssen, schossen ihm die Tränen in die Augen und stürzten brennend die Wangen hinab. Die Haut juckte, aber die Hände waren gefesselt und die Gelenke schmerzten von den fest verknoteten Stricken.
Die Abteiltür ging auf, und der Schaffner, ein junger Spund in blauer Dienstuniform und Mütze, fragte:
»Wollen Sie einen Tee?«
»Arschloch!«, presste Mark hervor, und wieder füllten sich seine Augen mit Tränen.
Mark heulte, der Schaffner verzog sich beleidigt in den Vorraum und steckte sich eine Belomorkanal an. Es war seine erste eigenständige Fahrt, auf der er ohne Lehrmeister unterwegs war, und gleich gab es Probleme.
Kapitel 7
Die Zeit verging wie im Flug. Schon trafen Briefe mit Mai-Stempeln auf den Kremlwiesen ein. Schon tirilierten ringsum die Vögel und erfüllten die erblühende Landschaft mit Rufen und Gesang.
Die Sonne schien scheinwerferhell. Die Luft war frisch und klar.
Selbst Ekwa-Pyris bekam rote Wangen, und auf seiner Nase zeigten sich winzige Sommersprossen.
Die beiden Bewohner der Kremlwiesen waren in ausgezeichneter Stimmung. Vor einer Woche hatte der Alte von einem georgischen Bauern ein Paket mit fünf Kilo Apfelsinen bekommen. Die ganz überraschend mit Wodka gefüllt waren. Der Alte hatte es als Erster bemerkt – seine empfindliche Nase hatte es ihm verraten. Da der Alte gutmütig und mitteilsam war, erzählte er Banow sogleich davon. Drei Tage später verspeisten sie die Apfelsinen und schliefen direkt am Feuer ein. Leicht hätten sie sich eine Erkältung einfangen können.
Als die Apfelsinen verzehrt waren, bekamen die Augen des Kremlträumers einen besonderen Glanz. Auf einmal redete er von irgendwelchen Kartentricks und versprach Banow, ihm diese Tricks zu zeigen, sobald der Soldat Wasja ihm ein Kartenspiel beschafft hatte.
Aber Wasja weigerte sich entschieden, oben Karten zu besorgen. Er sagte rundheraus, er habe für Kartenspiele nichts übrig und halte sie für sozial schädlich. Darauf wusste der Alte nichts zu erwidern, er seufzte nur tief und warf Banow einen bedauernden Blick zu.
Allerdings hatte das Gespräch ungewöhnliche Folgen. Bereits am nächsten Tag brachte der Soldat Wasja ein Dominospiel mit und bestand auf einer Partie. Dieses Mal weigerte sich der Alte und verwies auf die große Anzahl unbeantworteter Briefe.
Und so blieb das Dominospiel am Feuer liegen.
Die Tage vergingen, ständig trafen Briefe und Päckchen ein. Banow taten die Augen weh von den Hunderten und Tausenden fehlerhafter und schwer lesbarer Briefe. Das Feuer brannte. Dreimal pro Tag kam Wasja, klapperte mit dem Henkelmann, setzte sich zu ihnen, wünschte Banow und Ekwa-Pyris guten Appetit, erzählte etwas und schielte immer wieder schwermütig auf das Dominospiel, das noch unberührt neben ihnen im Gras lag.
Kapitel 8
In einer Winternacht, als Pjotr und Sachar erst lange über dies und das geredet, über die Liebe gestritten hatten und dann eingeschlafen waren, knirschten draußen Schritte im Schnee, jemand stolperte an der Schwelle, fluchte. Dann wummerte es laut und unnachgiebig gegen die Tür.
Sachar stand auf, um zu öffnen, machte aber kein Licht, er überlegte nicht, wer da wohl mitten in der Nacht gekommen sein mochte. Er schob den Riegel zurück, erst in dem Moment versuchte er zu erkennen, wer da hereingekommen war und ihn, den Hausherrn, nun beiseitestieß.
Sie waren zu zweit und gingen direkt in die Wohnstube.
»Wer seid ihr?«, fragte Sachar.
»Spar dir deine Frage. Mach Licht, dann siehst du es!«, sagte eine Stimme, die Sachar bekannt vorkam, die er aber niemandem zuordnen konnte.
Sachar riss ein Streichholz an, entzündete die Kerosinlampe und hängte sie an den Deckenhaken.
Trübes Licht flackerte auf und erhellte die Gesichter der Ankömmlinge. Sofort erkannte Sachar den geflohenen Baubrigadier in seiner schmutzstarren Wattejacke und einen anderen Bauarbeiter, mit dem er nie gesprochen, ihn aber irgendwann einmal gesehen hatte.
»Genug gegafft«, sagte der Brigadier schwankend, »rück ein Stück Fleisch raus!«
Sachar war nun hellwach und bedauerte, dass er so gedankenlos die Tür geöffnet hatte. Die beiden Bauarbeiter waren dermaßen betrunken, dass sie sich kaum auf den Beinen halten konnten, vor morgen früh würden sie also nicht wieder verschwinden.
»Na, wird’s bald?« Der Brigadier wurde wütend, sein Gesicht, rot und aufgedunsen, verfinsterte sich.
Widerwillig ging Sachar in die Räucherkammer. Die schwere Schiebetür aus Eisen rasselte beim Öffnen. Sachar streckte im Dunkeln seine Hand aus und seine Finger stießen auf einen warmen Schinken, der an einem Haken hing. Sachar fasste ihn mit beiden Händen und nahm ihn herunter. Am liebsten wäre er in der Räucherkammer geblieben, hier drin war es angenehm und wohlig. Er hatte den Schinken an diesem Tag hineingehängt, damit er warm und weich wurde, er stammte noch aus den Herbstvorräten. Am nächsten Morgen wollte er ihn hoch auf den Hügel bringen und damit zum Frühstück allen eine Freude machen, aber der unverhoffte Besuch der flüchtigen Bauarbeiter machte seine Pläne zunichte.
»Los, ein bisschen flotter«, hörte er den betrunkenen Brigadier rufen, »zack, zack!«
Sachar brachte nicht den ganzen Schinken mit, sondern nur ein kleines Stück. Zum Glück war ihm noch rechtzeitig eingefallen, dass in der Räucherkammer eine gut geschliffene Klinge lag, mit der er sonst das Fleisch anstach. Er schnitt also eine Scheibe von dem Schinken ab und hängte den Rest zurück an den Haken.
»Hast du Becher?«, fragte ihn der Brigadier und stellte eine Literflasche Schnaps auf den Tisch.
Sachar holte zwei Becher.
»Ich trinke nicht mit«, sagte er.
»Wir scheißen auf dich«, brummte der Brigadier und füllte die Becher mit Selbstgebranntem. »Na dann, Prost, Stjopa!«
Die Bauarbeiter tranken und aßen, dann tranken sie wieder. Das Fleisch war alle.
»Los, hol noch Fleisch!«, rief der Brigadier, ohne sich umzudrehen.
Aber er bekam keine Antwort. Er schaute sich um und sah, dass nur sie beide noch wach waren, Sachar lag schon auf der Pritsche und schlief oder stellte sich schlafend. Pjotr schlief ganz sicher, sein gleichmäßiges Schnarchen zerriss alle paar Minuten die Stille.
Der geflohene Brigadier stand auf, trank im Stehen den Schnaps aus und ging zu Sachar.
»Ej, du Pisser, hol uns noch Fleisch! Wärmt seinen Arsch hier, das faule Schwein!«
»Nein, mehr kriegt ihr nicht!«, antwortete Sachar und blieb liegen. »Der Rest ist für die anderen, es ist sowieso der letzte Schinken.«
Der Brigadier drehte sich zu seinem Saufkumpan um, der sich kaum noch aufrecht halten konnte.
»Hast du das gehört, Stjopa? Er gönnt uns den Schinken nicht!«