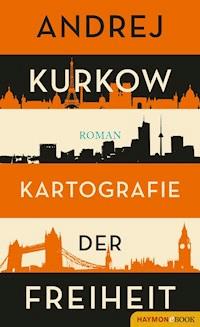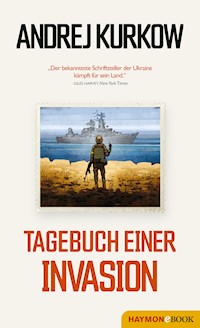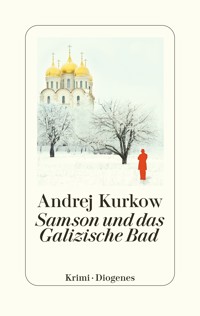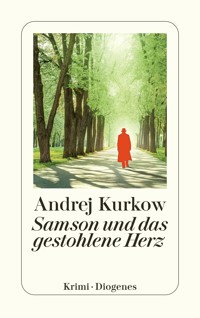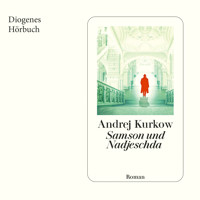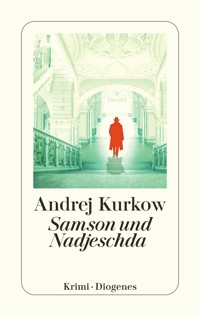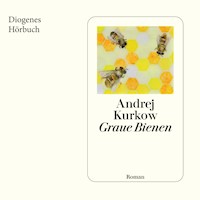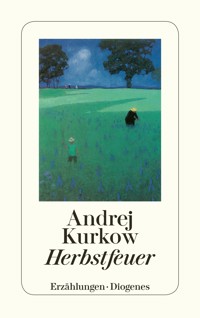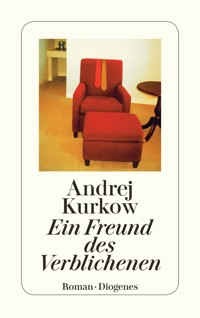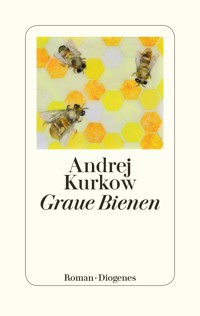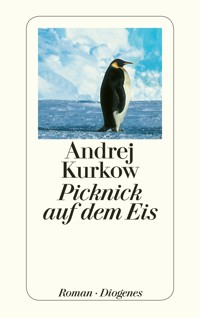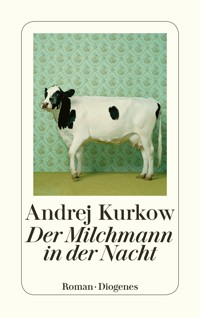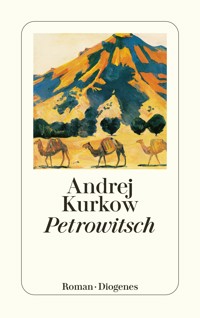
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der junge Geschichtslehrer Kolja gerät auf der Suche nach den geheimen Tagebüchern des ukrainischen Vorzeigedichters Taras Schewtschenko in die kasachische Wüste, wo er bei einem Sandsturm fast umkommt. Ein alter Kasache und seine beiden Töchter retten ihm das Leben. Doch das ist erst der Anfang einer langen Reise – und einer zarten Liebesgeschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Andrej Kurkow
Petrowitsch
Aus dem Russischen von Christa Vogel
Diogenes
1
Im Frühling 1997 erwarb ich, nachdem ich meine Zweizimmerwohnung am Stadtrand günstig losgeworden war, eine Einzimmerwohnung direkt im Zentrum von Kiew neben der Sophienkirche. Die alten Leute, die sie verkauften, emigrierten nach Israel und versuchten, mir mit der Wohnung Hunderte von völlig unnötigen Kleinigkeiten anzudrehen, wie zum Beispiel einen selbstgebastelten Kleiderständer.
Grigorij Markowitsch, das Oberhaupt der Familie, plauderte munter drauflos: »Ich kann jeden Gegenstand einschätzen! Ich verlange wirklich nur den realen Wert.«
Einiges kaufte ich, aber den größten Teil der Sachen und Sächelchen ließ ich liegen. Ich erstand auch ein Bücherregal samt Büchern – sie wollten es loswerden, um es nicht von der Wand reißen und die Bücher nicht zum Antiquar tragen zu müssen. Ich weiß nicht, wieviel von den fünf bezahlten Dollar auf die Bücher und wieviel auf das Regal entfielen, jedenfalls hatte ich mir die Bücher nicht genau angesehen, sondern nur so nebenbei die Studienausgabe von Lew Tolstojs Krieg und Frieden entdeckt. Das Buch hatte ein großes Format und war wohl eine Ausgabe der fünfziger Jahre. Solche Bücher liebte ich, wobei es mir gar nicht so sehr auf den Inhalt, sondern auf das solide Aussehen ankam.
Am zwölften März sollte die Schlüsselübergabe stattfinden. Ich fuhr gegen Abend dorthin. Vor dem Hauseingang stand ein Kleinbus von der Agentur ›Sochnut‹. Die Alten beluden ihn, wobei ihnen zwei Vertreter der Agentur respektvoll behilflich waren.
›Nun, Kolja Sotnikow‹, sagte ich zu mir, als ich allein in der neuerworbenen Wohnung stand. ›Jetzt bist du Herr dieser Bruchbude!‹
Ich warf noch einmal einen Blick auf die Risse und dachte an die unvermeidliche Renovierung. Dann ging ich zum Bücherregal, zog das großformatige Buch heraus und schlug es auf. Unter dem Einband erwartete mich eine Überraschung. Auf eine mir nur aus Agententhrillern bekannte Art steckte im Buch ein Geheimfach, in dem allerdings weder Gold noch Waffen lagen. Innen, in einer sorgfältig ausgeschnittenen Nische, lag ein zweites Buch, eine spätere Ausgabe von Taras Schewtschenkos Der Kobsar1.
Verwundert zog ich es heraus, und da ich vermutete, daß sich unter dem Einband noch etwas Unerwartetes versteckte, schlug ich es auf. Aber es war ein echtes Buch, das nicht in eine Schatulle verwandelt worden war. Ich blätterte einige Seiten durch und wollte diese ›Buchmatrjoschka‹ schon wieder an ihren Platz legen, um irgendwann einmal meine späteren Gäste damit in Erstaunen zu versetzen, als ich mit einem harten Bleistift an den Rand geschriebene Kommentare entdeckte. Mit dem aufgeschlagenen Buch in der Hand ging ich näher an die Lampe heran und las die säuberlich an den Rand geschriebenen Zeilen.
»Patriotismus war für T.S. eine ebensolche Leidenschaft wie die Liebe zu einer Frau oder wie der Haß auf den armenischen Dienst und besonders auf den militärischen Drill.«
›Diese Bemerkungen hat wohl kaum ein Dissident oder ein Literaturlehrer geschrieben …‹, dachte ich in Erinnerung an meine eigene Erfahrung als Lehrer.
Nach der pädagogischen Hochschule hatte ich selber die obligatorischen drei Jahre als ›Historiker‹ in einer Dorfschule absolviert, aber es war mir in der ganzen Zeit nicht gelungen, den gesunden, rotbackigen Kindern der Melker und Traktoristen ein Interesse an Geschichte einzuimpfen oder gar in ihnen den Wunsch zu erwecken, die vielfältigen historischen Rätsel und Geheimnisse zu begreifen, die ich aus der Masse der durchgearbeiteten Bücher herausgefiltert hatte.
Es wäre unsinnig gewesen, Grigorij Markowitsch, dem direkten Vorbesitzer der Wohnung, die Urheberschaft dieser Kommentare zu unterstellen. Er war Oberst im Ruhestand gewesen und sehr stolz darauf. Ich hatte ihn selber beim Einpacken seiner Medaillen angetroffen – er hatte sie auf den Tisch gelegt und jede in ein extra Taschentuch gewickelt, von denen er anscheinend Unmengen besaß.
Er hatte mir eine gezeigt und stolz dabei gesagt: »Ich habe Prag eingenommen!«
›Ob Prag das wohl gemerkt hat?‹ dachte ich und konnte kaum ein Lächeln unterdrücken, als ich diesen kleinen, ausgedörrten, aber immer noch agilen Neunzigjährigen ansah.
Auch die dreckige Küche bedurfte dringend einer Renovierung. Man mußte sie vom Geist der alten Bewohner befreien. Aus irgendeinem Grund überträgt sich das Alter der Eigentümer auf die Gegenstände, ja sogar auf die Wände, und um sich nicht plötzlich selbst alt zu fühlen, muß man wenigstens die Oberfläche mit Farbe verändern, muß so neue Frische hineinbringen.
Ich stellte den Teekessel auf den verrußten Gasherd und begann wieder das Buch durchzublättern und über diese merkwürdigen Aufzeichnungen nachzudenken. Auf einer der Seiten fiel mir ein besonderer Gedanke auf, der mit meinen eigenen Überlegungen übereinstimmte: »Der Patriotismus eines Hungrigen ist der Versuch, von jemandem eine Scheibe Brot zu bekommen, der Patriotismus eines Satten ist eine edle Haltung, die Respekt hervorruft.«
Ich wollte gern wissen, was für ein Mensch diese Kommentare zu Der Kobsar geschrieben hatte, wollte Zeugen der Zeit finden, in der das alles geschrieben worden war. Meine jetzige Arbeit als Nachtwächter, eingeteilt nach dem humanen Prinzip ›eine Nacht Dienst, zwei Nächte frei‹, erforderte keine geistige Anstrengung. Mein Hirn langweilte sich. Und plötzlich dieses rätselhafte Geschenk, das besser war als jedes Kreuzworträtsel.
Ich blätterte immer weiter, wie man ein Buch durchblättert, das man nicht nur so einfach lesen, sondern gründlich durchstudieren will, mit Papier und Bleistift daneben. Noch ein Gedanke fiel mir auf: »Ein absoluter Patriot kümmert sich nicht um nationale Mehrheiten oder nationale Minderheiten. Die Liebe zu seiner Frau ist stärker als die Liebe zur Heimat, weil die Frau, die seine Liebe erwidert, sowohl das Symbol der Heimat als auch das Ideal eines absoluten Patrioten ist. Die Verteidigung der Frau, die seine Liebe erwidert, ist die höchste Form des Patriotismus.«
An einer anderen Stelle, unter einem der Gedichte, war eine bloße Tagebucheintragung: »16. April 1964. Ich traf mich mit Lwowitsch in der Bierstube gegenüber vom Pfandhaus und berichtete ihm von dem fertigen Manuskript. Er wollte es lesen, aber das muß ja nicht sein. Nach der Provokation im Kino scheint mir seine Hand sogar zu feucht zum Händedruck zu sein. Und dann diese Angewohnheit, sich die ganze Zeit nach allen Seiten umzusehen.«
Ich saß bis Mitternacht da, dann schloß ich die ›Matrjoschka‹ und stellte das Buch wieder auf das Regal.
Am nächsten Tag fuhr ich bei einem Bekannten vorbei, einem Bildhauer, der das Kiew der letzten dreißig Jahre wie seine Westentasche kannte.
»Eine Bierstube gegenüber vom Pfandhaus?« fragte er nach. »Sicher, da ist jetzt das Café ›Russischer Tee‹. Nein, entschuldige, jetzt nicht mehr ›russischer‹. Entweder nur noch ›Tee‹ oder … da ist jetzt alles nicht mehr so, wie es war, und drum herum auch nicht diese …«
»Aber kanntest du zu dieser Zeit irgendeinen Lwowitsch?«
Der Bildhauer überlegte.
Sein zweistöckiges Atelier war voll von noch unbearbeiteten Steinbrocken, Modellen, kleineren Skulpturen und Unmassen von Fotografien, die statt Tapeten an der Wand klebten. Zu diesen Fotos ging er jetzt, nachdem er sich vom niedrigen Teetisch erhoben hatte.
»Hier sind viele Leute aus dieser Bierstube, aber ich kann mich nicht erinnern … Lwowitsch … Lwowitsch … Ich glaube nicht, daß er einer der Stammtischbrüder war. Da ging viel Laufkundschaft hin, Leute, die, obwohl sie ziemlich oft auftauchten, nie wirklich zu der Gruppe gehörten. Vielleicht war er einer von denen? Ich will versuchen, mich zu erinnern, aber nicht heute. Dazu brauche ich richtiges Regenwetter oder ein Gewitter – dann kann ich mich hervorragend erinnern …«
»Beim nächsten Gewitter rufe ich an und erinnere dich daran«, versprach ich beim Abschied.
Die Renovierung der neuen Wohnung ging sehr schleppend, man kann schon sagen dilettantisch, vor sich. Die Bekannten, die versprochen hatten, mir beim Streichen der Wände zu helfen, waren plötzlich spurlos verschwunden, und so blieb ich allein vor den Wänden auf den vielen Eimern mit mattweißer Farbe sitzen. Da ich aber nicht allein mit dem Streichen anfangen wollte, beschäftigte ich mich mit verschiedenen Kleinigkeiten, mit dem Abkratzen alter Farbfetzen von den Rohren im Badezimmer und ähnlichem Unsinn.
Da rief unerwartet der Bildhauer an.
»Weißt du, er ist gestern gestorben, dieser Lwowitsch; natürlich nur, wenn es überhaupt der ist, den ich meine. Mich hat ein alter Bekannter angerufen und mich gebeten, ihm bei der Beerdigung zu helfen – es gibt niemanden, der den Sarg trägt. Wenn du willst, fahren wir zusammen dahin!«
Der Vorschlag war so unerwartet wie sonderbar.
»Aber ich kenne ihn doch gar nicht …«, entfuhr es mir.
»Aber du hast ihn gesucht! Ich habe ihn schließlich auch nicht gekannt«, sagte der Bildhauer. »Aber noch schlimmer ist, daß ich mich auch nicht an diesen Alik erinnern kann, der mich angerufen hat. Er beteuert mir, daß wir uns aus dieser Bierstube kennen …«
Zu einem Rendezvous mit einem Toten zu fahren, an den ich einige nie gestellte Fragen hatte, schien mir ziemlich albern. Aber ich sagte zu.
Man beerdigte ihn auf dem Berkowzy-Friedhof. Er hatte kein eigenes Grab, sondern man legte ihn zu Verwandten, die sich dort schon für die Ewigkeit eingerichtet hatten. Das gelbe ausgedörrte Gesicht, das im offenen Sarg zu sehen war, war völlig ausdruckslos. Der Bildhauer flüsterte mir, als er sich über das Grab beugte, ins Ohr: »Das Gesicht sagt mir gar nichts.« Aber Alik, der die ganze Beerdigung organisiert hatte, erinnerte den Bildhauer an einige Episoden aus alten Zeiten. Und der Bildhauer nickte. Dann erwähnten sie in meiner Gegenwart ein paar Namen.
Ich faßte mir ein Herz und fragte den schon älteren Alik nach einem Menschen, der sich für das Werk von Taras Schewtschenko und für Fragen des Patriotismus interessiert hätte. Ich erklärte ihm, daß der ein Bekannter des verstorbenen Lwowitsch gewesen war.
Alik kratzte sich hinter dem Ohr. Er schwieg und zuckte mit den Schultern. »Später«, sagte er schließlich, »du kommst doch nachher zum Leichenschmaus?«
Ich nickte.
Wie sich sehr bald herausstellte, hatte der Bildhauer den Leichenschmaus bei sich im Atelier organisiert. Ungefähr sieben Menschen saßen an dem Teetisch. Der Bildhauer briet auf einem in der Ecke stehenden Elektroherd Rinderleber. Die anderen tranken, ohne auf das Essen zu warten, Wodka. Schweigend, ohne einen Toast, sogar ohne Seufzer.
Als die erste Portion der gebratenen Leber aufgetischt wurde, wurden alle ein wenig munterer. Der Bildhauer verteilte Gabeln auf dem Tisch, stellte Brot hin. Die Gesellschaft wurde etwas lebhafter, und einer brachte einen ersten Toast auf den Verstorbenen aus, ging aber gleich auf die Lebenden über und beendete seine etwas zusammenhanglose Rede mit dem Gedanken, daß früher alles besser gewesen sei.
»Ja, ja«, stimmte ein anderer zu.
Der Leichenschmaus verlief, wie es sich gehörte. Und als sie gingen, waren alle betrunken. Über den Verstorbenen wurde kein böses Wort gesagt. Nachdem man einmal seiner gedacht hatte, wurde eigentlich überhaupt nicht mehr von ihm gesprochen. Als sie vom Tisch aufstanden, um sich die Beine zu vertreten, entdeckte sich einer der Gäste als jungen Mann auf einem der alten Fotos.
»Oh!« rief er schmollend und verstimmt, als sei er beleidigt, daß seitdem dreißig Jahre vergangen waren.
Ich ging auf ihn zu und fragte ihn nach dem Menschen, der sich für Schewtschenko und Fragen des Patriotismus begeistert hatte.
»Ach«, sagte er. »Damals haben sich viele für solche Fragen begeistert.«
»Und hat jemand darüber geschrieben?«
»Na klar haben die darüber geschrieben, aber sicher! Und im Selbstverlag herausgegeben. Aber was für einen Sinn hatte das? Wer nicht gekämpft hat, hat auch nichts verloren.«
Er faselte noch alles mögliche, dann sagte er plötzlich: »Aber es gab auch Mystifikatoren, ich erinnere mich an einen von denen – der hieß Klim –, er tat immer so, als wenn er was Philosophisches schreiben würde. Alle wollten, daß er daraus vorliest, aber er zog nur das Manuskript heraus, blätterte es vor ihrer Nase durch und steckte es wieder in seine Aktentasche. Und zu Hause saß er in der Küche und hat Puschkin-Verse per Hand in Prosa umgeschrieben, na ja so, damit die nicht in Versen, sondern in kompletten Zeilen da stehen …«
»Und wo ist er jetzt?« fragte ich mit dem Hintergedanken, daß er durchaus der Autor der Kommentare zu Der Kobsar sein könnte.
»Klim? Weiß der Teufel. Ich habe ihn mal auf dem Univorplatz gesehen. Weißt du, da treffen sich Leute und spielen Schach um Geld. Das war vor etwa zwei Jahren. Aber danach habe ich ihn nicht mehr getroffen.«
Jede Gesellschaft schottet sich auf ihre Weise ab. Die Bienenzüchter versammeln sich und reden über nur ihnen verständliche Dinge. Und sie werden sicher lange darüber beraten, ob sie jemanden als Mitglied in ihren Verein aufnehmen oder nicht. Die Schachspieler sind da keine Ausnahme. Diejenigen, die in der Nähe der Universität spielen, kennen sich gegenseitig, mit den übrigen sind sie ganz förmlich per Sie. Und mit Fremden spielen sie nur um Geld.
Ich ging einige Male um die Versammlung von Schach- und Damespielern herum, die die Bänke des Platzes dicht bevölkerten. Niemand beachtete mich. Jede Gruppe verfolgte bewegungslos das Schachbrett in der Mitte. Keiner sah die Spieler an, als sei ihre Anwesenheit bloß eine ärgerliche Notwendigkeit. Es war nicht erkennbar, wer für wen war oder ob überhaupt jemand eine Partei ergriffen hatte. In geheimnisvollem Schweigen wurde einzig die Situation auf dem Brett beobachtet, sie war die Hauptsache.
Klim mußte jetzt etwas über sechzig Jahre alt sein, aber die meisten Mitglieder des Schachklubs entsprachen dieser Beschreibung. Da das Spiel schweigend ablief, war es nicht einmal möglich, zufällig zu hören, wie jemand einen anderen beim Namen nannte. Ich schloß mich einfach einer Gruppe an und wartete geduldig auf die Entwicklung der Dinge, wobei ich versuchte, mich sozusagen körperlich in das Vertrauen dieser Fanatiker des Schachbretts einzuschleichen.
Plötzlich überfiel mich ein merkwürdiger Zustand, eine Art unerklärliche Trance, und ich wurde anscheinend tatsächlich eine Zeitlang Teil dieses lebendigen Brettspiel-Organismus.
Nachdem ich bis Spielende etwa eine Stunde in diesem Zustand mit den übrigen von der Schachtrance erfaßten Figuren verbracht hatte, schüttelte ich abrupt meine Erstarrung ab. Als ich meine Wirbelsäule aufrichtete, spürte ich, daß dieser temporäre kollektive Zustand mich diesen Menschen nähergebracht hatte. Leider spielte ich schlecht Schach und hätte kaum die einfachsten Züge der zu Ende gegangenen Partie kommentieren können. Aber andere konnten das sehr gut, und ich war ein dankbarer Zuhörer.
Zwei alte Männer prügelten sich zu Anfang fast, als sie über einen angeblich falschen Zug des Läufers stritten. Meine Nichteinmischung in ihren Streit wirkte sich positiv aus. Sie nahmen sich meiner an und wiederholten die grundlegenden Züge der Partie aus dem Gedächtnis.
»Und wer hat da gespielt?« fragte ich schließlich, als ich spürte, daß ich bereits das Recht zu einer Frage hatte.
»Filja und Mischa …«, antwortete einer von ihnen, der größere und krummere. »Die sind neu, die sind noch nicht lange hier.«
Ich fragte, ob Klim noch spielte.
»Na Klim!« Der andere alte Mann machte eine Odessaer Geste, das heißt, er hob mit beiden Händen eine riesige unsichtbare Wassermelone hoch. »Klim spielt kaum noch, aber wenn der spielt, kommen solche Dummheiten« – und er wies mit dem Kopf auf die verlassene Bank – »wie die da nicht vor.«
Nach fünf Minuten wußte ich, daß Klim in einer Gemeinschaftswohnung auf der Schota-Rustaweli-Straße wohnte und daß er manchmal freitags auf den Platz kam, daß er wegen seiner kranken Leber nicht mehr trank und aufgehört hatte, Aquariumfische zu züchten, weshalb auch niemand wußte, wovon er jetzt lebte.
Ich ging in dem Gefühl weg, ein Mitglied dieses Klubs geworden zu sein. Hätte nur noch gefehlt, daß ich anständig Schach oder Dame spielen gelernt hätte. Aber das lag mir nicht. Einmal war es schade um die Zeit, und außerdem mochte ich überhaupt keine langsamen Spiele.
2
Am Freitag morgen blätterte ich wieder in Der Kobsar und ergötzte mich an den Bleistiftkommentaren.
»Die Weichheit der Heimaterde unterscheidet sich nicht von der Weichheit fremder Erde, weil sie wie jede beliebige Erde der Urgrund der Menschheit ist und sich nicht zwischen den einzelnen Nationen gemäß der Qualität dieser Nationen aufteilen kann.«
Mich erstaunte nicht mal die Klarheit der Formulierungen, sondern der Gegenstand der Überlegungen, als wenn der Mensch, der das geschrieben hatte, sich nur deshalb von den Gefühlen und den Reimen des Taras Schewtschenko entfernt hatte, um über seinen eigenen Schmerz zu berichten, um über sein eigenes Leid klagen zu können. Aber warum hatte ihn das in den relativ glücklichen sechziger Jahren so beschäftigt? Ein Nationalist war er nicht, sonst wären diese Kommentare auf ukrainisch geschrieben. Russischer Chauvinismus war es auch nicht, da neben den eigenen Gedanken Hochachtung, Mitleid und vielleicht sogar Liebe zu Schewtschenko mitschwang. Einen Moment lang dachte ich, daß seine Überlegungen Lenins Thesen ähnelten – insbesondere die These über das Verschwinden von Nationen und Nationalitäten in der Zukunft. Aber im selben Augenblick stellte ich mir vor, was Lenin wohl dazu sagen würde, daß die geliebte Frau die Heimat sei? Nein, ich glaube nicht, daß der Große Glatzkopf mit dieser These einverstanden gewesen wäre, wie schön auch immer die Krupskaja in ihrer Jugend gewesen sein mochte.
Aber die Zeit verging, ich legte das Buch beiseite, ohne es vergessen zu können, und machte mich auf die weitere Suche nach dem Autor dieser Kommentare. Ich ging zum Vorplatz der Universität. Meine Intuition flüsterte mir zu, daß Klim heute dort sein würde. Aber es war nicht nur Intuition. Draußen schien die Sonne, die Vögel zwitscherten. Es wäre dumm gewesen, bei so einem Wetter zu Haus zu sitzen – besonders wenn das Zuhause ein Zimmer in einer Gemeinschaftswohnung auf der stark befahrenen Schota-Rustaweli-Straße war.
Ich fand ihn tatsächlich auf dem Platz. Zuerst suchte ich die beiden Alten, die mich schon kannten. Sie zeigten mit dem Finger auf eine Bank, wo die unbefristete Schachmeisterschaft des Univorplatzes ausgetragen wurde. Herauszufinden, wer von den Spielern Klim war, bereitete keine Schwierigkeit, weil der andere Schachpartner höchstens vierzig war.
Nachdem ich das Ende der Partie abgewartet hatte, die nicht weniger als zwölf Mitglieder des ›Klubs‹ verfolgten, ging ich zu Klim.
Dem hatte der hart errungene Sieg ganz offensichtlich ein Gefühl von Genugtuung verschafft, und nachdem alle Fans schon zu Bänken mit anderen Spielern gezogen waren, sogar ohne ihm zu gratulieren, feierte der Sieger für sich allein. Seine eingefallenen Augen in dem knochigen Gesicht leuchteten feurig und jugendlich.
»Dem haben Sie es aber gezeigt«, sagte ich zu Klim anstelle einer Begrüßung.
»Ja, nicht schlecht«, stimmte er zu. »Witek hat auch was drauf, aber ich bin eine uneinnehmbare Festung für ihn.«
Da ich Angst hatte, mich bei einem tieferen Fachgespräch über Schach zu blamieren, wechselte ich schnell das Thema und kam gleich zur Sache.
»Erinnern Sie sich an Lwowitsch?« fragte ich den immer noch glückselig lächelnden Klim.
Sein Lächeln erstarb.
»Natürlich erinnere ich mich …«, sagte er und sah mich mit leicht zugekniffenen Augen an. »Und was sind Sie, ein Verwandter von ihm?«
»Nein.«
»Aber Sie sehen ihm etwas ähnlich …«
Das Gespräch rollte auf einen Abhang zu, und ich mußte es entweder beenden oder schnell unter Kontrolle bringen.
»Ich glaube, ich bin zufällig an eins Ihrer Manuskripte geraten …«, sagte ich.
»Ja?« wunderte sich der Alte. »An welches denn?«
»Nun ja, es ist weniger ein Manuskript als eher Kommentare zu Der Kobsar von Schewtschenko … übrigens sehr interessante.«
Der Alte griff sich an sein schlechtrasiertes Kinn und sah mich erneut durchdringend an.
»Kommentare?« wiederholte er laut. »Das sind nicht meine … Ich habe andere Kommentare geschrieben … Und Der Kobsar ist Ihnen auch zufällig in die Hände geraten?«
»Ja, die Kommentare stehen am Rand der Seiten …«
»Und was ist das für ein Buch? Ein gewöhnliches? Was für eine Ausgabe?« fragte der Alte vorsichtig.
»Kein ganz gewöhnliches … Eine Art von Matrjoschka, die in einen Band von Tolstoj steckt.«
Der Alte nickte und lächelte wieder, während er auf den Asphalt unter seinen Füßen blickte.
»So also bist du aufgetaucht!« sagte er leise.
Dann hob er wieder den Kopf und sah mich nicht mehr durchdringend, sondern eher ruhig und entspannt an.
»Wenn Sie Geld für ein Fläschchen trockenen Weißen haben, dann lade ich Sie zu mir nach Hause ein.«
Geld hatte ich, so daß wir nach einem kurzen Marsch auf der Route Univorplatz–Delikatessengeschäft–Schota-Rustaweli-Straße in einem geräumigen Zimmer mit einer hohen von Stuck und Zickzackrissen geprägten Decke landeten. Im Zimmer standen zwei Schränke, ein Bücher- und ein Kleiderschrank, beide alt, aus den gediegenen fünfziger Jahren. Ein kleiner Tisch, der eher in eine winzige Neubauküche gepaßt hätte, sah in diesem Zimmer wie eine Zwergenmißgeburt aus.
Der Alte reichte mir ein Messer.
»Machen Sie das Fläschchen auf!« sagte er und ging auf den Flur.
Er kam mit zwei Gläsern zurück.
»Als anständiger Mensch werden Sie mich wohl zu einem Gegenbesuch einladen?« fragte er plötzlich mit einem Lächeln.
»Selbstverständlich«, versprach ich.
»Dann zeige ich Ihnen was!« Der Alte ging zum Bücherschrank und öffnete die Tür. »Da.« Er zog aus dem unteren Fach einen ziemlich dicken Band heraus.
Ich nahm das Buch in die Hand – es war die Studienausgabe von Der Kobsar. Die angenehme Rauheit des Einbandes, Kaliko-Baumwollgewebe, war eine Freude für die Hände; es gibt Stoffe, deren Berührung ein fast physisches Vergnügen bereitet.
»Schlagen Sie es auf. Schlagen Sie es auf!« sagte der Alte.
Ich öffnete das Buch. Vor mir lag wieder ein Matrjoschkabuch. In dem Inneren von Der Kobsar steckte ein zweites, etwas bescheideneres Buch, aber auch eine Ausgabe dieser Jahre: Dostojewskijs Der Idiot.
Ich blickte Klim fragend an.
Er lächelte, aber er lächelte nicht mir zu, sondern eher seiner Vergangenheit, die durch mein Erscheinen jäh aufgerissen worden war.
Eine traurige Vermutung zwang mich plötzlich, das Dostojewskij-Buch aus seinem gemütlichen geheimen Lagerplatz herauszuziehen und durchzublättern. Und die Vermutung erwies sich als richtig. Auf den Rändern von Der Idiot tauchten Bleistiftkommentare auf, nur daß die Handschrift hier größer war.
»Haben Sie das geschrieben?« fragte ich Klim.
»Ja, ich«, sagte er und setzte sich an den kleinen rechteckigen Tisch.
»Und Der Kobsar?« Ich streckte meine Hand nach der Flasche aus und goß den Riesling in die Gläser, während ich gleichzeitig versuchte, meine Gedanken in eine gewisse logische Ordnung zu bringen.
»Der Kobsar? Nein. Den hat jemand anderer kommentiert …« Der Alte streckte seine Hand aus und nahm das Glas.
»Lwowitsch?« fragte ich, um ihn zu etwas aktiveren Erinnerungen zu provozieren.
»Wieso Lwowitsch? Lwowitsch hatte sich Die toten Seelen ausgesucht.«
»Hören Sie«, begann ich mit dem Gefühl, daß mein Kopf in einen dicken Nebel versank und überhaupt nichts mehr von den vergangenen und jetzigen Geschehnissen begriff. »Hatten Sie so etwas wie einen Literaturzirkel?«
»Keinen Literaturzirkel, sondern einen Philosophiezirkel«, berichtigte mich der Alte. »Und nicht ›hatten‹, sondern haben … Wenigstens solange ich lebe. Ich bin mein eigener Zirkel.«
»Aber wer hat die Kommentare zu Der Kobsar geschrieben?« fragte ich.
»Slawa Gerschowitsch … Friede seiner Seele …«
»Wieso, ist er gestorben?«
»Sie haben ihn ermordet … Stromschlag.« Der Alte ließ traurig den Kopf hängen. »Er war ein guter Junge! Ein heller Kopf! Noch vor den Kaschpirowskijs und den Hypnotiseuren kannte er alle diese Kunststücke … Deshalb haben sie ihn auch umgebracht …«
Nebel begann wieder meinen Kopf zu umhüllen.
»Was hat Der Kobsar mit Hypnotiseuren zu tun?« fragte ich in völligem Unverständnis.
»Na Sie machen mir Spaß!« Der Alte sah mich an wie einen Idioten. »Was ist denn Ihrer Meinung nach hohe Literatur? Einfach Buchstaben und Metaphern? Es ist auch ein Mittel, den geistigen Strom weiterzugeben, wie eine Stromleitung! Wollte man sich mit einer düsteren tiefgreifenden Energie aufladen, schlug man ein Buch von Dostojewskij auf. Wollte man sich erheitern und in einem helleren Zustand verweilen, dann nahm man ein Prosawerk von Turgenjew in die Hand … Diese Idioten à la Kaschpirowskij haben alles in die Heilung von Hämorrhoiden per Fernseher pervertiert. Aber glauben Sie mir, der Tag des Heiligen Georgij geht vorbei, und die Literatur wird bleiben, als einziger Leiter aller Bioenergie.«
»Nun, und was für eine Energie gibt Der Kobsar weiter?« fragte ich.
»Das hätte man lieber Gerschowitsch fragen sollen … Aber ich sage Ihnen, da geht es um mehr als Der Kobsar und als um Schewtschenko selbst … Das ist so eine Sache … Nun, und deswegen haben sie ihn umgebracht …«
»Weswegen?«
Der Alte trank seinen Wein aus. Wieder strich er sich über das stachelige, schlaffe Kinn.
»Weil Gerschowitsch herausgefunden hat, wo etwas sehr Wertvolles für das ukrainische Volk versteckt ist … Das verstehen Sie nicht einfach so! Denken Sie nicht, daß ich verkalkt bin! Wenn Gerschowitsch jetzt lebendig hier neben uns stünde, würde er Ihnen in fünf Minuten alles erklären!«
»Sind denn Manuskripte von Gerschowitsch erhalten?« fragte ich hoffnungsvoll.
»Manuskripte? Es gab ein Manuskript, und in dem lag ein Brief …« Der Alte nickte im Takt zu seinen eigenen Worten. »Lwowitsch und ich haben ihm das Manuskript in den Sarg unter seinen Kopf gelegt …«
»Ohne es zu lesen?«
»Selbstverständlich. Er hatte uns darum gebeten. Er hat uns viel erzählt, alles, worüber er nachdachte, hat er erzählt. Auch den Brief haben wir gesehen. Im Brief wurde das auch erwähnt, dieses Vergrabene … Ein Brief von Schewtschenko selber, aus Mangyschlak. Vielleicht haben sie ihn wegen dieses Briefes umgebracht?! Auf jeden Fall ist in der Nacht, und das war 1967, als sie ihn umgebracht haben, jemand in seine Wohnung eingebrochen. Eine Kristallvase haben sie gestohlen, haben alles auf den Kopf gestellt … aber die Akte nicht gefunden! Er hatte sie bei Grischa, dem Mann seiner Schwester, versteckt. Danach haben wir sie von Grischa geholt und ihm ins Grab unter den Kopf gelegt.«
»Bei Grigorij Markowitsch?«
»Ja!« Plötzlich strahlten Klims Augen. »Also sind Sie ein Verwandter von Grischa Markowitsch?«
»Ich bin überhaupt kein Verwandter von irgendwem! Es interessiert mich einfach so.«
»Nun, für ›einfaches Interesse‹, junger Mann, kann man teuer bezahlen!«
Den letzten Satz des Alten überhörte ich.
Der Nebel in meinen Gedanken hatte sich ein wenig gelichtet. Der gerade entdeckte Zusammenhang zwischen dem seligen Gerschowitsch und dem nach Israel ausgewanderten Grigorij Markowitsch stachelte meine Neugier an.
»Soll ich Ihnen dieses Buch verkaufen?« fragte der Alte plötzlich mit einer merkwürdigen Intonation. »Das Aquarium habe ich schon verkauft, es ist hier sehr wenig übriggeblieben …«, und er sah sich nach allen Seiten um.
»Das Buch?« fragte ich nach. »Wieso, wollen Sie ausreisen?«
»Nein, ich gehe weg … Nicht sofort natürlich … ein bißchen später. Erinnern Sie sich, wie Tolstoj gestorben ist?«
Ich nickte.
»Ich liebe ihn …«, sagte der Alte. »Ich habe ihn viele Male gelesen, ich wollte von ihm leben lernen, aber daraus ist nichts geworden … So lerne ich wenigstens von ihm zu sterben. Einen bemerkenswerten Tod hatte er … Nicht wahr? Ich gehe von hier nach Konotop. So, daß ich nicht ankomme … Verstehen Sie mich?«
Ich trank ein zweites Glas Wein, aber der Wein half mir nicht, diese Fragmente der Vergangenheit an ihre Stelle zu rücken und zusammenzukleben wie eine antike Amphore. Nein, natürlich verstand ich, daß alle diese Leute, die der alte Klim als eigensinniger Abgesandter jetzt vorstellte, übergeschnappte alte Leute über sechzig waren, die den Sinn des Lebens in der Literatur und in der Philosophie gesucht hatten. Mir, dem Vertreter einer anderen Generation, fiel es ziemlich schwer, mit ihm zu reden. Wir gebrauchten zwar dieselben Worte, aber er maß diesen Worten offenkundig einen anderen Sinn zu als ich. Ich glaube, daß wir nur den Wein gleich wahrnahmen. Wein aus einer Flasche konnte in zwei Gläsern nicht verschieden sein.
Der Alte holte aus dem Bücherschrank eine Karte von der Ukraine hervor und zeigte mir eine dicke Bleistiftlinie, die entlang der Eisenbahn verlief. »Hier werde ich langgehen«, sagte er und fuhr mit dem Finger über eine Linie. Jedesmal wenn er an einen Bahnhof kam, blieb sein Finger stehen.
Ab einem bestimmten Moment spürte ich, daß der Alte mich überforderte. Ich schrieb mir seine Telefonnummer auf und versprach, ihn in den nächsten Tagen in meine neue Wohnung zu einem Glas Wein einzuladen.
»Nun, wollen Sie das Buch kaufen?« fragte er zum Schluß noch einmal, als ich schon an der Tür stand.
»Hundert Dollar!« verkündete er stolz und mit einer Miene, als hätte er absichtlich einen unannehmbaren Preis genannt, und zwar nicht, weil er es zu teuer verkaufen wollte, sondern um den unschätzbaren Wert des Gegenstandes zu beweisen.
»So viel habe ich nicht bei mir«, sagte ich und hörte als Antwort so etwas wie einen Seufzer der Erleichterung.
3
Am nächsten Tag kam der alte Klim zu mir zu Besuch. Wir tranken zwei Flaschen trockenen Wein, und solange wir tranken, kam das Gespräch nicht ins Stocken. Was ich von dem Alten zu hören bekam, regte meine leicht beschwipste Phantasie an. Der selige Slawa Gerschowitsch hatte offenbar ein Geheimnis entdeckt – entweder ein philosophisches oder ein eher materielles. Weshalb er dann durch eine selbstgebastelte elektrische Konstruktion zu Tode kam. Wenn man alles recht bedachte, wurde dieses Geheimnis, das ihm einen so ungewöhnlichen Tod beschert hatte, völlig oder teilweise in dem Brief von Schewtschenko aus Mangyschlak erklärt, wobei nicht klar war, wie dieser Brief in seine Hände geraten und danach mit seinem Manuskript und dem Körper auf dem Friedhof von Puschtscha-Wodiza begraben worden war.
Mein erster Gedanke war in gewissem Sinn gottungefällig. Ich wollte nämlich das Manuskript und den Brief aus dem Grab holen, um mich von der Existenz des Geheimnisses zu überzeugen, an das der alte Klim so hoch und heilig glaubte. In der Kriminalistik findet sich ziemlich häufig das Wort Exhumierung. Aber es betrifft immer die Ausgrabung eines Körpers. Mein Gedanke, ein Manuskript und einen Brief zu exhumieren, war viel weniger gräßlich und schmutzig, obwohl ich mir in dem Wissen, daß das Manuskript und der Brief unter dem Kopf des toten Gerschowitsch lagen, schwer vorstellen konnte, wie ich diesen Kopf anheben sollte, ohne dabei auf den Kern des Todes zu stoßen, auf das Geheimnis, das man nur als den Tod an sich bezeichnen kann.
Am Montag, dem für Friedhofsbesuche unbeliebtesten Tag, fuhr ich mit der Straßenbahn nach Puschtscha-Wodiza. Wie ich es mir ausgemalt hatte, war der Friedhof menschenleer. Ein leichter Wind ließ die langen hohen Kiefern zwischen den Gräbern schwanken. Das Knarren dieses Waldes vermittelte einen merkwürdigen Eindruck – als ob ich in einer vor langem verlassenen, verwilderten Stadt wanderte, inmitten von unsichtbaren, unter der Erde versteckten Ruinen.
Zunächst spazierte ich einfach so herum und las die sauber eingemeißelten Inschriften auf den Grabmälern. Dann mußte ich in die schmalen Pfade zwischen den Grabstellen eindringen. Der Friedhof lag auf einem Hügel, und seine natürliche Grenze war auf der einen Seite ein steiler Abhang, der zu einem Waldsee führte. Methodisch kämmte ich die Namen auf den Grabmälern durch, bis ich fast am äußersten Rand vor der Böschung den bekannten schlampig auf ein schmiedeeisernes Kreuz geschriebenen Namen fand. Die Ärmlichkeit des Grabes verwunderte mich zuerst, aber als ich dann auf der Bank einer benachbarten Grabstätte saß, einen Kuckuck hörte, der weiß Gott wem den Lebensrest abzumessen versuchte, kam ich zu der Schlußfolgerung, daß einem Menschen, der sich sein ganzes Leben lang mit Philosophie beschäftigt hatte, der Marmor irgendwelcher Grabstätten gleichgültig sein mußte. Vielleicht hätte er nicht einmal ein Kreuz haben wollen. Aber das Kreuz hatten wahrscheinlich seine Freunde aufgestellt. Wenn es Verwandte gewesen wären, hätten sie sicherlich mehr Pomp veranstaltet. So ein Grab wird dann immer gleich zum Prestigeobjekt, da will man sich nicht lumpen lassen …
In diese Gedanken versunken saß ich etwa fünfzehn Minuten da und betrachtete das Grab schon mit völlig anderen Augen – ich betrachtete es wie einen Safe, den man irgendwie öffnen mußte. Mir war klar, daß es für jede Arbeit Spezialisten gibt. Was für Spezialisten ich hier brauchte, war mir auch klar – natürlich keine Totengräber. Die sind erstens teuer, und zweitens war, was ich vorhatte, wohl kaum legal. Deshalb mußte ich zwei nicht völlig versoffene Obdachlose finden und zwei Spaten. Und graben durfte man nur nachts, worin auch ein gewisser mystischer Charme lag. Der bevorstehenden Sache sah ich furchtlos und ohne Bedenken entgegen, angetrieben von der Leidenschaft, das Geheimnis zu entdecken. Ich war zu jedem Risiko bereit und spürte gleichzeitig, daß es überhaupt kein Risiko gab. Wenn schon die Lebendigen heutzutage allen gleichgültig waren, wer würde sich dann um eine Leiche kümmern, deren Kopf wir einige Minuten lang anheben würden, um ihn auf etwas Weicheres zu betten – auf etwas Weicheres als ein Manuskript.
4
In der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag war ich wieder auf dem Friedhof, nur diesmal in Begleitung von zwei angsteinflößenden Kumpeln. Die beiden Obdachlosen hatte ich auf dem Bahnhof gefunden und jedem von ihnen nach Beendigung der Arbeit zwei Flaschen Wodka versprochen. Jetzt liefen sie mit ihren Spaten um das Grab herum, wohl um sich einzustimmen, oder vielleicht warteten sie auch auf eine besondere Eingebung.
»Was willste da finden?« wollte der eine von ihnen auskundschaften, ein untersetzter Bursche mit einem bläulichen Gesicht. Er hieß Schora und lächelte dauernd angespannt und unangenehm.
»Das habe ich doch schon gesagt, unter seinem Kopf liegen Papiere …«
Schora brummte etwas und machte einen ersten Spatenstich. Da nahm auch sein Kollege, ein kleiner hagerer Mann um die vierzig, der Senja hieß, an der anderen Seite den Spatenstiel in die Hand.
Sie schaufelten die Erde auf den Pfad zwischen Gerschowitschs Grab und dem Nachbargrab, das etwas gepflegter war. Der Erdhaufen wuchs an. Der nachtblaue Himmel hing tief über dem Boden, es war warm, und irgendwelche Vögel gaben von Zeit zu Zeit abrupte, dumpfe Schreie von sich.
Außer einigen Rauchpausen arbeiteten die beiden schweigsamen Totengräber träge und ohne jede Begeisterung. Schließlich stieß Schoras Spaten auf Holz, da wurden sie wieder munter. Sie legten den Grabdeckel frei.
»Sollen wir ihn hochholen, oder wühlen wir so?« fragte Schora mich.
»Wenn wir den Sarg nicht hochholen, können wir dann trotzdem den Deckel abnehmen?« wollte ich wissen, weil ich aus irgendeinem Grund dachte, daß Obdachlose sich beim Öffnen von Gräbern besser auskannten.
Schora sah konzentriert nach unten in das ausgehobene Grab.
»Man kann ihn abreißen und raufholen. Selbst wenn was abbricht, ihm wird das ja scheißegal sein.«
Schora und Senja polkten mit den Spaten den Deckel des nicht tief eingegrabenen Sargs auf und hievten ihn nach oben. Das Mondlicht konnte trotz Verstärkung durch Myriaden von Sternen nicht das Innere des offenen Sarges beleuchten, der in dem ausgehobenen Grab lag. Irgend etwas Dunkles, Kompaktes wurde sichtbar. Ich beugte mich hinunter und erwartete, wenigstens die Umrisse eines Körpers zu sehen, aber umsonst. Nur ein süßlicher Zimtgeruch drang von unten herauf.
»Na und nun?« fragte Schora plötzlich. »Kletterst du selber runter?«
Ich begriff, daß er mit mir redete. Ich drehte mich um.
»Wieso ich? Wir haben doch alles genau verabredet«, sagte ich entrüstet.
Plötzlich fiel etwas Schweres auf meinen Hinterkopf. Ich verlor das Gleichgewicht, stolperte, fiel auf die warme nächtliche Erde und hörte nur noch das leise, vorsichtige Flüstern von sich entfernenden fremden Stimmen.
Als ich wieder zu mir kam, wurde es schon hell. Die ersten frühen Vögel riefen mit ihren lauten Gesängen gleichsam zum Appell. Meine Hand berührte wie von selbst den Nacken und ertastete geronnenes Blut. Langsam und vorsichtig stand ich auf. Ich sah mich um, ein Spaten steckte in der Erde, der andere lag daneben, offenbar hatten sie mich mit dem niedergeschlagen. Alle Taschen waren umgestülpt, und mein ganzes Geld – Gott sei Dank nicht sehr viel – war natürlich futsch. In dem ausgehobenen Grab lag im offenen Sarg der Leichnam, den sie auf die Seite gedreht hatten. Neben seinem völlig schwarzen Kopf lag eine Tüte, aus der ein Aktendeckel herausragte.
Bei dem Gedanken an meine nächtlichen Helfershelfer konnte ich mir ein Lächeln nicht verkneifen. Ich stellte mir vor, daß sie einen richtigen Schatz erwartet hatten – Gold oder sonstwas – und dann nach uraltem Muster den überflüssigen Dritten loswerden wollten, um den Schatz unter sich zu teilen. Sie hatten sich solche Mühe gegeben und bekamen als Schatz nur das Geld, das ich ihnen auch so versprochen hatte.
Als ich endgültig zu mir gekommen war, stieg ich ins Grab hinunter. Der auf der Seite liegende Gerschowitsch schien sich fast absichtlich so hingelegt zu haben, daß ich Platz hatte, mit meinem Fuß dort aufzutreten. Ich nahm die Tüte mit den Papieren an mich und legte sie oben ab. Dann kletterte ich selbst wieder hoch. Den Sargdeckel stellte ich mit dem schmaleren Teil auf seinen Fuß und ließ ihn wieder hinunter. Der Deckel blieb an einer Wurzel hängen und hing über dem Kopfende fest. Mit einem der Spaten schlug ich auf den Deckel ein und zwang ihn, wieder seine richtige Stellung einzunehmen. Dann schaufelte ich eine halbe Stunde das Grab zu, ebnete es ein und stellte das schmiedeeiserne Kreuz wieder an seine Stelle.
Als ich alles erledigt hatte und die Tüte mit den Papieren in der Hand hatte, fiel mir wieder der seltsame süßliche Geruch auf – es kam mir so vor, als sei meine ganze Kleidung von diesem Geruch durchtränkt. Auch die Tüte verströmte Zimtgeruch.
Die Sonne wurde wärmer. Ich sah noch einmal auf das Kreuz. Ich mußte gehen, hier konnte bald jemand auftauchen. Wie spät es wohl sein mochte?
Ich krempelte automatisch die Ärmel hoch und guckte auf die Uhr. Es war kurz nach fünf. ›Na so was, die Uhr haben sie nicht geklaut?‹ bedachte ich meine Helfer mit traurigem Spott. ›Oder hat das Leben ihnen nur beigebracht, Taschen auszurauben?‹
Ich lief zur Endhaltestelle der Straßenbahn. Irgendwo weit entfernt, auf dem Waldstück zwischen Kurenewka und Puschtscha-Wodiza fuhr schon klingelnd wie ein Wecker eine erste Straßenbahn, um mich nach Hause zu bringen und mich von dem geronnenen Blut auf dem Nacken und dem süßlichen Geruch zu befreien, der anscheinend in meine sämtlichen Kleider eingedrungen war. Ein Geruch, der eine beruhigende Wirkung hatte und ein zartes, fast leichtsinniges Lächeln verursachte, völlig unabhängig von dem, was ich gerade dachte.
5
Als ich nach Hause kam, zeigte die Küchenuhr fünf vor sieben. Vor dem Spiegel im Flur bemerkte ich, daß meine gesamte Kleidung einer gründlichen Säuberung bedurfte und ich selber einem Obdachlosen ähnelte, der auf einem Lehmhaufen genächtigt hatte. Ich zog schnell meinen Morgenmantel an und weichte die Kleidung in einer großen Schüssel ein. Dann beschloß ich, mich auch selber einzuweichen, natürlich in der Badewanne. Ich ließ heißes Wasser ein und tauchte so tief unter, daß das Wasser überschwappte. Die Hitze des Wassers drang bis in die Knochen, und im Schlüsselbein schmerzte es angenehm wie in der Sauna. Ganz langsam kam mein Körper wieder zu sich, der Kopf auch, der sich allmählich von dem leisen Brummen befreite, das an den Spatenschlag erinnerte. Ich begann, meine Gedanken wieder in die Reihe zu bringen und alles so ruhig wie möglich ohne jede Eile zu überdenken.
Die nächtliche Episode mit den Obdachlosen und dem Ausgraben des Sarges war schon fast vergessen. Jetzt wartete auf mich, wenn ich gewaschen und frisch wäre, auf dem Küchentisch die Akte, derentwegen ich mich in dieses riskante Abenteuer gestürzt hatte. Aber der heutigen gefährlichen und dynamischen Zeit schien mir jedes Abenteuer angemessen.
Als ich mich mit einem großen Frotteehandtuch abgetrocknet hatte, stellte ich zu meiner Verwunderung fest, daß der süßliche Geruch, den ich zuerst auf dem Friedhof von Puschtscha-Wodiza bemerkt hatte, immer noch da war. Ich beugte mich zu der auf dem Fußboden stehenden Schüssel mit meinen schmutzigen Sachen hinunter. Doch die Schüssel roch nach Waschpulver. Der Zimtgeruch mußte von irgendwo weiter oben, auf der Höhe meiner Schultern und meines Gesichts, ausströmen.
›Na gut‹, dachte ich. ›Das ist ja nicht der schlechteste Geruch, und es gibt keinen Geruch, der nicht irgendwann verfliegt.‹
Am Küchentisch schlug ich die Akte auf und fand eine Unmenge von Seiten, mit der mir schon bekannten Handschrift dicht beschrieben. Aber ich war in so einem Zustand, daß ich mich in diese winzigen handschriftlichen Zeilen nicht vertiefen konnte. Ich wollte nur den Brief finden, von dem Klim erzählt hatte. So nahm ich das ganze Bündel in die Hand und blätterte es wie einen Fächer durch. Tatsächlich fiel ein Umschlag aus dem Bündel heraus und landete auf dem Boden. Aus dem Umschlag zog ich ein wie aus einem Heft gerissenes, verwischtes Blatt mit kaum sichtbaren, von der Zeit lila gewordenen Tintenzeilen heraus.
Ich las es schnell durch, und noch bevor ich den Inhalt ganz verstanden hatte, spürte ich, daß ich tatsächlich auf etwas Interessantes und Rätselhaftes gestoßen war. Das Blatt war mit ›Rapport‹ betitelt, aber im Grunde war es eine ganz gewöhnliche Denunziation. Ein gewisser Rittmeister Palejew berichtete einem Oberst Antipow, daß der »Soldat Schewtschenko während seiner Ausgänge auf der Petrowsker Festung oft auf dem Sand hinter der Wanderdüne säße und trotz des Verbotes irgend etwas schriebe und gestern in diesen Sand etwas eingegraben habe, etwa sechs Meter entfernt von dem alten Brunnen zur Meeresseite hin.«
Draußen ergoß sich schon helles Sonnenlicht über die Welt. Der Morgen wurde heiß und verwischte die Grenze zwischen Frühling und Sommer. Ich trank Tee, legte die im Januar 1851 geschriebene Denunziation beiseite und dachte: ›Was kann Taras Schewtschenko da wohl in diesem fernen Mangyschlak vergraben haben?‹ Geld hatte er keins, und selbst wenn er welches gehabt hätte – warum hätte er es im Sand vergraben sollen? Nein, er war nicht so ein Mensch, der seine Kopeken vor anderen versteckt hätte. Ich erinnerte mich an meine Schulzeit und die Geschichte von dem Tagebuch, in das der Soldat Schewtschenko seine Verse geschrieben habe und das er angeblich immer im Stiefel bei sich getragen hatte. Vielleicht hat er dieses Buch vergraben, so weit weg wie möglich von den Augen der Denunzianten vom Typ dieses Rittmeisters Palejew?
›Man müßte es dort im Sand suchen‹, dachte ich und stellte mir gleich vor, was für ein freudiges Geschrei sich in der Ukraine erheben würde. Vielleicht würden sie mir dafür ein paar hunderttausend Dollar zahlen oder eine staatliche Lebensversorgung garantieren? Schließlich war es eine Reliquie?!
Und dennoch hatte der unbekannte im Sand von Mangyschlak vergrabene Gegenstand nur einen ziemlich bedingten Wert, vielleicht nur einen musealen. Einige Gelehrte würden Doktorarbeiten darüber schreiben – und das wäre dann das ganze Ergebnis.
Ich zog die Mappe mit den vom seligen Gerschowitsch vollgeschriebenen Blättern heraus und hatte plötzlich ein Blatt mit einer deutlich topographischen Zeichnung vor mir. Ich suchte die mit einem Stift gezeichnete Karte ab, jedoch erlosch mein Interesse augenblicklich, als ich unter der Zeichnung Gerschowitschs eigenhändige Unterschrift entdeckte: »Abgezeichnet von Material der Schewtschenko-Expedition auf der Ausstellung des Archivs im Literarischen Museum.«
Ich seufzte und sah aus dem Fenster. Die Sonnenbrandung schwappte mit einer gelben Welle auf meinen Küchentisch. Ich gähnte und rieb mir die zufallenden Augen. Die Munterkeit nach dem warmen Bad hatte nicht lange angehalten. Mein Körper brauchte Schlaf.
6
Gegen Abend setzte ich mich ausgeruht wieder an den Küchentisch. Zu Anfang stillte ich meinen Hunger mit einem Stückchen Mortadella, dann nahm ich Gerschowitschs Manuskript wieder in die Hand und betrachtete nun etwas aufmerksamer die einzelnen Zeilen.
Und wieder schlug mir dieser süßliche Zimtgeruch entgegen. Ich hob ein Blatt hoch und roch daran. Dann roch ich automatisch an meiner Hand, in der ich das Blatt hielt, und bemerkte, daß meine Hand diesen Geruch noch stärker ausströmte als das Blatt selbst.
Ohne die Ursache für diesen Geruch herausfinden zu wollen, wandte ich meine ganze Aufmerksamkeit den handgeschriebenen Zeilen Gerschowitschs zu.
Die ersten Seiten schienen mir eine Wiederholung oder ein zweiter Aufguß derselben Gedanken zu sein, die er schon mit Bleistift an den Rand von Der Kobsar geschrieben hatte, aber dann, auf der siebenten Seite, gingen seine Überlegungen in eine andere Richtung.
»Der nationale Reichtum wird im Innern eines auserwählten Menschen geboren und verdammt ihn zu einem Wanderleben und zu einer qualvollen Suche, wohin er seinen Reichtum bringen soll. Denn als Auserwählter kann er zwar von seiner Nation geliebt und geachtet, aber auch nicht verstanden oder falsch verstanden werden, was nur seine innere Trauer verstärkt. Die Qualen, die mit der Unmöglichkeit zusammenhängen, einen Ort für den ihm vom Himmel geschenkten Reichtum zu finden, können ihn sowohl zur Geistesverwirrung treiben als auch in seltsame und tragische Verirrungen des Schicksals geraten lassen, das ihn in weit von der Heimat (der Frau) entfernte Länder führen kann.«
Dann folgte die Beschreibung der Reisewege, auf denen Grigorij Skorowoda in der Ukraine unterwegs gewesen war. Aber schon auf der nächsten Seite kehrte Gerschowitsch zu Schewtschenkos tragischem Schicksal zurück. Und hier bemerkte ich gleich die Ähnlichkeit mit den Überlegungen, die ich schon in der Denunziation des Rittmeisters Palejew gelesen hatte.
»Der Platz (bei dem Brunnen), den T.G. Schewtschenko ausgesucht hat, um den unbekannten Gegenstand zu vergraben, zeugt von seinem heißen Wunsch, entweder selbst dorthin zurückzukehren, um das Versteckte auszugraben, oder daß ein anderer nach seiner Beschreibung leicht in der Lage wäre, diesen Ort zu finden. Dieser Ort müßte also noch existieren, da er mindestens zwei Kilometer vom Meer entfernt liegt. Was den im Sand versteckten Gegenstand selbst betrifft, so handelte es sich wahrscheinlich um ein Manuskript oder ein Notizbuch – beides müßte sich bei dem heißen Klima im Sand lange gehalten haben. Es ist gut möglich, daß er in diesem Notizbuch Gedanken und Gefühle ausgedrückt hat, die seine Zeitgenossen noch nicht verstehen konnten. Sie sind wohl kaum in Versform aufgeschrieben (die damals zugänglichere Form).«
Während ich diese Seite las, erinnerte ich mich an eine Mitteilung über eine Auktion in New York, auf der unlängst das Manuskript von Einsteins Relativitätstheorie versteigert wurde – sie wollten vier Millionen Dollar dafür, aber der Käufer bot nur drei.
›Wieviel würden sie wohl für ein unbekanntes Manuskript von Schewtschenko auf einer Auktion in Kanada bieten?‹ Da leben die reichsten und sentimentalsten Ukrainer, und einer von denen könnte ja unter Tränen der Rührung ein paar Millionen Dollar, zwar nur kanadische, aber immerhin auch Dollar, hinblättern.
Ich lächelte über das Spiel meiner Phantasie, die sich eine rührende Szene in dem Leben der kanadischen Diaspora ausmalte. Dann aber fiel mir ein, daß sich seit den sowjetischen Zeiten im Bewußtsein der Generationen das Verständnis von Reichtum und Schätzen verändert hatte. Obwohl alle als Heranwachsende Stevenson gelesen hatten, hatten sie aber gleichzeitig auch die Werke der sowjetischen Klassiker gelesen, in denen die jungen Schatzsucher plötzlich in einer vergrabenen Kiste statt Gold und Brillanten einen Parteiausweis oder einen vaterländischen Orden fanden. Und dann stellten sie sich pioniermäßig still und ordentlich auf und salutierten vor dem für eine gerechte Sache Gefallenen. Sicher kamen die Überlegungen des seligen Gerschowitsch daher. Daher auch der Hang, nicht materielle Werte zu suchen, sondern symbolische Schätze, geistige Kostbarkeiten. Und was wäre, wenn dort im Sand bis heute ein einfaches Goldstück oder gar zwei lägen? Und was, wenn er sie dort versteckt hatte, damit sie ihm nicht irgendein betrunkener Offizier wegnahm, der, durch das Leben am Rande des Imperiums völlig verroht, zum Verlust jeglicher Moral gebracht worden war. Was dann? Dann wären diese niedergeschriebenen Überlegungen von Gerschowitsch einfach die Mittel eines Versteckspiels mit der Realität, in der er lebte. So eines Spiels, wie das Spiel mit den geheimen Bücher-Matrjoschkas, das sich entweder er oder Lwowitsch oder Klim ausgedacht hatten.
›Na schön‹, dachte ich. ›Das ist ja alles interessant, aber wie sagte mein ehemaliger Nachbar, ein Alkoholiker: ‘Man kann das Leben genießen, aber man darf nicht vergessen, die leeren Pfandflaschen zurückzugeben.’‹ Das hieß für mich, daß ich dieses Manuskript in Ruhe zu Ende lesen würde und vielleicht sogar eine geistige Bereicherung erführe, aber ich mußte auch das Geld für eine Mortadella verdienen …
Nachdem ich das Manuskript in die Mappe zurückgesteckt und noch einmal an meiner nach Zimt duftenden Hand gerochen hatte, zog ich mich an. Jede dritte Nacht war in gewissem Sinne eine martialische – ich bewachte ein Lager mit finnischer Kindernahrung, das dem Wohltätigkeitsfonds ›Korsar‹ gehörte.
7
Nach dem Schichtwechsel mit Wanja, einem Sportstudenten, setzte ich mich an den alten Kanzleitisch, auf dem das ganze Instrumentarium eines Nachtwächters stand – ein elektrischer Teekessel, ein kleiner tragbarer Fernseher, ein Gummiknüppel, ein Telefon und eine kleine Gaspistole. Die Mittel zur Verteidigung und zum Schutz waren offensichtlich minimal und erweckten nicht den Wunsch, die anvertrauten materiellen Werte bis zum letzten Blutstropfen zu verteidigen. Aber sie zahlten hier anständig, und auch die Arbeit schien ziemlich ungefährlich. Die Kindernahrung würde, zumal das Verfallsdatum auf den Pappkartons schon abgelaufen war, kaum Interesse bei heutigen Dieben hervorrufen.
An den Kisten und am Tisch vorbei lief träge eine dicke Ratte. Ich verfolgte sie mit spöttischem Blick, schaltete den Fernseher ein und ging mit dem Teekessel zu dem drei Schritte entfernten Waschbecken, begann also mit dem Ritual des Arbeitsantritts. Nach dem Tee und ein paar Filmen stellte ich gewöhnlich vier Stühle nebeneinander an die Wand und schlief friedlich bis zum Morgen, bis zu dem Weckklopfen an der Tür, wonach der Vorsitzende von ›Korsar‹ Gritschenko mit einer alten Diplomatentasche, die schon lange ihre diplomatischen Formen verloren hatte, durch die geöffnete Tür kam. Gritschenko war ungefähr fünfzig Jahre alt, und äußerlich sah er wie ein klassischer Buchhalter aus – er war dickbäuchig, rundgesichtig, kahlköpfig. Lächeln konnte er anscheinend nicht, aber sein Gesichtsausdruck, immer etwas betreten, hätte jeden beliebigen Betrachter zum Lächeln gebracht.
Wenn er den großen Raum, vollgestellt mit Pappkisten, auf die quadratische blaue Schilder mit einem glücklichen Kleinkind geklebt waren, mit einem Blick überflogen hatte, nickte er mir gewöhnlich zu. Das hieß, daß ich gehen konnte und erst nach drei Tagen und zwei Nächten zur nächsten Schicht wiederkommen mußte.
In dieser Nacht war es mir nicht vergönnt, mich am Arbeitsplatz auszuschlafen. Zunächst klingelte mitten in einem Kriegsfilm das Telefon. Ich nahm den Hörer ab, aber ich hörte nur ein heiseres Schnaufen. Einem Scherz sah das nicht ähnlich, deshalb wiederholte ich geduldig
»Hallo!«.
»Schließ die Tür ab!« hörte ich Gritschenkos ungewöhnlich heisere Stimme. »Verbarrikadiere sie …«
»Aber sie ist ja zu!« sagte ich und sah mich nach der schweren Eisentür um, die mit zwei Riegeln verschlossen war.
Gritschenko legte den Hörer auf, ohne sich zu verabschieden. Ich legte auch auf und guckte weiter auf den kleinen schwarzweißen Bildschirm, auf dem gerade die Bösen einen Guten mit einer Maschinenpistole durchlöcherten, auf dessen weißem Hemd schwarze Blutflecken erschienen.
Als ich den Film zu Ende gesehen hatte, erinnerte ich mich an den Anruf und sah mich aufmerksam im Lager um. Fenster gab es hier keine, so daß die Tür in jedem Fall die einzige Stelle war, durch die ungebetene Gäste eindringen konnten. Aber diese Tür war eine ›Lagertür‹, noch aus sowjetischen Zeiten, als auf jeden Einwohner nicht weniger als eine Tonne schweren Eisens kam. Um sie von außen aufzubrechen, hätte man mit einem Panzer dagegen fahren müssen. Der Decke entlang lief das blecherne Gedärm des Belüftungssystems, das in der Wand verschwand. Das Rohr war sehr dick, und manchmal liefen Ratten darüber und benutzten es wie einen Übergang zu einem anderen Raum. Es reichte eine Ratte, um die Luft durch ihr dumpfes Poltern vibrieren zu lassen. Die Pappkisten, die in einigen Reihen aufeinanderstanden, stützten dieses Rohr von unten, so daß es die Ratten nicht schwer hatten, in die Öffnungen der Belüftungsanlage zu gelangen.
Aber in diesem Moment war es ruhig im Lager, und die einzige Ratte, die ich heute gesehen hatte, war fast wie auf Zehenspitzen – unhörbar und träge – über den Boden gelaufen.
Ich wechselte mit der Fernbedienung das Programm und geriet in die Mitte eines Films über Karatekämpfer. Ich starrte auf den Fernseher und beschloß, daß mir für heute anderthalb Filme vor dem Schlaf genügten.
Wieder klingelte das Telefon.
»Hallo?« ertönte eine weibliche Stimme. »Kann ich Viktor Iwanowitsch sprechen?«
»Sie haben sich verwählt«, antwortete ich ruhig, ohne meinen Blick von der Prügelei im Fernseher zu wenden.
»Na wen kann ich dann sprechen?« fragte die Frau fröhlich.
»Was soll das, ist das ein Scherz?«
»Du hör mal!« ertönte scharf und unerwartet eine männliche Stimme aus dem Hörer. »Mir ist es schnurzpiepe, wie du heißt … Wenn du weiterleben willst, mach die Tür auf und verdufte blitzschnell. Klar?«
Instinktiv warf ich den Hörer auf die Gabel und machte sofort den Fernseher aus. Die eintretende Stille half mir, meine Gedanken zu sammeln. Ich begriff, daß Gritschenkos Anruf nicht grundlos gewesen war. Irgend etwas war da außerhalb des Lagers vorgefallen. Aber bis jetzt war ich drinnen, da hatte ich nichts zu befürchten.
Trotzdem hatte ich mich erschrocken. Es kam mir selber merkwürdig vor, daß man mich in der letzten Nacht auf dem Friedhof mit einem Spaten niedergeschlagen hatte, aber was hatte ich denn getan? Ich hatte ein Grab geöffnet, wenn auch mit fremder Hilfe. Da hatte ich keine Angst gehabt. Aber das hier war eine völlig andere Realität. Ich saß wie in einer Festung, und trotzdem fürchtete ich mich.
Ich zuckte mit den Schultern. Ich horchte wieder – alles war still.
Nach fünf Minuten klingelte erneut das Telefon. Ich nahm den Hörer ab und legte gleich wieder auf.
Es klingelte sofort wieder.
Diesmal nahm ich ab.
»Kolja, bist du es?« krächzte Gritschenko.
»Ja natürlich … was ist los?«
»Mach niemandem auf! Das sind Dreckskerle … Ich komme morgen früh vorbei! Auf Wiedersehen.«
Und ich hörte nur noch, daß es wieder im Hörer tutete.
Diesmal legte ich den Hörer auf den Tisch. Ich war der Meinung, daß ich für diese Nacht genügend Anrufe erhalten hatte.
Als ich auf den zusammengestellten Stühlen ein wenig vor mich hin döste, klopfte jemand an der Tür. Hartnäckig und laut.
Ich lag, ohne mich zu bewegen, angespannt auf dem Rücken, lag da und wartete darauf, daß das Klopfen aufhörte. Das trat nach zwanzig Minuten ein. Aber trotzdem konnte ich bis zum Morgen nicht einschlafen.
Kurz nach acht kochte ich mir, ganz zerschlagen nach der schlaflosen Nacht und den nervlichen Erschütterungen, einen Tee und machte den Fernseher an. Alles, was ich tat, machte ich ganz besonders vorsichtig und leise, wobei ich gleichzeitig auf jedes Geräusch lauschte, das von der Straße hereindrang. Es drangen tatsächlich einige Geräusche in das Lager für Kindernahrung. Ich hörte vorbeifahrende Autos. Dann kam eins, das ganz in der Nähe stehenblieb – anscheinend war hinter der Wand noch ein Lager, und was sich in den oberen Stockwerken des Gebäudes befand, wußte ich sowieso nicht.
Ich trank den Tee und wartete, daß es neun würde, die Zeit, um die gewöhnlich Gritschenko kam. Bald war es neun. Im Fernsehen lief eine Zahnpastareklame, und ich stellte den Apparat aus, als könne das die Zeit beschleunigen.
Aber Gritschenko kam nicht. Ich sah alle Papiere durch, die unter einer durchsichtigen Plexiglashülle auf dem Kanzleitisch lagen – Visitenkarten, ein Frachtbrief. Hier war auch eine Liste mit den Telefonnummern der Nachtwächter, meine eingeschlossen, und darunter stand Gritschenkos. Ich rief ihn an, aber am anderen Ende der Leitung nahm niemand ab.
Um zehn fühlte ich mich ungemütlich. Ich ging einige Male im Lager auf und ab und betrachtete diese Pappkisten, dachte an das nächtliche Wirrwarr, von dem ich jetzt Kopfschmerzen hatte. Wieso sollten sie hier einbrechen? Doch nicht wegen der Kindernahrung mit dem abgelaufenen Verfallsdatum?
Ich ging zu einem kleineren Stapel und setzte die obere Kiste runter auf den Boden. Trotz einiger Skrupel riß ich das Klebeband auf, mit dem die Oberseite versiegelt war, und sah hinein. In der Kiste lagen Blechbüchsen mit blauen Aufklebern, auf denen ein ausländisches Kleinkind sorglos und ein bißchen dümmlich lächelte. Ich nahm eine von ihnen in die Hand und schüttelte sie. Es klang nach Mehl. Die Dose war nicht ganz voll, aber daran war auch nichts besonders Erstaunliches.
Mit der Dose in der Hand kehrte ich an den Tisch zurück und steckte den Teekessel wieder in den Stecker. Noch einmal betrachtete ich den Aufkleber auf der Dose und begriff, daß da drin wohl Milchpulver für Kinder war. Ich hatte Lust auf Kaffee mit Milch. Nescafé hatte ich, und nun war auch noch Trockenmilch aufgetaucht, so daß mein Wunsch absolut erfüllbar war.
Ich öffnete die Dose, schüttete das gelbliche Pulver in meine Tasse, dann fügte ich ein Löffelchen Nescafépulver hinzu und goß kochendes Wasser darüber.
Nachdem ich ein paar Schlucke getrunken hatte, fühlte ich mich wohler, die Müdigkeit verschwand, und meine Stimmung besserte sich. So einen Milchkaffee hatte ich noch nie probiert, und gleich tauchte ein verbrecherischer Gedanke auf: Ob ich nicht ein paar von diesen Kindermilchdosen mit nach Hause nehmen sollte? Vielleicht waren sie für die Kinder schon verdorben, aber für den Kaffee waren sie hervorragend.
Nach dieser Tasse Kaffee legte ich mich wieder auf die in einer Reihe aufgestellten Stühle, ohne weiter an die nächtlichen Ereignisse oder an Gritschenko zu denken, der bis jetzt nicht gekommen war. Ich hatte ein Gefühl, als ob ich flöge, und schon nach ein paar Minuten erhob ich mich in einen unbekannten offenen und grenzenlosen Raum voller verschiedener Farben und bizarrer Formen. Meteoriten flogen an mir vorüber, mal gelbe, mal rote, Kometen wendeten jäh und ließen krumme Schweife hinter sich verglühen. Mein Körper ordnete sich mühelos meinen Gedanken unter – ich mußte nur denken, daß ich nach rechts wollte, um fliegenden Gegenständen auszuweichen, da hatte sich der Körper schon nach rechts gewandt. Zum ersten Mal spürte ich so deutlich eine Einheit von Seele und Körper, und auch der Körper selbst war schwerelos und unbelastet, er war leicht und leicht lenkbar. Ich brauchte mich nicht anzustrengen, mußte die Muskeln nicht arbeiten lassen. Ich flog und sah mich nicht mal nach der unten gebliebenen Erde um. Sie war sicher schon zwischen den Hunderten von anderen kleinen Himmelskörpern verlorengegangen.
8
Mein Flug dauerte nicht weniger als zwei Tage. Und als ich ›landete‹ und mich in der ursprünglichen Lage, auf den in einer Reihe aufgestellten Stühlen auf dem Rücken liegend, wiederfand, war mein erster Wunsch aufzuschreien. Ein entsetzliches Hungergefühl nagte an mir, außerdem verging mein Körper fast vor Schmerz, vor einer Starrheit, die von den Knochen und Gelenken direkt in die Sinne, in Emotionen übertragen wurde. Ich hob mit Mühe meine Hand zu den Augen und sah auf die Uhr – es war halb zwei. Und die erste Frage, die in meinem Hirn auftauchte, war: Was für ein halb zwei? Tag oder Nacht? Dazu hätte man aufstehen, die Tür aufmachen und auf die Straße sehen müssen: War es hell, dann war es Tag. Diese so einfache Lösung ließ sich aber nur mit Mühe verwirklichen. Mir gelang es, mich auf einen der Stühle zu setzen, aber das bewirkte einen solchen Schmerzanfall in der Wirbelsäule, daß ich mich gleich wieder in die frühere Lage versetzte. Nach etwa fünf Minuten wiederholte ich den Versuch, und mit einer unerhörten Willensanstrengung hielt ich mich, ungeachtet des Schmerzes, in einer sitzenden Position. Ich begann langsam die Hände zu bewegen, winzige Übungen zu vollbringen, indem ich die Muskeln anspannte und die Gelenke bewegte. Auf die Beine kam ich erst nach anderthalb Stunden. Ich stand, spürte ein leichtes Schwindelgefühl, machte erste Schritte zum Kanzleitisch. Schließlich saß ich am Tisch, sah dumpf auf das Telefon, dessen Hörer abgenommen war und neben dem Teekessel lag. Der Anblick des Telefons rief mir die schlaflose Nacht in Erinnerung und die beruhigende Tasse Kaffee mit ›Milch‹. Mein Blick wanderte wie von selbst zu der Dose mit der ›Kindernahrung‹.
›Das ist wohl eher zum Fliegen als zum Kaffeetrinken, geschweige denn Kindernahrung …‹
Nachdem ich etwas gesessen hatte, ging ich zur Eisentür und horchte – draußen herrschte absolute Stille. Das hieß, es war Nacht … Was sollte ich jetzt tun? Bis zum Morgen dasitzen? Oder jetzt gleich hinausschleichen? Ja, aber warum war in diesen Tagen niemand hierhergekommen? Gritschenko hatte doch einen Schlüssel! Obwohl er es selbst mit einem Schlüssel nicht geschafft hätte, hier hereinzukommen, weil die Tür ja von innen mit zwei Riegeln verschlossen war. Nur ich konnte sie öffnen, aber in gewissem Sinne war ich gar nicht hiergewesen. Vielleicht war er auch gekommen, hatte geklopft, hatte gerufen …
Allmählich begann ich nervös zu werden. Meine Anwesenheit in diesem Lager ähnelte einem bei lebendigem Leibe Begrabenen. Natürlich hatte ich die Möglichkeit, die Gruft zu verlassen, ich mußte nur einige Erfolgsrezepte beherrschen, um diesen Ort unbemerkt zu verlassen und alles zu vergessen, wie den mißlungenen Flug ins All. Obwohl – der Flug hatte irgendwie stattgefunden. Ich konnte mich an die winzigsten Kleinigkeiten erinnern, und wenn ich ein Maler wäre, könnte ich einige von den Meteoriten und Kometen, die ich in dem offenen Raum getroffen hatte, in den schönsten Farben malen.
An der Wand über dem Waschbecken hing ein kleiner Spiegel, und ich ging dahin, um meine Augen zu befeuchten und mich anzusehen. Mein Gesicht erinnerte mich an die Filmaufnahmen aus Auschwitz. Vielleicht war das etwas übertrieben, aber ich hatte noch nie auf meinem Gesicht so riesige graublaue Halbkreise unter den Augen und eine so spitze Nase gesehen.
Nachdem ich mich mit kaltem Wasser gewaschen hatte, ging ich zum Tisch zurück. Widerwillig aß ich die mitgebrachten Wurstbrote. Das Brot war bereits hart, und die Wurst war so wenig frisch, wie ich in diesem Moment hungrig war.
Ich stellte den Teekessel an, sah auf den Nescafé und dann automatisch auf das ›Milchpulver‹.
›Mit dem Kaffee warten wir lieber ein bißchen. Noch so ein Flug, und ich sterbe vor physischer Erschöpfung.‹
Also kochte ich mir Tee. Ich guckte auf die Uhr – fünf vor vier Uhr. Stille. Selbst die Ratten verrieten mit nichts ihre Anwesenheit.
Als ich den Tee ausgetrunken hatte, legte ich drei Dosen des ›Milchpulvers‹ in meine Tasche. Keine Ahnung, warum ich sie mitnahm. Sicher wollte ich irgendwann noch einmal in den Kosmos fliegen. Dann ging ich zur Tür, horchte wieder, und als ich nichts hörte, schob ich die schweren eisernen Riegel beiseite. Nach einer kurzen Pause öffnete ich die Tür, durch den entstehenden Spalt drang die frische Nachtluft herein – angenehm kalt wie ein Gin Tonic mit Eis.
»Na los!« machte ich mir selbst Mut, öffnete die Tür und trat über die Schwelle. Dann zog ich die Tür ganz leise zu und drehte den Schlüssel im Schlüsselloch um. Das schwere Riegelschloß knirschte leise. Ich steckte den