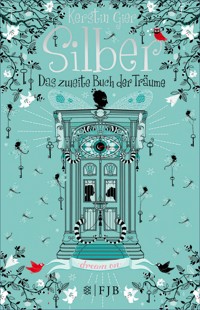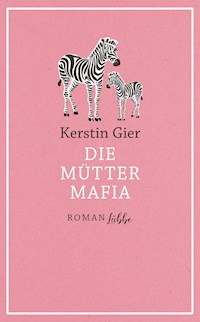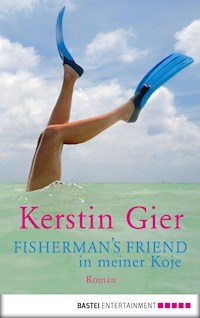9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Habe ich es bisher in meinem Leben überhaupt zu was gebracht?!", fragt sich Felicitas, als sie die magische 30 überschreitet. Den Traummann hat sie noch nicht gefunden, so viel steht fest. Um ehrlich zu sein, nicht mal einen richtigen Mann. Sie hat nur Till, der wohl ewig ein Versager bleiben wird. Warum, zum Teufel, kann sich ihre Freundin damit brüsten, schon ein Paradeexemplar von Ehemann eingefangen zu haben? Als sie Erik begegnet scheint sich das Blatt zu wenden. Nur dumm, dass gerade eine Laufmasche ihre Strümpfe ruiniert hat. Doch immerhin hat Erik ihre Beine gesehen - und das lässt Felicitas hoffen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
KERSTIN GIER
Die Laufmasche
17 gute Gelegenheiten,den Traummann zu verpassen
ROMAN
Lübbe Digital
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG erschienenen Werkes
Lübbe Digital in der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG
Titel auch als Hörbuch bei Lübbe Audio erhältlich
Originalausgabe
Copyright © 1998 by Bastei Lübbe GmbH & Co. KG, Köln
Umschlaggestaltung: Ulf Hennig
Titelillustration: © Robin Bartholick/Corbis
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-0064-9
Sie finden uns im Internet unter
www.luebbe.de
Bitte beachten Sie auch: www.lesejury.de
Handlung und Personenin diesem Romansind von vorne bis hintenerstunken und erlogen.
Für Frank und Heidiund ihre blühende Fantasie
Die erste Gelegenheit
DEN NACHMITTAG, BEVOR ich meinen Traummann das erste Mal haarscharf verpasste, verbrachte ich in der Badewanne. Wahrscheinlich wäre ich ein paar Stunden darin sitzen geblieben, um zu beobachten, wie meine Haut immer schrumpeliger wurde, wenn es nicht an der Tür geklingelt hätte. Es war meine Freundin Nina.
»Du bist wenigstens schon geduscht!«, sagte sie, als ich im Bademantel öffnete. »Ich bin wieder mal zu nichts gekommen. Ich konnte Kristin erst vor einer halben Stunde zu ihrer Großmutter bringen, weil die Freitagnachmittag zur Kosmetikerin geht, und zwar immer von drei bis vier, geschehe, was da will. So was von unflexibel!«
Ich rieb mir müde die Augen. »Waren wir verabredet?«
»Hast du geschlafen?« Nina ging vor mir her in die Küche. »Ich weiß nicht mehr, wann ich mich das letzte Mal nachmittags hinlegen konnte.«
Ich lehnte mich an den Türrahmen. »Das Klassentreffen, stimmt’s? Das hatte ich völlig vergessen.«
Nina schüttelte ärgerlich den Kopf. »Felicitas! Wir haben doch noch Montag miteinander telefoniert! Du bist hoffentlich nicht anderweitig verabredet?«
Ich antwortete nicht.
»Was für eine Frage«, murmelte Nina. »Natürlich nicht. Hast du was zu trinken?«
»Mineralwasser«, sagte ich. »Oder Apfelsaft.«
»Ich habe nicht vor, nüchtern zu dem Klassentreffen zu gehen, du vielleicht?«
»Wie wär’s mit Sekt?«
»Schon besser. Ich hatte einen grauenhaften Tag.«
Nina ließ sich in einen meiner Korbsessel fallen, streckte ihre Beine aus und musterte mich kritisch.
»Was ziehst du an?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Weiß nicht. Ist doch auch egal!«
»Egal?«, wiederholte Nina und sah mich vorwurfsvoll an. »Wenn ich das sagen würde, wäre es etwas anderes! Ich bin ja schließlich schon mit einem Mann gesegnet. Aber du als Single kannst es dir wirklich nicht leisten, dich gehen zu lassen.«
»Ich bin kein Single«, sagte ich matt.
»Aber so gut wie«, beharrte Nina. »Till ist kein richtiger Mann, und ihr habt keine richtige Beziehung!«
Ich fragte nicht, was Nina sich unter einer richtigen Beziehung und einem richtigen Mann vorstellte, weil ich ihre Antwort längst kannte. Ein richtiger Mann studierte nicht achtzehn Semester lang, ohne nicht wenigstens in einem Fach das Vordiplom zu schaffen. Für Nina gab es nur eine einzige Sorte richtiger Männer, und das waren die, die eine Frau spätestens drei Wochen nach dem Kennenlernen von der Bürde befreiten, ihr eigenes Geld verdienen zu müssen. Richtige Männer konnten ein Einkommen aufweisen, das für zwei reichte, inklusive repräsentativer Doppelhaushälfte, gehobenem Mittelklassewagen, parkplatzfreundlichem Zweitwagen und einer Fernreise pro Jahr. Ninas Ansichten waren nicht mal exzentrisch, meine Mutter zum Beispiel dachte ganz genauso. Sie hielt Till genauso wenig für geeignet, ihr Schwiegersohn zu werden, wie er selber.
›Wenn du deine besten Jahre an einen Versager verschwendest, wirst du niemals die Gelegenheit haben, einen richtigen Mann kennen zu lernen‹, pflegte sie zu sagen.
Nina sagte jetzt etwas ganz Ähnliches. »Mach dich schön! Du weißt niemals, ob dir nicht doch irgendwann ein Traummann über den Weg laufen wird. In den ersten drei Sekunden einer Begegnung macht man sich ein unrevidierbares Bild von seinem Gegenüber, haben die Psychologen herausgefunden. Mit fettigen Haaren und einem ausgeleierten T-Shirt hast du dann keine Chance!«
»Meine Haare sind nass, nicht fettig«, sagte ich beleidigt. »Und ich hatte nicht vor, ein ausgeleiertes T-Shirt anzuziehen.«
»Gut«, sagte Nina. »Denn denk nur mal an heute Abend: fünfzig Männer am Beginn ihrer Karriere, im besten Alter, um eine Familie zu gründen. Die Gelegenheit bekommst du so schnell nicht wieder. Zieh dieses scharfe rote Kleid an, das seit Monaten ungetragen in deinem Schrank herumhängt.«
»Woher weißt du das?«
»Dass du es noch nie getragen hast?« Nina grinste tückisch. »Weil ich dich kenne.«
»Ich hatte eben bisher noch nie die richtige Gelegenheit«, sagte ich lahm. Das Kleid hatte meine Wohnung tatsächlich niemals verlassen. Dabei war es mit raffinierten Schlitzen ausgestattet und war sündhaft teuer gewesen. Zusammen mit Seidenstrümpfen, Pumps und meinem geerbten Rubincollier war ich darin schlicht overdressed zu jedem, aber auch jedem Anlass, der mich seit dem Kauf des Kleides aus der Wohnung getrieben hatte.
»Passende Anlässe muss man sich oftmals selber schaffen«, sagte Nina, als habe sie meine Gedanken gelesen. »Heute Abend ist die Gelegenheit für dich und das Kleid! Trink noch ein Glas Sekt!«
Der Sekt und vor allem die Tatsache, dass Nina selber sich in einen schwarzen Cocktailfummel mit Strassborte warf, dazu Netzstrümpfe und eine dreireihige Perlenkette auspackte, brachten mich tatsächlich dazu, das geschlitzte Kleid anzuziehen. Ich fand sogar, dass ich darin gegen Nina geradezu underdressed wirkte, zumal sie auch mit dem Make-up nicht sparsam umging und ihre Haare eine halbe Stunde lang mit meinem Lockenstab quälte.
Zum Schluss, nach einer Überdosis »Obsession« aus dem Zerstäuber, warf sie ihre Mähne in den Nacken und lächelte mich im Spiegel an: »Sehe ich jetzt noch so aus, als würde ich einen Arzt mit Gewichtsproblemen, eine Tochter im Kindergartenalter und eine Doppelhaushälfte in der Vorstadt haben?«
Ich war ganz fasziniert von meinem eigenen Spiegelbild. Die Investition in das Kleid hatte sich vielleicht doch gelohnt. »Ja«, sagte ich zerstreut. »Du siehst ganz toll aus.«
Nina stieß mich ärgerlich in die Rippen. »Das war die falsche Antwort. Wenn ich nicht so aussehe, als würde ich einen Oberarzt, ein Landhaus mit Swimmingpool sowie ein BMW-Cabrio mein Eigen nennen und als wäre ich noch viel zu jung für eine fünfjährige Tochter, hat sich die Mühe nicht gelohnt.«
»So wirst du dann aussehen, wenn wir zwanzig Jahre Abitur feiern«, sagte ich. »Fürs Zehnjährige reichen die Doppelhaushälfte und der Arztgatte allemal.«
»Du machst aber auch was her«, sagte sie befriedigt. »Du weißt schon, die Sache mit den ersten drei Sekunden! Heute hast du wirklich gute Karten.«
Wir mussten – wegen des Sekts – ein Taxi rufen, das uns zu dem Klassentreffen chauffierte. Nina hatte bedeutend mehr Sekt getrunken als ich.
»It’s raining, men, halleluja«, sang sie gutgelaunt. »Ich bin gespannt, was aus den Jüngelchen von damals geworden ist, du nicht?«
»Nein«, sagte ich ehrlich. Nina betrachtete mich kopfschüttelnd von der Seite. »Du wirst nächstes Jahr schon dreißig«, sagte sie. »Und jeder ist seines Glückes Schmied. Womit ich sagen will, dass die Gelegenheiten immer seltener werden und du heute eine dieser seltenen Gelegenheiten hast!«
Ich antwortete nicht. Seien wir doch mal ehrlich: Es gibt weitaus mehr Gelegenheiten, den Traummann zu verpassen, als ihm zu begegnen. Letzteres liegt rein statistisch betrachtet gefährlich nahe bei Null. Diese Erkenntnis ist es meiner Ansicht nach, die ein Mädchen zur Frau macht. Wir arrangieren uns mit diesem Sachverhalt, so gut wir können. Dabei gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten: Man konnte es machen wie Nina und schon in frühen Jahren den Begriff »Traummann« neu definieren – Hauptsache, er bringt genug Geld nach Hause und die Bereitschaft, es mit einer Frau zu teilen –, oder man machte es wie ich und hoffte hartnäckig darauf, irgendwann doch noch einmal dem Traummann vor die Füße zu laufen. Wenn man also davon ausgeht, dass ich, rein rechnerisch betrachtet, seit zwölf Jahren auf diese Gelegenheit wartete – wenn man mal von den zwei Wochen absieht, in denen ich Till für meinen Traummann hielt –, ist es um so verwunderlicher, dass ich die Gelegenheit nicht nutzte. Aber so ist das mit guten Gelegenheiten: Nichts und niemand bereitet uns jemals darauf vor.
Das Klassentreffen sollte sich in einem Ausflugslokal in der Vorstadt ereignen, nicht weit von unserer alten Schule entfernt. Haus »Waidmannsheil«, mit trüben Butzenscheiben, jägergrün gekachelten Außenwänden, Kegelbahn und einem eigens für Reisebusse dimensionierten Parkplatz.
»Wer hat denn das ausgesucht?«, fragte ich leicht schockiert.
Nina faltete die Einladung auseinander. »Gaby von der Dries«, las sie vor.
Ich hatte keine Ahnung, wer das war. »Sie muss früher anders geheißen haben.« Es hatte außerdem sieben Gabys in unserer Stufe gegeben.
»Immerhin hat diese einen Adeligen geheiratet«, sagte ich neidisch und bezahlte den Taxifahrer.
»Pah«, schnaufte Nina. »Von der Dries! Das hört sich nicht nach einem Adeligen an, sondern nach einem Holländer mit eigener Klärgrube.«
Ich musste lachen. Wir waren beide nicht so ganz sicher auf den Beinen, Nina wegen des Sekts, ich wegen der hohen Absätze. Arm in Arm stolperten wir in den Eingang. Dort lauerte eine lächelnde, blendend blonde Frau in einem Lodenkostüm Marke Waidmannsdank. Ich erkannte sie sofort an ihren großen, braunen Augen, obwohl sie früher dunkelblond gewesen und – Ehrenwort! – Senkbeil mit Nachnamen geheißen hatte.
»Nein«, rief sie froh. »Felicitas! Toll, dass du gekommen bist.«
Nina und ich starrten sie an. Gaby Senkbeil. Das zweitblödeste Mädchen der Stufe.
›What would you do if you get a Million Dollar?‹ hatte unser Englischlehrer gefragt, als wir den »Großen Gatsby« durchnahmen.
Und wer hatte sich gemeldet und mit engelhaftem Lächeln geantwortet ›I would give it all to the poor‹? Richtig, Gaby Kuhauge. Jetzt hatte sie einen Holländer mit eigener Fäkalverwertung geheiratet und dazu passend Frau-Antje-blondes Haar.
»Und das ist doch nicht etwa Nina, Nina Herberger?«, schrie sie.
»Ich heiße jetzt Hempel«, sagte Nina so hoheitsvoll, wie es bei diesem Namen gerade noch möglich war.
»So heißt unser Hausarzt auch«, sagte Gaby prompt. »In der Ahornstraße.«
»Das ist mein Mann«, sagte Nina und schob mich weiter, bevor Gaby ihr Entzücken kundtun konnte. »Jetzt wird sie allen schon an der Türe erzählen, dass ich einen Arzt geheiratet habe«, raunte sie zufrieden.
Auch im Inneren hielt die Gaststätte, was sie von außen versprach. Dunkle Holzpaneele an den Wänden, dekoriert mit rustikalen Wagenrädern, Plastikmohnblumen und Weizenhalmen in Zinnkrügen mit eingravierten Jagdszenen. An der Theke, vor sich eine Stange Kölsch, standen ein paar Männer und fachsimpelten über den neuen Tormann vom FC Weidenpesch. Sie unterbrachen sich nur kurz, als wir reinkamen, um anerkennend durch die Zähne zu pfeifen.
»Ihr müsst nach hinten durchgehen«, rief Gaby von der Tür aus. »In den Festsaal.«
Gerade wollten wir ihren Worten Folge leisten, als ein weiterer Mann den düsteren Raum betrat. Als sein Blick flüchtig den meinen kreuzte, war es, als würde in mir ein verborgener Schalter umgelegt. Es fühlte sich an, als fließe das Blut plötzlich rückwärts durch meine Adern, und das, bevor ich überhaupt registriert hatte, dass der Neuankömmling wirklich brennend gut aussah. Die beeindruckende Körpergröße, die breiten Schultern, die dunklen Locken, die edle Hakennase, alles das bemerkte ich erst viel später, als mein Blut zwar wieder in die richtige Richtung floss, nur schneller als sonst. Es war eindeutig etwas anderes als das Äußere, was mich an diesem Mann magisch anzog, etwas, das ich nicht in Worte fassen konnte.
»Eins, zwei, drei«, hörte ich Nina neben mir im Flüsterton die Sekunden zählen. Der Blick des Mannes streifte uns noch einmal flüchtig. Dabei sah ich, dass er dunkelgrüne Augen hatte, von dichten schwarzen Wimpern umrahmt. Ich seufzte unwillkürlich. Der Grünäugige lehnte sich über die Theke und sprach mit dem Wirt.
Nina stieß mich unsanft in die Rippen. »Mach den Mund zu, das ist unvorteilhaft. Obwohl ich dich ja verstehe. Sieht wirklich nicht übel aus. War der bei uns in der Klasse?«
»Nie im Leben«, sagte ich. Ich hatte Recht. Der Mann hatte sich hierher verlaufen. Sein Auto sei verreckt, erklärte er dem Wirt, ob er von hier den Pannendienst anrufen dürfe? Beim Klang seiner Stimme, einer reizvollen Mischung aus Tom Waits und der Synchronstimme von Tom Hanks, wurden meine Knie ganz weich. Ich musste ihn einfach weiter anstarren.
»Los, sag was!«, forderte mich Nina auf und stieß mich wieder in die Rippen. Ich wünschte sie mindestens auf den Mond.
Der Mann telefonierte kurz mit dem Pannendienst. Danach lehnte er sich lässig an die Theke und bestellte beim Wirt ein Kölsch.
»Mach schon!« Nina trat mir auf den Fuß, auf meinen gerade von einer Nagelbettentzündung genesenden großen Zeh. Der Schmerz durchzuckte mich wie ein tückischer Blitzschlag, nur von unten nach oben. Aber was sollte ich sagen? Was, um Himmels willen, konnte ich sagen? Was musste ich sagen, damit er mich sympathisch fand?
»Steh nicht da wie eine Salzsäule! Sag irgendwas«, zischte Nina am Ende ihrer Geduld. »Sag wenigstens ›hallo‹, sonst ist er wieder weg!«
Aber wer in diesem Augenblick »Hallo« sagte, war nicht ich, sondern Natalie Hoppe, meine beste Feindin, die ausgerechnet jetzt das schummerige Szenario betreten musste.
Natalie Hoppe war in derselben Straße groß geworden wie Nina und ich, und sie hatte auch dieselbe Klasse besucht. Sie gehörte zu der Sorte Mädchen, die immer ihre Hausaufgaben machen, niemals jemanden abschreiben lassen und dem Lehrer verraten, bei wem man stattdessen abgeschrieben hat. Natterlie die Schlange hatten wir sie genannt. Einmal, im sechsten Schuljahr, hatte sie in einer Mathearbeit restlos alles bei mir abgeschrieben. Sie war damals schon bösartig, hinterhältig und tückisch gewesen, aber noch nicht besonders schlau, denn sonst hätte sie von einem anderen abgeschrieben. Natalie und ich hatten also dreizehn höchst skurrile Fehler in der Arbeit, und als der Lehrer wissen wollte, wer von wem abgeschrieben hatte, sagte Natalie doch wahrhaftig, ich sei der Übeltäter gewesen. Der Lehrer glaubte ihr, zumal sie in den nächsten Arbeiten von besseren Schülern abschrieb. Dabei lag es auf der Hand, dass Natalie abgeschrieben hatte, denn sie war der geborene Nachmacher. Alles machte sie nach. Sie kopierte meine Frisuren, meine Klamotten, meine Sprechweise, meine Gestik, meine Mimik, einfach alles. Unsere Eltern gehörten dem gleichen Tennisclub an, und wenn Natalie nicht von mir herausbekam, wo ich meine wirklich originelle Latzhose herhatte, dann kitzelte ihre Mama es aus meiner Mama heraus. Es dauerte nie länger als zwei Tage, da tauchte Natalie mit dem gleichen Stück in der Schule auf und warf mir triumphierende Blicke zu.
Wenn ich eine neue Freundin hatte, setzte Natalie alles daran, dass es ihre Freundin wurde. Sie beschenkte die Betreffende großzügig, lud sie zu sich nach Hause ein und setzte die schrecklichsten Gerüchte über mich in die Welt; diesbezüglich waren ihrer sonst spärlich ausgebildeten Fantasie keine Grenzen gesetzt. Eine Zeit lang war die ganze Klasse davon überzeugt, dass bei uns zu Hause das Lendenstück meines Ponys Clarabella als Weihnachtsbraten verzehrt worden war, dass mein Vater wegen Ladendiebstahls im Gefängnis gesessen hatte und dass meine Mutter eine Affäre mit dem achtzehnjährigen Tennistrainer unterhielt. Ganz gleich, was ich tat, Natalie wollte es auch tun, und natürlich immer eine Spur besser, schöner und teurer. Was bei mir ein kleines, dickes Pony war, wurde bei Natalie ein großes, schlankes Rassepferd, ein kleines Pony wurde eigens angeschafft, um dem Rassepferd Gesellschaft zu leisten. Mein Schüleraustauschprogramm nach London wurde von Natalie durch ein Highschool-Semester in Kalifornien übertrumpft. Clerasil hieß das Mittel gegen meine Pubertätspickel, bei Natalie war es ein vierwöchiger Aufenthalt auf einer Schönheitsfarm am Mittelmeer. Obwohl die Bemühungen, Natalie pickelfrei, schlank und gebildet zu gestalten, erfolgreich waren, gab es nicht einen Jungen in der ganzen Schule, der Natalie mochte. In der Abizeitung stand über sie: »… Aufsehen erregenden Gerüchten zufolge soll Natterlie in Gesellschaft eines männlichen Objekts gesichtet worden sein, das aus verständlichen Gründen anonym bleiben wollte.«
Aber Natalie hatte niemals unter ihrer Unbeliebtheit gelitten. Im Gegenteil, sie schien alles zu tun, um die Antipathie ihrer Umgebung zu kultivieren. Auch jetzt erfasste sie das einzige Objekt in diesem Raum, um das es sich lohnte, in Konkurrenz zu treten: meinen grünäugigen Pannenmann an der Theke! Er lehnte jetzt mit dem Rücken zur Wand, trank sein Bier und konnte jeden Atemzug hören, den wir taten. Natalie lächelte strahlend.
»Hallo Felicitas, hallo Nina! Habt ihr etwa auf mich gewartet?«
»Guter Witz«, antwortete Nina.
Natalie musterte uns von oben bis unten. »Gottogottogott, habt ihr euch aufgekratzt.«
Sie selber hatte sich den Räumlichkeiten perfekt angepasst. Sie trug eine schlammfarbene Bluse mit aufgesetzten Brusttaschen, auf denen ein teures Markenlogo prangte. Ihre Hose hatte die gleiche Farbe wie die Resopalplatten ringsrum.
Nina warf die Locken in den Nacken. »Wir sind heute noch zu einer Cocktailparty eingeladen«, log sie.
Jetzt lächelte der Mann an der Theke mir zu. Ich lächelte wieselflink zurück.
»Du hast eine Laufmasche«, sagte Natalie und zeigte mit den Fingern auf meine Strumpfhosen.
Alle schauten auf meine Beine, auch der Typ mit den grünen Augen. Tatsächlich, durch die neuen Strümpfe lief eine Laufmasche, vom Knöchel bis hoch zum Hintern, wo der raffinierte Schlitz im Kleid aufhörte.
»Oooooh«, stöhnte ich mit niedergeschlagenen Augen.
Natalie zupfte ungefragt an meinem Knie herum und löste eine weitere Laufmasche aus. »Billige Strümpfe«, sagte sie naserümpfend.
»Oh, ein Fall für ›Wetten dass‹«, spottete Nina. »Wetten, dass Natalie Hoppe es schafft, am Zupfen einer Strumpfhose den Preis zu erraten?«
Ich schaute wieder zu dem Grünäugigen hinüber, aber er schaute in sein Bierglas. Jetzt hatte ich meine Chance verspielt. Nur Schlampen tragen billige Strümpfe mit Laufmaschen. Ich seufzte verzweifelt, und da blickte er von seinem Bierglas auf und lächelte mir erneut zu. Ich lächelte auch. Scheiß auf die Laufmasche! Auf diese Weise hatte er wenigstens auf meine Beine gesehen!
»Kommt dein Till heute Abend eigentlich auch?«, unterbrach Natalie unseren Blickflirt.
»Welcher Till?«, fragte ich erschrocken zurück.
»Du weißt schon, der Typ, der dich auf der Klassenfahrt in Bingerbrück auf dem Damenklo der Jugendherberge entjungfert hat«, sagte sie, diabolisch grinsend.
Mir stockte der Atem. Dem Grünäugigen, schien es, ebenfalls.
»Ach, der Till«, erwiderte Nina an meiner Stelle. »Der, den du Felicitas mit allen Tricks ausspannen wolltest. Ich weiß noch, wie du ihn mit einer Jahreskarte für die Kölner Haie bestechen wolltest. Du hast erst aufgegeben, als Till ›Natterlie Hoppe ist eine widerliche Ziege mit platten Titten‹ an die Schulwand gesprüht hat.«
»Damals waren wir noch Kinder«, sagte Natalie zu dem Grünäugigen und warf sich demonstrativ in die schlammfarbene Brust.
»Und es gab noch keine Wonderbras«, ergänzte Nina. Wenn es um Natalie ging, hatte sie schon immer zu mir gehalten. »Komm, Felicitas, wir gehen zu den anderen. Sicher ist auch jemand Nettes gekommen.«
Der magische Moment war vorüber. Der Grünäugige drehte sich um und bestellte noch ein Bier. Natalie folgte uns federnden Schrittes in den Festsaal des Hauses.
Hier hingen hunderte und aberhunderte von stattlichen Jagdtrophäen an den Wänden, und in der Mitte luden steiflehnige Stühle mit jägergrünen Plastikpolstern um in Hufeisenform gestellte Resopaltische zum gemütlichen Zusammensein ein. Die ganze Pracht wurde von meterlangen Neonröhren bis in den allerletzten Krähenfuß ausgeleuchtet. Ich war geblendet und auf der Stelle wieder stocknüchtern.
»Wirklich tolle Beleuchtung«, raunte ich Nina zu. Ihr Lippenstift strahlte wie eine rote Ampel. »Und wie passend wir gekleidet sind!«
Nina zupfte nervös an ihrem Strassbesatz. »Wo ist hier ein Kellner? Ich möchte um nichts in der Welt nüchtern werden.«
»Felicitas! Nina!« Das war Caroline Kreuzer, in Jeans und naturweißem Schlabberpulli. Zu dritt hatten wir Biologie-Leistungskurs geschwänzt und stattdessen Skat im Café gegenüber gespielt. Caroline hatte sich zumindest äußerlich nicht viel verändert.
Dankbar setzte ich mich neben sie auf ein grünes Plastikpolster, das sofort eine chemische Verbindung mit meiner Seidenstrumpfhose einzugehen begann. Unter dem Tisch konnte man meine Laufmaschen wenigstens nicht sehen.
Zu meiner Linken ließ sich ein seriöser bebrillter Herr mit Übergewicht nieder, den ich nie zuvor gesehen hatte. Nina ließ mich einfach im Stich. Sie machte sich auf die Suche nach einem Kellner.
»Felicitas Trost?«, fragte der seriöse Herr zu meiner Linken.
Ich nickte unsicher.
»Ulrich Schulze-Reimpel«, sagte er. »Früher Schulze.«
Ulrich. Drahtig, verwegen, unangepasst, frech, der Albtraum aller Lehrer. Heute verheiratet, zwei Kinder und Beigeordneter im Stadtrat.
»Du hast dich aber verändert«, sagte ich.
»Das will ich doch meinen«, sagte Ulrich. »Im Augenblick bauen wir ein Haus in Pesch. Mit Wintergarten und Indoor-Swimmingpool.«
Ich musste mich abwenden. Caroline auf der anderen Seite war nach der Schule als Au-pair nach Dublin gegangen, hatte einen Iren mit Landgut kennen gelernt und geheiratet.
»Du Glückliche!«, entfuhr es mir.
»Ja! Ich habe das Glück festgehalten, als es sich mir bot«, sagte Caroline.
»Wie meinst du das?«
»Dem Schicksal«, sagte Caroline doch wahrhaftig, »muss man manches zäh abringen.« Sie senkte die Stimme. »Das Schicksal präsentiert einem niemals eine endgültige Lösung, sondern öffnet lediglich Tore und Türen für uns. Ob wir diese Wege betreten oder nicht, liegt dann ganz bei uns.« Caroline machte eine kleine Pause und sah mich mit weit aufgerissenen Augen an. »Ich habe die Chance genutzt, als ich sie bekam, weißt du. In Form eines Briefes. Möchtest du ihn sehen?«
»Es ist wohl sehr einsam da, wo ihr wohnt?«, sagte ich mitleidig, und da bekam Caroline wieder einen beinahe normalen Gesichtsausdruck.
»Ja, aber wunderschön«, schwärmte sie. »Wir haben vierzehn Pferde, zwei Hunde und jede Menge Katzen.« Sie legte die Hände auf ihren Schlabberpulli. »Und bald auch ein Kind, in fünf Monaten. Ich bin ja so glücklich. Und alles wegen dieses Briefes. Soll ich ihn dir zeigen? Ich trage ihn immer bei mir!«
»Gratuliere.« Ich musste mich wieder abwenden. Zurück zu Ulrich Schulze-Reimpel.
»Und was machst du so?«, wollte er wissen.
»Ich arbeite in einem Verlag in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit«, sagte ich, aber niemand hier war an meiner Karriere interessiert.
»Und dein Mann?«, fragten Caroline und Ulrich gleichzeitig.
»Ich bin nicht verheiratet«, sagte ich, und mir war, als hörten im Umkreis von zehn Metern alle zu sprechen auf und schauten mich an.
»Oh«, sagte Caroline betroffen und machte sich an ihrer Handtasche zu schaffen.
»Ich bin immer noch mit Till zusammen«, sagte ich schnell.
»Mit Till Meyer?«, erkundigte sich Ulrich. »Der hat mich und meine Familie neulich mit dem Taxi zum Flughafen gefahren.«
»Oh«, sagte Caroline wieder. Sie hielt mir einen mehrfach zusammengefalteten Zettel hin. »Das ist der Brief, von dem ich dir erzählt habe, lies mal.«
»Später.« Ich erhob mich, um mich für ein Weilchen auf dem Klo zu verbarrikadieren. Ich kam nicht weit. Gleich hinter dem Stuhl fingen mich mehrere ehemalige Mitschüler ab und wollten wissen, was ich so machte.
»Und selbst?«, fragte ich zurück. Überflüssig zu sagen, dass sie alle verheiratet waren, unheimlich erfolgreich und stolze Besitzer von Eigenheimen sowie geborenen oder noch ungeborenen Kindern.
»Und du?« Mir wurde mitleidig auf die Schultern geschlagen. »Man hat uns gerade erzählt, dass du deinen Führerschein los bist, wegen Trunkenheit am Steuer.«
Ich schüttelte milde den Kopf. »Da hat euch Natalie einen Bären aufgebunden.«
Auf dem Weg zum Klo dementierte ich noch drei weitere Gerüchte, eines davon bezüglich meiner Liebschaft mit unserem gichtgebeugten, graubärtigen ehemaligen Erdkundelehrer. Natalie hatte ihr Gift gründlich verspritzt. Schließlich traf ich auf Till, umringt von ehemaligen Mitschülern, die ihm staunend lauschten.
»Als Schauspieler kommt man unheimlich viel herum«, sagte er. »Heute kleines Fernsehspiel in Hamburg, morgen Theater in München.«
Seine Zuhörer schienen beeindruckt.
»Jeder hier weiß, dass du ein Taxifahrer im neunzehnten Semester bist, der sich ab und zu als Komparse verpflichtet«, flüsterte ich in sein Ohr. »Kleines Fernsehspiel in Hamburg, dass ich nicht lache.«
Till drehte sich zu mir um. »Kann alles noch kommen«, meinte er und grinste. »Na, kleine Zuckerfee, lass dich umarmen.«
»Hier sind alle verheiratet, vom Glück verwöhnt und unheimlich erfolgreich. Nur ich nicht«, murmelte ich in seine Jacke.
»Warum hast du auch allen erzählt, dass ich Taxi fahre?«
»Das war nicht ich«, sagte ich. »Das war Natalie Hoppe. Sie hat mein Leben zerstört.«
»Nur weil sie mich als Taxifahrer geoutet hat?«
»Ach, nein«, sagte ich mit einer wegwerfenden Handbewegung. »Doch nicht deinetwegen. Da war ein ganz toller Mann draußen an der Bar. Und weißt du, was Natalie dem erzählt hat?«
»Die Geschichte, wie du eine Kartoffel in den Auspuff ihres ersten schicken Cabriolets gesteckt hast?«
»Viel schlimmer. Sie hat behauptet, du hättest mich auf dem Damenklo in Bingerbrück in der Jugendherberge entjungfert!« Ich wurde nachträglich noch einmal rot. »Kannst du dir vorstellen, was der jetzt von mir denkt?«
Till lachte. »Haha, von wegen entjungfert. Hast du denn nicht gesagt, dass du auf diesem Gebiet beinahe krankhaft zurückgeblieben warst? Selbst mit achtzehn wusstest du nicht mal, wo genau du den Tampon reinschieben musstest!«
»Ich glaube nicht, dass das weniger peinlich gewesen wäre«, sagte ich.
Tills Freund Ollie stellte sich zu uns. »Hast du noch Urlaub in diesem Jahr?«, fragte er mich.
Ich bejahte.
»Dann könntest du mit uns in Skiurlaub fahren. Saas Fee, sensationell günstig, erster Novemberschnee.«
Das klang in der Tat verlockend. »Wie günstig?«, erkundigte ich mich.
»Fünfhundert die Woche, einschließlich Skipass, Verpflegung und Fahrtkosten«, erklärte Ollie stolz.
»Wahnsinn!«, sagte ich beeindruckt. »Wie kann das sein?«
»Vorsaisonpreise«, sagte Ollie. »Wir teilen uns zu mehreren ein schnuckliges Chalet. Till fährt auch mit.«
»Ach ja?« Till und ich wussten längst nicht alles voneinander. »Und wer noch?«
Ollie lachte etwas verlegen. »Ein Kollege von mir mit seiner Frau und ein alter Schulfreund von diesem Kollegen. Auch mit Frau und –«
»Potthässlich«, fiel Till rasch ein. »Deshalb wäre es schön, wenn du mitkämst.«
»Ja«, sagte ich. »Ich könnte wirklich mal wieder Urlaub gebrauchen.«
»Fein!« Ollie strahlte. »Dann sag’ ich morgen auf dem Treffen, dass das letzte Bett auch noch vergeben ist.«
»Morgen trefft ihr euch?«
»Ja, aber da brauchst du wirklich nicht zu kommen«, sagte Till wieder schnell. »Da geht es bloß um den organisatorischen Kram. Total langweilig.«
Ich sah ihn misstrauisch an. Irgendwas stimmte doch da nicht. Aber ehe ich der Sache auf den Grund gehen konnte, stieß Nina zu uns.
»Komm, wir fahren«, sagte sie. »Ich habe alle befragt, die in die engere Wahl kämen, aber von denen ist keiner mehr solo.«
»Ich bin solo«, sagte Ollie, aber Nina schenkte ihm keinen Blick. Sie wusste, dass er höchstens zweitausend netto verdiente.
»Suchst du einen neuen Mann, Nina?«, fragte Till.
»Ja«, erwiderte Nina. »Aber für Felicitas. Sie soll endlich auch ein schönes Leben haben.«
»Sie hat doch mich.«
Nina schnaubte verächtlich. »Dich zum Mann zu haben und ein schönes Leben zu führen schließt einander zwingend aus.«
Till war nicht mal beleidigt. Ich strebte hinter Nina dem Ausgang zu. Den frühen Abgang bedauerte ich keineswegs, im Gegenteil, wer weiß was für Gerüchte Natalie noch alles in die Welt gesetzt hatte.
Als wir den schummrigen Thekenraum betraten und ich hoffnungsvoll nach dem Grünäugigen Ausschau hielt, hörten wir eilige Schritte hinter uns.
»Halt! Felicitas!« Es war Caroline. Sie war völlig außer Atem.
»Der Brief«, keuchte sie. »Du wolltest doch den Brief lesen, der mir damals Glück gebracht hat.«
»Äh, ja«, stotterte ich. »Aber unser Taxi wartet.«
»Das macht nichts«, sagte Caroline. »Du kannst ihn mitnehmen, ich schenke ihn dir einfach. Er wird dir Glück bringen, so wie mir. Du kannst es gebrauchen.« Sie drückte mir den zusammengefalteten Zettel in die Hand.
»Danke«, sagte ich. Caroline lächelte und kehrte zu den anderen zurück. »Sie kann einem Leid tun«, sagte ich zu Nina. »Sie ist völlig durchgeknallt!«
Der Grünäugige war längst nach Hause gegangen.
Die zweite Gelegenheit
SO EINE PLEITE, schimpfte Nina im Taxi. »Du hättest den Typ wenigstens nach seiner Telefonnummer fragen können! Das war die Gelegenheit!«
Ich seufzte und faltete Carolines Brief auseinander. Es war eine blasse, abgegriffene Kopie, der Maschine geschriebene Text ziemlich erstaunlich.
»Hör doch mal«, sagte ich. »Das ist ein Kettenbrief! Caroline hat mir einen Kettenbrief gegeben!«
»Lauter Nieten, die Männer«, meinte Nina. »Aber wenigstens sind die Frauen alle vor Neid erblasst, als ich gesagt habe, dass ich eine Kinderfrau habe. Ganztags! Die können ja nicht wissen, dass ich damit meine grauenhafte Schwiegermutter meine!«
Ich hörte ihr nicht mehr zu. Der Brief, dem Caroline den irischen Mann mit Landgut, vierzehn Pferde und baldiges Kindesglück zu verdanken hatte, war wirklich skurril. »Lieber Empfänger«, stand dort in schlechter Schreibmaschinenschrift und noch schlechterem Deutsch. »Dieser Brief wurde vor zehn Jahren von einem Priester auf Haiti begonnen und soll dir Glück bringen. Du musst inerhalb von zehn Tage zehn Kopien anfertigen und diese an zehn Menschen weiterleiten, die dir am Herzen liegen. Harry Peterson aus Philadelphia gewann zwei Tage, nach dem er seine Kopien weg geschickt hatte, zwei Millionen Dollar in der Lotterie. Heather Matthews aus Maryland wurde noch am gleichen Tag, an dem sie die Kopien verteilt hatte, von ihrem Knochenmarxkrebs geheilt. Dies soll nur als Beispiel dienen um zu zeigen, wie viel Macht dieser Brief hat. Wenn du es wagst, die Kette zu unterbrechen, wirst du großes Unglück auf dieh lenken. So hat Daryl Jones in Texas den Brief erhalten und einfach vergessen. Inerhalb der nächsten zehn Tage verlor er zuerst seine Arbeit, dann verunglückten Frau und Kinder tötlich mit dem Auto. Glücklicher weise erinnerte er sich an den Brief und schickte doch noch zehn Kopien ab. Gleich am nächsten Tag fand er eine neue Arbeit. Dieses Beispiel soll nur als Beispiel dienen, um zu zeigen, was passiert wenn man die Kette unter bricht. Viel Glück.«
Ich musste lachen. »Was hältst du davon?«, fragte ich Nina.
»Man muss schon sehr verzweifelt sein, um an so was zu glauben«, erwiderte sie. »Aber bei Caroline hat es gewirkt. Sie hat mir ein Foto von ihrem Gutshof gezeigt. Traumhaft, sage ich dir. Und der Mann konnte sich auch sehen lassen. Ich hatte wohlweislich alle Bilder von Robert aus meiner Brieftasche entfernt. Auf Fotos sieht er noch dicker aus als in Wirklichkeit.«
In meiner Wohnung – Nina war mit dem Taxi weitergefahren, zurück in ihre Doppelhaushälfte zu Mann und Kind – las ich mich noch einmal durch die abenteuerliche Orthografie von Carolines Brief. Ich hatte gedacht, Kettenbriefe seien seit Hermann völlig aus der Mode gekommen. Hermann war ein kleiner Klumpen Teig, und er kam auch mit einem Kettenbrief. Man musste Hermann in den Kühlschrank stellen und mit Mehl und Milch füttern. Innerhalb von zehn Tagen wuchs er auf weit mehr als den doppelten Umfang heran. Dann, so schrieb der Kettenbrief vor, sollte man Hermann in drei Stücke teilen. Ein Drittel schenkte man mit besagtem Kettenbrief an einen Freund weiter, aus einem Drittel buk man einen leckeren Kuchen, und das letzte Drittel musste man im Kühlschrank weiterfüttern, bis es wieder teilbar war. Eine Zeit lang hatte auf diese Weise jeder einen Hermann im Kühlschrank gehabt, und eigentlich war das ganz nett gewesen. Das Schlimmste, was einem passieren konnte, wenn man Hermann vergaß, war ein verschimmelter Kühlschrank. Harmlos, wenn man es mit den Folgen verglich, die das Ignorieren dieses Kettenbriefes hatte.
Wenn Caroline mich besser gekannt hätte, hätte sie wissen müssen, dass ich den Brief irgendwo hinlegen, vergessen und damit den Fluch des Priesters auf mich ziehen würde. Ich legte den Brief also irgendwo hin und vergaß ihn. Die Strümpfe mit den Laufmaschen dagegen rollte ich sorgfältig zusammen und legte sie in meine Wäscheschublade. Zur Erinnerung an meine erste Begegnung mit einem wirklichen Traummann.
Das Telefon klingelte direkt neben meinem Ohr.
»Felicitas Trost.«
»Ja, guten Tag, hier ist Simone. Ist Ihr Sohn da?«
Ich kannte keine Simone. Mein Sohn war auch nicht zu Hause. Ich hatte überhaupt keinen.
»Kann es sein, dass du dich verwählt hast?«
»Eigentlich nicht.« Das klang beleidigt und selbstsicher zugleich.
Ich sah auf die Uhr. Viertel vor acht. Samstagmorgen. Ein freier Tag. Einer, an dem ich hatte ausschlafen wollen. Und jetzt hatte ich über Nacht einen Sohn bekommen.
»Wie soll mein Sohn denn heißen?«, fragte ich, um sicherzugehen, dass ich nicht fünfzehn Jahre später aufgewacht war.
»Mike«, antwortete Simone ungeduldig.
»Mike? Ausgeschlossen. Du musst dich verwählt haben.«
Das Gör legte auf, ohne sich zu entschuldigen. Ich ließ mich zurück ins Bett fallen. Mike! So würde ich meinen Sohn nie nennen. Meiner würde David heißen oder vielleicht Jeremie. Ich konnte unmöglich klingen wie eine, die einen Sohn namens Mike hat. Mikes Mutter hatte unter Garantie Dauerwellen und war mindestens sechsunddreißig. Sie hatte Mike mit zwanzig bekommen und Manfred, genannt Manni, geheiratet, als sie im fünften Monat war. In Weiß. Mit einer dieser gelockten Kunstseidenschleifen im Haar. Ich zuckte zusammen. Jetzt fing das schon wieder an. Ich malte mir das Schicksal wildfremder Leute aus, von denen ich noch nicht mal wusste, ob es sie überhaupt gab.
Ich beschloss aufzustehen, den Kater zu füttern und die Fenster zu putzen.
»Rothenberger!«, rief ich, aber Rothenberger kam nicht.
Er war ein sehr hübscher Kater, der aussah wie ein Luchs, mit sandfarbenem, grau getupftem Fell, buschigem Schwanz und lustigen Fellbüscheln auf den Ohrspitzen. Seine gelben Augen schielten ziemlich, und deshalb war er nach Anneliese Rothenberger benannt. Rothenberger war ein rücksichtsvoller Kater. Samstags, wenn ich ausschlafen konnte, kam er nie vor neun Uhr von seinen Streifzügen zurück. Er tauchte auch nicht auf, als ich die Lauge für die Fenster anrührte. Er konnte über den Balkon auf das nächste Garagendach und von da auf ein verwildertes Grundstück springen. Was er dort tat, konnte ich nur vermuten.
Meine Fenster hatten es wirklich nötig. Ich pflegte sie in so großen Abständen zu putzen, dass das Saubermachen ein echtes Erfolgserlebnis bot. Dummerweise regnete es. Aber da ich mir nun einmal vorgenommen hatte, Fenster zu putzen, tat ich es auch. Zumal es draußen so aussah, als würde es überhaupt nie wieder aufhören zu regnen. Von wegen goldener Oktober.
Als ich beim vorletzten Fenster angelangt war, klingelte das Telefon. Diesmal ließ ich den Anrufbeantworter rangehen.
»Hallo, hallo! Und hier ist wieder ›Der Preis ist Scheiß‹ mit Felicitas Trost. Ich bin im Moment nicht zu Hause, aber unter den ersten zehn Anrufern verlose ich auch heute wieder wunderbare Preise. Wer wagt, gewinnt eine formschöne, verchromte Nagelschere, garantiert rostfrei! Sprechen Sie – jetzt!«
Ich wischte zufrieden die Vogelkacke von der Fensterbank. Immer wieder komisch, mein Anrufbeantworter. Nach dem Piepton sprach meine Arbeitskollegin aus der Presseabteilung von Jorge und Kriechbaum auf Band. Sie sagte, dass sie aus zuverlässiger Quelle erfahren habe, dass der Verlag in den nächsten Tagen Konkurs anmelden und wir alle unsere Jobs verlieren würden. Ich wusste, dass die Quelle sehr zuverlässig war, denn die Arbeitskollegin unterhielt ein streng geheimes Verhältnis mit einem der Geschäftsführer. Trotzdem bewegte ich mich nicht von meiner Trittleiter herunter.
»Vielleicht«, fuhr die Kollegin mit unverkennbar hysterischem Unterton fort, »vielleicht können die nicht mal mehr die laufenden Gehälter auszahlen.« Dann fing sie an, mein Band voll zu schniefen und zu schluchzen. Erst als das Schluchzen verstummt war und die synthetische Frauenstimme des Apparats Datum und Uhrzeit ergänzte, begriff ich die Ungeheuerlichkeit der Nachricht. Aber ich putzte dennoch gelassen zu Ende. Wenn es tatsächlich so war, dass ich in nächster Zeit arbeitslos würde, dann konnte ich ohnehin nichts daran ändern. Jedenfalls würde es nichts nützen, mir das Wochenende damit zu verderben. Es war ganz gegen meine Gewohnheit, sich über ungelegte Eier aufzuregen.
Vogel-Strauß-Politik, Problemnegierung und Realitätsflucht nannte Nina das, aber sie hatte schließlich Architektur studiert und nicht Psychologie. Ich hielt mich besser an die weisen Ratschläge aus dem Volksmund. Du sollst erst schreien, wenn es wehtut, gieße das Kind nicht mit dem Bade aus, ein Unglück kommt selten allein, und wenn der Hahn kräht auf dem Mist, ändert sich’s Wetter, oder es bleibt, wie es ist.
Später klingelte das Telefon erneut. Diesmal war es Till. Er müsse den ganzen Tag Taxi fahren, sagte er mit weinerlicher Stimme, und ob ich ihm einen Gefallen tun könnte.
»Nee«, sagte ich sicherheitshalber.
»Es ist aber wichtig!«, flehte Till. Im Kaufhof gäbe es nämlich ein Supersonderangebot, Markenskihandschuhe mit Neoprenoberflächen und extralangen Stulpen, und das Angebot sei so sensationell günstig, dass die Menschen sich darauf stürzen würden wie die Geier. Und da er den ganzen Tag im Taxi festsitze, solle ich mich doch bitte, bitte unter die Geier mischen und ein Paar für ihn ergattern, in Blau, wenn’s ginge.
»Du hast dann auch einen Gefallen bei mir gut«, setzte er hinzu.
»Das wäre dann der Zweihundertundzehnte«, sagte ich.
»Ja, und wer hat dir neulich das Regal angedübelt?«
»Und wer hat dich dafür zum Essen eingeladen, deine Hemdenknöpfe angenäht und das Referat abgetippt?«, fragte ich zurück. »Aber gut, ich hol’ dir die verdammten Handschuhe, ich muss sowieso noch zum Einkaufen, wenn ich nicht verhungern will.«