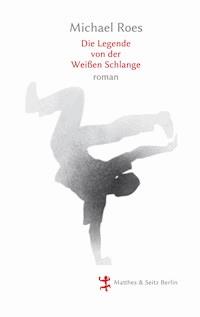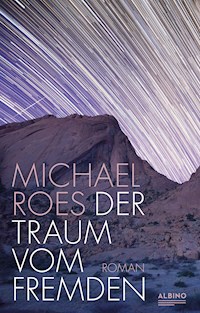Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie klingt Musik, wenn man sie nicht hören kann? Michael Roes erzählt in Die Laute die Geschichte von Asis, einem jemenitischen Jungen, der von Melodien erfüllt ist, nachdem er von einem Blitz getroffen wurde, und der sein Hörvermögen verliert, nachdem er einer brutalen Bestrafung unterzogen wurde. Asis erlernt die Gebärdensprache und erkämpft sich seine Position und seine Haltung als Gehörloser in der Welt der Hörenden. Es verschlägt ihn nach Polen, nach Krakau, wo er als junger Erwachsener zu studieren beginnt: Er wird Komponist. Michael Roes führt den Leser in eine Welt von gefühlten Geräuschen, imaginierten Berührungen, gesehener Sprache und gebärdeten Gefühlen. Die Laute ist ein berührendes Plädoyer für die tiefgreifende und umwälzende Kraft der Literatur und der Musik, die es ermöglicht, ein erfülltes Leben gegen alle äußeren Widerstände zu führen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 629
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Roes
Die Laute Roman
Michael Roes
die Laute
roman
für Amir, Ghufran undmeine anderen gehörlosen Freunde in Aden
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Ich kann eine Geste nicht verstehen, wenn ich sie nicht als eine Möglichkeit in einem bestimmten Raum sehe. Also gibt es eine Grammatik der Gesten, ihre ›Geometrie‹.
Ludwig Wittgenstein
Die Handbewegung derer, die ihren Kopf schützen wollen, blieb die gleiche.
Wisława Szymborska
Bis hierher haben wir die Räder geschoben, ich das kleinere, leichtere, Rafał sein verrostetes altes Herrenrad. Warum gerade hierher? Rafał zuckt mit den Schultern. Wenig Autoverkehr, gebärdet er, und es geht leicht bergab. Wird dir helfen das Gleichgewicht zu halten.
Er lehnt sein Rad an eine Bank am Wegrand und hilft mir in den Sattel. Gerade noch mit den Zehenspitzen kann ich den Boden erreichen. Setz deine Füße auf die Pedale, fordert er mich auf. Ich werde dich festhalten.
Einen Augenblick ist alles in der Schwebe. Rafałs rechte Hand am Lenker, seine linke auf meiner Schulter. Mein Blick fällt auf die Friedhofsmauer. Sie und die Friedhofskapelle sind aus denselben gebrannten Ziegeln in der Farbe geronnenen Bluts errichtet wie die Kościuszko-Festung in meinem Rücken.
Ich habe das Gefühl, der Hügel starre mich aus seinen toten Augen an. Ich mag ihn nicht, diesen Kegel zu Ehren eines Kriegshelden. Drei Jahre lang haben sich Tausende Arbeiter abgemüht, diesen Hügel aufzuschütten. Unter die Erde haben sie die Asche gefallener Soldaten gemischt. Nur einmal bin ich hinaufgestiegen, gleich am zweiten Tag nach meiner Ankunft, um von dort oben auf meine neue Heimat, auf diese beiden ungleichen Schwestern, Krakau und Nowa Huta, blicken zu können.
Am Fuß des Hügels befindet sich die Festung aus rostroten Ziegeln, unheimlich wie ein Zuchthaus, eine Heilanstalt, eine Abdeckerei. Die Österreicher haben sie gebaut, einige Jahre, nachdem polnische Arbeiter den Gedenkhügel aufgeschüttet hatten. Nun haben dort ein Radiosender und ein Wachsfigurenkabinett ihren Sitz. Es war kalt und diesig, ein bewölkter Apriltag wie heute, Ostermontag. Emaustag. Es hatte sogar ein wenig genieselt, zunächst war ich ganz allein dort oben, und die Türme der Altstadt wirkten unendlich weit entfernt hinter diesem Schleier aus Nebeltröpfchen und Braunkohledunst. Und hinter der fernen Silhouette Krakaus, dreimal so hoch wie die Türme des Wawel, ragte der Schornstein des Hüttenwerks von Nowa Huta in den grauen Himmel, die wahre, wenngleich menschenleere Kathedrale in diesem Talkessel. Wie stolz ich auf dieses Wahrzeichen war, diesen Triumph des Neuen über das Alte.
Näher, wenn auch ebenso unwirklich wie die Altstadt und das Hüttenwerk, liegen das Fußballstadion von Wisła Kraków und die Błonia-Wiese, diese merkwürdige baum- und strauchlose Steppe inmitten der Stadt, seit Jahrhunderten freigehalten, damit der erste polnische Papst der Kirchengeschichte dort dereinst seine Messe für Millionen feiern kann.
An meinem Hügelbesuchstag war sie indessen menschenleer, aber das benachbarte Stadion füllte sich langsam, auch wenn ich die Schlachtgesänge der berüchtigten Krakauer Hooligans nicht hörte.
Auf der südlichen Hügelseite liegt das Weichseltal, und wie ein weggeworfenes graugrünes Plastikband der Fluss darin. Träge schneidet er der Straße, die Rafał mich nun herunterrollen lässt, den Weg ab, das gelbschwarze Band einer Baustellenabsperrung. Nur der sandgelbe Gebäuderiegel des Prämonstratenserinnenklosters direkt am Weichselufer könnte noch verhindern, schnurstracks in ihre schwefelsaure Trägheit zu stürzen.
Ich erinnere mich an vereinzelte Paare, die mich schließlich aus meiner Betrachtung der Stadtschwestern gerissen haben, jugendliche Paare ohne einen Blick für die Gegensätze, Augen nur für sich selbst, auf dem steilen Pfad zur Hügelkuppe verstreut, offenbar nur hier an diesem Nieselregentag, um mit sich allein zu sein und sich ungestört küssen zu können. Warum hier? Warum nicht zu Hause? Wollen sie dem Himmel näher sein? Oder einfach nur die Erde und die Asche der gefallenen Soldaten zwischen ihren aneinander stoßenden Zähnen spüren?
Diese acht- und schutzlose Intimität erschien mir an diesem zweiten Tag nach meiner Ankunft wesentlich fremder als die vergilbte und zerknitterte Postkartenidylle mit ihren himmelstürmenden Schloten im Hintergrund.
Und an die Krähen erinnere ich mich, nur halb so groß wie in Aden, ein ganzer Schwarm am steilen Hügelhang, wie Schwalben kleben sie daran und hacken in den Kunstrasen auf der Suche nach Gewürm, das es hier nicht gibt. Diese Krähen habe ich nicht vergessen, weil Krakau ja eher eine Stadt der Tauben ist; der Taubenplage und der Taubennarrheit. Angesichts der kotzerfressenen Renaissancefassaden wünschte man sich eigentlich einen Schwarm der Adener Monsterkrähen, die ein für allemal mit diesem Unschuld heuchelnden Ungeziefer aufräumte.
Von hier, vom Backsteinportal des cmentarz Salwatorski, wirkt der Hügel wie das, was er ist, ein Trümmerberg, kahl wie ein Totenschädel, von Menschenhand aufgeschüttet, ohne jedes Leben darin, ein gigantischer lieb- und schmuckloser Grabhügel.
Dann gibt Rafał mir einen sanften Stoß, lässt seine Hand aber noch in meinem Rücken liegen. Langsam rollt das Fahrrad an. Eine einspurige Allee, rechter Hand der Erlöserfriedhof, ansonsten unbebautes Land. – Natürlich weiß ich, warum wir gerade hier mit dem Lernen beginnen. Das Haus seiner Mutter liegt nur wenige Straßen entfernt. Wir mussten nur ein wenig Luft nachpumpen, die Räder aus dem Keller tragen und die kaum mehr als zweihundert Meter bis hierher schieben. Vielleicht hat Rafał ja auf derselben schmalen Straße Radfahren gelernt, vor zwanzig Jahren, angeschoben von seinem Vater oder seinem älteren Bruder, ehe sie bei einem Lawinenunglück in den Karpaten am selben Tag ums Leben kamen, als Rafał acht Jahre alt war.
Nun gibt er mir einen kräftigen Stoß und lässt meinen Rücken los. Er hat mir erklärt, wie die Bremsen funktionieren, zwei Handbremsen, eine Rückrittbremse. Mehr zu wissen ist offenbar nicht notwendig, solange es bergab geht. Ich müsse gar nichts tun, außer im Sattel zu bleiben, versichert er mir. Vergisst, dass mein Gleichgewichtssinn nicht so funktioniert wie bei anderen Menschen. Aber solange das Fahrrad rollt, da hat Rafał recht, scheint es kinderleicht zu sein, nicht umzufallen. Er läuft noch einige Meter neben mir her, aber das sanfte Gefälle genügt zur Beschleunigung, sodass er bald nicht mehr Schritt halten kann und zu seinem eigenen Rad zurückkehrt.
Noch bin ich mir unsicher, was ich von dieser Art der Fortbewegung halten soll, fast so schnell wie ein Auto im Stadtverkehr, doch rundum ungeschützt und untrennbar mit diesem Gerät voller gefährlich vorstehender Hieb- und Stichwaffen verschweißt, an denen man sich bei einem Sturz mühelos entleiben kann. Dazu braucht man nicht einmal einen anderen Verkehrsteilnehmer, der einen abdrängt oder überfährt. Doch zweifellos macht es auch Spaß, wie mir der Fahrtwind Tränen in die Augen treibt und an meinen Haaren zerrt und ich ohne jeden Kraftaufwand bergab sause.
Es heißt, dass manche Sterbende im Augenblick des Todes ihr ganzes Leben an ihrem inneren Auge vorbeiziehen sehen. Mir geht es nun bei dieser meiner ersten Radfahrt so. Die Kräfte aller vorangegangenen Bergbesteigungen scheinen sich in dieser einen Abfahrt wieder in kinetische Energie, in Erinnerungsenergie zu verwandeln. Ich beginne, ein wenig mit den Bremsen zu spielen, nur für den nicht ganz auszuschließenden Fall, dass ich sie plötzlich brauchen werde.
1
Der Nachmittag ist bewölkt, ein leichter Wind weht, sodass das Spiel der Jungen kein Ende findet. Sie sind aufgeregt und erhitzt, aber nicht müde. Schläfrig werden sie erst am nächsten Morgen sein, in der Arabisch- und der Englischstunde.
Asis ist ein wenig schmächtig für seine dreizehn Jahre, aber ausdauernd und flink. Seit zwei Jahren spielt er in dieser Mannschaft und hat es vom linken Verteidiger bis zum Stürmer geschafft. Er trainiert jeden Nachmittag und wünscht sich, eines Tages Profifußballer zu werden und vielleicht sogar ins Ausland gehen zu können, so wie Isa Schawki, sein großes Vorbild, der in der saudischen Nationalmannschaft spielt und dafür sogar die saudische Staatsbürgerschaft geschenkt bekommen hat.
Sein Vater lächelt über den sportlichen Ehrgeiz seines Sohnes und ist im Grunde seines Herzens stolz auf Asis, auch wenn er darüber nicht spricht. Er ist nur ein einfacher Schuhmacher. Aber er sorgt dafür, dass Asis immer die besten Fußballschuhe auf dem Spielfeld trägt, während andere Jungen seiner Mannschaft, selbst sein bester Freund Hamid, barfuß spielen.
Hamid besitzt die teuersten Fußballschuhe, die es in Ibb zu kaufen gibt. Er hat sie von seinem Vater geschenkt bekommen. Hamids Vater ist einer der reichsten Männer Ibbs. Aber Hamid zieht seine Schuhe aus und versteckt sie in einer Plastiktüte, wenn er zum Training geht. Als einziger der Spieler geht er nachmittags noch auf eine Privatschule. Das reicht schon, um sich zum Gespött der Mannschaftskameraden zu machen.
Asis’ Mutter, die selbst nie die Schule besuchen durfte und weder lesen noch schreiben kann, wünschte sich, ihr Sohn würde sich mit demselben Ehrgeiz, der ihn auf dem Fußballplatz beflügelt, der Schule widmen. Fußball, so glaubt sie, sei kein ernsthafter Beruf, mit dem man eine Familie ernähren könne. Und in dieser Hinsicht ist sie eine wirklich erfahrene Frau.
Asis hatte seiner Mutter versprochen, sie zum Arzt zu begleiten. Nun ist es zu spät. Er glaubt nicht, dass es etwas Ernstes ist. Seit Wochen schon klagt sie über Schwindel, Kopfschmerzen und Erschöpfung. Trotzdem hat er ein schlechtes Gewissen. In der kurzen Halbzeitpause verlässt er den Platz und geht zum Taxiphone, um seiner Mutter irgendeine Ausrede für sein Fernbleiben mitzuteilen. Asis’ Familie hat kein eigenes Telefon. Er muss die Nachbarin anrufen, die dann bei seiner Mutter anklopft und sie zum Telefon holt oder ihr seine Nachricht übermittelt.
Die folgenden Sekunden wird Asis nie mehr vergessen. Der Weg vom Fußballplatz zu den nächsten Häusern führt über eine staubige Freifläche, ihr Spielfeld ist im Grunde nichts anderes als diese von einer grobkörnigen, grauschwarzen Schlacke bedeckte Brache hinter der Altstadtmauer. Sie nennen ihn zwar »Aschenplatz«, aber dieser scharfkantige Quarz hat nichts mit den feinen grauen Flocken zu tun, die Asis’ Mutter allabendlich aus dem Küchenofen schaufelt. Wer hier stürzt, schürft sich unweigerlich tiefe Wunden in Knie und Handballen, und die tiefer eingedrungenen Granulatsplitter schimmern noch Jahre später blauschwarz durch die Haut hindurch.
Torpfosten gibt es nicht. Steine, Schulranzen oder Sandalen bilden die Markierungen, die vor jedem Spiel neu abgemessen werden. Von der täglichen Beanspruchung ist der Platz vor den Toren schon ganz ausgehöhlt, sodass sich in den Regenzeiten das Wasser darin sammelt. Doch selbst diese Schlammteiche halten sie nicht vom Training ab. Asis mag ein nasses Fußballfeld lieber als ein staubiges. Trotz der Schlammspritzer bis hinauf zum Hals fühlt er sich am Abend sauberer als mit den Staubkrusten bis in die Ohren und unter die Lider.
Ein leises Donnergrollen kündigt ein Gewitter an, aber Asis denkt nur daran, was er seiner Mutter sagen soll.
Auf diesem freien, hautaufschürfenden Feld gibt es nichts als einen einsamen hölzernen Strommast und einige Sandbuckel. Je zwei Schulranzen markieren die Torpfosten. Noch etwa dreißig Meter vom Taxiphone entfernt, direkt unter dem Strommast, trifft Asis der Blitz. Von der Wucht des Einschlags wird er zurückgeschleudert und dann, während er noch zu Boden stürzt, seltsamerweise nach vorn geworfen. Und als er sich verblüfft umdreht, sieht er seinen eigenen Körper im Dreck liegen. »Allmächtiger Gott, sieht verdammt so aus, als sei ich tot!« denkt er.
Dann sieht er, wie seine Spielkameraden auf ihn zurennen und sich über ihn beugen. Und von der anderen Seite kommt der Mann aus dem Taxiphone, nicht der Manager, sondern jemand, der dort zufällig telefoniert hat. Er bahnt sich einen Weg durch die Jungenschar, kniet sich neben Asis’ Körper und beginnt sogleich, mit seinen Handballen fest auf Asis’ Brust zu drücken, sodass Asis seine eigenen Rippen knacken hört. Der Mann muss verrückt sein, denkt Asis, denn während er seinen Brustkorb malträtiert, singt er ein einfaches, idiotisches Kinderlied.
Lass ihn singen und mir die Rippen brechen! denkt er achselzuckend und steigt eine Treppe hinauf, die vorher noch nicht da war. Er denkt an seine Mutter, die nun ohne ihn zurechtkommen muss. Aber früher oder später wäre er ohnehin gegangen. Nun müssen eben Nasik und Aschraka, seine Schwestern, sie bei Arztbesuchen oder Behördengängen unterstützen.
Es wird immer heller, je höher Asis steigt, als würden die Wolken sich lichten. Das war aber ein kurzes Gewitter! Ein einziger Blitz, und alles nur meinetwegen! – Er muss lächeln. Ja, je mehr er sich von dem Körper da unten entfernt, desto größere Freude erfüllt ihn. Wenn nur dieser Mann mit dem Tanz auf seinen Rippen und seinem blöden Gesang aufhören würde! Asis ist dem Licht schon so nah, nur einige Schritte noch, doch – Rummms! – wird er innerhalb eines Augenblicks die Stufen hinunter und zurück in seinen Körper katapultiert.
Er weiß, dass er zurück in seinem Körper ist, denn er fühlt Schmerzen, Schmerzen in seiner Stirn, wo der Blitz in seinen Körper eindrang, und im rechten Bein, seinem gefürchteten Stürmerbein, durch das die elektrische Ladung austrat und in den nassen Boden fuhr. Nur ein lebender Körper kann einen so krassen Schmerz empfinden, weiß Asis. Er möchte den Mann anschreien, mit seinem Pressen und Singen aufzuhören. Doch auch wenn er zurück in seinem Körper sein mag, gehorchen will ihm dieser noch nicht.
Endlich, endlich kann er Zunge und Lippen bewegen, und mit dem grenzenlosen Ärger dessen, der aus einem wunderschönen Traum gerissen wird, fährt er seinen Lebensretter an: »Ist ja schon gut, ich bin doch keine Gummipuppe!«
»Vor einigen Minuten warst du es noch«, sagt der fremde Mann mürrisch, lässt von Asis ab und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Die Schuhspitzen und die Knie seiner dunklen Hose sind schlammverschmiert.
Der Mann will einen Krankenwagen rufen, und tatsächlich sieht Asis’ Gesicht schrecklich aus: Nässe und Staub haben eine grausilbrige Maske gebildet, und auf der Stirn befindet sich ein flammendrotes Mal, eine Verbrennung dritten Grades, sagt der Mann, die unbedingt behandelt gehöre. Doch Asis will von Krankenwagen und Unfallstationen nichts wissen.
Der Mann zuckt gleichgültig mit den Achseln, reicht Asis die Hand und hilft ihm aufzustehen. Gegen seinen Willen muss Asis sich auf den Arm des fremden Mannes stützen, um nicht gleich wieder in den Dreck zu fallen. Sein Kopf droht zu zerspringen, und sein rechtes Bein ist noch immer taub.
Der Mann zieht eine Visitenkarte aus seiner Brieftasche und reicht sie Asis. »Lass dich von deinen Freunden nach Hause bringen. Und wenn die Schmerzen in den nächsten Tagen nicht abklingen, komm mich besuchen!«
Dann geht der fremde Mann zurück zum Taxiphone, um sein unterbrochenes Telefongespräch fortzusetzen. – Auf der Visitenkarte liest Asis:
Dr. Fuad al-Halawi
Kardiologe
»Was ist ein Kardiologe?«, fragt er seinen Freund Hamid.
»Keine Ahnung«, antwortet Hamid. »Immerhin wusste er, was zu tun war. Ich glaube, du bist für einen Augenblick echt tot gewesen.«
»Das ist wahr«, sagt Achmad, der rechte Verteidiger. »Ich habe mein Ohr auf deine Brust gelegt. Aber da war nichts mehr. Der Alte hat dein Herz wieder zum Schlagen gebracht!«
»Blödsinn!«, widerspricht Asis. »Ich war die ganze Zeit hellwach! Und dieser Verrückte hat mir fast die Rippen gebrochen! – Egal, ich muss jetzt ohnehin nach Hause. Wir sehen uns morgen!«
Am nächsten Morgen bleibt Asis im Bett. Seiner Mutter hat er nichts von dem Blitz erzählt. Als Entschuldigung hätte es ohnehin nicht getaugt, sie hätte ihm kein Wort geglaubt. Und sein lädiertes und schmutziges Gesicht ist für sie ja ein ziemlich vertrauter Anblick. So kommt er häufig vom Training nach Hause.
Sie kocht ihm einen Tee und lässt ihn dann in Ruhe. Am Nachmittag steht Asis auf, am nächsten Tag geht er wieder zur Schule, und nach der Schule steht er wie üblich mit seinen Kameraden auf dem Aschenplatz, als sei nichts gewesen. Sein Kopf und sein Bein schmerzen noch ein wenig, aber auch nicht mehr als nach den üblichen Verstauchungen und Prellungen. Und Asis ist nie ein wehleidiger Junge gewesen.
Nach einer Woche hat Asis den Vorfall und den fremden Mann fast vergessen. Nur die Brandnarbe auf der Stirn erinnert ihn daran, dass es diesen Unfall wirklich gegeben hat. Aber Asis schaut selten in den Spiegel. Und es ist nicht die einzige Narbe, die er hat. Wunden und Narben gehören so selbstverständlich zu seinem Alltag wie die Bohnen zum Frühstück oder die graue Schuluniform zum Unterricht.
2
Sein vierzehnter Geburtstag geht vorüber, ohne dass irgend jemand ihn beachtet hätte. Im Jemen werden Geburtstage nicht gefeiert. Aber er selbst hat daran gedacht. Er fragt sich, warum man in Amerika Geburtstagspartys veranstaltet und sich beschenkt, in seiner Heimat aber nicht einmal einen Gedanken daran verschwendet. Freut sich niemand über den Tag, an dem ein Mensch das Licht der Welt erblickt hat? Gut, sein Vater und seine Mutter kennen nicht einmal das genaue Datum ihrer Geburt. Aber der Geburtstag ihrer Kinder müsste doch ein Anlass zur Freude sein, oder?
Vielleicht muss man so reich wie die Amerikaner sein, um Geburtstage feiern zu können. Für seine Eltern ist er jedenfalls nicht nur ein Geschenk gewesen, sondern auch eine ständige Bürde. Überhaupt haben die Menschen im Grunde keinen eigenen Verdienst an ihrem Dasein, Anfang und Ende des Lebens liegen allein in Gottes Hand. Wenn also jemand eine Party schmeißen müsste, wäre es vor allem Gott.
Asis weiß, dass er mit diesen Gedanken einen gefährlichen Weg beschreitet, ist aber noch nicht zufrieden. Wird denn im Westen ein Geburtstag deshalb gefeiert, weil es jemand verdient hätte, geboren worden zu sein? Liegt der Sinn dieser Feier nicht vor allem darin, dass es sich gerade nicht um eine Art Siegesfeier oder Pokalgewinn handelt, sondern dass das einfache, verdienstlose und vollkommen ungerechtfertigte Dasein gefeiert wird: »Wie schön, dass es dich gibt, Asis!«
Ob sich Gott wenigstens freut? Asis versucht, sich mit den Augen Gottes zu sehen. So sehr er sich auch bemüht, viel Liebenswertes kann er an sich nicht entdecken. Mit zwiespältigen Gefühlen registriert er die unübersehbaren Veränderungen, die in den letzten Monaten mit ihm vor sich gegangen sind. Das alles kam nicht unerwartet, ähnliche Veränderungen hat er bei seinen Kameraden, die ihm ein wenig voraus waren, bereits mit einer Mischung aus Befremden und Eifersucht studieren können: Das sprießende Haar unter den Achseln, zählbar noch, aber von ganz anderer Art als das Kopfhaar, knisternde, drahtige Spiralen, die Stimmen, rauer, tiefer nach Wochen des unentschiedenen Auf und Ab, und vor allem die Gerüche der schwitzenden Kameraden auf dem Fußballplatz, streng, animalisch, erwachsen, obwohl es, bis auf einen ersten schwarzen Flaum auf der Oberlippe, doch immer noch Kindergesichter sind.
Dann die verstörenden Auswüchse im Verborgenen, über die er mit niemandem reden kann. Nicht, dass er sich ernsthaft deswegen sorgte. Das filzige Tierhaar, dichter als in seinen Achselhöhlen, wird er, wie die anderen Männer, im Hamam abrasieren, wenn er sich das Barthaar zu schneiden beginnt. Dass alles nun größer und praller geworden ist, was vorher allein zum Pinkeln diente und sonst allenfalls einigen leichtfertigen Alten ein Anlass zu Zoten und Anspielungen bot, erfüllt ihn sogar mit zunehmendem Stolz, weiß er doch immerhin von Rüden, Hähnen und Böcken, wofür diese Körperteile über das Pinkeln hinaus noch Verwendung finden und dass für diesen Zweck durchaus auch die Größe zählt, um zum Ziel zu kommen oder zumindest Eindruck zu schinden.
Mehrfach hat er in amerikanischen Filmen gesehen, wie die Jungen über diese Dinge Witze reißen oder, noch erstaunlicher, mit ihren Eltern ernsthaft darüber reden. Ob das wahr ist? Unvorstellbar, mit seinem Vater darüber zu sprechen. Mit einem älteren Bruder vielleicht. Aber er hat keinen älteren Bruder.
Bis in die Träume reichen die Veränderungen. Hat er als Kind überhaupt geträumt? In den letzten Monaten sind die Träume so lebendig, dass er manchmal mitten in der Nacht aufgeschreckt ist, weil er die Traumerlebnisse für wirklich gehalten hat. Er hätte gerne gewusst, ob es den anderen genauso geht, mustert verstohlen die auf einmal fettigen und pickeligen Gesichter der Kameraden, die aussehen, als würden sie sich seit Wochen nicht mehr waschen, spürt denselben forschenden Blick auf sich selbst gerichtet, doch niemand spricht oder macht auch nur eine Anspielung auf die offensichtlichen Verwandlungen.
Früher hat er nicht über sich nachgedacht. Zumindest kann er sich nicht daran erinnern. Und nun vergeht kaum ein Tag, an dem ihm nicht etwas zur Frage wird, was ihm bisher immer selbstverständlich schien. Am fremdesten ist ihm das Gesicht, das ihn nun aus dem Spiegel anblickt. Es erweckt den Eindruck, als habe er es nie zuvor richtig gesehen, es war einfach sein Gesicht. Nun hat er Mühe, dieses fremde Antlitz mit sich selbst in Verbindung zu bringen. Es kommt ihm wie eine Maske vor, die er sich gewaltsam überstreifen musste, um überhaupt ein Gesicht zu haben. Sein Selbstbild ist eher roh und verschwommen, als habe man ihm die Haut abgezogen.
Das Gesicht im Spiegel wirkt, trotz einiger Pickel und Mitesser, durchaus ansehnlich: große schwarze Augen, eine gerade Nase, schön geschwungene Lippen, annähernd gerade weiße Zähne, einige Narben, die man aber nur sieht, wenn das Haar fingernagelkurz geschnitten ist, leicht abstehende Ohren, die allein der als störend empfindet, der Makellosigkeit mit Schönheit verwechselt.
Mag sein, dass die meisten dieses Gesicht alles in allem für ein liebenswertes halten würden, aber es ist eben nicht sein wirkliches Gesicht! Asis’ Miene verfinstert sich, er kneift die Augen zusammen und presst die Lippen aufeinander, ja, so sieht es seinem Selbstbild schon ähnlicher!
3
Die Tage verlaufen wie immer. Am Morgen geht Asis zur Schule, am Nachmittag spielt er mit seinen Kameraden Fußball und träumt von einer Profikarriere. Und manchmal hilft er seinem Onkel in der Werkstatt oder begleitet seine Mutter zu einem Arzt oder einer Behörde.
Doch dann, etwa zwei Wochen nach dem Blitzschlag, trifft es Asis erneut, nicht wie Feuer aus heiterem Himmel, aber doch so unerwartet, dass ihm wieder für einen Augenblick das Herz stehen bleibt: Aus einem Frisörsalon dringt Musik, traditionelle Lautenmusik, wie Asis sie unzählige Male gehört hat. Seine Eltern mögen diese Art von Musik, auch wenn sie nicht besonders musikalisch sind. Er und seine Freunde hingegen lieben arabischen Rap und Hiphop. Daher versteht er nicht, was ihm gerade widerfährt: Er bleibt vor dem Laden stehen, lauscht der ’Ud und fühlt die Töne in sich eindringen, dass es ihm schier das Herz zerreißt. Tränen treten ihm in die Augen, es ist lächerlich, er hat seit Jahren nicht mehr geweint, und ein Schmerz sprengt seine Brust, der mit nichts zu vergleichen ist, was er je zuvor verspürt hat. Dabei sind es doch nur Töne, die aus einem billigen Kassettenrekorder auf die Straße dringen, Töne, die er nicht mal zu benennen weiß. Er hat als kleiner Junge hin und wieder mal trommeln dürfen, wenn die Hochzeitskapelle eine Pause gemacht hat, Trommeln war in Ordnung, klingen die Schläge doch wie ein rasendes Herz oder wie Gewehrsalven. Aber Flöten und Lauten, das sind Instrumente für Barbiere und Bader.
Er reißt sich zusammen, wischt sich die kindischen Tränen aus dem Gesicht und rennt das letzte Stück zum Trainingsplatz. Wie immer geht es laut zu unter den Kameraden. Und er ist glücklich über die Anfeuerungsrufe und die wilden, unartikulierten Schreie. Es sind mehr Klänge als Worte, aber sie sind kraftvoll, körperlich, unvermittelt und direkt wie ein Foul im Strafraum oder die Umarmungen nach einem Tor.
Auf angenehme Art erschöpft und zerschlagen kehrt Asis am Abend heim und geht nach einem raschen Abendessen und einer kurzen Katzenwäsche früh zu Bett.
Mitten in der Nacht wacht er auf. Musik erfüllt sein Zimmer. Verwirrt schaut er sich um. Es gibt kein Radio in seiner Schlafkammer. Jemand will ihm einen Streich spielen, denkt er. Natürlich hat er niemandem von jenem Augenblick der Rührung erzählt, aber vielleicht hat ihn jemand dabei beobachtet, wie er mit tränenüberströmtem Gesicht einem Lautenstück gelauscht hat.
Er macht Licht und schaut sich in seinem Zimmer um. Die Musik ist so deutlich zu hören, als säße der ’Udspieler im selben Raum. Aber in dieser kargen Kammer gibt es nichts außer seiner Matratze und der Wäschetruhe. Er öffnet die Tür. Im Haus ist es still. Dann das Fenster, aber auch auf der Straße ist alles ruhig. Er kneift sich in den Arm, so fest, daß er aufschreit. Doch es gibt keinen Zweifel, er ist wach, und die Musik ist so deutlich zu hören wie sein Schrei. Er tritt zornig gegen die Matratze, dann noch heftiger gegen die alte Nussbaumtruhe. Weinend vor Schmerz ergreift er die verstauchten Zehen und hinkt zu seinem Nachtlager zurück. Es nützt alles nichts: Die Musik ist in seinem Kopf.
Er legt sich wieder hin und hört zu. Was soll er sonst auch tun? Und sie klingt im Grunde gar nicht übel, wenn auch ganz anders als die Musik, die er sonst hört. Er kann sie nicht wirklich beschreiben, dieses springbrunnenartige Aufschäumen und Zerperlen der Töne. Und nicht nur die Art der Musik ist ihm fremd, sondern auch das Gefühl, das sie in ihm weckt. Es ist allenfalls mit den Tagträumen vergleichbar, wenn er sich als gefeierten Stürmer im Stadion von Kuwait oder Abu Dhabi sieht. Aber auch dieser Vergleich hinkt. Ein Traum, ja, aber zarter, tiefer, unlösbarer als diese groben Heldenphantasien.
Er steht noch einmal auf, schaltet das Licht an und durchsucht alle Taschen. Die Musik klingt weiter, jeder Ton so klar und rein, wie kein Lautsprecher der Welt ihn würde erzeugen können. Endlich findet er sie, die Karte von Dr. Fuad al-Halawi, Kardiologe.
Kardiologe, das klingt doch wie Nervendoktor oder Irrenarzt. Hat der Mann ihm nicht angeboten, ihn aufzusuchen, wenn er Probleme bekäme? Und wenn es in diesem ganzen Irrsinn etwas gibt, dessen er sich gewiss ist, dann in diesem Punkt: Der Blitz ist schuld!
4
Als Asis geboren wurde, wohnten in Ibb noch fünfzigtausend Menschen. Inzwischen sind es doppelt so viele. Die alten Häuser sind fünf- und sechsstöckige Türme aus dem orangefarbenen, grau und rosa schimmernden Tuffgestein der Umgebung. Die Altstadt liegt fast genauso hoch wie die Hauptstadt Sanaa. Aber da Ibb in den letzten Jahren unaufhörlich gewachsen ist, ziehen sich Häuser und Straßen nun hinunter bis ins ehemals grüne Tal.
Dr. Fuad al-Halawi wohnt im neuen Stadtzentrum unterhalb der Altstadt. Asis ist nur selten in diesem Viertel, seit ihr alter Fußballplatz von Neubauten verdrängt wurde und sie auf den Aschenplatz direkt hinter der Altstadtmauer ausweichen mussten.
In der Altstadt ist jede Gasse gepflastert. Die Gassen verlaufen so wirr über die Bergkuppe, dass Fremde sich schnell verlaufen. Manche sind so eng, dass man schon Schwierigkeiten hat auszuweichen, wenn einem ein vollbepackter Esel entgegenkommt. Trotzdem wagen sich manche Bewohner und Händler mit ihren Automobilen hinein. Nicht selten verursachen sie ein großes Verkehrschaos, wenn sie in den engen Gassen stecken bleiben oder ihnen ein anderer Wagen entgegenkommt. Dann gibt es ein wildes Gehupe und Geschrei.
Früher gab es Stadttore, die nach al-’Aischa, dem Nachtgebet, geschlossen wurden. Davon weiß Asis nur aus den Geschichten der Älteren, die sich nach den ruhigen Nächten ohne Motorengeheul und wütenden Hornstößen zurücksehnen. Asis aber ist es so lieber. Wie könnte er sonst in die Stadt zurückkehren, wenn ihr Spiel mal wieder kein Ende fände?
Hier in der Neustadt sind noch immer viele Straßen nicht asphaltiert. Zu schnell wachsen neue Häuser die Hänge hinauf und hinab, die meisten unfertig und ohne jeden Plan. Fast alle sind aus Beton gebaut, mit großen Fenstern selbst zur lauten und staubigen Straße hin, während in den alten steinernen Wohntürmen viele Fenster noch aus dünnen Alabasterscheiben bestehen, sodass zwar Licht in die Innenräume dringt, aber niemand von außen hineinsehen kann.
Dr. Fuad al-Halawi ist nicht überrascht, Asis plötzlich in seinem Sprechzimmer zu sehen.
»Wie geht es dir, junger Mann? Du hast doch nicht in deinen jungen Jahren schon Herzprobleme?«
»Sie haben gesagt, ich solle zu Ihnen kommen, wenn der Blitz einen bleibenden Schaden angerichtet haben sollte.«
»Und hat er das?«
»Seit einigen Tagen höre ich Musik in meinem Kopf, Lautenmusik. Sie lässt sich nicht abstellen.«
»Das sind vermutlich akustische Halluzinationen. Das kann vorkommen, wenn ein starker Stromschlag unser Gehirn trifft.«
»Was ist das für eine Krankheit, diese Halluzoo –«
»Eine Halluzination ist eine Art Traum, ohne dass du schläfst.«
»Aber es ist nicht wie ein Traum. Es ist vollkommen wirklich. Ich höre die Musik so deutlich, wie ich Ihre Stimme höre!«
»Ich bin kein Nervenarzt, ich bin Herzspezialist. Doch bin ich sicher, dass diese Halluzinationen in einigen Tagen wieder verschwinden werden. Wenn du dir aber Sorgen machst, kann ich dich zu einem Neurologen schicken, der sich deinen Kopf genauer ansieht.«
»Muss ich mir denn Sorgen machen?«
»Ich glaube nicht. Quält sie dich denn, die Musik?«
»Nein, eigentlich ist sie ganz schön. Aber sie gehört nicht zu mir. Ich interessiere mich nicht für Musik. Zumindest nicht für diese Art von Musik.«
»Vielleicht solltest du ihren Ruf ernst nehmen.«
»Und Musiker werden und die Leute unterhalten?«
»Die Musik existiert nicht nur zu unserem Vergnügen, Asis!«
Wütend verlässt Asis die Praxis von Dr. Halawi. Ein Herzspezialist, das ist nun wirklich das Letzte, was er braucht! Soll der Kerl sich doch um seine Herzensangelegenheiten kümmern und ihn, Asis, in Ruhe lassen. Unzufrieden kickt er eine leere Plastikflasche vor sich her. Es geht bereits auf al-Maghrib, das Abendgebet zu und ist bereits zu spät, um noch zum Training zu gehen.
Wenn er nur wüsste, wie er diese Töne aus seinem Kopf herausbekäme! Nein, verrückt ist diese Musik in seinem Kopf nicht, aber sie klingt auch nicht so wie die Lieder der berühmten ’Udspieler, die seine Eltern so sehr mögen. Ja, diese Art von Musik hat Asis bisher noch nie gehört. Das einzige Wort, das ihm dazu einfällt ist Wassermusik, Nieselregen, Schauer, Sturzbäche, Fontänen … Er war noch nie am Meer, aber vielleicht klingen die Wellen so, wenn sie gegen die rasiermesserscharfen Klippen branden und in Myriaden silberner Tröpfchen zerstäuben oder auch nur sanft wie eine Lammzunge an den puderfeinen Strand lecken. Und ohne sich wehren zu können, überschwemmt ihn die Musik in seinem Kopf mit einer bisher nie gekannten Sehnsucht nach dem Meer.
5
Was für ein merkwürdiges Instrument! Bisher hat Asis es immer für plump gehalten, dickbäuchig wie eine Schwangere und langhalsig wie eine hölzerne Giraffe, dann dieser kleine, in den Nacken geworfene Kopf mit den acht Ohren. Nein, das ist kein Instrument zum Verlieben, das ist allenfalls ein missgebildetes Kind, das man nur bemitleiden kann, wenn man es nicht direkt nach der Geburt ersäuft hat.
Asis streicht über die Stahlsaiten. Wenn sie reißen, denkt er, können sie mir gnadenlos einen Finger oder ein Ohr abreißen. Und in sein Mitleid mischt sich ein erster Anflug von Respekt.
Asis weiß, es ist ein altes Instrument. Schon der junge Daud spielte darauf für König Suleiman und für seinen Freund Jonathan, erzählt ihm Dr. Fuad, als er vollkommen überraschend vor Asis’ Elternhaus auftaucht und ihm die alte Laute in die Hand drückt.
»Bei mir zu Hause stand sie nur ungenutzt herum. Dabei ist es ein sehr wertvolles Instrument von einem berühmten Lautenbauer in Damaskus. Es ist eine wahre Schande, dass seit Jahren niemand mehr darauf gespielt hat!«
Asis weiß nicht, was er sagen soll. Ehe er das Geschenk ablehnen oder sich auch nur dafür hätte bedanken können, ist Dr. Fuad schon wieder verschwunden. Er wird es ihm gleich Morgen nach der Schule zurückbringen, nimmt er sich vor. Was soll er mit diesem hässlichen Ding? Und was bringt Musik überhaupt? Zu Hause gibt es keinen Plattenspieler oder Kassettenrekorder oder auch nur ein Radiogerät und natürlich keinerlei Instrument. Mit den Freunden hört er zwar hin und wieder Musik, aber das ist etwas anderes. Dabei geht es gar nicht so sehr um die Klänge, sondern viel mehr um Songtexte, um das Aussehen der Sänger, um ihre Freundinnen, Autos oder Skandale. Rhythmus und Melodie klingen in seinen Ohren so gleich, dass er sich weder die Titel noch die Bandnamen merken kann. Musik ist einfach eine Art Hintergrundrauschen des Zusammenseins, wenn sie gerade mal nicht Fußball spielen.
Asis folgt dem alten Aquädukt, der früher einmal die Stadt mit Regenwasser aus dem Gebirge versorgt hat. Mit der ’Ud auf dem Rücken wandert er bis zu einer einsamen Schlucht, in der ein kleiner Wasserlauf den steilen Berg hinabstürzt. Früher sei es ein richtiger Wasserfall gewesen, hat ihm sein Vater erzählt, als er ihn zum ersten Mal hierher führte. Das Wasser habe sich in kleinen Becken gesammelt, und die Jungen aus der Stadt seien häufig hierher gekommen, um in den Becken zu baden oder unter dem Wasserfall herumzutollen.
Normalerweise redet sein Vater wenig, wenig mit Asis, und noch weniger mit seiner Frau und seinen Töchtern. Die Stimme von Asis’ Mutter ist sanft, Asis hört sie gerne. Doch die Stimme seines Vaters ist noch zarter, zerbrechlicher. Selten erhebt er sie gegen seine Frau oder seine Kinder, meistens schweigt er.
Sein Vater hat keine eigene Werkstatt, sondern arbeitet auf einer Plastikplane am Straßenrand. Auf der schwarzen Folie breitet er Leder- und Gummistücke, Zwirn und Aale und einige vergessene Schuhe aus. Am Mittag spannt er einen alten, löchrigen Regenschirm zum Schutz vor der Sonne auf. So sitzt er dort vom frühen Morgen bis zum Anbruch der Dämmerung. Eine von Asis’ Schwestern, meistens die Jüngere, Aschraka, bringt ihm am Mittag einen Topf mit Bohnen und Brot. Sonst unterbricht er seine Arbeit nur zu al-Thuhr und al-’Asr, zum Mittags- und Nachmittagsgebet, das er in der nahe gelegenen Dschamia kabir, der Großen Moschee von Ibb verrichtet.
Aus dem Wasserfall ist ein Rinnsal geworden, das Wasser steht grün und trüb in den halbvollen Becken, niemand badet mehr hier.
»Früher hat es von Ende Mai bis Anfang September fast täglich geregnet«, seufzt seine Mutter in jedem Sommer aufs Neue. Doch inzwischen herrscht auch in Ibb Regen- und Wassermangel. Und die kaum zwei Stunden entfernte Großstadt Taiz muss bereits vollständig durch Tankwagen mit Wasser aus anderen Provinzen versorgt werden.
Asis mag dieses abgeschiedene Tal. Er schließt die Augen und hört dem Wasser zu. Am Anfang vernimmt er nicht mehr als ein graues, feinkörniges Rauschen. Doch je länger er lauscht, umso mehr teilt der Klang sich wie die einzelnen Schnüre eines Perlenvorhangs. Der Wasserfall klingt nun vielstimmig, zu vielstimmig vielleicht, weil die verschiedenen Melodien in diesem Klangteppich kaum zu verfolgen sind. Asis versucht es trotzdem. So, wie das Wasser sich an den Steinblöcken und ausgewaschenen Rinnen verzweigt, getrennte Wege fließt, unterschiedlich stürzt und aufschlägt, folgt Asis den verschiedenen Tonsträngen, schält ihr Muster aus der Lautgischt und erfindet seine eigene Stimme dazu. Nein, nicht er erfindet die Stimme, seine Laute spielt mit dem Wasser, seine Finger fließen über die Saiten, die Töne perlen aus dem hölzernen Bauch, nicht in einer bestimmten Tonfolge, sondern eher als ein dichter Klang, als würde er ein Glas Murmeln schütteln oder eine Perlenkette zerreißen und die Perlen auf den harten Marmorboden prasseln lassen. Gebannt lauscht er diesem Gespräch, und es kommt ihm vor, als sei es die ’Ud selbst, die spräche.
6
»Rate, wer auf dem Hochzeitsfest meines Bruders die ’Ud spielen wird!« Asis hört das Angeberische in Hamids Stimme und zuckt nur gleichgültig mit den Achseln. »Bilal!«, ruft Hamid stolz, als habe nicht sein reicher Vater, sondern er selbst diesen Mann zur Hochzeit Nassars eingeladen. Asis’ Mimik bleibt unbewegt. Aber er weiß natürlich, wer Bilal ist. Wer hätte seinen Namen nicht gehört! Er ist der berühmteste ’Ud-Spieler der Arabischen Halbinsel und stammt aus Dschibla, gar nicht weit von Ibb entfernt. Sein Vaters- und Familienname ist unbekannt. Manche sagen, er sei Waise, bösere Zungen behaupten, seine Familie habe ihn verstoßen, da sein Musikantendasein Schande über die eigene Sippe gebracht habe. – Offenbar ist es im Jemen möglich, verehrt und ehrlos zugleich zu sein.
Die bevorstehende Ankunft des Meisters verbreitet sich, zweifellos von Hamid geschürt, wie ein Lauffeuer in der Altstadt. Selbst Asis’ Herz schlägt höher, auch wenn er sich, zumindest Hamid gegenüber, nichts davon anmerken lässt. Er hat Bilal nie zuvor gesehen und nie sein Lautenspiel gehört. Es gibt keine Tonaufnahmen davon. Doch als Hamid nun auf einen alten Mann weist, der mit gebeugtem Haupt, die Hände in den Taschen seiner schmutzigen Hose vergraben, über den Platz zu Karims Teehaus schlurft, kann er es nicht glauben.
»Das ist Bilal?«
Hamid nickt eifrig. Offenbar sieht er nicht das, was Asis sieht.
»Stell mich dem Meister vor«, bittet Asis seinen Freund.
»Das kannst du nicht wirklich wollen«, antwortet Hamid.
»Und warum nicht?«
»Wenn man ihn auf der Straße anspricht, muss man damit rechnen, von ihm geohrfeigt oder geküsst zu werden.«
Asis muss seinem Freund recht geben. Weder will er die Faust, noch die Lippen dieses Mannes spüren.
Am Abend sitzt er, der alte gebeugte Mann, im großen, festlich geschmückten Hochzeitszelt der Familie al-Khasami, eine Schale Tee und eine Schüssel Reis vor sich. Er schweigt, während er isst und trinkt. Asis beobachtet ihn vom Zelteingang. Die anderen Festgäste, ausschließlich Männer, beachten ihn nicht.
Vor allem durch den Verkauf seiner Felder an Bauunternehmer ist Abdul-Latif al-Khasami, Hamids Vater, reich geworden. Das Haus der al-Khasamis steht oben auf dem Berg, in der Nähe der alten Burg, mit Blick über die ganze Altstadt und das Neubaugebiet im Tal.
Das Festzelt nimmt die gesamte Länge und Breite der Gasse vor dem Beit al-Khasami ein. Es fasst wohl dreihundert Gäste oder mehr. Jeder, der die Gasse nur durchqueren will, ist zu einem weiten Umweg gezwungen.
Stimmengewirr dringt auf die Gasse, und nur einige leise, ein wenig verloren wirkende Lautentöne. Die Männer im Zelt reden laut und wild durcheinander. Kaum jemand hört dem berühmten Bilal zu. Den alten Mann scheint es nicht zu kümmern. Unrasiert und ein wenig schmuddelig sitzt er in der Nähe des Bräutigams, der angesichts dieses Festes wesentlich verdrießlicher dreinblickt.
Die reisverklebten Hände wischt sich Bilal an der Hose sauber. Die Hände scheinen das einzige zu sein, dessen Reinlichkeit dem Alten am Herzen liegt. Dabei müsste er doch durch seine Auftritte genug verdienen, um sich ansehnlichere Kleidung leisten zu können und nicht in dem erbärmlichen Zimmer des Funduq al-Arisa hausen zu müssen.
Als Hamid Bilal im Auftrag seines Vaters ein großes helles Zimmer im Beit al-Khasami anbietet, lehnt Bilal die Einladung schroff ab. »Du glaubst, ich passe in euren Palast?«, knurrt der Alte mürrisch. »Schau doch hin, Junge! Was soll ich alter Dreckskerl in einem großen sauberen Zimmer!«
Als Hamid diese kurze Begegnung seinem Freund erzählt, kann Asis es kaum glauben. Wie kann ein Mensch so wunderbare Töne hervorzaubern und zugleich so hässliche Worte von sich geben?
Asis zieht sich einige Schritte vom Zelteingang zurück und stimmt leise und von den anderen unbeachtet seine Laute. Nur der Alte im Zelt, so scheint es Asis, hält kurz inne, als er dieses Echo der eigenen vertrauten Klänge hört. Er streicht über die Saiten, als seien es die seidigen Haare eines Kindes. Seine Lippen sind nach wie vor zusammengepresst, aber seine Augen lächeln.
Erneut berührt Bilal die Saiten, und diesmal klingen sie. Doch anders als die Hochzeitsklänge zuvor. Diese Töne, so empfindet es Asis, hören sich an wie noch niemals zuvor gespielt, wie in diesem Augenblick geboren. Und zugleich wirken sie so unerreichbar fern, als gehörten sie einer unwiderruflich verlorenen Vergangenheit an.
Asis weiß im Grunde nicht viel mehr über diesen ’Ud-Spieler, als Hamid ihm erzählt hat. Doch schon mit diesen ersten Tönen, die nichts mehr mit der Heiterkeit von Festmusik zu tun haben, öffnet sich die Tür zur Vergangenheit einen Spalt weit, und die Musik erzählt von glücklichen und schmerzhaften Augenblicken, für die es keine Worte gibt.
Je länger Bilal spielt, umso zerrissener und widersprüchlicher wird sein Spiel. Asis kann nicht sagen, ob es heitere Szenen sind, die in Katastrophen enden, oder Unglücksfälle, über die Bilals Musik hinwegzutrösten versucht. Hört denn niemand sonst die Verzweiflung, die aus der scheinbaren Leichtigkeit von Bilals Improvisation herausklingt?
Schließlich hält Asis es nicht mehr aus. Er zupft zwei, drei leise Töne in einer der langen, zum Zerreißen gespannten Pausen, die Bilal im Gespinst seiner Erzählung lässt, zwei, drei Töne, die nicht wirken, als falle ein junger ungeduldiger Schüler dem Meister ins Wort, sondern als berühre eine Hand die andere
Was hast du gesagt?, fragt Bilals Laute. Sag es noch einmal!
Und wieder nimmt Asis die losen Fäden der Geschichte auf und spinnt sie in eine hoffnungsvollere Richtung fort.
Nach und nach verstummen die Männer im Zelt, und auch auf der Gasse wird es still. Selbst im Haus, in dem die Frauen feiern, alle festlich gekleidet, so dass man nicht recht weiß, wer die Braut ist, tritt nach und nach Stille ein, Fenster öffnen sich, nachlässig verschleierte Gesichter blicken hinaus und lauschen.
An einem der Fenster steht Hamids Schwester Inaja, schöner als die Mondsichel bei sternklarer Nacht. Asis erinnert sich an sie noch als seilspringendes Mädchen, doch seit sie als junge Frau gilt, hat er ihr Gesicht nicht mehr gesehen.
Versunken in Asis’ und Bilals Spiel bemerkt sie nicht, dass der Junge sie anschaut, ihr Gesicht mit seiner Musik berührt, mit seinen Tönen über ihr mit Perlenschnüren geschmücktes Haar streicht, eine junge Königin Arwa. Sieht es, aber will es nicht bemerken, kennt sie ihn doch als Freund ihres jüngeren Bruders, ein Fußballverrückter, ja ein Kind noch, während sie doch bereits ihrem Cousin Kaizi versprochen ist und nach diesem bald das nächste Hochzeitsfest im Hause al-Khasamis ansteht. Asis, auch in diesem Wort schimmern Perlen auf, nun erinnert sie sich an seinen Namen. Offenbar ist er mehr als nur ein staubverkrusteter oder schlammbespritzter Stürmer mit aufgeschürften Knien, er scheint auch ein junger Magier zu sein, mit der seltenen Macht, die Menschen glücklich zu stimmen. Oder zutiefst unglücklich.
Bilal hat in seinem langen Leben genug Dinge erfahren, um sich nicht mehr von der leichtsinnigen Zuversicht der Jugend mitreißen zu lassen. Unerbittlich erzählt er weiter von trügerischem Glück und unerfüllter Hoffnung. Und mal kraftvoll trotzig, mal engelhaft schwebend flicht Asis seine jugendlichen Träume in Bilals Bitterkeit. Die Zuhörer lauschen gebannt diesem Zwiegespräch zwischen dem alten Meister und dem Jungen, den sie bisher nur als den Sohn des Flickschusters Ali Asadi kannten. Und dieser Spuk würde wohl die ganze Nacht fortdauern, würde Nassar, der Bräutigam, Bilal jetzt nicht in den Arm fallen und ihn, gröber als nötig, auffordern, zu den altbekannten Weisen zurückzukehren.
7
»Was bedeutet ’Ud?« – Es ist Bilal, der diese Frage ohne vorangegangenen Gruß an Asis richtet. Er hat das Festzelt vor der vereinbarten Zeit verlassen, aber niemand von den Feiernden scheint es zu kümmern.
»Ein Stück Holz«, antwortet Asis, mehr erstaunt als ängstlich.
Bilal schaut den Jungen grimmig an. »Ein Stück Holz? Schafskopf! Hast du in der Schule nicht aufgepasst?«
»Ich verstehe nicht, was Sie meinen, Meister.«
»’Ud ist abgeleitet vom Verb ’ada, zurückkehren, zugehören, zu etwas werden, sich verwandeln. ’Ud heißt also Rückkehr und Verwandlung!«
»Rückkehr wohin?« – Asis fühlt sich unbehaglich wie in der Schule. Zugleich aber ist dieser Alte anders als alle Lehrer, die er bisher gehabt hat, ernster, unerbittlicher, als gehe es um mehr als nur um die Bedeutung eines Wortes.
»Das Ziel kann ich dich nicht lehren. Aber den Weg. Du hast eine Gabe, Junge, die meine weit übersteigt.« Dem Alten scheint dieses Lob eine große Mühe abverlangt zu haben. Sogleich schränkt er es wieder ein: »Aber deine Fingertechnik ist eine Katastrophe, Schafskopf! Wenn du wirklich ein Meister werden willst, musst du üben, üben, üben! Denn die Technik ist es, in der die Gabe Laut wird. Und du fängst spät damit an. Wahrscheinlich wird deine Technik deiner Gabe ein Leben lang hinterherhinken!« – Den letzten Satz murmelt der Alte eher für sich selbst, als habe er den Jungen bereits vergessen, der mit hochrotem Kopf vor ihm steht.
»Trotzdem wollen Sie mich unterrichten?«
»Früher hatte ich immer nur Schüler, die die Saiten zupften wie einen Stacheldrahtzaun. Ich hatte das Unterrichten längst aufgegeben. Du weißt zwar nicht einmal, wie man eine ’Ud richtig stimmt. Aber du streichelst die Saiten, als seien sie aus Seide gesponnen.«
»Ich werde Sie nicht bezahlen können«, flüstert Asis, und erneut schießt ihm das Blut ins Gesicht. »Mein Vater ist ein einfacher Schuster.«
»Keine Angst, mein Junge, ich werde schon etwas finden, mit dem du dich erkenntlich zeigen kannst«, knurrt der Alte, »Komm an deinen schulfreien Tagen zu mir nach Dschibla!«
Er sitzt im Religionsunterricht und schreibt das Wort Inaja in sein Heft. Er weiß nicht, warum er das tut. Er schreibt es ein zweites Mal, in noch sorgfältiger gezeichneten Buchstaben.
Der Religionslehrer lässt die Klasse gemeinsam wiederholen, was er gerade gesagt hat. Asis’ Lippen sprechen mit den anderen die Worte nach, ohne zu begreifen, was sie da nachplappern.
Hamid, sein Banknachbar, stößt ihn an: »Was kritzelst du da vor dich hin?«
Asis schüttelt den Kopf und schlägt das Heft zu. »Nichts. Wieso?«
»Du weißt, meine ältere Schwester heißt Inaja!«
Dschibla liegt nur zehn Kilometer von Ibb entfernt, beharrt aber stolz auf ihre Eigenständigkeit. Obwohl die Stadt wesentlich kleiner ist als Ibb, ist sie doch größer an Geschichte. Vor tausend Jahren war sie einmal die Hauptstadt des Jemen.
Sie liegt auf der Kuppe eines Basalthügels. Über eine Steinbrücke betritt man die Unterstadt, und ein steiler Pfad führt von dort hinauf zur Oberstadt und zur Großen Moschee der Königin Arwa. Unmittelbar gegenüber der Moschee lebt Bilal, nicht in einem eigenen Haus, sondern in einem kleinen dunklen Zimmer des Funduq al-Arwa.
Nachdem der junge König Mukharam schwer erkrankte, übernahm seine Gemahlin, Arwa bint Ahmad, die Regierungsgeschäfte. Und als Mukharam bald darauf starb, wurde Arwa Königin. Sie regierte das Land bis zu ihrem Tod im Jahr 1138. Sie wurde zweiundneunzig Jahre alt. Jedes Kind im Jemen kennt diese Geschichte.
Unter ihrer klugen Herrschaft erblühte das Land. Sie ließ Terrassen zum Feldanbau und Aquädukte zur Wasserversorgung bauen. Sie legte auch den Grundstein zur Großen Moschee, in der sie nach ihrem Tod beigesetzt wurde.
Die Häuser in Dschibla sind ähnlich hoch und trutzig gebaut wie in Ibb, doch sind alle Türstürze und Fenstereinfassungen mit weißem Kalk verputzt. Nur Bilals Herberge wirkt düster und schäbig. Aber er lebt seit ewigen Zeiten hier, und in der Nachbarschaft erzählt man sich, dass er als junger Mann einmal in der Woche mit der Wirtin seines Hotels, einer alten Witwe, habe schlafen müssen, um die Kosten für die ärmliche Unterkunft zu begleichen. – Nun ist die Witwe seit einem halben Jahrhundert tot, längst führt eine Enkelin mehr schlecht als recht das Haus, und nur Bilal selbst könnte noch bezeugen, was an diesen Gerüchten der Wahrheit entspricht.
Niemand öffnet auf sein Klopfen. Aber die Tür ist nicht abgeschlossen. Also tritt Asis ein.
Meister Bilal sitzt am Tisch. Die Gaslampe brennt auf kleiner Flamme und lässt die Ecken des Zimmers im Dunkel. Der Meister sitzt still und ein wenig gekrümmt da und versucht, weißen Zwirn in eine Nähnadel einzufädeln. Seine rechte Hand zittert. Auf den Schenkeln liegt die weiße Senna des Meisters, die wohl schon seit Längerem eingerissen ist und die Bilal nun flicken will.
Asis schämt sich, dass er unaufgefordert ins Zimmer getreten ist und nun den Meister in der ganzen Verletzlichkeit des Alters vor sich sieht. Bilal trägt nur sein Unterhemd und eine knielange Unterhose, während er das Ende des Fadens in den Mund nimmt und befeuchtet und dann zwischen Daumen und Zeigefinger hin und her rollt. Offenbar hat er Asis nicht erwartet. Asis nicht und auch keinen anderen Besuch.
Nun hält er die Nadel gegen das Licht, beugt den Kopf vor und versucht, den Zwirn durch das Nadelöhr zu führen. Aber das Zittern der Hände nimmt zu, je mehr er sie zur Ruhe zwingt.
Asis würde ihm gerne Nadel und Faden aus der Hand nehmen. Ihm wäre es mit Leichtigkeit gelungen, das störrische Garn ins Öhr zu zwingen, ist er in diesen Dingen doch schon als kleiner Junge seinem Vater zur Hand gegangen. Aber er befürchtet, den Alten zu beschämen. Er ruft leise seinen Namen: »Meister Bilal!« Doch der Alte müht sich weiter, als habe er Asis’ Stimme nicht gehört.
Endlich hat der Faden seinen Weg gefunden, und Bilal legt das zu flickende Gewand auf den Tisch. Die Arbeit scheint dem Alten Vergnügen zu bereiten. Er beginnt, ein Lied zu summen. Asis lauscht, aber er erkennt die Melodie nicht. Ja, er hat den Eindruck, dass der Meister erschreckend falsch singt und keinen Ton richtig trifft. Davon unbeirrt summt der Alte jetzt allerhand Variationen, die eher dem Zischen und Pfeifen der Gaslampe gleichen als menschlichem Gesang.
Asis darf nicht länger an der Tür stehen bleiben und seinen Meister, der sich alleine glaubt, bei seinen privatesten Verrichtungen beobachten. Es kommt ihm vor, als würde er den Meister nackt sehen. Er ruft noch einmal seinen Namen: »Meister Bilal!«, lauter, aber nicht so laut, dass sich der Meister erschrecken könnte. Er klopft gegen den hölzernen Türrahmen und fährt fort: »Ich bin’s, Asis! Sie haben mich gebeten, zu Ihnen nach Dschiblah zu kommen!« – Doch der Meister hebt nur einmal kurz den Kopf, als habe in einer der dunklen Ecken eine Maus leise geraschelt, und fährt dann unbeirrt mit seiner Näharbeit und seinem Lampengesang fort.
Laut aufstampfend tritt Asis ins Zimmer und ruft mit kräftiger Stimme: »Salam alaikum, Meister Bilal! Ich bin’s, Ihr neuer Schüler!« – Erschrocken wendet sich der Alte zu Asis um.
»Warum hast du nicht angeklopft, mein Sohn? Der Schüler tritt nicht einfach unaufgefordert ein!«
Der Alte weist auf einen Stuhl und fährt dann mit der Näharbeit fort, doch ohne weiter vor sich hin zu singen. Asis setzt sich.
»Du bist verdächtig still für einen Dreizehnjährigen«, grummelt Bilal schließlich, nachdem er den Riss geflickt hat. »Fast kommst du mir wie ein Dieb oder ein Spion vor, Junge!«
»Vierzehn«, antwortet Asis knapp.
»Was?«
»Ich bin vor einigen Wochen vierzehn Jahre alt geworden!«
Der Alte schüttelt den Kopf. Und plötzlich begreift Asis, dass das Alter seinen Meister hat schwerhörig werden lassen. Die Finger spielen auf den Saiten immer noch so kunstvoll, wie sie es seit Jahrzehnten geübt sind, aber der Meister hört es nicht mehr, hört seine eigene Stimme nicht mehr und nicht die leisen Töne des Alltags.
8
Früher ist er immer gleich hellwach gewesen. Dämmerte es draußen, ist er aufgesprungen und hat sich ohne nachzudenken in den Tag gestürzt. Nun liegt er lange mit geschlossenen Augen da, auf merkwürdige Weise unentschieden und zweifelnd. Nicht, dass ihn sein gegenwärtiges Leben abstieße. Aber irgendetwas in ihm beharrt darauf, dass es nicht sein Leben sei; dass hier ein Irrtum vorliegen müsse und der Blitz den Falschen getroffen habe.
Bilal ist kein Mensch, mit dem man gerne aufwacht. Um sein Nachtlager türmt sich ein Wall aus schmutziger Wäsche und Essensresten, und Asis’ erste Aufgabe ist es, das Zimmer des Meisters in Ordnung zu bringen. Am frühen Morgen wirkt Bilal besonders unappetitlich, nicht nur, will er ein alter Mann ist, sondern weil er sich darüber hinaus um seine Körperpflege ebenso wenig kümmert wie um die Sauberkeit seiner Behausung.
Während des Unterrichts wechselt Bilal kaum ein Wort mit Asis. Mit einem alten Holzlineal schlägt er auf Asis Finger, wenn er sie nicht richtig auf die Saiten setzt, und nickt kaum merklich, wenn sein Spiel Fortschritte macht. Ansonsten bleibt sein Gesicht mürrisch und abweisend.
Dann wiederum, in Momenten, in denen Schweigen wohl täte, beginnt er zu fabulieren und zu schwätzen, sodass selbst ein so junger und unerfahrener Mensch wie Asis die Geschichten des Meisters kaum glauben kann. Er ahnt, dass sie vor allem der Einsamkeit entspringen. Wenn Asis nicht da wäre, würde Bilal sie trotzdem erzählen, dem Tisch oder der Lampe. Aber da der Meister ihn in diesen Phasen unaufhaltsamer Redseligkeit genau beobachtet, zwingt Asis sich, eine Miene der Gutgläubigkeit aufzusetzen. Vermutlich geht es gar nicht anders, als sich zum Glauben zu zwingen! denkt er. Ist es nicht geradezu das Wesen des Glaubens?
»Früher hatte die ’Ud nur vier Saiten«, fabuliert der Meister.
»Früher?«, fragt Asis beflissen.
»In der Zeit des Propheten.«
»Das ist tausendvierhundert Jahre her!«
»Das Instrument ist fünfmal so alt!«, erklärt Bilal stolz, als habe er selbst es vor mehr als siebentausend Jahren erfunden. »Erst Ziryab fügte eine fünfte Saite hinzu.«
»Aber heute hat sie doch zehn Saiten.«
»Nein, fünf!«, beharrt der Alte. »Jede Saite ist ein Zwilling. Mit ihnen musst du das Stimmen beginnen. Nur wenn die Brüder in absoluter Harmonie schwingen, wirst du das Instrument beherrschen lernen.«
»Und wie harmonieren die Brüderpaare miteinander?«
»Das liegt ganz an dir. Jede Region, jede Musikerfamilie, ja jeder Musiker schafft eine eigene, für sie eigentümliche Stimmung. Manchmal stimmt ein guter Spieler sein Instrument sogar für jedes Lied neu, je nach dem, in welcher Farbe es klingen soll.«
»Also kann ich sie stimmen, wie ich will!«, wirft Asis lächelnd ein.
»Diese Freiheit, mein Junge«, murmelt der Alte, »ist kein Segen, sie ist ein Fluch!«
Manchmal aber vergisst Asis das Misstrauen, und die Stimme des Meisters beginnt, ihn fortzutragen, wie die Töne, die er seiner Laute entlockt. Dann ist es nicht die Erzählung, sondern der Rhythmus, der Klang, wie sie erzählt wird, die ihn in die Lügen eintauchen lässt, ohne in ihnen zu ertrinken.
»Die Wahrheit ist, dass die erste ’Ud bereits von Lamech, dem Urururenkel von Adam gebaut wurde. Vorbild war sein Sohn, der tot in einem Baum hing. Der Wind fuhr durch seine Rippen und erzeugte einen klagenden Ton. Also formte Lamech das Instrument wie den Brustkasten seines Sohnes.«
»Wieso hing der Junge tot im Baum?«
»Das weiß ich nicht. Vielleicht war es ein Unfall, vielleicht hat er sich auch selbst aufgehängt. Wen kümmert’s! Den Vater offenbar nicht. Sonst hätte er sich von dem toten Sohn wohl kaum zu diesem Instrument der Freude und des Vergnügens anregen lassen, nicht wahr?«
Einmal entschlüpft Asis die Frage, wann der Meister denn bete oder die Moschee besuche. Er selber nimmt es mit der Frömmigkeit zwar nicht so genau. Doch ein Mensch wie Bilal ist ihm in seiner Heimat bisher noch nicht begegnet.
»Nie, wenn ich etwas Wichtigeres zu tun habe«, antwortet der Meister mürrisch.
Etwas Wichtigeres als das Gebet? fragt sich Asis, ohne seine Frage laut zu stellen.
»Wenn sie wenigstens sängen, anstatt zu flüstern oder zu schreien!«, fährt Bilal wütend fort. »Sie benehmen sich, als wollten sie gar nicht, dass Gott sie hört! – Nun geh zur Moschee, verrichte dein Gebet und lass mich mit deinen Fragen in Ruhe, Junge!«
Erleichtert verlässt Asis das dunkle Zimmer, tritt hinaus in den blendendhellen Freitagmorgen und macht sich auf den Weg. Doch erreicht er sein Ziel nicht, wenn sein Ziel denn ein Gotteshaus gewesen ist. Er lässt sich von einigen anderen Moscheeschwänzern verlocken, mit ihnen Fußball zu spielen. Nicht einmal ein schlechtes Gewissen haben sie, im Gegenteil, endlich haben sie die ganze Straße für sich, während die Männer sich zum Gebet in der Moschee versammeln. Und sie spielen voller Dankbarkeit so lange, bis die Straße wieder von Fahrzeugen und Verkaufsständen verstopft ist.
In dieser Stunde, findet Asis, hätten sie Gott mehr gelobt, als sie es in der Moschee vermocht hätten. Die Musik, die Melodien in seinem Kopf, und auch die vielen freien Stunden, die er bei seinem Meister verbracht hat, haben ihn einsam gemacht. Und er will keinesfalls so werden wie Bilal, ein bitterer alter Mann.
Dann wieder mag er genau das an seinem Meister, was die meisten anderen Menschen wohl für wenig liebenswert halten würden: Seine schroffe, abweisende Art, die niemand vermuten würde, der ihn nur von seinen öffentlichen Auftritten kennt. Und die Rücksichtslosigkeit, mit der er die Wahrheit sagt, zumindest das, was er für wahr hält!
»In alter Zeit hat man noch geglaubt, die Laute habe magische Kräfte,« erklärt der Meister ernst. »Man hat sie auf Kriegszüge mitgenommen und während der Schlachten gespielt, um die eigenen Soldaten zu stärken und die Gegner zu schwächen.« Nach einer Pause fügt er lächelnd hinzu: »Heute erklingt sie vor allem auf Hochzeiten, die in den meisten Fällen ja nichts anderes sind als der Beginn des ehelichen Schlachtfelds.«
»Sie waren nie verheiratet, Meister?«, wagt Asis zu fragen, und bereut schon im nächsten Augenblick, diese Frage gestellt zu haben.
»Ich bin ein Bastard, Junge«, knurrt der Alte böse, »und habe Bastarde gezeugt. Ich habe viele Frauen gehabt, so viele, dass meine ’Ud niemals Grund zur Eifersucht fand. Ja, ohne ihre Hilfe wäre wohl kaum eine Frau mir räudigem Hund verfallen!« – Der Alte bemerkt Asis’ verstörte Miene, und von einem Wimpernschlag zum nächsten ändert sich erneut sein Ton.
»Aber auch das ist kein Segen, mein Sohn, glaub mir«, sagt er mit rauer Stimme, doch ohne jede Bosheit. »Wenn du dir ein glückliches Leben mit Frau und Kindern wünschst, dann lass deine Finger von diesem verfluchten Instrument!«
9
Asis sitzt mit der Laute im Schoß da und bewegt sich nicht. Seine Hände liegen regungslos auf den Saiten, und nicht einmal seine Lider senken sich. Er hat in den vergangenen Monaten viel gelernt, ohne jeden Zweifel, aber sein Meister ist verrückt, und wenn er, Asis, sich nicht vor diesem Meister schützt, wird er bald ebenso verrückt sein.
Bilal redet weiter, als gäbe es Asis gar nicht. Seine Augen starren durch Asis hindurch, er lächelt. »Blaue Töne«, sagt er. »Blaue Töne, aber was hören wir? Immer nur die roten und gelben!« – Der Meister legt sein großes Altmännerohr an das Schallloch, sein Brustkorb hebt und senkt sich unruhig. Dann zupft er an der äußersten Saite, so hart, dass sie einen scheppernden, schmerzhaften Misston von sich gibt. Bilal knurrt zustimmend.
»Fast schon violett. Die Flamme eines Schweißbrenners. Das Herz der Flamme!« – Sein Gesicht ist schweißbedeckt. Asis hat seinen Meister noch nie schwitzen gesehen. Er hatte angenommen, dass der Alte gar nicht mehr schwitzen könne. Die Stirn ist in Falten gelegt und noch zerfurchter als üblich. Er scheint wütend zu sein, obwohl er lächelt. Er reißt nun wie jemand, der gar nicht weiß, dass er ein Musikinstrument in Händen hält, an den Saiten. Hatte Asis zunächst noch geglaubt, der Meister mache einen Witz, so beginnt er, sich jetzt vor dem zu fürchten, was sich vor seinen Augen abspielt. Er versteht es nicht. Der Unterricht begann wie immer. Vielleicht war Asis ein bisschen weniger bei der Sache als sonst, aber das hat Bilal bisher nie gestört. Wenn sein Schüler dem Unterricht nicht aufmerksam folgt, ist es nur zu seinem eigenen Schaden.
»Rot, rot, rot!«, schreit Bilal verzweifelt und lächelt, wie ein Hund lächelt, der die Zähne fletscht.
Wie hat das alles begonnen? fragt er sich. Er denkt an zu Hause. Seine Mutter will schon seit Langem, dass er mit dem Lautenspiel aufhört und sich wieder auf die Schule konzentriert. Sein Vater schweigt, wie immer, wenn er eigentlich widersprechen, aber den häuslichen Frieden nicht gefährden will.
»Das klingt wie Klatschmohn«, brüllt Bilal und schlägt mit der Faust auf den Lautenhals. »Wie eine aufgeschnittene Kehle!« – Er gurgelt und spuckt, als wäre es seine eigene Kehle, in die das Schächtblut sickert.
Asis ist wie gelähmt. Was soll er tun, wenn der Meister nun wirklich den Verstand verliert? Bilal starrt ihn an. Und plötzlich scheint er wieder wahrzunehmen, was er sieht. Mit der vertrauten, etwas rauen und mürrischen Stimme sagt er: »Du hast bisher mit den Fingernägeln gespielt. Deswegen blieb dein Klang ein wenig kratzend. Hier, nimmt das!«
»Eine Feder?«
»Ja, ein Rischa. Mit dem Kiel einer Feder wurde die ’Ud von den alten Meistern gespielt. Dies ist nur eine Taubenfeder. Aber wenn du selbst ein Meister bist, bekommst du einen echten Rischa, eine Adlerfeder. Dann erst wird der Klang deines Spiels schwerelos sein.«
Auf dem Weg zurück nach Ibb wird ihm schlagartig bewusst, dass niemand ihn wirklich kennt, Hamid nicht, und nicht der verrückte Bilal, und schon gar nicht seine Eltern. Ja, und nicht einmal Gott! Er weiß im Augenblick ja nicht einmal selbst, wer er ist
Man kennt sich nur, geht es ihm durch den Kopf, wenn man nicht über sich nachdenken muss, wie der Fußball spielende Junge, der er war, bevor der Blitz ihn traf. Man fühlt sich doch erst krank, wenn man seinen eigenen Körper spürt. Sonst lebt man ganz selbstverständlich in ihm, ohne sich seiner ständig bewusst zu sein. Genauso verhält es sich auch mit der Seele!
Kaum ist er zu Hause, bittet sein Vater ihn, beim Zuschneiden des Leders zu helfen. Schon lange hat sein Vater ihn um nichts mehr gebeten. Und Asis begreift sofort, dass sein Vater nach einer Gelegenheit sucht, in Ruhe mit ihm zu sprechen.