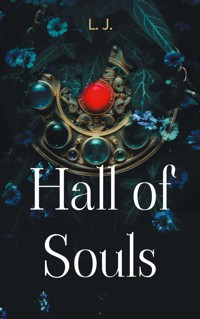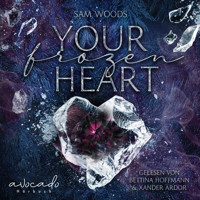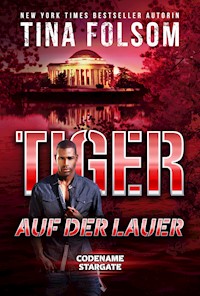10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schwarzkopf & Schwarzkopf
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Im Alter von zehn Jahren verliert Annabella ihre Eltern bei einem Gasunfall. Fortan lebt sie bei ihrer Großmutter auf einem abgelegenen Bauernhof. Beim Spielen auf einer Wiese trifft sie auf einen ebenfalls zehnjährigen Jungen, der behauptet, er sei Ukog aus der Dimension Darnoc und er sei hier, um ihre Welt zu zerstören. Aella wundert sich nicht darüber, sie ist es gewohnt, so etwas von Jungs in ihrem Alter zu hören. Vom ersten Moment an ist sie in den sonderbaren Jungen mit den außergewöhnlichen Augen verschossen und nennt ihn Ken, da sie Barbiepuppen liebt und sich sicher ist, dass er ihr Traumprinz sein muss. Als sie Ken erzählt, dass er zu schwach sei, um es mit den Menschen aufzunehmen, und dass er manchen von ihnen nicht einmal im Zweikampf überlegen wäre, erschrickt dieser zutiefst. Denn was Aella noch nicht weiß: Ken stammt tatsächlich aus einer anderen Dimension und hat sowohl den Auftrag als auch die Fähigkeiten, die gesamte Menschheit und die Erde zu vernichten. Da sein Volk nicht lügen kann und auch keine Lügen kennt, glaubt er Aella. Er beschließt zu trainieren, bis Aella der Meinung ist, er sei für den Kampf bereit, und folgt ihr nach Hause. Aellas Großmutter ist sich sicher, dass er von daheim ausgerissen ist und sich diese Geschichte ausdenkt, weil er misshandelt wurde, und nimmt ihn auf. Neun Jahre später, Aella steht kurz vor ihrem Abitur, wird ihr klar, dass Ken damals die Wahrheit gesagt hat. So muss sich Aella neben üblichen Teenager-Problemen wie Schulstress, Eifersucht, Unsicherheit und nervigen Klassenkameraden mit einer schweren Verantwortung auseinandersetzen. Als sie erkennt, dass sie Ken nicht umstimmen kann, beginnt sie, sich zu fragen, ob es tatsächlich mehr Leid auf der Welt gibt als Glück und ob es nicht das Beste wäre, wenn der Planet mit einem Schlag verschwinden würde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
JANINA EBERT
DIE LEGENDE DES WELTENWANDLERS
Fantasy-Roman
Für Annika
1
DAS ABLAUFDATUM EINER FREUNDSCHAFT
Menschen setzen sich gerne Deadlines. Manchmal tun sie es, um sich zuvor nicht mit dem Problem beschäftigen zu müssen. So ging es zumindest mir. Das Datum, vor dem ich mich fürchtete, war der Tag nach meinem 19. Geburtstag, den ich natürlich noch kräftig feierte, ehe ich mich der Sache stellen wollte, die ich seit geschlagenen neun Jahren verdrängte.
Der Wecker meines Smartphones riss mich unsanft aus den Träumen, ich drehte mich stöhnend zur Seite und erinnerte mich daran, was es gekostet hatte, um zu verhindern, dass es im nächsten Moment an der Wand zerschellte.
»Ich hasse dich«, murrte ich, während ich den Alarm ausschaltete. »Irgendwann stehe ich nachts auf und brülle dich an, damit du weißt, wie sich das anfühlt!« Ich stand auf und legte mich im nächsten Moment – unfreiwillig – wieder hin. »So kann ein Tag anfangen«, stöhnte ich und schob meine Schultasche zur Seite, über die ich gestolpert war. Wie konnte ich nur davon ausgehen, dass es mich zum Lernen animieren könnte, das Teil direkt vor dem Bett zu platzieren?
Humpelnd machte ich mich auf den Weg ins Badezimmer und versuchte dabei, nicht an die Schule zu denken. Ich stand kurz vor meinem Abitur, und obwohl ich deswegen nachts immer wieder schweißgebadet aufwachte, schaffte ich es, mich vor dem Lernen zu drücken. Ich begrüßte mein Spiegelbild mit einem herzhaften Gähnen und versuchte dann, meine Haare zu bändigen, damit nicht noch ein verliebtes Vogelpärchen auf die Idee käme, sich überglücklich auf sein neues Zuhause zu stürzen. Das war gar nicht so unwahrscheinlich – jetzt mal von meiner adretten Morgenfrisur abgesehen –, denn ich lebte auf dem Land oder ehrlicher gesagt mitten in der Pampa. Mit zehn Jahren hatte ich meine Eltern bei einem Gasunfall verloren. Meine Oma, die damals noch in derselben Stadt gewohnt hatte, war mit mir hierhergezogen, auf den abgelegensten aller Bauernhöfe, weil sie sich sicher gewesen war, dass mir Abstand und die Natur guttun würden. Der Hof war umgeben von Wald und Feldern, weit und breit stand kein anderes Haus, und es grenzte wahrlich an ein Wunder, dass es eine Bushaltestellte am Ende des Zufahrtsweges an der Landstraße gab. Diese hatte mir die Liebe aller anderen Kinder aus der Umgebung eingebracht, denn meinetwegen fuhr der Schulbus einen gewaltigen Umweg, und ich bekam jedes Mal, wenn ich ausstieg, eine zerknüllte Mathearbeit oder Ähnliches an den Kopf. Zum Glück waren diese Zeiten vorbei, da ich vor Kurzem in den Besitz eines Autos gekommen war, bei dem ich immer befürchtete, dass die Sperrmüllabfuhr es eines Tages mitnehmen würde.
Nachdem ich einigermaßen zufrieden mit meinem Aussehen war, stieg auch meine Laune ein wenig und ich ging nach unten in die Küche.
»Guten Morgen!«, begrüßte ich meine Großmutter, die am Tisch saß und Kaffee trank. Ich nahm mir ebenfalls eine Tasse und setzte mich kurz zu ihr.
»Morgen? Es ist fast Mittag, es gibt bald Essen!«
Ich grinste verlegen. »Ich habe es vorher aus dem Bett geschafft und damit ist für mich noch Morgen!«
Schmunzelnd schüttelte sie den Kopf. »Na, mein Kind, wie fühlt man sich mit 19?«
»Na ja, nicht anders als vor zwei Tagen auch. Das Blöde ist nur, dass ich bald mit der Schule fertig bin und mir überlegen muss, was ich danach machen will.«
Sie legte ihre Hand auf meine und lächelte mich ermutigend an. »Aber das ist doch schön! Ich weiß, du liebst diesen Hof, aber du kannst nicht ewig hierbleiben. Du musst hinaus in die Welt und dort dein Glück suchen. Ich bin dafür, dass du irgendwo studierst.«
Ich seufzte tief. Die Tatsache, dass man in unserer Gegend beruflich gar nichts anfangen konnte, war nämlich der Grund für meine Deadline.
Ich stand auf. »Weißt du, wo Ken ist?«
»Oh, er ist schon früh aufgestanden, ich glaube, er ist spazieren gegangen.«
»Okay, ich finde ihn schon.«
Ich stellte meine Tasse in die Spülmaschine, dann verließ ich den Hof und streifte über die Felder, die sich dahinter erstreckten. Ich brauchte nicht lange, bis ich ihn fand. Ich kannte seine Lieblingsplätze ganz genau.
»Hey«, begrüßte ich meinen besten Freund mit schwacher Stimme.
Er hatte die Beine um einen Ast geschlungen und hing kopfüber an einem Baum. Jedem anderen wäre das Blut ins Gesicht geschossen und hätte ihm die unvorteilhafte Ähnlichkeit mit einer Tomate verliehen, er hingegen sah wie immer auffallend gut aus. Ich hatte nicht einen einzigen Tag erlebt, an dem sein Aussehen mir nicht fast den Atem geraubt hätte. Das lag vor allem an seinen außergewöhnlich hellen Augen, deren Intensität ich vom ersten Moment unserer Begegnung an liebte. Genau wie alles andere an ihm. Aber das war es nicht, worum ich mich sorgte.
Er legte den Kopf schräg. »Hallo. Siehst du traurig aus oder liegt das an der Perspektive?«
Ich musste lachen. »Nein, ich bin wirklich ein bisschen traurig. Kannst du vielleicht herunterkommen? Ich würde gerne mit dir reden.«
»Klar.« Er ließ sich fallen, drehte sich und landete geschickt auf den Füßen. Dann setzte er sich und klopfte auf das weiche Gras neben sich, das in diesen Tagen besonders saftig aussah. »Komm zu mir!« Zögernd ließ ich mich nieder. »So ernst habe ich dich lange nicht mehr gesehen. Jetzt lach doch mal!«, forderte er mich auf, und sein Grinsen war so breit, als würde er meinen Part übernehmen wollen.
Ich zupfte einige Halme aus, als könnte ich so die passenden Worte finden. Aber so einfach war es nicht. »Weißt du, wie lange wir uns schon kennen?«, begann ich nach einer gefühlten Ewigkeit.
Zwischen seinen Augenbrauen bildete sich eine kleine Denkfalte. »Ähm … schon eine ganze Weile … neun Jahre, oder?«
Ich nickte und in meinem Kopf spielte sich die erste Begegnung mit ihm noch einmal ab.
Ich sah mich, wie ich als zehnjähriges Mädchen auf einer Wiese lag, in den wolkenlosen Himmel blickte und mit meinem Schicksal haderte. Ich konnte den Tod meiner Eltern nicht begreifen, und dass ich mich schwertat, in der neuen Umgebung Freunde zu finden, machte alles noch schlimmer. Tagelang hatte ich mich unter der Bettdecke verkrochen und nahezu pausenlos geweint. Irgendwann, als meine Großmutter es nicht mehr ertrug, dass es nichts gab, was mich aufheitern konnte, zwang sie mich, hinauszugehen. Stundenlang war ich durch den Wald und über die Felder gezogen und hatte nicht gefunden, worauf sie gehofft hatte. Aber im nächsten Moment sollte sich alles verändern. Meine Lider senkten sich, und als ich sie wieder öffnete, blickte ich in diese unglaublich hellen Augen. Verständlicherweise schreckte ich hoch und krabbelte erst einmal rückwärts.
Der Junge, der etwa in meinem Alter war, grinste mich frech an. »Hey, tut mir leid, wenn ich dich erschreckt habe.«
Ich atmete auf und schämte mich für meine Reaktion, denn ich wollte nicht wie ein Angsthase wirken. Bereits zu diesem Zeitpunkt fühlte sich mein Herz an, als würde es in mir Trampolin springen.
Der Junge mit den wilden schwarzen Haaren, die aussahen, als hätte er sich sämtliche Stylingprodukte auf einmal hineingeschmiert, fragte mich: »Wie heißt du?«
»Aella«, antwortete ich. In Wahrheit hieß ich Annabella, aber meine Großmutter hatte mir den Spitznamen gegeben und ich hatte ihn dankbar angenommen. Vielleicht, weil Annabella für mich immer das Mädchen bleiben würde, das Eltern gehabt hatte und das ich nicht länger war. »Und wie heißt du?«, fragte ich ihn.
»Ich bin Ukog, freut mich sehr!«
Sofort lag ich lachend auf dem Rücken und hielt mir den Bauch. »Ukog? Du heißt wirklich Ukog?«
»Klar. Wohnst du hier?«
Ich zeigte hinter mich. »Ja, auf dem Bauernhof dort! Und du? Wie bist du hierhergekommen? Machst du einen Ausflug?«
Er kratzte sich am Kopf. »Kann man sagen … Ich komme aus Darnoc.«
»Wo ist das?«
»Das kann man nicht so genau sagen. Darnoc ist eine Parallelwelt, die neben eurer existiert. Ich bin durch ein Portal gekommen, fast jeder Darnocianer kann das. Meine Aufgabe ist es, eure Welt zu vernichten.«
Diese Aussage wunderte mich nicht im Geringsten. Schon im Kindergarten hatten mich Jungs mit ihren imaginären Waffen beschossen, mich an einen Baum gefesselt, der als Marterpfahl umfunktioniert wurde, oder mich in einen Zombie verwandelt, indem sie mir an die Stirn tippten. Was also sollte ich von einem Jungen halten, der behauptete, aus Darnoc zu kommen? Nicht viel mehr.
»Hör auf mit dem Unsinn!«
»Das ist kein Unsinn«, blieb er weiter dabei.
Ich seufzte. »Könnt ihr Jungs nicht einmal etwas spielen, was uns Mädchen auch gefällt?«
»Wie meinst du das?«
Beleidigt verschränkte ich die Arme vor der Brust. Da traf ich einmal jemanden in dieser Ödnis, der dazu auch noch Gefühle in mir auslöste, die ich nicht verstand, und dann hatte der ganz andere Vorstellungen von Spaß als ich!
»Du bist doof! Du kannst unsere Welt gar nicht auslöschen, dafür gibt es bei uns viel zu starke Männer! Ein kleiner Junge kann so etwas nicht, also lass uns doch was anderes machen!«
Seine Augen wurden groß. »Bist du dir sicher?«
Ich nickte kräftig.
Erschrocken klatschte er sich die Hände vors Gesicht. »Oh nein! Die müssen was falsch gemacht haben! Das darf nicht wahr sein, gut, dass du es mir gesagt hast!« Er wurde kreidebleich, was ich nun doch ein wenig übertrieben fand. »Weißt du, wie man Welten zerstört?«
»Natürlich nicht, ich bin ein Mädchen! Aber ich habe mich schon einmal geschminkt, das ist gar nicht so schwer, wie alle immer tun.«
»Gut, pass auf! In allem und jedem ist Energie. In dir, in mir, in dieser Wiese, einfach überall! Wenn ich etwas zerstören will, strecke ich meine Arme aus und führe sie zusammen, was total anstrengend ist. Das, was ich kaputt mache, verschlingt sich dann selbst. Wenn ich die Hände zusammenschlage, ist es weg. Aber das sieht einfacher aus, als es ist, das ist nämlich wie ein Kampf. Der mit der größeren Energie gewinnt, das heißt, ich kann dabei auch kaputtgehen! Deswegen soll ich in einer anderen Welt erst ganz viele Wesen besiegen, damit sie weniger Energie hat als ich, und sie dann vernichten. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du mir erzählt hast, dass es Männer gibt, die stärker sind als ich! Wie soll ich diese Welt zerstören, wenn ich nicht einmal einen Einzelnen von ihnen besiegen kann? Was soll ich jetzt bloß machen?«
Ich hob die Schultern und konnte mich nicht entscheiden, ob ich den seltsamen Jungen toll oder blöd finden sollte. Einerseits hörte er mit seinem Spiel trotz meiner Bitte nicht auf, andererseits hatte er so schöne Augen und ein süßes, liebes Lächeln.
»Ich kann nicht mehr zurück, das darf ich erst, wenn ich meinen Auftrag ausgeführt habe!«, erklärte er mir. Ich verdrehte die Augen. Dann nahm er meine Hände und mein Herz übertraf sogleich alle Rekorde im Hochsprung. »Meinst du … meinst du, ich kann vielleicht bei dir bleiben? Ich will trainieren, bis ich stark genug bin! Aber so lange brauche ich einen Ort, wo ich leben und mich verstecken kann. Niemand darf merken, dass ich hier bin, ehe ich nicht bereit bin, meinen Auftrag zu erfüllen!«
Ich strahlte übers ganze Gesicht, denn die Vorstellung, einen netten Spielkameraden zu haben, war natürlich verlockend. »Das klingt super! Ich kann dir ja dann sagen, wann du stark genug bist. Aber wenn du bei mir bleiben willst, brauchst du unbedingt einen anderen Namen, Ukog ist voll doof.« Mir fiel sofort etwas ein. »Du heißt ab jetzt Ken!« Ich spielte damals leidenschaftlich gern mit Barbies, und da ich wusste, dass Ukog mein Traumprinz sein musste, war das der einzig denkbare Name.
»Gut, machen wir es so. Dann heiße ich ab jetzt Ken!«
Freudig packte ich ihn an der Hand und wir rannten den ganzen Weg bis zum Bauernhof. Ich klopfte wie wild an die Tür und erzählte meiner Oma ganz aufgeregt, was passiert war, sobald sie die Tür öffnete. Ken tischte ihr dieselbe Geschichte auf wie mir. Aber sie war nicht genervt, sondern verzog mitleidig das Gesicht.
»Hach herrje, kommt erst einmal herein, ich mache euch einen Kakao!«, bot sie an und ging mit uns in die Küche. Sie stellte ihm die Tasse hin, über deren Inhalt er sich gierig hermachte.
»Kann ich auch etwas zu essen haben?«, fragte er und wischte sich mit der Hand über den Mund. »Ich habe schrecklichen Hunger!« Er fuhr sich über den Bauch.
Erschrocken griff meine Oma nach seinem Arm. »Kind, was ist denn da passiert?« Sie schob den Ärmel seines Shirts ein wenig hoch und jetzt sah auch ich die vielen blauen Flecken und Schürfwunden.
Ken winkte ab. »Das kommt vom Training in Darnoc. Aber das ist noch gar nichts!« Er zeigte auf seinen anderen Arm. »Der hier war schon zweimal gebrochen! Und einmal haben wir so hart trainiert, dass mir ganz schwindlig wurde und ich nicht mehr richtig laufen konnte. Aber kann ich jetzt bitte etwas zu essen haben? Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal etwas gekriegt habe!«
Meine Oma wurde blass. »Ja, ich … ich mache dir gleich etwas …« Sie begann, hektisch in den Küchenschränken zu wühlen. Verwundert sah ich ihr dabei zu und hörte, wie sie murmelte: »Was soll ich nur tun? Der Junge wird ganz offensichtlich misshandelt, er wird geschlagen und sie lassen ihn hungern! Bestimmt hat er sich deswegen diese verrückte Geschichte ausgedacht, oh Gott, was haben sie ihm nur angetan?« Ich hielt den Atem an, als ich Tränen in ihren Augen schimmern sah. »Ich … ich kann ihn unmöglich beim Jugendamt melden, erst vor Kurzem ist wieder ein Kind zu Tode gekommen, weil die nicht eingegriffen haben. Man hört doch ständig, wie unfähig die sind! Sie würden ihn gewiss zurückbringen oder ihn von einem Heim ins nächste schicken. Ich dürfte mich auch nicht um ihn kümmern, niemand würde einer alten Frau wie mir erlauben, ein Kind zu adoptieren, ich sorge ja schon für Aella …« Sie verharrte in ihrer Bewegung, eine Träne rollte über ihre Wange. »Ich habe keine andere Wahl. Ich kann den Jungen nicht zurückschicken, nicht nach dem, was passiert ist. Die Welt dort draußen ist kalt und grausam, hier ist es für ihn am sichersten.« Sie drehte sich zu ihm um und streichelte Ken über die Haare. »Es ist bestimmt das Beste, wenn du bei uns bleibst. Ich war mal Lehrerin, weißt du? Ich kann dir alles beibringen, was du brauchst, und du kannst mit Aella Hausaufgaben machen, dann bist du auf das Leben vorbereitet, ohne dass du zur Schule musst. Du sollst dich hier wie zu Hause fühlen, aber du musst aufpassen, dass dich niemand sieht, in Ordnung?«
Ken nickte fröhlich. »Keine Sorge, das hatte ich ohnehin vor. Ich werde mich verstecken und darauf achten, dass mich keine Menschenseele außer euch beiden zu Gesicht bekommen wird!«
Bis er 15 war, zog Ken dieses Vorhaben eisern durch. Er ging am Tag nur sehr selten raus, die meiste Zeit verbrachte er im Haus und achtete auch dort darauf, dass ihn niemand zufällig sah. Wenn er an einem Fenster vorbeimusste, robbte er manchmal sogar über den Boden, wenn er sich nicht sicher fühlte. Manchmal schaffte ich es, ihn zu einem Spaziergang zu überreden, doch bei dem kleinsten Geräusch kletterte er erschrocken auf einen Baum oder sprang ins Gebüsch. Ab seinem 15. Geburtstag hatte meine Großmutter begonnen, ihm dieses Verhalten auszureden. Niemand würde sich über einen Jungen in seinem Alter wundern, vor allem da er deutlich älter aussah. Es war gut möglich, dass jemand wie er in unserer strukturschwachen Gegend keine Lehrstelle fand und deswegen den ganzen Tag zu Hause verbrachte. Meine Oma wusste das und ermutigte ihn von da an, sich mehr unter Menschen zu wagen, was ihn viel Überwindung gekostet hatte.
»Und du willst immer noch unsere Welt zerstören?«, fragte ich, obwohl ich die Antwort kannte. Mittlerweile wusste ich, dass es sich nicht um ein blödes Spiel handelte. Ken besaß Fähigkeiten, die weit über die eines Menschen hinausgingen. Meine Oma hatte dies nie erkannt.
»Findest du es hier nicht schön? Nicht einmal ein bisschen?«
Er seufzte tief. »Doch, sehr sogar. Du weißt, wie sehr ich an deiner Großmutter und dir hänge. Ich bin euch unheimlich dankbar dafür, dass ihr mich ausbildet und auf meinen Kampf vorbereitet. Aber ich habe keine andere Wahl, auch wenn es mir das Herz zerreißt.«
Tränen liefen über seine Wangen, aber das war kein ungewohnter Anblick. Dort, wo er herkam, schien es normal zu sein, dass auch Männer ihre Gefühle zeigten. Allerdings schluchzte er dabei nicht und rührte sich nur wenig, was das Ganze seltsam aussehen ließ. Und er blinzelte nicht – aus Angst, dass ihn in dieser Sekunde jemand angreifen könnte. Er sah auch nicht fern und surfte nicht im Internet, denn er ertrug es nicht, auf Bildschirme zu sehen. Was er ebenfalls nicht tat, war lügen. Lange hatte ich gedacht, er sei einfach schrecklich naiv oder sogar dumm, weil er alles für bare Münze nahm, was ich ihm erzählte. Aber irgendwann hatte es mir gedämmert, dass Wesen wie er wohl schlicht nicht wussten, was eine Lüge war. Genau diese Eigenschaft hatte es mir neun Jahre lang ermöglicht, ihn von seinem Plan abzuhalten, denn wenn ich ihm versicherte, dass er noch nicht so weit sei, glaubte er es.
»Worüber wolltest du mit mir reden? Denkst du, dass ich in Kürze bereit dafür bin, meine Aufgabe zu erfüllen?«
Unsicher hob ich die Schultern. »Ja, vielleicht dauert es nicht mehr lange. Aber ein wenig Geduld musst du noch haben!« Ich legte mich neben ihn und genoss, wie der Wind durch meine Haare strich. Seit ich mit einem Jungen unter einem Dach lebte, der alles, was ich kannte, zerstören wollte, wusste ich die Natur viel mehr zu schätzen. »Eigentlich wollte ich mit dir über etwas anderes reden. Was ist der Grund dafür, dass ihr unsere Welt vernichten wollt? Ich weiß, dein Volk hat es dir befohlen und du bist nicht berechtigt, das infrage zu stellen, aber hat man dir nie einen Grund genannt? Bist du wirklich nur eine Killermaschine, die ohne Widerworte pariert?«
Dieses erneute Gespräch war so ziemlich mein letzter Hoffnungsschimmer, ihn doch noch von seinem Plan abzubringen. Denn wenn mir das nicht langsam gelang, hatte ich ein gewaltiges Problem. Schließlich musste ich von zu Hause weg, und es war nahezu unmöglich, ihn mitzunehmen. Außerdem würde er sich nicht ewig von seinem Vorhaben abhalten lassen. Meine größte Angst war, dass sein Volk eines Tages jemanden nachschicken würde, um zu sehen, weshalb er so lange trödelte.
Er setzte sich auf, und ich sah in seinem Blick dieselbe Verwirrung, die ich empfand, wenn ich in ein Chemiebuch blickte. »Ich dachte, du wüsstest es und würdest mir deshalb helfen? Wieso hast du nie nachgefragt?« Unsicher hob ich die Schultern. »Wir Darnocianer sind edle und mutige Krieger. Jeder von uns hegt dieselben Moralvorstellungen, wir leben alle nach den gleichen Regeln, denn wir wissen, dass es zum Untergang der Gesamtheit führen kann, wenn sich auch nur ein Einzelner nicht daran hält. Aber nicht in allen Welten denkt man so wie wir. Wir fürchten, dass es anderen Wesen wie euch ebenfalls bald gelingt, in Parallelwelten zu reisen, und dass sie so unseren Frieden stören. Deswegen haben wir uns mit ebenbürtigen Nationen zusammengeschlossen, um alle Welten, die den Frieden stören könnten, zu vernichten und eine ultimative Lebensgemeinschaft zu schaffen. Wir haben die Menschen über einen langen Zeitraum beobachtet und immer wieder gewarnt, dass sie sich ändern müssen, wenn sie auch Teil dieses großen Ganzen sein wollen. Aber es hat alles nichts genützt, sie blieben machthungrig, niederträchtig und boshaft. Edle Absichten sind ihnen fremd, sie quälen und zerstören. Deswegen wurde einstimmig entschieden, dass es das Beste sei, wenn sie und ihre Welt verschwinden.«
Das musste ich erst einmal verdauen. So ernst hatte ich ihn noch nie reden hören. »Deswegen bist du hier?«
»Ja. Und ich dachte, dass du mir hilfst, weil du ebenso über deine Art denkst. Die meisten Menschen sind recht schwach. Deswegen hat mein Volk wohl gedacht, es genügt, mich loszuschicken. Aber du hast mich ja Gott sei Dank gewarnt, dass hier nicht alle gleich sind und es durchaus Menschen gibt, mit denen ich es noch nicht aufnehmen kann.«
»Na ja, eigentlich helfe ich dir nur, weil … weil ich dich eben mag. Und du bist sicher, dass ihr uns keine zweite Chance geben könntet? Ich meine, Menschen können sich ändern!«
Er seufzte. »Ich kann verstehen, dass du dir das wünschst. Ich wünsche mir selbst nichts sehnlicher, als dich verschonen zu dürfen, glaube mir! Wenn ich könnte, würde ich für immer bei dir bleiben, denn die vergangenen Jahre hätten nicht schöner sein können. Aber du musst auch mein Volk verstehen. Wenn man zu viele Ausnahmen macht, gibt es keine Regel mehr. Außerdem habe ich selbst nichts zu bestimmen. Ich bin eins der schwächeren Exemplare, das hat man schon in meiner Kindheit festgestellt.«
Ich grübelte. »Aber seid ihr wirklich so anders als wir? Ich meine, äußerlich seht ihr uns doch sehr ähnlich. Niemand erkennt, dass du kein Mensch bist.«
Er schüttelte den Kopf. »Wir sind uns nicht ähnlich. Gut, was das Äußerliche betrifft, hast du recht, aber unsere Gesinnung unterscheidet uns deutlich voneinander. Abgesehen davon, dass wir viel stärker und schneller sind und die Energie, die durch unseren Körper fließt, besser und vor allem bewusst einsetzen können. Hinzu kommen einige andere, sehr nützliche Fähigkeiten, die ich leider noch nicht alle beherrsche. Es kommt noch viel Arbeit auf mich zu. Doch es ist wesentlich schwieriger, mich zu töten als euch Menschen.«
Ich wurde hellhörig. »Nur, weil du so stark bist oder bist du uns auch noch in etwas anderem überlegen?«
Er zögerte kurz, dann streifte er sein T-Shirt ab und zeigte auf seine Brust. »Das ist das Entscheidende.«
»Dein Herz? Das ist auch bei uns so.«
»Nein, es ist anders.« Er verzog das Gesicht und gab ein schmerzvolles Stöhnen von sich. Mit großen Augen sah ich zu, wie etwas unter seiner Haut hervortrat und sie immer dünner werden ließ, ehe sie aufriss. Es sah aus wie ein rotes Juwel.
»W-w-was ist das?«, stammelte ich erschrocken.
Er atmete erleichtert auf, seine Schmerzen schienen beendet. »Darin wohnt meine Seele. Wenn du genau hinguckst, kannst du sie sehen.«
Ungläubig näherte ich mich ihm und stellte fest, dass dieses Juwel durch seinen ganzen Körper führte, auf seinem Rücken trat es ebenfalls hervor. Tatsächlich schien sich darin etwas Nebelartiges zu bewegen. »Wow«, flüsterte ich, denn ich war so beeindruckt, dass meine Stimme versagte.
»Das muss zerstört werden, um mich zu töten. Es braucht einen gezielten Stich, um mich zu töten. Alles andere bringt mich nicht um. Du könntest mir den Kopf abschlagen, er würde sogleich nachwachsen. Das ist schon ein bisschen anders als bei euch, oder?«
Ich nickte, dann hörte ich ein Rufen: »Aella, Ken, kommt ihr? Es gibt Mittagessen!«
Er sprang auf. »Ich komme!«, brüllte er aus Leibeskräften.
»Sag, dass ich gleich nachkomme!«, bat ich hastig, denn im nächsten Moment war er bereits verschwunden. Er konnte derart schnell rennen, dass er mit den Augen kaum zu verfolgen war.
Ich lehnte mich gegen den Stamm und erste Tränen liefen über meine Wangen. Es würde mir nicht gelingen, ihn umzustimmen, so viel stand fest. Er müsste dazu sein ganzes Volk verraten, was mir nun schmerzlich bewusst wurde.
Ich muss ihn töten, dachte ich und mein Herz fühlte sich an wie ein Nadelkissen. Wenn ich weiter auf dieser Erde leben will, muss ich die Information, die er mir gegeben hat, nutzen und ihn töten. Ich schluchzte heftig, mein ganzer Körper schmerzte bei diesem grausamen Gedanken. Dabei hatte ich neun Jahre Zeit gehabt, mich an ihn zu gewöhnen.
»Ich kann es nicht«, wimmerte ich und schlang die Arme um meine Schultern, als könnte ich damit die Verantwortung von ihnen nehmen, die ich deutlich spürte. Die Zukunft der Welt lag in meinen jungen Händen. Ich konnte sie retten, zumindest für ein paar Jahre. So lange bis sein Volk stutzig wurde und nach ihm suchte. Aber dafür musste ich meinen besten Freund hinterrücks töten. Wie konnte jemand wie er nur so etwas vorhaben? Er war der beste Freund, den man sich wünschen konnte. Er war immer fröhlich, nahm sich stundenlang Zeit, um mich zu trösten, wenn es mir schlecht ging. Er wusste immer, wenn mit mir etwas nicht stimmte, und gab nicht auf, ehe ich wieder lachte. Meiner Großmutter las er jeden Wunsch von den Augen ab, er half uns beiden, wo er nur konnte. Wieso um alles in der Welt musste er so etwas Schreckliches vorhaben? Warum tat sein Volk ihm so etwas an?
Ich atmete ein paar Mal durch, ehe ich mich kraftlos an dem Stamm nach oben zog. Zitternd fuhr ich mir mit den Fingern übers Gesicht, ich versuchte zu vertuschen, dass ich geweint hatte, denn ich wollte weder ihn noch meine Oma beunruhigen. Mit einem mulmigen Gefühl im Bauch machte ich mich auf den Weg zurück zum Haus.
Wenn ich ihn nicht töte, wird er mich eines Tages umbringen, drehte sich mein Gedankenkarussell unaufhörlich weiter.
2
MEIN RECHT AUF LEBEN
»Gott, schmeckt das gut!«, nuschelte Ken, der ein Stück Fleisch im Mund hatte und Brot nachschob.
Meine Oma lächelte. »Freut mich, dass es dir schmeckt! Es ist schön, dass du so einen gesegneten Appetit hast. Ich habe schon immer lieber für richtige Esser gekocht.«
Gesegneter Appetit war leicht untertrieben. Meine Großmutter durfte dank ihm wie für eine Großfamilie kochen, elf Kinder waren nichts im Vergleich zu ihm! Ich ging davon aus, dass er diese Mengen aß, weil er die Energie für seine außergewöhnlichen Fähigkeiten brauchte.
»Aella, wieso isst du nichts?«
»Ich esse doch«, erwiderte ich leise und starrte auf mein Essen, das nach meinem wahllosen Herumgestocher ziemlich bemitleidenswert aussah.
»Nein, du schiebst alles hin und her, das ist nicht essen.«
Ich seufzte. »Ich glaube, ich bin aufgeregt, weil ich diese Woche Abitur schreibe.« Mit entschuldigendem Blick stand ich auf. »Es ist wohl besser, wenn ich in mein Zimmer gehe und lerne.«
»Tu das, Kindchen. Das wird schon«, ermutigte sie mich und schenkte mir ein warmes Lächeln. Als ich die Küche verließ, hörte ich noch, wie sie Ken darum bat, den Rasen zu mähen, woraufhin der sogleich aufsprang. Zu dem Hof gehörte noch immer ein beachtliches Grundstück, und ich war heilfroh, dass ich es nie mähen musste. Ken hingegen nahm die Herausforderung dankend an.
In meinem Zimmer versuchte ich tatsächlich zu lernen, aber es war unmöglich. Wie sollte man sich auf Mathe konzentrieren, wenn der personifizierte Weltuntergang durch den eigenen Garten wirbelte und sich um das Gras kümmerte?
Stöhnend wippte ich mit meinem Stuhl. Vielleicht sollte ich durchfallen. Dann hätte ich noch ein Jahr, ehe ich hier raus musste. Nervös kaute ich an meinen Fingernägeln. Ich konnte Ken auf keinen Fall verlassen. Meine Oma wusste nicht, wer er war und was er vorhatte. Sie sah zwar, was er tat, aber sie begriff nicht, dass seine Fähigkeiten nicht menschlich waren. Wer sollte ihm die Lügen auftischen, die ihn davon abhielten, unsere Welt zu zerstören, wenn ich nicht mehr da war? Aber ihn mitnehmen ging schlecht, wie sollte ich ihn als Studentin durchfüttern? »Ah, ich hasse mein Leben!« Wütend raufte ich mir die Haare, dann feuerte ich das Mathebuch durch den Raum und setzte mich an meinen Laptop.
Ich hatte Glück, Bea war online. Sie war meine beste und einzige Freundin. In meiner Klasse hatte ich nie Anschluss gefunden, aber ich hatte es auch nie versucht. Ehe ich sie anschreiben konnte, blinkte auch schon das Nachrichtensymbol.
Hey Aella, das Schriftliche liegt endlich hinter mir! :)
Ich lächelte und freute mich für sie, denn ich wusste, dass sie in der Schule genauso ein Überflieger war wie ich und ziemlich Panik geschoben hatte.
Hey, freut mich! Ich wünschte, es wäre bei mir auch schon so weit … das Warten bringt mich um. Wie war’s denn?
Joa, nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte. Man hat im Voraus das Gefühl, dass das der Tag ist, der über das ganze Leben entscheidet und an dem sich alles ändert, aber letztendlich ist der Raum, in dem man sitzt, auch nur ein Klassensaal und man schreibt auf einen Bogen Papier und der Lehrer schmatzt genauso nervtötend beim Essen, wie er es bei jeder anderen Kursarbeit auch getan hat. Also echt nix Besonderes und die Themen waren auch okay. Klar, ich hätte mehr machen können … Aber das Minimalprinzip hat sich bisher ja bewährt ;)
Ich grinste. Solche Aussagen waren typisch für sie.
Na ja, ich habe es ja auch bald geschafft. Ich muss mir langsam Gedanken darüber machen, was danach kommen soll …
Also ich habe beschlossen, dass ich dich in meinen freien Tagen besuche! :) Ich habe ja jetzt ein eigenes, wenn auch vorsintflutliches Auto, das heißt meinem Besuch steht nichts mehr im Wege!
Mir stockte der Atem. Das durfte nicht wahr sein! Ich hätte nichts lieber getan, als mich mit ihr zu treffen – wenn ich nicht Ken zu verstecken hätte. Seit ich vor neun Jahren aus der Stadt, in der sie wohnte, weggezogen war, hatten wir nur über Telefon und Internet Kontakt gehalten. Der Bauernhof lag so abgeschieden, dass sie mich mithilfe öffentlicher Verkehrsmittel unmöglich besuchen konnte. Was mein Auto anging, hatte ich ihr immer erzählt, dass ich mit ihm nur sehr ungerne eine so lange Fahrt antreten würde. Dass ich dabei mindestens einmal liegen bleiben würde, war sogar ziemlich realistisch. Im Grunde hätte ich Bea gerne besucht, aber ich hatte stets Angst, dass Ken in meiner Abwesenheit etwas Dummes tun könnte. Nun, da sie auch mobil war, saß ich in der Patsche.
Bist du dir sicher? Du musst doch für das Mündliche lernen, oder?
Ich war der Verzweiflung nahe, denn ich musste ihren Besuch um jeden Preis abwenden. Vielleicht sollte ich ihr erzählen, dass meine Oma in Wahrheit Chefin eines Drogenkartells war und ein Besuch damit viel zu gefährlich? Oder dass es in den Wäldern um den Hof Werwölfe gab? Oder dass ich unter der Pest litt? Das alles würde sie mir genauso wenig glauben wie die Wahrheit, und mir fiel nicht ein einziger Grund ein, der sie von ihrem Vorhaben abhalten würde.
Ach, das passt schon. ;) Ich melde mich noch mal, wenn ich Genaueres weiß. Ich muss jetzt weg, wir wollen noch ein bisschen feiern. Bis dann
Mit heftigen Bauchschmerzen klappte ich den Laptop zu. Hatte ich nicht schon genug Probleme?
Ich legte die Arme auf den Schreibtisch und ließ meinen Kopf unsanft darauffallen. Am liebsten hätte ich ihn mehrfach gegen die Wand gedonnert. »Oh Gott, ich wünschte, ich hätte die üblichen Sorgen …« Das war wirklich kein Alter, in dem man einen mordlustigen besten Freund gebrauchen konnte!
Kaum hatte ich das gedacht, riss er die Tür auf und stürmte mit unerträglich guter Laune in den Raum. »Hey!« Er schien irritiert. »Was lernst du gerade?«
Ich seufzte. »Bio. Ich sehe mir meine Arme an.« In Gedanken fügte ich hinzu: Und ich stelle fest, dass meine Hypophyse extrem viele Endorphine produziert, wenn du mich anlächelst.
»Ah okay. Und wie kommst du voran?«
»Joa, ganz gut.«
Er warf sich auf mein Bett. »Das freut mich.«
Ich seufzte. »Aber im Grunde muss ich kein Abitur machen. Ich meine, ich gehe seit neun Jahren zur Schule, obwohl ich weiß, dass es meine Welt nicht mehr lange geben wird.«
Er wirkte gequält. »Aella! Mach mir bitte keine Vorwürfe, du weißt, dass es nicht meine Entscheidung war! Ich würde euch eine letzte Chance geben, wenn ich das könnte.«
Ich massierte mir die Schläfen, hinter denen es schmerzhaft pochte. »Ja, ich weiß«, erwiderte ich leise.
Er stand auf und legte mir die Hand auf die Schulter. »Du weißt doch, das Letzte, was ich will, ist, dir wehzutun. Du bist die wichtigste Person in meinem Leben und bedeutest mir unglaublich viel. Aber es war deine Gattung, die entschieden hat, dass es mit euch zu Ende geht.«
Entgegen aller Vernunft keimte Hoffnung in mir auf. »Ken, ich bin kein schlechter Mensch. Ändert es nichts, dass es mich gibt? Nicht jeder von uns ist niederträchtig, böse und machthungrig. Zählt das überhaupt nicht?«
Er kratzte sich am Kopf. »Natürlich weiß mein Volk das, aber es reicht nicht aus. Die wenigen, die anders sind, können nicht genug ausrichten. Eure Zahlen müssen katastrophal sein.«
»Welche Zahlen?«, fragte ich verwundert.
»Die Morde, die Armut, die verhungerten Kinder, die Gewalt gegenüber Hilflosen, die Ausgebeuteten und die Gedemütigten, die gequälten Tiere, die zerstörte Natur … Das alles spielt eine Rolle, wenn einer Welt das Recht auf ihre Existenz aberkannt wird.«
Ich schluckte, denn ich konnte mir durchaus vorstellen, dass wir nicht gerade gut dastanden. Aber wie sollte ich das im Alleingang ändern?
Genau da griff Kens Argument, warum ich kein Grund war, die Vernichtung abzublasen.
»Aber eigentlich wollte ich dich etwas fragen. Hast du nicht Lust, an den See zu gehen? Es ist schrecklich heiß!« Er unterstützte diese Aussage, indem er ein Hecheln von sich gab.
Ich musste lachen und warf in einem Anflug von schlechtem Gewissen einen Blick auf meine Bücher, doch er hatte mich längst überzeugt. »Ich packe schnell meine Sachen und dann gehen wir.«
»Super, ich warte draußen auf dich!«, rief er, öffnete das Fenster und sprang hinunter. Mein Zimmer befand sich im zweiten Stock, aber für ihn war das, wie von der Terrasse zu springen, er konnte weitaus tiefere Stürze verschmerzen.
Ich holte meinen Bikini und zwei Handtücher aus dem Schrank, dann ging ich ins Wohnzimmer. »Oma, wir … was hast du?«, fragte ich erschrocken.
Sie saß kopfschüttelnd auf der Couch und hatte Tränen in den Augen. Sie wies mit einem Nicken auf den flimmernden Fernseher. »Sie haben zwei Babyleichen gefunden. Eine im Wald, eine in einem Müllcontainer. Einfach abgelegt wie Dreck, in Plastiktüten. Kannst du mir sagen, wieso jemand so etwas tut, Aella? Was haben die Kleinen getan, dass es Menschen gibt, die sie nicht leben lassen?«
Mit einem dicken Kloß im Hals hob ich die Schultern. »Ich weiß es nicht«, presste ich hervor.
Sie seufzte tief. »Was wolltest du sagen?«
»Ken und ich gehen an den See.«
»In Ordnung, viel Spaß!«
Wie in Trance hob ich die Hand und verließ den Raum. Nachdenklich kaute ich auf meiner Unterlippe herum. Und was, wenn Ken recht hatte? Was, wenn wir unser Recht auf Leben verwirkt hatten? Natürlich konnten die Kinder, die heute geboren wurden, nichts für das, was ihre Eltern getan hatten, aber uns musste klar sein, dass wir Verantwortung für alle kommenden Generationen übernahmen. War es wirklich ungerecht, wenn wir nach Tausenden Jahren Missachtung dieses Urgesetzes dafür zur Rechenschaft gezogen wurden?
Ich trat in die Tür und beobachtete Ken, der mehrere Flickflacks schlug. Wenn ich ihn tötete, was mir nur aus dem Hinterhalt heraus gelingen konnte, wäre ich dann nicht genau wie die, wegen derer er hier war? Er war so unschuldig, seit neun Jahren glaubte er mir jede einzelne Lüge. Woher konnte ich mir als Mensch das Recht nehmen, ein Wesen wie ihn zu töten? Vielleicht war das, was er plante, das Beste, was den meisten in unserer Welt widerfahren konnte? Es gab so unendlich viel Leid, wahrscheinlich mehr als Glück. Wie viele mussten wohl gerade die schlimmsten Qualen ertragen und wären froh darüber, mit einem Schlag ausgelöscht zu werden?
Er bemerkte mich und winkte verwundert. »Hey, bist du angewachsen? Wieso kommst du nicht?«
Ich stieß mich vom Türrahmen ab und ging auf ihn zu. »Tut mir leid, ich war in Gedanken.«
Er legte den Arm um mich und zog mich mit sich. »Ich hoffe, es waren schöne Gedanken?«
»Da bin ich mir noch nicht sicher«, erwiderte ich leise.
Er streckte sich der Sonne entgegen. »Es ist viel zu warm zum Trübsalblasen! Willst du ein Wettrennen machen?«
Ich lachte. »Nein danke, kein Interesse und keine Chance!«
»Es ist blöd, dass ihr so langsam seid.«
»Dafür haben wir uns Autos gebaut.«
»Schon, aber ihr müsst auch ein bisschen mehr an euch arbeiten!«
Ich hob resigniert die Schultern. »Was nützt das noch? Wie du selbst gesagt hast: Unser Todesurteil ist gefällt.« Plötzlich musste ich mit den Tränen kämpfen, heute wurde mir alles zu viel. Ich lebte seit neun Jahren mit dem Wissen, dass die letzten Sandkörner, die die Zeit der Menschheit bemaßen, durch die Uhr rieselten, aber an diesem Tag schmerzte es besonders. Das Gespräch mit Ken hatte sämtliche Hoffnungen auf ein anderes Ende zunichte gemacht. Abgesehen von der Möglichkeit, ihn zu töten.
»Was hast du?«, fragte er besorgt und suchte meinen Blick, den ich verzweifelt vor ihm verstecken wollte.
»Ich will nicht sterben, Ken!«, brach es aus mir heraus. »Du hast recht, du hast mit allem recht, was du sagst! Die Menschen haben sich ihr Todesurteil selbst zuzuschreiben, das sehe ich ein, aber ich will trotzdem nicht sterben! Ich will einfach nicht tot sein, mein Lebenswille ist stärker als mein Verständnis. Ich bin 19 Jahre alt, ich stehe vor meinem Abitur, ich will etwas aus meinem Leben machen, statt es zu verlieren!« Ich konnte die Tränen nicht länger zurückhalten. »Kannst du das denn nicht verstehen? Findest du es nicht auch unfair, dass ich sterben muss, weil andere Mist gebaut haben?«
Er blieb stehen, offensichtlich überforderte ihn die Situation. Er sah zu Boden und fuhr sich mit beiden Händen durch die wilden Haare. »Natürlich verstehe ich das, aber es ist nun einmal so, dass man auch für die Verbrechen der Gesamtheit büßen muss. Und natürlich verstehe ich, dass du leben willst, das wünsche ich mir auch für dich! Aber ich darf keine Ausnahmen machen, ich darf nicht über jeden Einzelnen richten, sondern nur über das Ganze! Im Grunde darf ich nicht einmal das, denn mein Volk hat entschieden und nicht ich. Das Einzige, was ich tun kann, ist zu versuchen, dass wir es so sanft wie möglich hinter uns bringen.«
Schnaubend wandte ich mich ab. Es so sanft wie möglich hinter uns bringen. Solche Sätze hörten andere Mädchen von dem Jungen, den sie liebten im Bezug auf ihr erstes Mal, aber doch nicht auf ihre Ermordung bezogen! Warum musste mein Leben eigentlich so abgedreht sein?
Er nahm meine Hand und zog mich mit sich. »Hör endlich auf, traurig zu sein! Wir haben noch Zeit und die sollten wir genießen, findest du nicht? Auch auf mich wartet eine düstere Zukunft. Ich werde damit leben müssen, deine Großmutter und dich getötet zu haben, und ich weiß schon jetzt, dass ich das nicht kann. Deswegen will ich nicht darüber nachdenken, sondern mich über jede Minute freuen, die ich mit dir verbringen darf.«
Ich konnte nicht anders. Obwohl dieser Junge vorhatte, mich eines Tages umzubringen, musste ich lächeln. »Okay«, flüsterte ich.
Wenig später kam der See in Sicht und Ken kannte kein Halten mehr. Er warf seine Sachen auf den Boden und sprang hinein. Ich brauchte ein wenig länger, bis ich so weit war.
Das Wasser stand ihm bis zur Hüfte und er schlug mit den Armen darauf ein. »Mann, ich will endlich schwimmen können!«, ärgerte er sich.
Ich hatte unzählige Male versucht, es ihm beizubringen, doch immer ohne Erfolg. Er prügelte auf das kühle Nass ein, statt sich darin fortzubewegen. Bei anderen Dingen hatte es besser geklappt, zum Beispiel konnte er meinetwegen lesen und schreiben. Darüber war er sehr glücklich, er lieh sich ein Buch nach dem anderen von mir aus und betonte immer wieder, wie gerne er sie mitnehmen würde, wenn er zurück in seine Heimat musste. Die Darnocianer lasen nicht, sie sahen sich Symbole an, die ihnen alle Informationen, die sie brauchten, in den Kopf sendeten. Ich wusste nicht genau, wie ich mir das vorzustellen hatte, aber Ken konnte es nicht besser erklären.
Ich schwamm einige Züge und erntete dafür neidische Blicke, die ich amüsiert registrierte. »Jetzt guck nicht so! Es kühlt dich trotzdem ab.«
»Das stimmt«, sah er ein und hatte sofort wieder bessere Laune. Er holte tief Luft und tauchte mit dem Kopf ab. Ich bewunderte, dass er, obwohl er nicht schwimmen konnte, keinerlei Angst vorm Wasser hatte.
Nachdem wir noch ein wenig herumgealbert hatten – was für mich sicher wieder einige blaue Flecken bedeutete –, ging ich aus dem Wasser und legte mich auf das Handtuch, um die letzten Sonnenstrahlen einzufangen. Überglücklich rannte er auf mich zu und warf sich neben mich. »Ist das ein toller Tag, nicht wahr?«
»Ja. Aber du solltest deine Hose anziehen; wenn Leute vorbeikommen, halten sie dich für einen Perversen.«
Auch wenn es mich jedes Mal aus dem Konzept brachte, es war für mich nicht ungewöhnlich, ihn nackt zu sehen. Er kannte keinerlei Scham.
»Ist ja gut«, murrte er und streifte die Hose über.
Plötzlich kam mir ein Gedanke, den ich nur schwer über die Lippen brachte. »Ähm, Ken, ich … also du hast mir ja heute das Ding in deiner Brust gezeigt, und jetzt frage ich mich, ob es noch andere Sachen gibt, die bei euch anders sind.«
»Ja, vieles. Meine Welt sieht anders aus, viel schöner, um ehrlich zu sein. Und die Ednus. Sie entsprechen etwa euren Hunden, aber ihre Köpfe sind länger als ihre Körper und ich frage mich ständig, wieso sie nicht umkippen.«
Ich schüttelte lachend den Kopf. »So etwas habe ich nicht gemeint! Ich meine körperlich. Habt … habt ihr auch Sex wie wir? Oder zeugt ihr eure Kinder auf eine andere Art?«
Er kratzte sich am Ohr. »Um dir das zu beantworten, müsste ich erst einmal wissen, wie Sex bei euch funktioniert.«
Augenblicklich wurde ich rot. Ich hatte absolut keine Lust, bei den Bienchen und Blümchen anzufangen. »Schon gut, lassen wir das«, bat ich schnell, »Du siehst nackt zumindest aus wie ein Mensch. Ich denke, ihr macht es genauso.«
»Du hast als Kind nackt auch ausgesehen wie eine Frau in Darnoc, jetzt kann ich das nicht mehr beurteilen.«
»Ja, weil ich nicht so freizügig unterwegs bin wie du! Aber geändert hat sich bei mir nichts, so viel dazu.«
Er zeigte auf meine Brüste. »Doch.«
»Ken!«, schrie ich ihn empört an.
»Was habe ich jetzt wieder falsch gemacht?«, schrie er panisch zurück.
Ich musste lachen und winkte ab. »Vergiss es! Das wirst du nie lernen.« Ich strich mir eine Haarsträhne aus dem Gesicht und sah in den wolkenlosen Himmel. »Und die Frauen auf deinem Planeten sind echt solche Mannsweiber, wie du immer erzählst?«
»Sie sind keine Mannsweiber, sie sind Kämpferinnen! Mutige, tapfere Kriegerinnen, von unglaublicher Stärke, innerlich und äußerlich. Jeder Mann darf sich glücklich schätzen, wenn er eine Frau an seiner Seite hat, die ihn immer wieder von Neuem herausfordert und antreibt.«
Mein Herz wurde schwer und schien in meinem Körper zu sinken wie der kleine Stein, den ich nun in den See warf.
3
DER HÄRTESTE KAMPF DER WELT
Bea hatte gut reden! Von wegen das schriftliche Abitur sei wie eine normale Kursarbeit! Vor lauter Panik schwitzte ich mehr als bei meinem letzten Saunabesuch, hatte drei Liter Wasser intus, die Apfelernte des Jahres bereits vertilgt sowie sämtliche Schokolade, die man zu Weihnachten bekam, und trotzdem stürzte ich mich wie eine ausgehungerte Hyäne auf die Süßigkeiten, die die Lehrer als kleine Stärkung auf unsere Bänke legten. Ich war mit den Nerven echt am Ende, in meinem Kopf hämmerten immer dieselben Fragen: Was, wenn ich es nicht schaffte? Wieso entschied so ein blödes Gedicht aus dem 19. Jahrhundert über meine Zukunft? Wieso rannte alles, was ich gelernt hatte, panisch in meinem Hirn hin und her, statt sich in Reih und Glied aufzustellen und sich brav abrufen zu lassen, so wie wir das besprochen hatten? Und in welcher Klasse war ich, wie war eigentlich mein Name und was zur Hölle tat ich hier?
Ich war sicher, Todesangst konnte sich nicht grausamer anfühlen. Aber es kam noch schlimmer. Bei meiner verzweifelten Suche nach dem genialsten aller Einfälle, der jeden Deutschlehrer dazu bringen würde, vor Freude aufzujauchzen und nur noch mit meiner Abiturarbeit als Grundlage dieses Gedicht zu interpretieren, sah ich aus dem Fenster und bekam den Schock meines Lebens. Auf der Straße spazierte ein gut gelaunter Ken.
»Nein!«, schrie ich und sprang auf. Im nächsten Moment wurde mir abwechselnd heiß und kalt, denn ich hatte dummerweise vergessen, dass ich in einer Klasse mit zwei Lehrern und 25 Schülern saß, die sich über Ablenkung nicht gerade freuten.
»Annabella, setz dich wieder!«, ertönte sofort die strenge Stimme meines Deutschlehrers, dessen Finger auf meinen Stuhl zeigte. Auf den Boden hätte ich mich nicht gesetzt, so irre war ich noch nicht. »Es ist nicht fair, einen Aufstand zu machen, weil du die Nerven verlierst. Denk gefälligst an deine Mitschüler!«
Tz, die Nerven verlieren! Ich verlor die Kontrolle über eine Killermaschine, die vorhatte, uns alle umzubringen! Wie froh wäre ich gewesen, wenn es sich nur um meine Nerven gehandelt hätte?! Okay, ganz ruhig!, befahl ich mir selbst, setzte mich mechanisch wieder hin und bemerkte dank eines heftigen Schmerzes, dass ich mir gerade den halben Fingernagel abgebissen hatte. Ich musste cool bleiben! Falls Ken nicht gerade losmarschierte, um meine Welt zu zerstören, würde ich das mit meiner Zukunft machen, wenn ich jetzt panisch nach draußen rannte! Aber was zum Teufel machte er in der Stadt? Wo wollte er hin? Er hatte noch nie ohne mich den Hof verlassen! Was, wenn ihn irgendetwas auf den Gedanken gebracht hatte, es wäre so weit? Ken war unberechenbar, sein Gehirn funktionierte nicht wie andere Gehirne, er konnte Sachen so falsch verstehen, dass es fast wieder richtig war!
Hektisch hielt ich nach meiner Großmutter Ausschau, doch er war definitiv allein. Als ich mich reckte, sah ich, dass er einem alten Mann begegnete und sich demütig verbeugte. Hoffentlich erregt er nicht zu viel Aufmerksamkeit!, dachte ich und büßte noch einen Fingernagel ein. Dann verschwand er aus meinem Sichtfeld und ich war allein mit meinem ängstlich klopfenden Herzen und meiner Abiturarbeit.
Die folgenden Stunden zogen sich quälend in die Länge, und dass ich um einiges früher fertig war als meine Mitschüler, war nicht gerade hilfreich. Als wir endlich gehen durften, packte ich in Windeseile meine Sachen und stürmte nach draußen. Doch ich sollte nicht davonkommen, ohne mir noch einen fiesen Spruch einzufangen.
»Hey, kannst du uns mal sagen, was die Aktion sollte?«, pöbelte eine meiner Lieblingszicken.
Stöhnend drehte ich mich zu ihr um. »Tut mir leid, aber ich habe keine Zeit für Erklärungen!«
»Wie sieht’s aus, hast du schon die Zusage für die Klapse?«, rief eine andere. »Du hast sie doch nicht mehr alle! Andere müssen sich konzentrieren und du springst plötzlich auf und brüllst rum!«
Ich verdrehte die Augen. Ich musste versuchen, unsere Welt vor dem Untergang zu bewahren, aber andere mussten sich konzentrieren, oh mein Gott! »Sorry, ich muss weg!«, rief ich und zog damit noch mehr Unmut auf mich. Aber ich hatte meinen Ruf eh schon sicher. Völlig irre, ein MoF – Mensch ohne Freunde, Bauerntrampel … Na ja, wenigstens das hatte ich bald hinter mir. So oder so. Entweder waren alle tot oder ich lebte in einer anderen Stadt. Das Zweite war mir allerdings wesentlich lieber, aber leider auch schwieriger umzusetzen.
Ich hetzte nach draußen und suchte aufgeregt die Straße ab, doch ich konnte ihn nirgends entdecken. »Bitte, bitte, lass ihn zu Hause sitzen, ganz friedlich und in der festen Überzeugung, dass es noch nicht an der Zeit ist, unsere Welt zu vernichten!«, betete ich, als ich versuchte, mein Auto aufzuschließen. Doch meine Hand zitterte, als wäre ich betrunken.
Ich kann nicht mehr sagen, wie vielen Verkehrsteilnehmern ich die Vorfahrt nahm, wie viele rote Ampeln mich von hinten sahen und wie hoch meine durchschnittliche Geschwindigkeitsüberschreitung war. Trotz all dieser Vergehen schaffte ich es heil nach Hause.
Bleich und mit Angstschweiß im Gesicht stürzte ich ins Haus.
»Oma! Gott sei Dank, dir geht es gut!«, stieß ich hervor und eine erste Welle der Erleichterung strömte durch meinen mit Adrenalin vollgepumpten Körper.
Sie räumte gerade Geschirr in den Schrank mit dem Putzzeug – so viel zu ihrem geistigen Zustand – und sah mich verwirrt an. »Wieso auch nicht? Kind, was hast du denn? War dein Ausflug so schlimm?«
»Mein Ausflug? Oma, ich habe Abitur geschrieben!«
»Ach ja …«
Ich sah mich um. »Wo ist Ken? Oma, sag mir bitte, dass er hier ist!«
»Nein, er … er ist nicht da.«
»Wo ist er?«, fragte ich, mein Herzschlag dröhnte mir in den Ohren.
»Er, ich … ach, er hat es mir doch gesagt, wo wollte er noch einmal hin?«
Ich war kurz davor durchzudrehen und packte sie an den Schultern. »Oma, du musst dich erinnern! Ich flehe dich an, es geht um Leben und Tod!«
Erst schien sie verschreckt, dann lachte sie plötzlich. »Um Leben und Tod? So sehr kannst du ihn doch gar nicht vermissen!«
Ich öffnete den Mund, als ich eine Stimme hinter mir hörte.
»Vermissen? Du? Mich?«, fragte Ken und grinste.
Ich brauchte einen Moment, um das alles zu realisieren. Er hatte zwei riesige Tüten bei sich. Wie in Trance ließ ich mich auf den Stuhl sinken. »Einkaufstüten? Du warst einkaufen?«
Meine Oma schlug sich gegen die Schläfe. »Richtig, ich habe ihn ja losgeschickt!«
Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Am liebsten wäre ich schreiend auf den Tisch gesprungen, hätte mir das Shirt vom Leib gerissen, um mich dann aus dem Küchenfenster zu stürzen. Vielleicht würde ich vorher noch etwas anzünden.
»Wie viel Stress muss ein einzelner Mensch ertragen? Muss das ausgerechnet an dem Tag sein, an dem ich Abi schreibe? Einkaufen!!!«
Ken zog eine Augenbraue nach oben. »Stress? Wieso hattest du Stress?« Grinsend warf er mir eine Tafel Schokolade zu. Wenigstens hatte der Wolf nicht nur einen hübschen Schafspelz an, er wusste auch noch, was gestresste Frauen brauchen!
Ich schüttelte kaum merklich den Kopf. »Nicht so wichtig, ich habe mich unnötig verrückt gemacht. Sag mal, wie bist du eigentlich allein in die Stadt gekommen?«
»Mit dem Bus. Ich habe zu dem Fahrer genau das gesagt, was du immer zu ihm sagst. Und ich habe es ganz allein geschafft.« Er erwartete sicher, dass ich mich freute, aber mir war eher nach Heulen zumute. Das sah er mir auch an. »Mensch, was hast du denn? Du bist ja total blass!« Er nahm meine Hand und zog mich hoch, dann umarmte er mich. Wie ein Flummi sauste mein Herz durch meinen Körper, als er mir über die Haare streichelte. »Sicher, dass ich nichts für dich tun kann?«
»Nein, wirklich nicht«, antwortete ich mit zittriger Stimme. »Es geht mir schon besser, danke. Ich lege mich ein bisschen aufs Ohr und später bin ich wieder topfit.«
Er ließ mich los. »Wenn du was brauchst, ruf mich einfach!«
Ich nickte, aber das, was ich brauchte, konnte er mir nicht geben. Nämlich einen Plan, wie sich alles zum Guten wenden würde. Wie ich ihn davon abhalten konnte, meine Welt zu zerstören, und ihn im selben Atemzug davon überzeugen konnte, dass ich die perfekte Frau für ihn war.
Stöhnend ging ich in mein Zimmer. Dort warf ich mich aufs Bett und knabberte ein wenig an der Schokolade, ehe ich einschlief.
Als ich die Augen wieder aufschlug, fühlte ich mich wie gerädert. Ich sah auf den Radiowecker und stellte erschrocken fest, dass ich ganze fünf Stunden geschlafen hatte. »Wow«, murmelte ich, setzte mich auf und massierte mir den Nacken. Die ganze Aufregung hatte mich wohl ziemlich mitgenommen. Ich versuchte, das Gestrüpp auf meinem Kopf zu bändigen, dann schlüpfte ich in Top und Jogginghose und ging nach unten.
Ken stand im Wohnzimmer, die Hände zu Fäusten geballt, das Gesicht vor Wut verzerrt. Jeder Muskel schien angespannt, seine Arme bebten und an seinem Hals traten einige Adern hervor.
Irritiert blieb ich stehen. »Ähm, Ken?« Als Antwort bekam ich ein zorniges Knurren. »Was ist los?« Erst jetzt erkannte ich, dass er etwas in einer Faust hielt. Ich lehnte mich ein wenig zur Seite und rief meiner Großmutter zu: »Weißt du, was er hat?«
Sie lächelte mir freundlich zu und wunderte sich offenbar kein bisschen über seinen Zustand. »Ich habe ihn nur darum gebeten, Staub zu wischen. Ich fühle mich heute so müde.«
Ich blinzelte verwirrt. »Wieso wirst du deswegen wütend, Ken? Du hast schon einmal Staub gewischt.«
»Das ist es ja!«, brüllte er, wobei sich auch Panik in seine Stimme mischte.
Vorsichtig griff ich nach seiner Hand, mit der er den Putzlappen zerquetschen wollte. »Ken, du nimmst jetzt dieses Tuch und fährst damit über alle staubigen Oberflächen und niemandem wird etwas passieren, okay?«
Nun packte er mich an den Schultern und schüttelte mich derart heftig, dass meine Zähne klapperten. »Aella, verstehst du denn nicht?«, schrie er.
»Nein, Ken, ehrlich gesagt nicht!«, gab ich zurück und versuchte, ihn wegzustoßen, was mir nicht gelang. Er war zu stark, ich konnte ihn keinen Zentimeter bewegen, wenn er das nicht wollte.
»Ich habe das schon einmal getan, ich hatte ihn besiegt!«, rief er und hielt mir den Lappen unter die Nase. »Der Staub war weg, erledigt! Aber nun ist er wieder da, er ist zurückgekommen, ich habe versagt!« Tränen liefen über seine Wangen. »Wer weiß, was er vorhat? Und wo kommt er überhaupt her, wieso kann er sich unbemerkt ins Haus schleichen? Ich bin schwach, ich bin ein Versager! Ich war mir meiner Sache sicher, aber er ist zurück!«
Ich starrte Ken an, sprachlos, fassungslos und vor allem ahnungslos, wie ich darauf reagieren sollte. Lachen? Weinen? Ihm etwas gegen den Kopf schlagen? Irgendwann, als ich mich aus meiner Starre reißen konnte, legte ich ihm die Hand auf die Schulter. »Tja, Ken, du musstest leider dieselbe Erfahrung machen, die unzählige Hausfrauen in den Wahnsinn getrieben hat.«
Er presste die Hände gegen den Kopf. »Ah, ich wusste es! Dieses graue Zeug kann mich wahnsinnig machen! Es ist böse!«
Ich schlug mir so heftig gegen die Stirn, dass ein roter Abdruck blieb. »Die Einzige, die das Recht hat, hier drin wahnsinnig zu werden, bin ich!«
Ich ging in die Küche und schenkte mir ein Glas Orangensaft ein. Kurz überlegte ich, ihn mit Wodka zu mischen, anders hielt man es in diesem Haus ja kaum aus. Dann setzte ich mich auf einen Stuhl und sah nun doch belustigt zu, wie Ken den Schrecken überwand, seine Kämpferehre rufen hörte und zum zweiten Mal den Lappen schwang. Er raste in einer überwältigenden Geschwindigkeit durchs Haus, rannte über Tische und Stühle und schien wirklich jedes einzelne Staubkorn aufzuspüren. In der Gebäudereinigung würde er mit Sicherheit ganz groß rauskommen, dachte ich und schlürfte meinen Saft.
Nach einer Weile warf er sich erschöpft auf den Boden. »Ich … kann … nicht … mehr …«, stieß er hervor, was schwer zu verstehen war, denn seine Zunge hing recht seltsam in seinem linken Mundwinkel. Im nächsten Moment sprang er auf.
Ich gluckste. »Das heißt bei dir nicht mehr können? Du solltest mich mal nach dem Sportunterricht erleben, Junge.«
»Ich habe keine andere Wahl. Ich muss trainieren, daran führt kein Weg vorbei!«
Ich sah ihn kritisch an. »Du meinst, du willst dich wieder halb selbst umbringen?«
Seit einigen Tagen hatte er sein Trainingsprogramm geändert. Jedes Mal, wenn er zurückkam, sah er schrecklich aus. Aus tiefen Wunden blutend und mit blauen Flecken, blass und am Ende seiner Kräfte. Aber am Morgen danach sah er wieder aus, als sei nichts gewesen.
»Das ist das beste Training, das es gibt!«
»Oh, für Masochisten sicherlich. Aber was hast du eigentlich geändert, dass du dich plötzlich so fertig machst?«
»Soll ich es dir zeigen?«
Augenblicklich wurde ich nervös. »Du willst mich mitnehmen? Aber dein Training ist dir heilig!«
Er grinste. »Schon, aber wir sind Freunde, oder nicht? Wenn es dich interessiert, zeige ich es dir.«
Ich strahlte, denn ich wusste, dass das ein enormer Vertrauensbeweis war. Kaum jemand durfte wissen, wie sich Darnocianer auf ihre Kämpfe vorbereiteten. »Klar, gerne!« Voller Tatendrang stand ich auf. »Oma, wir sind weg!«, rief ich ihr zu und stellte irritiert fest, dass sie dabei war, etwa 20 Gläser mit Wasser zu füllen. Ich schüttelte kurz den Kopf und konzentriere mich dann voll und ganz auf Ken. Wie gut er aussah! Mit seiner leicht gebräunten Haut, den dunklen Haaren, dem strahlenden Lächeln und den überirdischen Augen. Ich hätte stundenlang neben ihm hergehen und ihn anschmachten können. Irgendwann wurde mir klar, dass ich genau das tat.
»Mensch, Ken, wie weit ist es denn noch?«, fragte ich, denn der Tag neigte sich bereits seinem Ende zu.
Fröhlich schwang er die Arme. »Ein gutes Training braucht eine ordentliche Aufwärmphase! Los, mach mit!«
Ich hatte sicher nicht vor, seine überaus albern anmutenden Übungen nachzuäffen. »Schon okay, ich bin warm genug«, behauptete ich halbherzig.
Er blieb stehen. »In Ordnung.« Dann begann er, mit den Händen herumzufuchteln.
Ich legte die Stirn in Falten. »Was machst du da?«
»Na, ich öffne das Tor!«
»Das Tor? Ähm, wo genau absolvierst du dein Training? Doch nicht in einer Parallelwelt, oder?«
»Doch, in der Welt von Licht und Schatten. Das ist ein Ort, an dem jeder trainieren kann.«
Die Rädchen in meinem Kopf drehten sich ratternd, und als sie einklickten, kam mir eine Erkenntnis, die mich nicht gerade freute. »Das heißt, du hättest das Tor überall öffnen können, oder? Wir sind völlig umsonst stundenlang durch die Pampa gelatscht.«
»Aufwärmtraining, Aella!«
Ich blies mir eine Haarsträhne aus dem Gesicht. »Großartig.«
Er strahlte. »Nicht wahr? Ich fand es auch super!« Wieder malte er mit seinen Fingern seltsame Formen in die Luft, und zwar so schnell, dass ich das Muster nicht erkennen konnte. Das tat ich erst, als es nach einigen Sekunden zu leuchten begann. Mit offenem Mund sah ich dabei zu, wie er es immer mehr vergrößerte, und bald befand sich vor uns eine wunderschön verschnörkelte, leuchtende Tür. Dann wurde es so hell, dass ich mir die Hand vor die Augen halten musste. Die Tür war verschwunden, dafür blickte ich nun in völlige Schwärze. Mir wurde mulmig zumute, doch Ken ergriff meine Hand und rief: »Komm, lass uns gehen!« Er zog mich mit sich und einen ängstlichen Herzschlag später fand ich mich in kompletter Dunkelheit wieder. Um uns herum war absolut nichts, ich konnte keinen Boden unter meinen Füßen erkennen, keine Wände, gar nichts. Trotzdem sah ich Ken klar und deutlich.
»Wieso nennt man das die Welt von Licht und Schatten? Hier gibt es kein Licht!«
Er lächelte. »Doch. Es gibt uns. Wir können nicht erwarten, dass es überall, wohin wir gehen, Licht gibt. Oft ist es an uns, dieses in die Dunkelheit hineinzubringen, verstehst du?«
Ich nickte langsam. »Ich glaube schon. Aber das ist etwas, was zumindest wir Menschen gerne verdrängen. Wir erwarten lieber, dass an jedem Tag die Sonne für uns scheint.« Ich ging einen Schritt nach vorne und spürte plötzlich einen heftigen Schlag am Hinterkopf, der mich zu Boden warf. »Aua!«, stöhnte ich entsetzt und rieb mir die schmerzende Stelle.
Ken lachte. »Wow, du bist ganz schön hinterhältig! »
»Ich bin hinterhältig?«, giftete ich empört, »wenn einer hinterhältig ist, dann …« Ich drehte mich zu der Person um, die mich niedergeschlagen hatte, und erstarrte, denn ich sah mir selbst in die Augen.
Ken machte einen Schritt auf die Seite und stand nun ebenfalls neben sich. »Das ist das Besondere an dieser Welt. Sie erzeugt ein Spiegelbild von uns, gegen das wir kämpfen. Das ist das härteste und beste Training der Welt, denn in jedem anderen Kampf, egal mit wem, steckt auch dieser. Wir selbst sind stets unser erbittertster Gegner und unsere einzige Chance zugleich.«
Ich wollte etwas sagen, da packte mich die andere Aella und zog mich auf die Beine, ehe sie zum nächsten Schlag ausholte. Erschrocken duckte ich mich, sie verfehlte mich knapp. »Ist das dein Ernst?«, schrie ich entsetzt und wich erneut aus. »Ich wollte dich begleiten, nicht selbst kämpfen!«
Er wehrte einen Fausthieb ab und nahm sich die Zeit, kurz zu mir herzusehen. »Echt?«
»Ja, echt!«, brüllte ich wütend und bekam meine Unaufmerksamkeit sofort zu spüren, denn meine Gegnerin trat mir in die Kniekehlen.