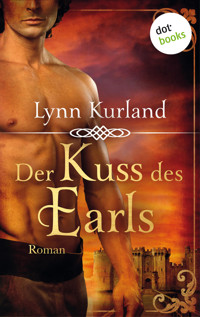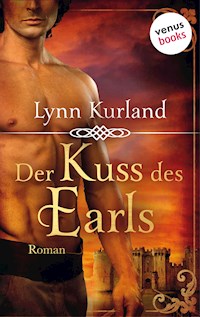0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: McLeod-Serie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Romantisch, schwungvoll, ein Genuss: der schottische Liebesroman „Die Leidenschaft des Highlanders“ von Lynn Kurland jetzt als eBook bei dotbooks. Endlich! Die Regisseurin Victoria McKinnon hat den perfekten Ort für ihre Aufführung von „Hamlet“ gefunden: Thorpeworld Castle in den schottischen Highlands! Allerdings hat sie die Rechnung ohne Connor gemacht. Der gutaussehende Lord ist wenig begeistert davon, dass sein Heim Theaterkulisse werden soll. Noch dazu weiß man in seiner Familie schon seit Generationen, dass man einer McKinnon ist nicht über den Weg trauen darf! Aber schon nach der ersten Begegnung ist er von ihrer starken Schönheit fasziniert, und auch in Victoria wird ein bisher unbekanntes Feuer entfesselt. Doch da gibt es ein schier unüberwindbares Problem … Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Die Leidenschaft des Highlanders« von Lynn Kurland ist ein besonderes Romance-Highlight für alle Fans historischer Liebesromane voller Romantik und Gefühl, das in Deutschland erstmals unter dem Titel »Der Geist des Highlanders« erschien. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 571
Ähnliche
Über dieses Buch:
Endlich! Die Regisseurin Victoria McKinnon hat den perfekten Ort für ihre Aufführung von »Hamlet« gefunden: Thorpeworld Castle in den schottischen Highlands! Allerdings hat sie die Rechnung ohne Connor gemacht. Der gutaussehende Lord ist wenig begeistert davon, dass sein Heim Theaterkulisse werden soll. Noch dazu weiß man in seiner Familie schon seit Generationen, dass man einer McKinnon ist nicht über den Weg trauen darf! Aber schon nach der ersten Begegnung ist er von ihrer starken Schönheit fasziniert, und auch in Victoria wird ein bisher unbekanntes Feuer entfesselt. Doch da gibt es ein schier unüberwindbares Problem …
Über die Autorin:
Lynn Kurland ist auf Hawaii aufgewachsen und begann dort schon im Alter von fünf Jahren mit dem Schreiben. Im College entdeckte sie schließlich ihre Leidenschaft für Liebesromane und beschloss kurze Zeit später, ihre eigenen zu verfassen. Heute lebt sie mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in den USA. Wenn sie nicht schreibt, spielt die ausgebildete klassische Musikerin Cello oder Klavier.
Von Lynn Kurland erscheinen bei dotbooks auch:
»Das Feuer des Lords«
»Die Sinnlichkeit des Highlanders«
Die Website der Autorin: www.lynnkurland.com
***
eBook-Neuausgabe Juni 2018
Dieses Buch erschien bereits 2008 unter dem Titel »Der Geist des Highlanders« bei Verlagsgruppe Weltbild GmbH.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe »Much Ado in the Moonlight« 2006 Lynn Curland
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.
This edition published by arrangement with Berkley, an imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC.
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2008 Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg
Copyright © der Neuausgabe 2018 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Valery Bascha, Dave Head
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (aks)
ISBN 978-3-96148-377-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Leidenschaft des Highlanders« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Lynn Kurland
Die Leidenschaft des Highlanders
Roman
Aus dem Amerikanischen von Margarethe van Pée
dotbooks.
Für die Damen in meinem Forum
Danksagungen
Abgesehen von meiner großartigen Familie, die das Leben für mich zum Himmel auf Erden macht, möchte ich folgenden Personen danken:
Gail Fortune, die mir meine erste Chance in dieser Branche gegeben hat, für ihr unerschütterliches Vertrauen in meine Geschichten;
Anne Sowards für ihre wundervollen Ideen, ihr Adlerauge und ihre Bereitschaft, sich auf die verwirrende Vielzahl an Protagonisten einzulassen;
Leslie Gelbman, weil sie mir immer wieder die Veröffentlichung meiner Arbeiten ermöglicht;
Judy G., die furchtlose, außergewöhnliche Camperin, die mir geholfen hat, mir vom Westen aus den Osten vorzustellen.
Und zuletzt möchte ich ganz besonders meinen Lesern danken, vor allem denen, die so wunderbare Zuschriften auf meiner Website und in meinem E-Mail-Postfach hinterlassen haben. Ich vergesse nie, dass Ihr es seid, die ihr schwer verdientes Geld für meine Bücher ausgeben. Ohne Euch hätten sie kein Zuhause. Tausend Dank!
Personen
Connor MacDougal, Laird des Thorpewold Castle
Victoria McKinnon
Thomas McKinnon, ihr Bruder
Iolanthe McKinnon, Thomas' Frau
Jennifer McKinnon, Victorias Schwester
John McKinnon, Victorias Vater
Helen McKinnon, Victorias Mutter
Mary MacLeod, Victorias Großmutter
Das Trio von The Boar's Head
Ambrose MacLeod
Hugh McKinnon
Fulbert de Piaget
Mrs Pruitt, die Gastwirtin im The Boar's Head
Die Schauspieler
Michael Fellini
Cressida Blankenship
Fred, der Inspizient
James MacLeod
Prolog
Thorpewold, GroßbritannienFrühling 2005
Sanft sank die Dämmerung über Thorpewold Castle herab. Die verfallene Pracht bildete die Kulisse für eine Szene, die sich in jedem der mittelalterlichen Schlösser auf der Insel hätte abspielen können.
Der Laird gab seinen Gefolgsleuten mit fester Stimme Anweisungen; er war gerecht und äußerst umsichtig. Seine Leute gehorchten den Befehlen des Lairds widerspruchslos. Bauern taten emsig ihre Arbeit, zufrieden mit ihrem Los und ängstlich darauf bedacht, ihrem Herrn zu dienen. Die Schläge des Schmiedehammers und die Laute des Viehs schallten durch die Luft. Männer unterhielten sich über das kühle Frühjahr und den Regen, der ausgerechnet in dem Augenblick einzusetzen schien, als sie zu ihren Fechtübungen ins Freie gegangen waren.
Es war ein Tag wie jeder andere, ein Tag, wie ihn jeder brave Mann zu beiden Seiten des Hadrianswalls erleben konnte.
Allerdings war dies nicht das mittelalterliche Schottland.
Und die Menschen in der Burg waren genau genommen auch keine Sterblichen.
Ambrose MacLeod wusste das. Er stand direkt hinter dem Außentor und beobachtete das Treiben. Er stellte den Fuß auf einen Stein, um sich bequemer an die Mauer lehnen zu können. Ja, ihm war nur allzu klar, was es hieß, ein Laird zu sein, schließlich war er selber einmal einer gewesen, und sein Clan war kriegerisch und schwer zu führen gewesen. Mit geübtem Blick musterte er den frisch ernannten Laird of Thorpewold Castle, um abzuschätzen, wie effektiv der Mann seine Aufgabe erfüllen würde, eine Burg dieser Größe samt den Kerlen, die dazu gehörten, zu regieren. Nun, effektiv war sicher ein viel zu zahmes Wort für die Art von Herrschaft, die Connor MacDougal ausüben würde.
Dieser MacDougal stand gerade auf der Außenmauer und gebot so bestimmt über seine Truppen, dass jeder Monarch der Gegenwart und der Vergangenheit ihn dafür bewundern müsste.
»Du da«, sagte er und zeigte auf einen unglückseligen Schotten mit knochigen Knien, »du übernimmst die erste Wache. Die Mauern werden rund um die Uhr abgesichert.«
Der Mann neigte respektvoll seinen Kopf. »Aber wir haben doch gar keine Mauern, die wir bewachen könnten, Mylord.«
Connor zeigte hinter sich auf die einzige Mauer, an der der Zahn der Zeit nicht genagt hatte. »Hier ist doch eine Mauer. Bewach sie.«
Der Mann eilte davon, sein karierter Rock flatterte ihm um die dünnen Beine.
»Und du da«, sagte MacDougal und zeigte auf einen anderen Mann, »du bewachst die Tore. Und du das Vieh. Du, Robert, du kümmerst dich um die Ställe. Ich will nicht, dass meinen Pferden etwas geschieht.«
Ambrose betrachtete das einsame Pferd im Hof, einen alten, nutzlosen Gaul, der selbst im äußersten Notfall kein geeignetes Reittier für einen Highlander abgegeben hätte. Warum kümmerte sich Connor überhaupt darum?
Andererseits hatte der Mann siebenhundert Jahre lang warten müssen, bis er die Burg sein Eigen nennen konnte; angesichts dieser Tatsache war es wahrscheinlich nicht weiter verwunderlich, dass er sein Eigentum beschützen wollte.
»Mylord«, begann ein Mann, der seine Kappe verlegen in den Händen drehte, »was ist mit dem Turm? Der Turm, den der junge Thomas McKinnon vollendet ...«
Connor fluchte. »Wir tun so, als gäbe es ihn nicht.«
»Aber wird er nicht zurückkommen, um Gebrauch von ihm zu machen?«
»Nicht, wenn er weiß, was gut für ihn ist«, knurrte Connor. »Und jetzt verschwinde und belästige mich nicht weiter mit deinen dummen Fragen. Kümmere dich um die Hühner.«
»Aber, Mylord«, wandte der junge Mann ein und bearbeitete seine Kappe so heftig, als wolle er sie zu Filz verarbeiten, »wir haben keine Hühner. Wir haben ... Huhn.«
Connor runzelte die Stirn. »Huhn?«
»Ein Huhn, Mylord.«
»Dann geh und kümmere dich darum, du Tölpel!«
»Aber es ist schon beinahe dunkel, Mylord. Das Huhn schläft.«
»Weck es auf und bring es in den Stall!«, rief Connor.
Der Mann nickte, verbeugte sich tief und eilte davon.
Kurz darauf hörte man eine Henne lautstark protestieren.
Ambrose lachte. Die Heiligen mochten all diese armen Narren vor Connor MacDougals Zorn bewahren. Aber wenigstens hatten sie eine anständige Burg, um diese Qualen zu ertragen.
Ambrose blickte zufrieden über die Festung. Jawohl, es war eine schöne Anlage. Der hintere Turm war im letzten Sommer von Thomas McKinnon wiederhergestellt worden. Thomas' Aufenthalt auf Thorpewold war eine interessante Angelegenheit. Er hatte kurze Zeit im Schloss gelebt und war dann mit seiner Braut nach Amerika zurückgekehrt. Sein Anwesen hatte er unbewohnt zurückgelassen, aber er hatte sicherlich vor zurückzukommen.
Und in weniger als vierzehn Tagen würde ein Sterblicher hierher kommen und die Burg beziehen. Ambrose lachte leise. Was würde Connor MacDougal wohl sagen, wenn er feststellte, dass er einen Gast hatte?
Ambrose wagte nicht, es sich auszumalen.
Und er vermied es außerdem, sich noch länger hier aufzuhalten. MacDougal hatte ihm schon mehrere finstere Blicke zugeworfen. Nicht dass Ambrose sich vor ihm fürchtete. Er und Connor hatten in der Vergangenheit schon manchen Händel ausgetragen, und er hatte sich stets wacker geschlagen. Leider war heute jedoch nicht der richtige Tag für solcherlei Vergnügungen. Am Ende würde ihm in der Hitze des Gefechts noch etwas über den bevorstehenden Besuch entschlüpfen, und dann wäre die ganze Überraschung ruiniert.
Nein, er kümmerte sich jetzt besser um seine eigenen Angelegenheiten und überließ MacDougal seinen Pflichten.
Er warf noch einen letzten amüsierten Blick auf die Männer, die sich beeilten, Connors Befehle auszuführen, dann drehte er sich um und ging den Weg hinunter, der vom Schloss zur Straße führte. Die Sonne sank gerade, und er genoss die Farben des Abends, während er zu einem kleinen Gasthof wanderte, der sich in einiger Entfernung zur geschäftigen Ortschaft an einen kleinen Hügel schmiegte.
Ambrose betrachtete bewundernd das solide Gebäude mit den schweren Dachbalken und den bleigefassten Fenstern. Das Haus war von einem hübschen Garten umgeben, in dem die ersten Frühlingsblumen dufteten.
Leider jedoch konnte er sie nicht riechen, denn seine Nase hatte ihren Dienst schon vor Jahren versagt.
Vor einigen hundert Jahren, um genau zu sein.
Allerdings war der Verlust des Geruchssinns nur ein geringer Preis für all das, was er in seinem Nachleben gewonnen hatte. Wer hätte je ahnen können, dass es so viel Vergnügen machen könnte, ein Gespenst zu sein?
Natürlich war es auch anstrengend, aber daran konnte er nichts ändern. Wer sollte sich sonst um sein eigenes Wohlergehen kümmern? Er schritt durch den Garten, wobei sein Schottenrock ihm um die Knie schwang und sein Schwert ihm gegen den Oberschenkel schlug wie schon seit vierhundert Jahren. Manche Dinge änderten sich eben nie. Ein Highlander blieb ein Highlander, ganz gleich in welchem Jahrhundert.
Er hatte den Eingang des Gasthauses beinahe erreicht, als die Tür aufflog und eine ältere Frau von freundlichem Wesen und stählerner Entschlusskraft heraussprang, einen Staubwedel in der Hand.
»In meiner Stube gibt es keine widerlichen Krabbeltiere«, erklärte sie und schüttelte den Staubwedel aus. »Weg mit euch, ihr kleinen Plagegeister!
Dann blieb sie nachdenklich auf der Schwelle stehen und blickte sich misstrauisch um, als ob sie nach etwas anderem als nach Ungeziefer Ausschau hielte.
Ambrose tat das Einzige, was ihm übrig blieb: Er versteckte sich hinter der Tür und wartete, bis Mrs Pruitt, die Wirtin, die während der Abwesenheit des Eigentümers das Gasthaus gepachtet hatte, rasch einen Blick über ihren Garten geworfen hatte und dann zögernd wieder ins Haus gegangen war.
Er stieß einen Seufzer der Erleichterung aus und überlegte, wie er weiter vorgehen sollte. Natürlich konnte er die Vordertür benutzen. Das tat er oft. Schließlich unterlag das Gasthaus im Grunde seiner Führung; er konnte kommen und gehen, wann er wollte. Heute Abend jedoch würde er einen anderen Weg wählen ...
Und er konnte nur hoffen, dass Mrs Pruitt von ihrem Tagwerk so müde war, dass die Küche heute Nacht leer war.
Als alles still war, schlich er auf Zehenspitzen zur Rückseite des Hauses und spähte durch das Küchenfenster. Drinnen war alles dunkel. Er stieß einen erleichterten Seufzer aus, dann trat er ein, entzündete mit einem Schlenkern des Handgelenks die Kerzen und ließ mit einer weiteren nachlässigen Geste das Feuer in dem glänzend schwarzen Ofen aufflackern.
Er zog sich einen Stuhl an den Ofen, schnipste mit den Fingern und holte einen Krug mit Ale aus der Luft, und dann lehnte er sich behaglich zurück und bereitete sich darauf vor, die erfreulichen Ereignisse zu überdenken, die ohne jeden Zweifel eintreten würden, wenn seine Enkelin – das war sie zumindest über mehrere Generationen hinweg – später in diesem Monat aus Amerika eintreffen würde. Sie war ein lebhaftes, eigensinniges Mädchen, aber da er diese Charakterzüge an sich selbst schätzte, sah er nicht ein, warum er sie ihr verübeln sollte.
Die Hintertür ging auf und schlug mit einem Knall wieder zu. Auf dem Läufer stand ein Mann, stampfte mit den Füßen und pustete sich in die hohlen Hände. »Kalt draußen«, murrte er. »Man sollte meinen, dass der Frost Ende März schon ein bisschen nachgelassen hätte.«
Ambrose schürzte die Lippen. »Du lebst jetzt seit vierhundert Jahren in England, Fulbert, und ich glaube, genauso lange beklagst du dich schon über das Wetter. Warum erwartest du eigentlich ständig, dass es wärmer ist als gewöhnlich?«
Fulbert de Piaget warf sich auf einen Stuhl und genehmigte sich ebenfalls einen Krug mit heißem Ale. »Die Hoffnung stirbt nie«, brummte er.
»Ja, das mag sein«, gab Ambrose zu, »aber der Frühling kommt, wann er will. Sei dankbar, dass du in diesem sanften, südlichen Land leben durftest. In den Highlands gibt es im März immer noch Eis und Frost.«
»Deshalb haben die Schotten ja auch immer schlechte Laune«, erwiderte Fulbert.
Ambrose hatte gerade den Mund geöffnet, um Fulbert über die Feinheiten des schottischen Charakters zu belehren, als sich die Tür öffnete und sein Landsmann Hugh McKinnon hereinspähte.
»Ist sie in der Nähe?«
Fulbert schürzte die Lippen. »Wer?«
»Mrs Pruitt«, erwiderte Hugh mit klappernden Zähnen. »Wer sonst?«
»Hab' sie nicht gesehen«, sagte Fulbert. »Sie ist vermutlich damit beschäftigt, sich zurechtzumachen, um ihrem Schatz hier zu gefallen.«
»Dem Himmel sei Dank«, stieß Hugh hervor und trat in die Küche. Er schloss die Tür hinter sich und nahm seinen Platz am Ofen ein. »Ich wünschte, du brächtest es endlich hinter dich, Ambrose«, sagte er. »Sprich mit der armen Frau.«
»Ja, genau«, warf Fulbert ein und wandte sich Ambrose zu. »Du hast der guten Mrs Pruitt eine Unterredung zugesagt, und du musst dein Versprechen halten.«
»Ich werde mit ihr sprechen, wenn ich die Zeit dazu finde«, erwiderte Ambrose mit zusammengebissenen Zähnen.
Fulbert grunzte. »Dann sorg dafür, dass du bald Zeit hast. Die Frau ruiniert mir langsam den Schlaf mit dem ständigen Piepsen und Rumoren ihrer Geräte.«
»Irgendwann wird sie es leid, hinter uns herzujagen«, erklärte Ambrose zuversichtlich.
»Vielleicht«, erwiderte Fulbert, »aber dich wird sie immer weiter verfolgen.«
»Ja, das stimmt«, warf Hugh ein. »Und sie hat genügend Geräte, um ihre Untersuchungen des Paranormalen in alle Ewigkeit fortzusetzen. Mir kommt es so vor, als ob der Paketdienst ihr alle vierzehn Tage eine neue Lieferung bringt.«
»Nun, heute Abend brauchen wir uns darüber keine Sorgen zu machen«, meinte Ambrose. »Ich bin mir ziemlich sicher, dass Mrs Pruitt zu Bett gegangen ist ...«
Hinter ihnen knarrte die Tür, die die Küche vom Esszimmer trennte.
»Iiih!«, kreischte Hugh und verschwand.
Wortlos schüttete Fulbert sein Ale in einem Zug herunter und löste sich ebenfalls auf.
Ambrose löschte alle Lichter bis auf eine einzelne Kerze, hatte jedoch keine Zeit, sich aus dem Staub zu machen, als die Tür auch schon ein zweites Mal knarrte. Er warf einen Blick über die Schulter, in der Hoffnung, seine Ohren hätten ihn getäuscht. Aber es war vergebens.
Die Tür öffnete sich einen Spaltbreit, und Ambrose sah mit Schrecken, dass ein Gespenster-Geigerzähler hindurchgeschoben wurde. Das Biest machte kleine, klickende Geräusche, an den Seiten brannten Lämpchen, und die beiden Metallzeiger sprangen hoch, als stünden aufsehenerregende Entdeckungen bevor.
Ambrose fluchte leise. Gab es denn auf dieser Welt keinen Frieden mehr?
Die Hand, die das Gerät hielt, schob sich durch den Spalt. Sie sollte sich besser darauf beschränken, Gäste zu bedienen und wohlschmeckende Mahlzeiten zuzubereiten, als arme, unglückselige Schatten zu quälen. Leider jedoch kümmerten sich die Hand und die Person, zu der sie gehörte, um Dinge, die sie nichts angingen.
Zum Beispiel um ihn.
Die Tür wurde aufgestoßen, und Mrs Pruitt sprang in die Küche, von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet.
Unwillkürlich wich Ambrose zurück. Er stellte sich neben die Hintertür, wo Mrs Pruitt seine Anwesenheit vielleicht nicht erspüren konnte.
»Ich weiß, dass Ihr hier drinnen seid«, erklärte Mrs Pruitt und schwenkte ihre Taschenlampe. »Zeigt Euch endlich, verdammt noch mal!«
Rasch hüpfte Ambrose auf einen Arbeitstisch, während Mrs Pruitt mit ihrer Taschenlampe in jeden Winkel leuchtete, bis sie schließlich vor der Tür stehen blieb. Der Geigerzähler klickte, und die Lämpchen blinkten besorgniserregend. Angstvoll starrte Ambrose auf die Zeiger, die hektisch hin und her schwangen.
Plötzlich jedoch gab es einen lauten Knall, und das Gerät versagte den Dienst. Auf einmal war es totenstill im Raum.
Mrs Pruitt warf den kaputten Geigerzähler auf den Tisch und betrachtete ihn mit geschürzten Lippen.
»Anscheinend war es doch nur der Wind unter der Tür«, murmelte sie.
Ambrose seufzte erleichtert auf.
»Feigling«, ertönte eine Stimme neben ihm. Ambrose warf Fulbert, der wieder aufgetaucht war, einen finsteren Blick zu.
»Kannst du mir daraus einen Vorwurf machen?«, flüsterte er gereizt.
»Du hast der Frau dein Wort gegeben. Ich habe doch selber gehört, wie du mit ihr verhandelt hast.«
»Ja, verdammt noch mal, aber ich habe mich nie festgelegt, wann ich das tun werde.«
Mrs Pruitt warf ihren Apparat in den Abfalleimer, drehte sich um und marschierte fluchend aus der Küche. Ambrose sah ihr erleichtert nach.
»Ich werde ihr sagen, dass du vorhast, sie zu verführen«, erklärte Fulbert mit unheilverkündendem Blick, »und dann werden wir ja sehen, was passiert ...«
Ambrose fragte sich, ob es ihm wohl besser ginge, wenn er Fulbert den Hals umdrehen würde. Aber Fulbert war immerhin der Gatte seiner Schwester – und wenn das nicht ausreichte, um einen Mann davon zu überzeugen, dass es Dinge zwischen Himmel und Erde gab, die einem einfach über den Verstand gingen, dann wusste er auch nicht weiter. Dem Kerl hier konnte er jedenfalls nicht so ohne Weiteres etwas antun, ohne dafür bezahlen zu müssen.
»Ich zeige mich ihr schon, wenn die Zeit reif ist«, erwiderte Ambrose mit fester Stimme. »Bis dahin sollten wir uns lieber um unsere nächste Aufgabe kümmern.« Gewandt sprang er vom Arbeitstisch und setzte sich wieder ans Feuer.
»Kuppelei!« Fulbert schnaubte verächtlich und zog sich ebenfalls wieder den Stuhl an den Ofen. »Ich habe so langsam das Gefühl, dass dies nicht wirklich die richtige Beschäftigung für einen Mann meines Standes ist.«
»Dann such dir eine andere Aufgabe«, erwiderte Ambrose spitz.
»Das würde ich ja, aber du würdest ja ohne meine Hilfe keine einzige dieser Hochzeiten zustande bringen, und was dann?«
»Nun ...« – »Dann müsste ich alle Katastrophen, die du verursacht hast, wieder in Ordnung bringen«, fuhr Fulbert in herablassendem Tonfall fort und holte sich erneut seinen Bierkrug aus seinem unsichtbaren Aufbewahrungsort. »Und, wer ist es dieses Mal? Der Name will mir nicht einfallen ...«
»Du weißt sehr wohl, wer hierher kommt.«
Fulbert nahm einen tiefen Schluck von seinem Ale. »Ich habe versucht, es zu vergessen.« Er warf Ambrose über dem Rand des Kruges einen Blick zu. »Na los, spuck es schon aus.«
»Victoria McKinnon, und wage es bloß nicht, dich über sie lustig zu machen.«
»Mich über sie lustig machen?«, echote Fulbert. »Niemals würde ich das wagen! Aber, bei allen Heiligen, müssen wir uns gerade mit dieser McKinnon abgeben? Ich kann mich an Mistress Victoria noch gut erinnern, von der Hochzeit des jungen Gideon mit deiner Enkelin, dieser Megan MacLeod McKinnon.« Er erschauerte. »Als ob es nicht schon schlimm genug gewesen wäre, dass diese Megan meinen Neffen geheiratet hat, jetzt sollen wir uns auch noch von einem anderen deiner Nachfahren peinigen lassen ...«
»Sprich nicht so von meiner kleinen Enkelin!«, bellte eine erzürnte Stimme. Hugh McKinnon tauchte auf, mit hochrotem Gesicht und gezogenem Schwert, dessen Spitze auf Fulberts Brust zeigte.
»Ich spreche ja gar nicht mehr von Megan«, brummelte Fulbert, »aber diese Victoria ...«
»Auch über sie dulde ich kein böses Wort!«, donnerte Hugh. »Sie ist ein entzückendes Mädchen ...«
»Hugh, sie ist der reinste Garnisonskommandant!«, rief Fulbert aus.
Hugh wand sich unbehaglich, stieß dann jedoch hervor: »Sie ist ... äh ... eben sehr zielgerichtet.«
Fulbert sprang so plötzlich auf, dass sein Stuhl umfiel. Schwungvoll zog er sein Schwert. »Und ich sage, sie ist unmöglich! Sie beschäftigt sich mit nichts anderem, als diese launischen Schauspieler und Tänzer zu unterweisen ...« Er schnaubte. »Albernheiten! Warum darf ich mir nicht einmal ein wenig Blutvergießen wünschen, wenn es um ein Frauenzimmer geht ...«
»Ich gebe dir so viel Blutvergießen, wie du willst, du anmaßender Brite!« Hugh schubste Fulbert.
Fulbert packte sein Schwert fester. »Milchgesichtiger Rockträger!«
»Milchgesichtig?«, wiederholte Hugh. »Milchgesichtig?«
Sie hoben die Schwerter, als wollten sie tatsächlich aufeinander losgehen. Ambrose fluchte. Wenn die Umstände es erlaubten, dann war auch er jederzeit für einen kleinen Kampf zu haben, aber hier war weder der richtige Zeitpunkt noch der richtige Ort.
»Macht das draußen miteinander aus«, befahl er.
Hugh bremste seinen Schlag, und auch Fulbert hielt inne, bevor er Hughs Schädel spaltete. Sie blickten einander an, zuckten mit den Schultern und verschwanden freundlich plaudernd durch die Tür.
Kurz darauf drang mächtiges Waffenklirren aus dem Garten herein. Ambrose hoffte, dass es bald zu Ende wäre, aber er wusste, dass es keinen Zweck hatte. Stumm begann er zu zählen, und es dauerte nicht lange, da flog die Tür auf, und eine wütende Mrs Pruitt mit Lockenwicklern und rosafarbenem Morgenmantel stürmte mit gezückter Videokamera in die Küche, wobei sie ihm fast ein Auge ausstach. Sie rauschte zur Hintertür hinaus.
Ambrose seufzte, als sich die Geräusche draußen veränderten. Blutvergießen? Ja, möglicherweise, und nicht nur dadurch, dass Mrs Pruitt über die Gartengeräte stolperte.
Von draußen drangen jetzt Flüche und Schreie zu ihm herein. Ambrose lehnte sich auf dem Stuhl zurück und harrte der Dinge, die da kamen. Plötzlich wurde es still, und anstelle der Flüche und Schreie hörte man das leise Murmeln einer Frau, die sich den Film auf ihrer Videokamera anschaute und feststellte, dass darauf nichts von den paranormalen Aktivitäten zu sehen war, die sie eigentlich erwartet hatte. Es überraschte Ambrose gar nicht, als Mrs Pruitt kurz darauf durch die Küche ins Esszimmer marschierte und ihre gesamte Ausrüstung verwünschte.
Hinter ihr betraten Hugh und Fulbert kopfschüttelnd die Küche. Die Schwerter hatten sie wieder in die Scheide gesteckt.
»Rede endlich mit ihr«, sagte Fulbert zu Ambrose.
Hugh stimmte mit einem nervösen Nicken zu.
Ambrose seufzte. »Ja, bald. Wenn unsere nächste Aufgabe erledigt ist. Ich hätte mich schon längst darauf vorbereiten müssen, aber der Winter in den Highlands war so angenehm ...«
»Ja, das ist er immer«, stimmte Hugh ihm wehmütig zu.
»Und deshalb habe ich herumgetrödelt, statt zu arbeiten. Und jetzt bleibt mir kaum mehr genügend Zeit.« Ambrose trank einen Schluck Ale. »Zum Glück wissen wir über den Jungen gut Bescheid.«
»Tatsächlich?«, fragte Fulbert. »Ich ziehe zwar stets interessanten Klatsch den langweiligen Fakten vor, aber ich muss mich doch fragen, wie viel von dem, was wir über ihn wissen, der Wahrheit entspricht.«
Hugh blickte ihn erstaunt an. »Was gibt es denn da groß zu wissen?«, stieß er hervor. »Connor MacDougal ist unangenehm, unhöflich und gefährlich.« Er warf Ambrose einen Blick zu. »Ich frage mich, warum wir so ein süßes, zartes Mädchen wie meine Victoria in diese Löwengrube schicken.«
»Süß?« Fulbert griff sich an den Hals. »Zart? Bist du wahnsinnig ge...?«
»Wie auch immer«, unterbrach Ambrose ihn mit fester Stimme. »Wir wollen diese beiden zusammenbringen. Und ich sage euch, am Ende werden wir sicher feststellen, dass wir uns in der einen oder anderen Hinsicht getäuscht haben, was das junge Paar angeht. Nun«, fügte er hinzu, »mich wird das nicht überraschen, aber zweifellos die anderen. Letztendlich wird alles gut werden. Und für den Moment müssen wir uns eben mit den Gerüchten über den Jungen begnügen, und ich werde ein wenig nachforschen, was unsere liebe Victoria so vorhat. In zwei Wochen treffen wir uns hier erneut und vereinbaren einen Plan.«
»Das ist reichlich Zeit«, stimmte Fulbert zu.
Ambrose warf ihm einen strafenden Blick zu. »Vor allem reichlich Zeit für dich und Hugh, es ohne einen Streit auszuhalten.«
Fulbert öffnete den Mund, um Ambrose zu widersprechen, aber dieser blickte ihn so streng an, dass er sich darauf beschränkte, leise in seinen Alekrug zu murmeln. Auch Hugh machte den Eindruck, als wolle er etwas anmerken, aber Ambrose brachte auch ihn mit seinem Blick zum Schweigen. Darauf verschränkte Hugh die Arme vor der Brust und starrte mit finsterer Miene ins Feuer.
Zufrieden damit, seine Gefährten an ihren Platz verwiesen zu haben, wünschte Ambrose ihnen eine gute Nacht, räumte Stuhl und Krug weg und verließ die Küche. Durch Esszimmer und Diele ging er nach oben, in sein eigenes Schlafgemach, das immer leer blieb, auch wenn das Gasthaus belegt war und noch Gäste eintrafen. Anscheinend wollte niemand die Nacht in dieser verschwenderischen Umgebung aus dem sechzehnten Jahrhundert verbringen. Ambrose verstand gar nicht, warum.
Aber es war ihm auch egal, solange er dadurch einen Schlafplatz hatte; für das Kommende sollte er besser gut ausgeruht sein. Es gab noch viel zu tun, zahlreiche Details und Pläne auszuarbeiten, von denen der Mann und die Frau, um die es ging, nichts ahnen durften.
Es versprach eine spannende Partie zu werden, und er konnte es kaum erwarten, sie zu spielen.
Kapitel 1
Es lag ein Geruch in der Luft, der Victoria MacLeod McKinnon gar nicht gefiel.
Mit dem Abendessen hatte es nichts zu tun, da war sie sich ziemlich sicher. Sie saß an einem sich schier durchbiegenden Bauerntisch im wunderschönen Haus ihres Bruders in Maine und genoss ein Abendessen, das dazu angetan war, den verwöhntesten Gaumen zu erfreuen, und dabei wahrscheinlich noch durch und durch gesund war. Victoria blickte sich bewundernd in Thomas' Esszimmer um, das auf den atlantischen Ozean mit seiner eindrucksvollen Brandung hinausging. Der Geruch der salzigen Luft, der sich mit den Küchendüften vermischte, hätte sie eigentlich erfrischen und ihr das Gefühl von Zufriedenheit geben müssen. Das geschmackvolle Interieur hätte sie in Entspannung versetzen müssen. Und der Gedanke daran, ein ganzes Wochenende hier verbringen zu können, hätte in ihr nur das Bedauern darüber wecken dürfen, dass sie nicht länger bleiben konnte.
Sie schnüffelte.
Da war es wieder. Irgendetwas stank wie die Pest.
Victoria blickte auf den Rosenkohl, den sie gerade auf die Gabel gespießt hatte, und unterdrückte das Bedürfnis, ihn ihrem Bruder in den Hals zu stopfen.
»Ich verstehe leider nicht, was daran so lustig sein soll«, sagte sie und zielte drohend mit der Gabel auf ihn.
Thomas, der Koch, Innenarchitekt und außerordentliche Wohltäter, schüttelte nur lächelnd den Kopf. »Entschuldigung, ich kann nicht anders.«
Victoria schürzte die Lippen. »Du hast mir dein Schloss angeboten«, sagte sie sehr betont, »du hast mir Geld gegeben, damit ich dort mein nächstes Stück aufführen kann. Du bezahlst alles, was mit dieser Produktion zusammenhängt und möchtest von mir nicht einmal einen Beleg darüber haben. Wieso bekommst du jedes Mal, wenn wir darüber sprechen, einen Lachanfall?«
»Dein Bruder hat zu lange in zu großer Höhe gelebt«, sagte ihr Vater, der neben ihr saß. »Das hat die Bereiche in seinem Gehirn geschädigt, die für den Humor zuständig sind.«
»Oh, John, sag doch nicht so etwas«, warf Victorias Mutter lachend ein. »Thomas ist einfach nur glücklich. Er bekommt ein Baby.«
»Nein, Mom«, erwiderte Thomas und ergriff die Hand seiner Frau. »Iolanthe bekommt ein Baby. Ich bin nur der nervöse werdende Vater.«
Victoria versenkte ihren Rosenkohl in Käsesauce und steckte den Bissen in den Mund, bevor sie es sich anders überlegte. Sie musste irre gewesen sein, als sie die Einladung in das Liebesnest ihres Bruders angenommen hatte. Was hatte sie sich nur dabei gedacht?
Wahrscheinlich hatte es an ihrem schlechten Gewissen gelegen; ihre Mutter hatte sie eingeladen; Victoria hatte kapituliert. Man hatte sie unter dem Vorwand nach Maine gelockt, sich ein bisschen Entspannung zu gönnen, bevor sie sich in ihre nächste Produktion stürzte. Ein ruhiges Wochenende abseits von all dem Trubel, hatte ihre Mutter gesagt. Victoria war zwar misstrauisch gewesen, aber sie hatte ihre Eltern schon seit einem Monat nicht mehr gesehen, und ihren Bruder sogar noch länger, und deshalb hatte sie widerstrebend nachgegeben und die Einladung angenommen.
Leider war jedoch ein Wochenende in Thomas' Traumhaus, bei dem sie gezwungen war, sein überwältigendes Glück mit seiner seit Kurzem auch noch schwangeren Frau anzusehen, für sie weder ruhig noch entspannend. Sie musste unbedingt wieder in die Stadt zurück, wo sie Kapitän auf ihrem eigenen Schiff war.
Und überhaupt, sie hasste Rosenkohl. Das war sicher Thomas' Idee gewesen. Er war auf dem Gesundheitstrip. Vorbei waren die Tage, in denen ihr Bruder das Geld nur so gescheffelt, gefährlich hohe Berge bestiegen und Mahlzeiten voller gesättigter Fettsäuren zu sich genommen hatte. An Stelle des wilden Mannes war der Homo sapiens domesticus getreten, mit Schürze und einer Einkaufsliste mit gesunden Lebensmitteln für eine Frau, der es vor allem morgens immer übel war. Victoria konnte sich nicht vorstellen, warum ausgerechnet Rosenkohl dagegen helfen sollte. Aber vermutlich war das Gemüse nicht die einzige Demütigung, die Iolanthe MacLeod erdulden musste, nachdem sie Thomas McKinnon geheiratet hatte.
Iolanthe machte allerdings keinen unglücklichen Eindruck. Victoria musterte ihre Schwägerin und sah nur eine strahlende, wenn auch leicht grünliche Schönheit, die zufrieden zu sein schien, an einen Mann gefesselt zu sein, der einmal sogar auf offener Bühne in der Nase gebohrt hatte. Er war zwar damals erst neun Jahre alt gewesen, aber Victoria hatte ihn danach als Schauspieler abgeschrieben und ihre Meinung nie mehr geändert.
Iolanthe hingegen schien dem Irrtum zu unterliegen, es sei etwas Gutes, mit Thomas McKinnon verheiratet zu sein. Nein, es war sogar noch schlimmer. Thomas und Iolanthe warfen sich von Zeit zu Zeit Blicke zu, die von tiefer, dauerhafter Liebe zeugten – als ob sie große Schwierigkeiten überwunden hätten, um endlich zusammen sein zu können.
Victoria schnaubte. Iolanthes einzige Prüfung hatte darin bestanden, Thomas auf seinem Schloss zu begegnen. Daraufhin hatte sie anscheinend komplett den Verstand verloren und ihn geheiratet.
Und jetzt hatte Victoria das zweifelhafte Vergnügen, dem Paar beim Turteln zuzuschauen.
Victoria wandte den Blick von den beiden Liebeskranken ab und betrachtete ihre Eltern. Sie gingen auch liebevoll miteinander um, klebten aber weit weniger aneinander. Ihre Mutter blickte heiter und gelassen auf Iolanthe, die Thomas abwehrte, weil er ihr ständig noch mehr Gemüse aufdrängen wollte. Victoria warf ihrem Vater einen Blick zu.
Sie liebte ihren Vater.
Natürlich liebte sie auch ihre Mutter. Helen MacLeod McKinnon war eine reizende Frau, die sogar lange Kostümproben durchstand, ohne unbehaglich hin und her zu rutschen. Aber sie hatte auch einen starken Hang zu dem, was sie als »MacLeod-Magie« bezeichnete. Victoria nannte es schlicht »Geisterseherei«, und sie zog die solide Verlässlichkeit ihres Vaters jedem unerwarteten Ereignis vor.
»Erklär mir noch einmal ganz genau, was du vorhast«, bat sie ihr Vater jetzt und wilderte auf ihrem Teller.
Victoria überließ ihren letzten Rosenkohl nur zu gern der Gabel ihres Vaters. »Um Licht und Ton habe ich mich schon vor zwei Wochen gekümmert. Die Kostüme werden morgen gepackt. Am Montag bin ich in Manhattan, um mich zu vergewissern, dass sie ordnungsgemäß verschickt werden. Und am Wochenende beenden die Schauspieler ihre Nebenjobs, um ab Montag nach Europa zu fliegen.«
»Nebenjobs?«, echote Thomas. Er verschluckte sich und half sich mit einem großen Glas Wasser.
»Sind die Pässe alle in Ordnung?«, fragte ihr Vater. »Haben die Schauspieler alle neue Fotos?«
Helen lachte. »Es sind Menschen, mein Lieber, keine Haustiere.«
»Das sagst du immer«, erwiderte John, »aber ich bin mir da nicht ganz sicher.« Er warf Victoria einen Blick zu. »Du weißt ja, dass es in England recht seltsam ist.« Er nickte wissend. »Du weißt schon. Seltsam.«
»Dad, es ist nicht der Mars«, sagte Victoria. »Ich werde es schon überleben.«
»Es wird ihr sogar gut tun, Dad«, fügte Thomas fröhlich hinzu. »Ein bisschen frische Luft, die idyllische englische Landschaft, ein Schloss, das nur darauf wartet, die Kulisse für ihr nächstes Stück zu werden. Ach, übrigens, Vic, was führt ihr eigentlich auf?«
»›Hamlet‹, du Idiot«, erwiderte Victoria. »Das habe ich dir schon ein Dutzend Mal gesagt.«
Schon wieder dieses Grinsen. Victoria hätte ihm am liebsten etwas an den Kopf geworfen, aber ihr Teller war leer, weil ihr Vater das ganze restliche Gemüse vertilgt hatte. Dabei eigneten sich Rosenkohlröschen hervorragend als Wurfgeschosse. Also bedachte sie ihren Bruder lediglich mit einem finsteren Blick, aber das beeindruckte ihn nicht im Geringsten.
Und sein Feixen beunruhigte sie, wenn sie ehrlich war. Er schien etwas zu wissen, was ihr entgangen war. Schon früher hatte er diesen Gesichtsausdruck immer gehabt, wenn er etwas im Schilde führte.
»›Hamlet‹«, sagte er jetzt. »Wie schön. Und wann ist Premiere?«
Victoria verdrehte die Augen. »Heute in vier Wochen. Das weißt du doch. Ihr habt Karten für die erste Aufführung, und ich habe euch einen Flug gebucht, mit dem ihr ein paar Tage vorher anreisen könnt. Erinnerst du dich?«
»Du hast nur einen Monat Zeit?«, warf ihr Vater zweifelnd ein. »Ist das nicht ein bisschen knapp, junge Frau?«
»Ich schaffe es schon.«
»Du bereitest mir keine Sorgen, eher deine Schauspieler. Vor allem dieser Felonius.«
»Fellini«, korrigierte Victoria ihn. »Michael Fellini. Du brauchst dir keine Gedanken zu machen; er ist ein Profi.«
»Er ist arrogant«, erwiderte ihr Vater.
»Ich finde ihn hinreißend«, konterte ihre Mutter.
Er ist perfekt, fügte Victoria im Stillen hinzu, aber sie hatte nicht die Absicht, dieses Thema mit den anderen am Tisch zu erläutern.
»Die Besetzung ist in Ordnung«, sagte sie laut. »Wir proben ja schon seit zwei Monaten. Außerdem benehmen sie sich alle tadellos, schließlich ist es für die meisten die Chance ihres Lebens. Wann werden sie noch einmal Gelegenheit dazu bekommen, Shakespeare in einem echten Schloss aufzuführen?«
»Hm«, sagte John skeptisch. »Ich hoffe, du hast eine gute zweite Besetzung. Hat Thomas dir dafür genug Geld gegeben?«
»Ja, Thomas hat mich mehr als gut versorgt«, versicherte Victoria ihm.
Und das stimmte. Ihr Bruder war unglaublich großzügig gewesen, er hatte Unterkunft, Essen, Transport und Gehälter für die gesamte ›Hamlet‹-Produktion auf der Insel bezahlt. Sie wusste zwar immer noch nicht genau, warum, aber sie war sich von Anfang an darüber im Klaren gewesen, dass sie einem geschenkten Gaul nicht ins Maul schauen würde.
Allerdings hielt sie das nicht davon ab, die Angelegenheit mit dem einen oder anderen misstrauischen Blick zu bedenken. Aber damit wartete sie lieber, bis er schlief.
Michael Fellinis Gage hatte sie mit der Summe, die ihr Thomas gegeben hatte, natürlich nicht vollständig bezahlen können; dafür hatte sie auf ihre Ersparnisse zurückgegriffen. Eine Geschichte mehr, über die sie lieber nicht mit ihren Eltern oder ihrem Bruder redete.
Aber sie konnte in Ruhe darüber nachdenken, sobald sie endlich wieder alleine war. Hoffentlich fand sich bald eine Gelegenheit, vom Tisch aufzustehen.
Jetzt war wahrscheinlich ein günstiger Zeitpunkt. Victoria lächelte in die Runde.
»Ich bin ein bisschen müde und denke, ich ziehe mich in mein Zimmer zurück. Danke für das Essen, Iolanthe.«
»Und was ist mit mir?«, fragte Thomas. »Bei mir bedankst du dich nicht?«
»Du kannst froh sein, dass ich dir nicht die Gabel zwischen die Augen ramme.«
Thomas lachte nur.
Victoria stellte ihren Teller in die Spüle, dann floh sie die Treppe hinauf, bevor sie ihrem grinsenden Bruder etwas an den Kopf warf, das sie später bereuen würde.
Sie schloss sich in ihrem Zimmer ein und versuchte, zur Ruhe zu kommen. Eigentlich hätte sie Bewegung an der frischen Luft gebraucht, sie ertrug es nicht, hier zu sitzen und darauf zu warten, dass ihr Urlaub vorbei wäre.
Während sie im Zimmer hin und her lief, ging sie im Geiste die Liste der Dinge durch, die sie bereits erledigt hatte und die noch ausstanden. Es war keine Kleinigkeit, das Stück in einem anderen Land aufzuführen. Wenn sie länger darüber nachgedacht hätte, hätte sie sich selbst wahrscheinlich für verrückt erklärt, aber Victoria stellte ihre Handlungen nie in Frage. Sie wusste einfach, dass sie es schaffen würde.
Ihr Selbstbewusstsein im Hinblick auf ihr Können hatte seinen Preis gehabt. Sie hatte es sich hart erarbeitet. Sie leitete ein nicht unbedeutendes Theater, setzte sich mit begabten, schwierigen Künstlern auseinander und schuf Aufführungen, die an Qualität denen am Broadway in nichts nachstanden.
Dabei spielte es keine Rolle, dass der Broadway für sie in unerreichbarer Ferne lag. Es spielte keine Rolle, dass sich ihre Bühne über einem esoterischen Teeladen befand. Und es spielte auch keine Rolle, dass sie ihre Requisiten in einem Keller neben den Kräuterteefässern aufbewahren musste, sodass ihre Kostüme immer ein wenig nach Reformhaus rochen. Die Leute konnten ins Theater kommen und sich in der Pause mit einem Kamillentee erfrischen. Es war eine großartige Atmosphäre, und sie war dankbar dafür.
Und jetzt würde sie also in England gastieren, mit einem richtigen, echten Schloss als Kulisse. Konnte es noch besser werden?
Nun ja, schon, wenn Michael Fellini sie als Frau genauso interessant fände wie als Regisseurin, zum Beispiel.
Da sie jedoch darauf erst Einfluss nehmen konnte, wenn sie mit ihm in England alleine war, wandte sie sich in Gedanken dem zu, was sie jetzt schon kontrollieren konnte. Sie blickte sich um. Ihre Koffer waren leider schon gepackt, ihr Bett war gemacht, und die achthundertseitige Abhandlung über die Politik von Elisabeth I. war auch schon durchgelesen. Sie hätte besser doch zusätzlich das kleine Buch über Reifröcke eingesteckt; es konnte nie schaden, alles über die Zeit zu wissen.
Sie seufzte. Sie brauchte einfach eine richtige Liebesgeschichte. Ihrer Meinung nach war das auch nichts anderes als Recherche. Ab und zu musste sie Regie bei romantischen Stücken führen, also wäre es sicher kein Nachteil, in dieser Hinsicht Bescheid zu wissen.
In ihrem eigenen Leben hatte bisher nichts dergleichen stattgefunden. Sie konnte nur hoffen, dass sich das bald änderte.
»Ich habe mich schon viel zu lange in diesem Haus aufgehalten«, sagte sie zu ihrem leeren Zimmer.
Sie sank auf den Fenstersims und schob die Scheibe hoch. Es war immer noch bitterkalt, aber vielleicht würde die frostige Temperatur sie ein wenig ablenken. Sie schloss die Augen und lauschte den Wellen, die an den Strand schlugen. Es war kein Wunder, dass Thomas dieses Haus so sehr liebte. Selbst sie könnte in Versuchung geraten, den Verkehrslärm in Manhattan gegen diese Stille einzutauschen.
Dann runzelte sie die Stirn. Über dem Rauschen der Brandung lag noch ein anderes Geräusch. Es klang wie Musik.
Dudelsackmusik.
Victoria presste ihr Ohr an die Scheibe und lauschte angestrengt. Ja, kein Zweifel. Da spielte definitiv jemand Dudelsack. Hatte Thomas Verwandte von Iolanthe aus Schottland einfliegen lassen, damit sie ihr ein Ständchen brachten? Hatte Iolanthe überhaupt Verwandte? Die Familie von Thomas' Frau umgab ein Geheimnis, das sie nicht hatte lüften können. Letztes Jahr hatte Thomas ihr noch versprochen, ihr alles zu erzählen, aber anscheinend hatte er es sich wieder anders überlegt.
Es klopfte leise an der Tür, und Victoria zuckte unwillkürlich zusammen. Die eingebildete Dudelsackmusik war offensichtlich zu viel für sie gewesen.
»Herein«, sagte sie und setzte sich aufrecht hin, um sich gegen ein weiteres Grinsen ihres Bruders zu wappnen.
Es war jedoch nicht Thomas' Kopf, der in der Tür erschien, sondern Iolanthes.
»Oh«, sagte Victoria überrascht. »Komm herein.«
Zögernd kam Iolanthe der Aufforderung nach.
»Ich wollte dich nicht stören«, sagte sie.
»Das tust du nicht«, erwiderte Victoria. »Ich kann ein bisschen Ablenkung brauchen.«
Iolanthe kam zum Fenster und setzte sich ebenfalls ans Fenster. »Victoria«, sagte sie langsam, »ich weiß, wir haben einander noch nicht besonders gut kennengelernt, und vielleicht ist mein Angebot gerade unpassend ... aber wenn du Hilfe brauchst in England, kannst du dich gerne an mich wenden.«
Victoria blinzelte verwirrt. »Hilfe?«, echote sie. »Warum sollte ich Hilfe brauchen?«
Iolanthe zuckte mit den Schultern. »Wer weiß? In meinem armseligen Leben hat es Zeiten gegeben, in denen ich die Gesellschaft einer Schwester wirklich nötig gehabt hätte.« Sie lächelte. »Das Angebot steht, du kannst jederzeit darauf zurückkommen.«
Sie stand auf, wünschte Victoria eine gute Nacht und verließ das Zimmer.
Victoria starrte auf die geschlossene Tür. Hilfe? Was für eine Art Hilfe? Warum hatte sie auf einmal das Gefühl, dass es sich nicht um ein ganz normales, gut gemeintes Angebot, sie zu unterstützen, handelte?
Die Dudelsackmusik drang durch das halb geöffnete Fenster herein, und Victoria lief ein Schauer über den Rücken.
Sie musste wirklich von hier verschwinden, bevor sie noch den Verstand verlor. Am liebsten hätte sie ihren Koffer gepackt und wäre auf der Stelle gegangen. Aber das hätte ihre Familie zu Recht für ein äußerst seltsames Benehmen gehalten.
Nein, sie würde sich jetzt für die Nacht fertig machen, sich die Decke über den Kopf ziehen und sich zwingen zu schlafen.
Und statt Montag würde sie morgen schon abreisen und sich wieder in die Welt begeben, die sie kannte und verstand, in der die Menschen zu ihr aufsahen und niemand sie infrage stellte, in der sie alles genau so organisieren konnte, wie es ihr gefiel, und alles auch in dieser Art umgesetzt wurde. Ja, das Theater war der richtige Ort für sie. Das Drehbuch war bereits geschrieben, und über das Ende des Stücks gab es keinerlei Zweifel.
Eine besonders klagende Melodie drang durch das Fenster, und beinahe wären ihr Tränen in die Augen getreten. Zum Glück war sie nicht besonders zart besaitet, und entschlossen schob sie das Fenster wieder herunter, zog die Vorhänge zu und marschierte in ihr Badezimmer.
Dudelsackmusik.
Unwillkürlich fragte sie sich, ob es in Thomas' Haus vielleicht spukte. Iolanthe hatte durchaus etwas von einem Wesen aus einer anderen Welt, und wer weiß, vielleicht hatte sie ja ein paar Gespenster mitgebracht.
Schnaubend schloss Victoria die Badezimmertür, ergriff ihre Zahnbürste und begann sich die Zähne zu putzen.
Das schien ihr das Vernünftigste zu sein.
Sie war sich sicher, gerade erst eingeschlafen zu sein, als Thomas an ihre Tür hämmerte. Victoria rieb sich die Augen und tastete nach dem Wecker. Sie konnte die Zahlen nicht erkennen, aber es war bestimmt noch mitten in der Nacht.
Thomas öffnete die Tür und warf ihr das Telefon zu. »Es ist für dich.«
Es dauerte einen Augenblick, bis Victoria das richtige Ende am Ohr hatte, aber sie bereute es sofort.
Im Hintergrund waren Schreie zu hören.
»Es ist Samstagmorgen«, sagte sie grimmig. »Ich hoffe nur, du hast einen guten Grund anzurufen.«
»Ja.«
Es war Fred, ihr Inspizient. Seufzend fuhr sich Victoria mit der Hand durch die Haare. »Was ist los?«
»Du wirst es nicht glauben«, begann er.
Die Schreie im Hintergrund wurden leiser. »Was werde ich nicht glauben?«, fragte sie ungehalten.
»Das war Gerard«, erklärte Fred.
»Warum hat er denn so geschrien?«
»Er behauptet, in der Requisitenkammer spukt es.«
Victoria war mittlerweile hellwach. »Es ist doch nur eine Requisitenkammer.«
»Das habe ich ihm auch gesagt.«
»In Requisitenkammern spukt es nicht.«
»Auch das habe ich ihm gesagt.«
Victoria zählte bis zehn, um sich zu beruhigen. Noch lieber hätte sie die Möglichkeiten gezählt, wie sie Gerard bestrafen könnte, wenn sie in einem anderen Jahrhundert leben würde, in dem Daumenschrauben und Folterbänke noch üblich waren. Er sollte für sie Strumpfhosen und Westen zählen und sich nicht irgendwelchen Halluzinationen hingeben. »Wo ist diese Memme jetzt?«, stieß sie zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor.
»Er ist ins Café gegangen und beruhigt seine Nerven mit einem doppelten Mocha-Latte.«
Victoria schürzte die Lippen. Sie brauchte Gerard. Wenn er sich nicht um die Kostüme kümmerte, war sie aufgeschmissen. Sie seufzte. »Meinst du, er kommt zurück? Glaubt er, dass es nur in der Requisitenkammer spukt? Oder sind die Kostüme etwa auch ... äh ...«
»Besessen?«
»Ja, so in der Art.« – »Kann ich nicht sagen. Dafür hat er zu laut geschrien.«
»Dann frag ihn. Sag ihm, ich bezahle ihn extra, wenn er ins Flugzeug steigt und den Sommer über auf Thorpewold Castle bei uns bleibt. Sag ihm, es liegt ganz bestimmt am Raum und nicht an den Kostümen. Sag ihm, in England gibt es keine Gespenster. Versprich ihm das Blaue vom Himmel, damit er mitkommt.«
»Klar, Boss.«
»Ich nehme an, er hatte noch nicht alles eingepackt, bevor er sah, was ihn zum Schreien gebracht hat.«
»Ganz im Gegenteil, er hat noch gar nichts eingepackt.«
Victoria schwieg. »Was machst du heute?«
»Ich fahre jetzt gleich nach Hause. Marge hat zum Mittagessen Thunfisch-Auflauf gemacht.«
Victoria blinzelte zur Uhr. »Es ist noch viel zu früh zum Mittagessen.«
»Ich brauche Zeit, um mich auf den Rinderbraten heute Abend vorzubereiten. Morgen genieße ich schließlich mein letztes Essen in den Staaten.«
Victoria musste unwillkürlich lächeln. »Hat sie Angst, du verhungerst den Sommer über?«
»Sie hat nichts Gutes über die englische Küche gehört.«
Victoria hatte schon häufig bei Marge gegessen und vermutete, dass Fred das englische Essen wohl überleben würde. »Na gut«, sagte sie seufzend. »Ich komme nach Hause und übernehme das Packen selber.«
»Kisten und Klebeband stehen bereit. Die Möbelpacker kommen am Montagmorgen, um alles zum Flughafen zu bringen.«
»Und der Rest der Ausrüstung? Licht? Ton?«
»Ist schon vor zwei Tagen in England angekommen. Es wird alles am Montag zu der Burg gebracht, die dein Bruder uns zur Verfügung gestellt hat.«
»In Ordnung«, sagte sie. »Dann sehe ich dich nächste Woche auf Thorpewold. Ich wünsche dir einen guten Flug. Und mach dir Notizen darüber, was du auf dem Schloss vorfindest. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Beschreibungen meines Bruders trauen kann.«
»Geht klar«, erwiderte Fred und legte auf.
Victoria sank aufs Bett zurück und erlaubte sich drei Minuten Vorfreude, ehe sie aufstand und Vorbereitungen traf, um in die Stadt zurückzufahren.
Am späten Nachmittag war sie bereits im Theater, was an ein Wunder grenzte. Sie hatte einen Blick in das Café oben an der Straße geworfen, und da sie Gerard nirgends entdecken konnte, hatte Fred ihn wahrscheinlich beruhigt und nach Hause geschickt. Dass er wieder an die Arbeit gegangen war, wagte sie gar nicht erst zu hoffen. Seufzend betrat sie den Teeladen, der den schönen Namen Tumult in der Teekanne trug und begrüßte die Besitzerin, Moonbat Murphy.
Moons Lächeln wirkte gequält.
Victoria blieb vor der Theke stehen. »Was ist los? Du hast doch nicht etwa auch Gespenster im Keller gesehen, oder?«
Moon blickte sie nicht an. »Nein, Vic.« Sie füllte weiter Tee in kleine Hanfbeutelchen.
Ob Moon wohl sauer war, weil es den Sommer über oben keine Vorstellungen gab?, überlegte Victoria. Machte sie sich Sorgen wegen des Geschäfts? Oder hatte sie eine schlechte Lieferung bekommen?
Die meisten Gründe verwarf Victoria sofort wieder. Die Bühne oben war über den Sommer an ein Yoga-Studio vermietet worden, und die Miete für den Requisitenraum hatte Victoria schon für das ganze Jahr im Voraus bezahlt. Außerdem hatte sie die Bühne für den Herbst schon wieder reserviert. Das ging jetzt seit fünf Jahren schon so. Wenn Moon mit dieser Regelung nicht zufrieden wäre, dann hätte sie doch bestimmt den Mut gehabt, mit ihr zu reden.
Victoria wollte schon nachfragen, besann sich dann jedoch eines Besseren und ging durch die Küche hinunter in den Keller.
Vor dem Requisitenraum blieb sie stehen. An der Tür war mit Klebeband ein Zettel befestigt. Victoria nahm ihn ab und faltete ihn auseinander. Das Papier war offensichtlich handgeschöpftes Bütten. Aber das machte den Text darauf nicht besser.
Vic,es tut mir leid, aber wir können das Theater oben nicht mehr weiter betreiben. Der Mann, der die Bühne diesen Sommer mietet, hat mir angeboten, den Laden zu übernehmen – und oben ein Yoga-Studio zu eröffnen. Wenn der Preis stimmt, muss man einfach Ja sagen, oder? Ich wusste, dass du mich verstehst.
Moon
P.S. Kannst du deine Sachen bis Montag rausholen? Mr Yoga meint, deine Kostüme schaden seinem Chi.
Victoria blickte fassungslos auf das Blatt Papier. Kein Wunder, dass Moon ihr nicht in die Augen blicken konnte. Scheinbar hatte sie vor, sich auf eine tropische Insel zurückzuziehen, wo sie in Frieden grünen Tee trinken und Yoga-Übungen machen konnte.
Am liebsten hätte Victoria sie und das Geld, das sie ihr gegeben hatte, in ihre verdammte Yoga-Matte gewickelt und in den Hudson geworfen.
Na ja, wer weiß, wozu es gut war. Vielleicht würde die Aufführung ein solcher Hit in England, dass man ihr dort eine Stelle anbot. Shakespeare hatte schließlich in London auch Erfolg gehabt; warum sollte es ihr nicht genauso gehen? Wenn sie fertig gepackt hatte, würde sie darüber nachdenken.
Wenn sie sich nämlich jetzt gleich intensiv damit beschäftigte, würde sie womöglich noch jemandem etwas antun. Sie steckte den Brief in die Tasche und schloss die Requisitenkammer auf. Eine Minute lang blickte sie sich um, und dann gab sie ein paar wenig damenhafte Kommentare über Kostümbildner im Allgemeinen und Gerard im Besonderen von sich. Sie würde alles selber packen müssen. Er hatte wirklich noch gar nichts gemacht. Wo waren diese tollen Männer bloß immer, wenn man sie brauchte?
Sie krempelte die Ärmel hoch und machte sich an die Arbeit. Wenigstens war es nicht so schrecklich viel, weil der Großteil der Theaterausrüstung irgendwo eingelagert war. Es hätte schlimmer kommen können. Sicher, sie hätte jemanden aus ihrem Team um Hilfe bitten können. Aber es war das letzte freie Wochenende vor dem Abflug, und sie konnte sich die Ausreden schon vorstellen ...
Es raschelte in den Kostümen.
Victoria kniete gerade vor einer Kiste und räumte Schuhe ein. Stirnrunzelnd blickte sie auf. Ein Windstoß? Hatte sie zu laut geseufzt? Sie starrte auf die mittelalterlichen Kleidungsstücke auf dem Gestell vor ihr. Nun, im Moment bewegte sich gar nichts. Sie schnaubte. Entweder hatte sie sich zu viele Gespenstergeschichten angehört, oder der Schlafmangel machte sich langsam bemerkbar. Sie wandte sich wieder ihrer Arbeit zu.
Metallbügel schlugen klirrend aneinander. Wieder blickte Victoria abrupt auf. Woher mochte der Windstoß kommen?
Aber hier regte sich kein Lüftchen.
Einer der Umhänge bewegte sich jetzt aber tatsächlich.
Von ganz allein.
Victoria rieb sich die Augen, und dann blickte sie erneut hin.
Jetzt konnte sie sehen, was den Umhang bewegt hatte.
Ein Mann stand dort, ein Mann in einem mittelalterlichen Highland-Kostüm. Seine Haare waren beinahe so leuchtend rot wie ihre eigenen. Ein immens großes Schwert hing an seiner Seite. Er trug ein weißes Hemd, und um die Taille hatte er sich eine Art karierte Decke gewickelt, deren eines Ende über seiner Schulter hing. Befestigt war sie mit einer riesigen Silberbrosche, besetzt mit funkelnden Smaragden und Rubinen.
Er drehte gerade einen dunkelroten Samtumhang zwischen den Händen und gab anerkennende Laute von sich. Um an die Hüte auf der Ablage zu kommen, musste er sich auf die Zehenspitzen stellen. Liebevoll streichelte er über eine lange, üppige Feder. Victoria merkte, wie ihr der Mund offen stehen blieb. Sie kniff sich.
»Aua!«, entfuhr es ihr.
Der Mann zuckte zusammen und schrie überrascht auf, als er sich zu ihr drehte.
Victoria starrte ihn ungläubig an, und der Mann trat unbehaglich von einem Fuß auf den anderen.
Victoria schluckte und zwang sich zu sprechen. »Sind Sie ein Gespenst?«, fragte sie.
Der Mann zog seine Mütze und knetete sie nervös in den Händen. »Hugh McKinnon«, stieß er hervor. Er deutete eine Verbeugung an und war im gleichen Augenblick verschwunden.
Victoria war wie erstarrt. Ihr gesamter Körper wurde taub, und entsetzt stellte sie fest, dass sie gleich in Ohnmacht fallen würde. Sie hatte aber keine Zeit, ohnmächtig zu werden; sie musste die Sachen für die Produktion packen. Und sie musste auch noch in ihre Wohnung, um für sich selber die Koffer zu packen. Sie musste sich vergewissern, dass Michael Fellini alles hatte, was er brauchte, und dass er den Erste-Klasse-Flug, den sie für ihn gebucht hatte, auch genoss. Sie musste den Requisitenraum ausräumen, da sie kein Anrecht mehr darauf hatte – aber das war in Ordnung, wenn es hier sowieso spukte. Sollte der Yoga-Mann doch hier sein Feng Shui verströmen.
Sie spürte, wie sie langsam vornüber kippte. Wenigstens war sie schon so nahe am Boden, dass sie sich nicht wirklich wehtun würde.
Sie blickte zur Decke, als ihr Bewusstsein zu schwinden begann. Wieder sah sie diesen Hugh McKinnon vor sich; diesmal beugte er sich in seinem Highland Kostüm über sie und musterte sie besorgt.
Sie konnte nur hoffen, dass das nicht irgendein kosmisches Omen war. Ihr Vater hatte sie davor gewarnt, dass im Schloss und auch in dem Gasthaus, das Megan in der Nähe besaß, unheimliche Dinge vor sich gingen. Kein Wunder, dass Thomas jedes Mal gelacht hatte, wenn sie den »Hamlet« erwähnt hatte.
Zum ersten Mal in ihrem Leben fragte sie sich, ob sie nicht besser die Finger von der Sache gelassen hätte.
Aber es war zu spät ...
Kapitel 2
Connor MacDougal stand auf den Zinnen von Schloss Thorpewold und blickte über die öde Landschaft. Er neigte nicht zur Sentimentalität, aber in Zeiten wie diesen, wenn die Touristensaison bevorstand und es ständig irgendwo spukte, dann sehnte er sich nach der Ruhe seiner Burg in den Highlands.
Natürlich hatte es zu seiner Zeit immer irgendwelche Auseinandersetzungen mit benachbarten Clans gegeben, um das ansonsten doch recht langweilige Frühjahr ein wenig zu beleben. Und natürlich hatte ihm auch die Jagd einen oder zwei Tage lang die Zeit vertrieben. Aber meistens hatte er schlicht das Rauschen von Wind und Regen genossen und den Klang der gelegentlichen Flüche seiner Männer, die in der Stille der Hügel widerhallten.
Die markerschütternden Schreie jedoch, die von Zeit zu Zeit in diesem Schloss hier ertönten, gefielen ihm gar nicht.
Aber ein Schatten tat, was er tun musste, und nahm mit jedem Vergnügen vorlieb. Thorpewold war nicht gerade Connors Lieblingsaufenthaltsort, aber er hatte auch keine Lust, auf sein Schloss in den Highlands zurückzukehren, deshalb musste er sich wohl oder übel damit zufriedengeben. Außerdem hatte er verdammt lange gewartet, bis er die Steine unter seinen Füßen sein Eigen nennen konnte. Er hatte zwar weder mit seinem Blut noch mit seinem Gold dafür bezahlt, aber er hatte seinen ganzen Willen aufgewendet, um das Schloss endlich zu bekommen.
Und er würde es auch nicht wieder hergeben.
Zumindest jetzt nicht mehr, wo niemand mehr in der Burg übernachtete. Zum Glück war er Thomas McKinnon und einige andere lästige Schatten im letzten Herbst auf einen Schlag losgeworden.
Nun ja, Thomas McKinnon hatte ja diese kleine MacLeod geheiratet und war eigentlich ohne Connors Zutun in sicherere Gefilde abgereist. Aber wenn dem nicht so gewesen wäre, hätte er ihn sicher selbst verjagt. Zum Glück war er ja jetzt weg, und hoffentlich bekam er nie wieder einen McKinnon zu Gesicht. Diese Familie verursachte nichts als Ärger, und er fürchtete sich zwar nicht vor ihnen, sehnte sich aber doch nach ein wenig Frieden.
Und Frieden vor Thomas McKinnon und seinesgleichen konnte man nicht hoch genug schätzen.
Er drehte sich um und ging die Mauer entlang, wobei er die Aktivitäten im Burghof im Auge behielt. Dort geschah nichts Besonderes. Männer übten sich im Schwertkampf und gingen den Beschäftigungen nach, die an einem angenehmen Morgen wie diesem üblich waren. Er beobachtete ihr Treiben und nickte. Jawohl, alle diese Männer würden ihn letztendlich mit Mylord anreden. Dafür würde er schon sorgen. Und wenn er jetzt noch einen geeigneten Garnisonshauptmann fände, dann könnte er ein schönes, friedliches Nachleben führen.
»Mylord?«
Connor drehte sich zu seinem ersten Anwärter auf diese Stellung um, Angus Campbell, einem Schatten mit beachtlichen Fähigkeiten, der jedoch leider nicht besonders klug war. Aber irgendwo musste man ja schließlich anfangen, wenn man nach einem Hauptmann Ausschau hielt.
»Ja?«, fragte Connor und gelobte sich im Stillen, jetzt am Tagesanbruch ein wenig Geduld zu üben.
»Ich bringe Euch Neuigkeiten, Mylord.« Angus schluckte, als ob er von Angst geplagt wäre.
Was mochte an seiner Kunde so furchterregend sein? Connor runzelte die Stirn. »Nun?«
Angus trat nervös von einem Fuß auf den anderen. »Menschenseelen beabsichtigen, in das Schloss einzudringen.«
»Touristen?« – »Nein, Mylord. Ich glaube nicht.« – »Du glaubst nicht«, wiederholte Connor langsam. »Vielleicht solltest du weniger glauben, und deine Augen mehr gebrauchen. Wenn es keine Touristen sind, was könnten sie dann sein?«
»Sie sind von einer anderen Art.«
»Von einer anderen Art?«, echote Connor. »Was für eine andere Art?«
Angus begann zu zittern. »Nun, Mylord, ich habe es so verstanden ...« Er schwieg theatralisch. »Im Gasthaus werden Vorbereitungen für Besucher getroffen.« Wieder machte er eine Pause. »Im Boar's Head, Mylord, dem Gasthaus unten an der Straße.«
»Dort werden ständig irgendwelche Reisenden beherbergt. Ich kenne das Gasthaus, du Schwachkopf!«
Angus duckte sich. »Sie haben Kisten und Koffer vorausgeschickt, und es sieht so aus, als erwarteten sie viele Gäste, Mylord. Der Schuppen ist voll bis unters Dach, und auch die Scheune vom alten Farris unten an der Straße ist vollgestellt. Ich habe einen großen Lastwagen gesehen, der seltsame, geheimnisvolle Dinge gebracht hat.«
»Woher weißt du, dass diese Sachen den Leuten im Gasthof gehören?«, fragte Connor.
Angus blinzelte. »Ich habe gelauscht, Mylord.«
Nun, das war ja wenigstens ein hilfreiches Verhalten. »Was hast du sonst noch gehört? Du solltest besser beten, dass es mir gefällt«, grollte Connor.
»Der Name McKinnon fiel, Mylord«, erwiderte Angus mit klappernden Zähnen.
»Unmöglich!«
Angus zitterte heftig. »Doch, es ist so, Mylord.«
»Ich dachte, ich hätte mich dieser verdammten Familie entledigt!«, knurrte Connor. Er maß den Mann vor ihm mit finsteren Blicken. »Diese Nachrichten gefallen mir gar nicht. Du kannst abtreten. Schick den nächsten Bewerber um den Hauptmannposten zu mir.«
Angus verbeugte sich und machte einen Kratzfuß. Da er jedoch anscheinend genauso wenig Richtungssinn wie gesunden Menschenverstand besaß, fiel er von den Zinnen.
Ein lautes: »Aua, das hat wehgetan«, ertönte von unten.
»Nicht zu fassen«, murmelte Connor. »Er muss mich falsch verstanden haben.«
»Ich würde sagen, lieber Freund, seine Ohren funktionieren noch ganz gut.«
Connor wirbelte herum und stand einem anderen Schatten gegenüber, der ebenfalls auf den Zinnen stand. »Verschwindet von meinem Dach, Ihr aufgeputzter Dreckskerl«, sagte er.
»Ach, wisst Ihr«, schnarrte Roderick St. Claire, »wenn Duncan MacLeod das zu mir sagte, hatte es wesentlich mehr élan.«
Connor zog sein Schwert. »Vielleicht ist meine Aussprache nicht ganz so geschliffen, aber meine Klinge ist genauso scharf.«
Roderick lächelte nur freundlich. Er zupfte an seinem Spitzenjabot und wischte einen nicht existierenden Fussel von seiner Hose. »Steckt Euer Schwert besser wieder ein, und wir schließen Waffenstillstand. Bei dieser Gaunerei braucht Ihr mich wahrscheinlich noch.«
»Gaunerei?«, echote Connor. »Ich habe nicht die Absicht, in eine Gaunerei verwickelt zu werden!« Bei allen Heiligen, das nun wirklich nicht, vor allem nicht mit diesem rüschenverzierten, viktorianischen Stutzer.
Andererseits, gestand er sich unwillig ein, konnte es natürlich durchaus sein, dass Roderick etwas wusste, das von Nutzen war. Und bevor er seine Neuigkeiten nicht ausgespuckt hatte, tat er dem Mann besser nichts an. Fluchend schob Connor sein Schwert wieder in die Scheide. Aber wenn die Situation es erforderlich machte, würde er es ohne Zögern gebrauchen, gelobte er sich.
»Nun gut«, sagte er mürrisch. »Was wisst Ihr?«
Roderick begutachtete prüfend die Spitzenkaskaden, die sich über seine Handgelenke ergossen. »Eine recht große Gruppe von Sterblichen beabsichtigt, in unserem bescheidenen Heim abzusteigen. Ich habe selber beobachtet, wie viel Betrieb im Dorf herrscht.«
»Das hat nichts zu bedeuten«, erwiderte Connor mit leichtem Unbehagen.
»Ach nein?«, sagte Roderick nachdenklich. »Nun, wir werden es ja vermutlich sehen, wenn sie in der Burg ankommen. Ah, sieh mal einer an, da kommt ja schon einer.«
Connor blickte zum Weg. Ein einzelner Mann kam auf das Schloss zu.
»Zum Teufel«., sagte er und kratzte sich den Kopf. Dann jedoch erinnerte er sich seiner Stellung. »Das ist kein Anlass zur Sorge. Es ist nur ein Tourist.«
»Lasst es uns abwarten«, schlug Roderick vor. »Bei der Gelegenheit können wir gleich den neuen Kandidaten für den Hauptmannposten auswählen. Oh, seht nur, wie viele Freiwillige dafür bereits herandrängen.«
Connor blickte in die Richtung, in die Roderick zeigte. Dort liefen tatsächlich Männer umher, aber es war schwer zu sagen, ob sie vorhatten, das Weite zu suchen, oder ob sie sich aufstellen wollten.
Er schubste Roderick von den Zinnen, nur aus Prinzip, und schritt dann würdevoll die Treppe zum Innenhof herunter. Fluchend klopfte Roderick sich den Staub von den Kleidern, aber Connor ignorierte ihn. Er hatte sich um Wichtigeres zu kümmern.
Der Sterbliche war jetzt durch das Tor getreten und starrte mit offenem Mund um sich, als sei er bisher über seinen Dorfanger noch nicht hinausgekommen.
»Na, der wirkt aber recht beeindruckt von unserem idyllischen Steinhaufen, oder?«, bemerkte Roderick, der wieder neben ihn getreten war.
Connor grunzte und stellte sich mitten in den Hof. Er verschränkte die Arme über der Brust und beobachtete den Mann, der sich gründlich umsah.
Das war kein Tourist, dachte er. Er hatte keinen Skizzenblock bei sich, keinen Reiseführer, in dem die schönsten Aussichtspunkte rot markiert waren, keine Videokamera, mit der er Thorpewold einfangen konnte. Wer mochte dieser Einfaltspinsel, der anscheinend den Mund nicht zubekam, nur sein?