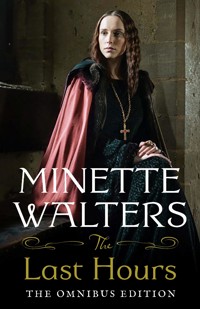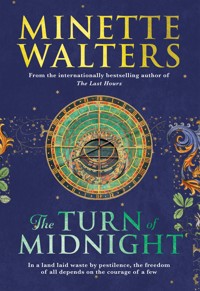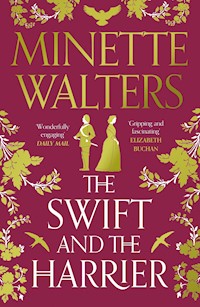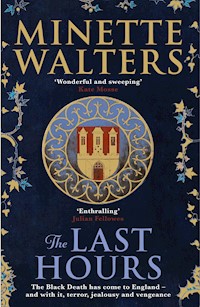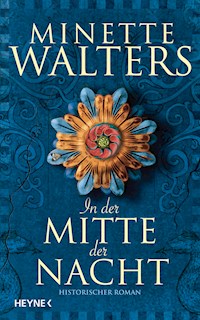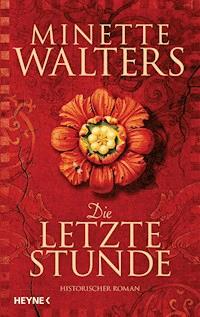
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Pest-Saga
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
»Ein Schwarzer Tod hat unser Land befallen. Nur wenige werden verschont bleiben.«
Südengland, Juli 1348: An der Küste ist die Pest ins Land gekrochen. Binnen kürzester Zeit entvölkert sie ganze Landstriche, Angst und Panik regieren. Allein Lady Anne, die Herrin von Develish, nimmt das Heft in die Hand. Sie bringt all ihre Schutzbefohlenen auf ihrem Anwesen in Sicherheit und lässt die Zugangsbrücke verbrennen. In ihrem kleinen Reich zählen nicht mehr gesellschaftliche Konvention und Rang, sondern Einsatz für die anderen. Als neuen Verwalter setzt Anne Thaddeus ein, den niedrigsten, aber klügsten ihrer Diener. Doch kann sich die Schicksalsgemeinschaft gegen die schreckliche Krankheit behaupten, die vor ihren Toren tobt? Gegen die Verzweifelten und Raffgierigen, die Develish angreifen? Werden die kargen Vorräte reichen? Dann geschieht ein grausamer Mord und droht Lady Annes Gemeinschaft endgültig zu zerreißen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 852
Ähnliche
Zum Buch
Anno 1348, Dorseteshire, Südengland: Am Hafen von Melcombe ist die Pest ins Land gekommen. Mit rasender Geschwindigkeit verbreitet sich die Seuche, Tausende sterben, der Rest lebt in panischer Angst vor der Strafe Gottes. Nur Lady Anne, die im Kloster erzogen und in Heilkunde unterwiesen wurde, stellt sich der Krankheit entgegen. Sie bringt kurzentschlossen all ihre Schutzbefohlenen in der Burg von Develish in Sicherheit und lässt danach niemanden mehr ein. Nicht einmal ihren Ehemann, der von einer Reise zurückkehrt. In ihrem kleinen Reich zählen fortan nicht mehr gesellschaftliche Konvention und Rang, sondern Einsatz für die Gemeinschaft. Als neuen Verwalter setzt Anne Thaddeus ein, den niedrigsten, aber klügsten ihrer Gefolgsleute. Das sorgt für enorme Spannungen innerhalb der Burggesellschaft, nicht zuletzt zwischen Lady Anne und ihrer Tochter Eleanor, die sie mit Hass verfolgt. Dennoch scheint die Burg ein Hort des Lebens in einer sterbenden Welt zu sein – bis ein Mord geschieht.
Zum Autor
Seit ihrem Debüt Im Eishaus zählt Minette Walters zu den Lieblingsautoren von Millionen Leserinnen und Lesern weltweit. Alle ihre Romane wurden mit wichtigen Preisen ausgezeichnet und in zahlreiche Sprachen übersetzt. Die letzte Stunde ist ihr erster historischer Roman. Er spielt in Dorset, wo die Autorin auch seit Langem mit ihrem Ehemann lebt.
MINETTE
WALTERS
Die
LETZTE
STUNDE
HISTORISCHER ROMAN
Aus dem Englischen von Sabine Lohmann und Peter Pfaffinger
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel THE LAST HOURS bei Allen & Unwin / Atlantic Books, UK
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2017 by Minette Walters
Copyright © 2018 der deutschen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Übersetzung: Sabine Lohmann bis einschl. Kap. 23; Peter Pfaffinger Kap. 24 bis Ende
Karten im Innenteil: Janet Hunt
Redaktion: Angelika Lieke
Umschlaggestaltung: Eisele Grafik·Design, München, unter Verwendung von Abbildungen aus dem Archiv der Universitätsbibliothek Heidelberg und Wikimedia/GNU-Lizenz für freie Dokumentation/Marcelangelo/https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grisaille.jpg
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN: 978-3-641-22467-7 V004
www.heyne.de
Für Madeleine und Martha.
Mit besonderem Dank an das Dorset History Centre für die Unterstützung bei der Entstehung dieses Buchs.
In Dorseteshire fegte die Pest das Land leer von Menschen, sodass fast keine Einwohner mehr am Leben waren. Von dort griff sie über nach Devonshire und Somersetshire, gar bis nach Bristol, und wütete solchermaßen, dass die Leute in Gloucestershire die aus Bristol nicht mehr bei sich dulden wollten und ihnen jeglichen Einlass verweigerten. Mit der Zeit aber gelangte sie doch nach Gloucester, ja bis nach Oxford und London, breitete sich schließlich über ganz England aus und traf das Volk so vernichtend, dass kaum jeder Zehnte am Leben blieb.
Geoffrey the Baker, Chronicon Angliae temporibus Edwardi II et Edwardi III
Wir sehen den Tod sich unter uns ausbreiten wie schwarzen Rauch, eine Seuche, welche die Jugend dahinrafft, ein unstetes Gespenst, ohne Gnade noch Wohlgestalt. Es wütet furchtbar, wo immer es sich zeigt, ein Schmerz im Kopf, der lautes Heulen auslöst, eine Verdickung unter den Armen, ein böse schmerzender Klumpen, eine Beule. Es ist ein hässlicher Auswuchs, der mit unziemlicher Eile hervorbricht. Die frühe Zierde eines Schwarzen Todes.
Jeuan Gethin (gest. 1349)
Und da waren jene, die so spärlich mit Erde bedeckt waren, dass die Hunde sie ausgruben und viele Leichen durch die ganze Stadt zerrten.
Agnolo di Tura, Cronaca Senese
Männer und Frauen [aus Florenz] verließen ihre Wohnstätten, ihre Verwandten, ihre Besitztümer …, als vermeinten sie, dass keiner in der Stadt am Leben bleiben würde, und ihre letzte Stunde gekommen sei.
Giovanni Boccaccio, Das Dekameron
DER DRITTE TAG IM JULI 1348
EINS
Develish, Dorseteshire
Die Sommerhitze sog alles Leben aus Develish. An den Bäumen welkten die Blätter, die Pferde ließen die Köpfe hängen, zu matt, um das Gras abzuweiden, die Hühner hockten dösend im Staub, und in den Feldern stützten sich die Bauern schwer auf ihre Sensen. Nur die Schmeißfliegen gediehen, schwärmten in Massen um die Misthaufen vor den Viehställen und brummten durch jeden Raum im Herrenhaus.
Es war kein Tag zum Reisen, und entsprechend übellaunig gebärdete sich Sir Richard of Develish. Jedes Mal, wenn seine Diener einer Forderung nicht schnell genug nachkamen, erhob er zornig die Stimme, und da er so unwillig war, die Reise anzutreten, erregte alles seinen Zorn. Nur dem beruhigenden Einfluss seiner Gemahlin, Lady Anne, war es zu verdanken, dass die Reisevorbereitungen nicht zum Erliegen kamen. Seelenruhig setzte sie sich über alle Entscheidungen Sir Richards hinweg und befahl der Dienerschaft, seine Taschen gemäß ihren Weisungen zu packen.
Eleanor, ihre vierzehnjährige Tochter, hörte all das Getöse von der Kemenate ihrer Mutter aus, die eine Treppe höher gelegen war. Sie war der Reise ihres Vaters ebenso abhold wie er und wünschte ihre Mutter zum Teufel, weil sie ihn dazu genötigt hatte. Das Mädchen hätte an einem Kissen für ihre Aussteuer sticken sollen, stattdessen aber stand sie am Fenster und sah zu, wie ein Planwagen mit Truhen beladen wurde, Truhen voller Vorräte, Kleidung und Gold für ihre Mitgift.
Selbst unter guten Umständen war Eleanor verwöhnt und launisch, aber die Hitze machte sie zum Biest. Ihr Blick fiel auf einen Knecht, der Weidenschösslinge in den Obstgartenzaun flocht. Er arbeitete geschickt, bog das grüne Holz mit starken, sonnengebräunten Armen, ehe er es zwischen die alten Zweige aus früheren Jahren einpasste. Nur ein hirnverbrannter Sklave würde bei solcher Hitze so hart arbeiten, sagte sich Eleanor, und ein zufriedenes Lächeln erhellte ihre Miene. Nichts behagte ihr mehr, als diesen Thaddeus Thurkell herabwürdigen zu können.
Wie alle Leibeigenen war er schmutzig und zerlumpt, aber einen Kopf größer als die meisten Männer in Dorset, und mit seiner dunkel getönten Haut, den langen schwarzen Haaren und mandelförmigen Augen wies er keinerlei Ähnlichkeit mit dem Mann auf, den er widerwillig Vater nannte – den kurzbeinigen, wieselgesichtigen Will Thurkell. Man munkelte, Eva Thurkell habe sich einst nach Melcombe abgesetzt und mit einem Matrosen eingelassen; andere meinten, Thaddeus sei die Frucht einer flüchtigen Liebschaft mit einem Zigeuner.
Wie immer die Wahrheit aussehen mochte, sicher war, dass der Vater den Sohn hasste und der Sohn den Vater. Als Kind war er täglich verprügelt worden, doch mittlerweile wagte sich Will mit seinem Stock nicht mehr an ihn heran, denn wie behauptet wurde, konnte Thaddeus eine Eisenstange übers Knie biegen und einen ausgewachsenen Mann mit einem einzigen Faustschlag zu Boden strecken. Dem Anschein nach fügte er sich in seine niedere Stellung in Develish, beugte den Kopf, wenn er musste, aber es war ihm anzumerken, dass er es ohne Ehrfurcht tat. Er sah an den Leuten vorbei, als wären sie gar nicht da, besonders an dem Mann, der ihn als Sohn angenommen hatte.
Will Thurkell war träge und verrichtete nur widerwillig die Fronarbeit, die er dem Gutsherrn als Gegenleistung für seine paar Streifen Ackerland schuldete. Selbst als Kind hatte Thaddeus schon an seines Vaters statt schuften müssen, unter der Androhung, dass seine Mutter andernfalls ausgepeitscht würde. Eine trübsinnige Person ohne jeden Lebensmut, hatte Eva über die Jahre mehr als ihren Teil an Strafe abbekommen. Nur die blassen, schwächlichen Kinder, die nach Thaddeus auf die Welt gekommen waren, blieben von den Wutausbrüchen ihres Mannes verschont.
Was nun aber nicht hieß, dass Eleanor auch nur das geringste Mitgefühl für Eva empfand. Die Hure hatte die Regeln gekannt, als sie sich in den Sündenpfuhl legte, und es war ihre eigene Schuld, dass sie ihren Bastard nicht als Wills Sohn ausgeben konnte. Offenbar hatte sie anfangs noch behauptet, Thaddeus sei aus einer Vergewaltigung hervorgegangen, aber kaum einer glaubte ihr, da sie nichts davon hatte verlauten lassen, bevor das dunkle Baby, das ihrem Mann nicht im Geringsten glich, auf die Welt kam. Der Makel der Illegitimität ließ Thaddeus ebenso sündhaft erscheinen wie seine Mutter, obwohl in seiner Haltung nicht ein Funken davon zu erkennen war. Er trug den Kopf hoch, anstatt den Blick beschämt zu senken.
Eleanor gefiel der Gedanke, Thaddeus in die Knie zu zwingen. Er war sechs Jahre älter als sie, und sie träumte davon, ihn zu demütigen. In der Hitze hatte er seinen Rock abgeworfen und arbeitete nun in kurzer Hose und losem Hemd mit aufgekrempelten Ärmeln. Es machte dem Mädchen Freude, ihn zu beobachten, zumal er sich dessen bewusst war; als er sich einen Fetzen um die Stirn gebunden hatte, damit ihm der Schweiß nicht in die Augen rann, sah er geradewegs zu ihrem Fenster hinauf, und sie lief puterrot an vor schuldbewusstem Verlangen.
Daran war nur ihr Vater schuld, weil er sie dem hässlichen, pockennarbigen Sohn eines benachbarten Gutsherrn versprochen hatte, dessen Anwesen, wesentlich ausgedehnter als Develish, zwei Tagesritte entfernt lag. Eine triste Zukunft war ihr bestimmt als Gemahlin von Peter of Bradmayne, der von so zwergenhafter Statur war, dass er kaum wie ein richtiger Mann auf einem Pferd sitzen konnte. Eleanors eigenes kleines Pony, eine hübsche Fuchsstute mit weißen Strümpfen, weidete jenseits des Burggrabens. Sie war versucht, hinauszugehen und Thaddeus anzuweisen, das Pony zu satteln und ihr hinaufzuhelfen. Falls er es wagte, sie dabei anzusehen, würde sie ihm eins mit der Reitgerte überziehen.
Diese amüsante Fantasterei wurde durch die Schritte ihrer Mutter auf der Treppe unterbrochen. Schnell huschte Eleanor zurück zu ihrem Schemel und Stickrahmen und täuschte Fleiß vor. Ihre Gefühle Lady Anne gegenüber grenzten an Hass, denn Eleanor wusste sehr wohl, dass sie die Auswahl ihres Zukünftigen ihrer Mutter zu verdanken hatte. Lady Anne zog Pflichterfüllung und Disziplin der Liebe vor. Sie war von Nonnen erzogen worden und hätte besser den Schleier nehmen sollen, da es ihr bevorzugter Zeitvertreib war, ihre Tochter wegen ihrer Verfehlungen zu rügen.
Aus ihrem Schweigen schloss Eleanor, dass Lady Anne die Stiche zählte, die dem Muster hinzugefügt worden waren, seit sie das letzte Mal nachgeschaut hatte. »Es ist einfach zu heiß«, erklärte Eleanor trotzig. »Meine Finger rutschen dauernd von der Nadel ab.«
»Du bestickst das Kissen nicht für mich, Tochter, sondern für dich selbst. Wenn du keinen Sinn in der Aufgabe siehst, dann suche dir eine lohnendere Beschäftigung.«
»Es gibt ja nichts.«
Durch das offene Fenster vernahm Lady Anne das Scharren der Pferdehufe auf dem trockenen Lehm unten auf dem Vorplatz, wo Sir Richards Tross sich zur Abreise sammelte. In den Feldern jenseits des Burggrabens konnte sie die Leibeigenen bei der mühseligen Plackerei des Heumachens sehen; weiter vorn schwitzte Thaddeus Thurkell über dem Weidenzaun. Es war nicht schwer zu erraten, womit sich Eleanor die Zeit vertrieben hatte. »Dein Vater lässt dich rufen, um Abschied zu nehmen«, sagte sie. »Er wird zwei Wochen fortbleiben.«
Das Mädchen stand auf. »Aber ich will nicht, dass er wegfährt; und das werde ich ihm auch sagen.«
»Wie du meinst.«
Eleanor stampfte mit dem Fuß auf. »Ihr seid es doch, die ihn wegschickt. Ihr zwingt immer alle dazu, Dinge zu tun, die sie gar nicht tun wollen.«
In Lady Annes Augen flackerte Belustigung. »Nicht deinen Vater, Eleanor. Er mag Wutanfälle bekommen, um uns daran zu erinnern, was er sich unseretwegen alles zumutet, aber er würde nicht nach Bradmayne reisen, wenn es nicht in seinem eigenen Interesse wäre.«
»Was für ein Interesse denn?«
»Es geht das Gerücht, dass Peter of Bradmaynes altes Kindheitsleiden wieder ausgebrochen sei. Dein Vater will mit eigenen Augen sehen, woran er ist, bevor er den Heiratsvertrag unterzeichnet.« Sie schüttelte den Kopf, als sie Hoffnung in den Augen ihrer Tochter aufblitzen sah. »Gib Acht, was du dir wünschst, Eleanor. Wenn Peter stirbt, wirst du womöglich gar keinen Ehemann mehr abbekommen.«
»Na, darum werde ich keine Tränen vergießen.«
»Das wirst du wohl, wenn dein Vetter das Haus erbt. Immer noch besser, Herrin von Bradmayne zu sein, als eine einsame alte Jungfer, die für ihren Unterhalt auf die Großmut eines Verwandten angewiesen ist.«
»Die Welt ist voll von Männern«, gab das Mädchen trotzig zurück. »Es gibt jede Menge sehr viel angenehmere Ehegatten als Peter of Bradmayne.«
»Aber keinen, den dein Vater sich leisten könnte«, erinnerte sie Lady Anne. »Develish ist Sir Richards einziges Gut, ein weiteres ist ihm nie gewährt worden. Glaubst du nicht, er würde eine größere Mitgift anbieten, wenn er nur könnte? Sonst verwöhnt er dich doch in allem. Sei dankbar für Bradmayne und bete, dass Peter stark genug sein möge, dir Söhne zu geben, auf dass einer davon dereinst Lord of Develish werde.«
Eleanor verabscheute diese Predigten, die sie sich unentwegt von ihrer Mutter anhören musste. »Vielleicht werde ich ja mit dem gleichen Fluch geschlagen wie Ihr«, murrte sie gehässig. »Vater sagt, es ist Eure Schuld, dass er keinen Erben hat.«
»Dann steht dir eine traurige Zukunft bevor«, entgegnete Lady Anne. »Ich bedauere jeden Tag, keinen Sohn zu haben, und das solltest du ebenfalls.«
»Ich sehe nicht ein, warum.« Mit einem Rascheln ihrer Schleppe, das beinahe verächtlich klang, wandte das Mädchen sich ab. »Es ist nicht meine Schuld, dass Ihr keinen bekommen habt.«
Lady Anne verzweifelte an der Dummheit ihrer Tochter. Eleanor war fraglos eine Schönheit mit ihrer blassen Haut, dem blonden Haar und den erstaunlich blauen Augen – eine Miniaturausgabe ihres Vaters –, doch all des jahrelangen geduldigen Unterweisens zum Trotz war sie unfähig, einen Gedanken im Kopf zu behalten. »Wenn du Brüder hättest, dann hätte Milord of Blandeforde deinem Vater mehr Ländereien bewilligt, und er hätte die Abgaben aus den anderen Gütern dazu nutzen können, deine Zukunft zu sichern«, sagte sie ruhig. »So aber ist es ihm nicht gelungen, einen reichen Mann dazu zu bringen, über die Magerkeit deiner Mitgift hinwegzusehen. Wir hatten viele Gäste hier, aber keiner hat ein Angebot für dich gemacht.«
Eleanors Augen verengten sich. »Sie fürchten, dass ich hager und hässlich werde wie Ihr, Mutter. Selbst Vater bringt es nicht mehr über sich, Euch anzurühren.«
»Nein«, stimmte Lady Anne ihr zu. »Und ich bin froh drum, obwohl es mir nicht gefällt, wie du ihn ermunterst, dich zu betätscheln.«
»Seid nicht so eifersüchtig. Ich kann doch nichts dafür, dass Sir Richard mich mehr liebt als Euch. Ihr hättet Sorge tragen sollen, ihn nicht zu enttäuschen.«
In Lady Annes Augen blitzte Belustigung auf. »Dein Vater liebt viele Frauen«, sagte sie, »aber du bist sein einziges Kind. Wenn du ihm nicht so ähnlich sähest, würde er seine Vaterschaft anzweifeln.«
»Ihr lügt!«
Ihre Mutter betrachtete sie prüfend. »Was kränkt dich, Eleanor? Dass dein Vater keine Söhne zeugen kann oder dass er vorgibt, ich sei deine einzige Rivalin um seine Gunst? Was glaubst du, wo er nachmittags immer hinreitet? Wen trifft er dann wohl? Er findet den gleichen Gefallen an Leibeigenen wie du.«
Das Mädchen stampfte wieder mit dem Fuß auf. »Ich hasse Euch«, zischte sie.
Ihre Mutter wandte sich ab. »Dann bete, dass Lord Peter frei von Krankheit sein möge und sich mit Sir Richard darauf einigt, dich zu ehelichen, bevor der Sommer vorbei ist. Wenn dein Gatte über die Selbstsucht deines Wesens hinwegzusehen vermag, wirst du ihn wohl leichter erdulden können als mich.«
Thaddeus Thurkell hielt seine Verachtung wohlverborgen, während er aus dem Augenwinkel beobachtete, wie die Tochter ihrem Vater Lebewohl sagte. Nichts daran war aufrichtig. Sir Richard und Lady Eleanor ähnelten einander allzu sehr; selbstgefällig und gierig nach Aufmerksamkeit, spreizten sie sich in ihren leuchtend bestickten Gewändern, und der einzige Zweck ihres geräuschvollen Abschieds war der, aller Blicke auf sich zu ziehen. Wie immer stellten ihr Gewand und Gebaren die Menschen um sie her in den Schatten, und wie immer stand Lady Anne am Rande, ungeliebt und unbeachtet. Sie hatte nichts von der Extravaganz ihres Gatten und ihrer Tochter, und darum mochte Thaddeus sie umso lieber. Er wusste, dass sie im Kloster aufgewachsen und von Nonnen erzogen worden war, und er nahm an, dass ihre stille Weisheit ebenso wie ihre Kenntnisse in der Heilkunde von jener Erfahrung herrührten.
Es stand Thaddeus nicht zu, Milady zu bemitleiden – es stand ihm noch nicht einmal zu, überhaupt an sie zu denken –, aber er konnte sie nicht in Gegenwart ihres Gatten und ihrer Tochter sehen, ohne sich an ihrer statt angegriffen zu fühlen. Sie erwiesen ihr ebenso wenig Achtung wie sein Stiefvater seiner Mutter, doch anders als Eva besaß Lady Anne zu viel Stolz, um sich anmerken zu lassen, dass es sie kränkte. Sie ließ es so aussehen, als stünde sie aus freien Stücken abseits, und wandte sich ab, als Sir Richard seine fleischigen Pfoten über die Flanken seiner Tochter wandern ließ, sie an sich zog und ihr schmatzende Küsse auf die Lippen drückte, bevor er seinen stämmigen Körper auf den Rappen hievte und sein Gefolge mit lauten Rufen aufforderte, sich in Bewegung zu setzen.
Während der Tross loszog, hielt Thaddeus den Kopf gesenkt und fuhr fort, grüne Weidenruten in den Zaun zu flechten. Das rumpelnde Geräusch der Wagenräder war nicht laut genug, um das Rascheln von Lady Eleanors besticktem Gewand zu übertönen, als sie über den Hof auf ihn zukam, aber Thaddeus mochte ihr nicht die Genugtuung verschaffen, sich umzudrehen und das Knie vor ihr zu beugen. Zur Strafe würde er einen Fußtritt bekommen und wegen seiner Unverschämtheit beschimpft werden, aber das war ihm immer noch lieber, als jemandem, den er verachtete, Ehrerbietung zu erweisen. Sollte Lady Eleanor auch nur einen Funken Gnade in sich haben, so war ihm noch nichts davon aufgefallen.
Wie zum Beweis hob das Mädchen eine der Weidenruten auf und zog sie ihm über. »Wie kannst du es wagen, mir den Rücken zuzukehren!«, giftete sie.
Thaddeus richtete sich auf, und diesmal traf die Rute ihn unter dem Kinn.
»Benimm dich deinem Stand gemäß!«, befahl Eleanor. »Senk den Kopf und beug das Knie. Du hast mich nicht anzusehen.«
Thaddeus antwortete nicht, bückte sich nur, um einen weiteren Weidenzweig aufzuheben, und begann, ihn in den Zaun zu flechten, ungeachtet des Schlages, der zwischen seinen Schultern landete. Gewiss sah Sir Richards neuer Verwalter vom Haus aus zu, und wenn er die Arbeit ruhen ließ, um sich Lady Eleanors Launen zu fügen, würde ihm harte Bestrafung blühen. Es wurde gemunkelt, der Mann sei eigens dazu eingestellt worden, den Leibeigenen zusätzliche Steuern zur Befriedigung von Sir Richards Verschwendungssucht abzupressen, und Thaddeus war nicht geneigt, durch eine Bußabgabe dazu beizutragen. Er verachtete Lady Eleanor und den Verwalter gleichermaßen, aber es fiel ihm leichter, ein paar Schläge von einem halbwüchsigen Mädchen einzustecken, als es seiner Familie fiel, auf einen Scheffel Korn zu verzichten.
Weitere Züchtigung blieb ihm dank Lady Anne erspart. Sie packte ihre Tochter beim Handgelenk und entwand ihr die Gerte, während sie den Knecht für die Untadeligkeit seiner Arbeit pries. »Du musst meine Tochter entschuldigen, Thaddeus. Sie weiß den Unterschied zwischen guter und schlechter Arbeit nicht zu würdigen. Du verdienst hohes Lob für das, was du tust.«
Er wandte sich um und verbeugte sich. »Danke, Milady. Ich hoffe, dieser Tag findet Euch wohlauf.«
»Gewiss doch.« Sie legte die Hand auf Eleanors Arm. »Nun komm, Kind. Wir haben drinnen zu tun.«
Thaddeus sah ihnen nach und fragte sich, warum sich in der Tochter so wenig von der Mutter wiederfand. In allem schlug das Mädchen dem Vater nach – selbst in der Grausamkeit –, nur ihre anmutige Gestalt glich der von Lady Anne. Die Mutter war dunkel, die Tochter blond wie ihr Vater. Thaddeus’ eigene Lage machte ihn besonders empfänglich für Familienähnlichkeiten. Immer suchte er nach Unterschieden innerhalb einer Familie, wie ein Buckliger nach Verkrümmungen am Rückgrat anderer. Es war tröstlich zu wissen, dass man nicht allein war mit seinem Makel.
Als Kind hatte Thaddeus darum gebetet, dass seine Haare eine andere Farbe annehmen oder seine Knochen zu wachsen aufhören mögen, sodass Will in ihm etwas sähe, was er wiedererkennen könnte. Aber als die Hiebe nach und nach immer schlimmer wurden, lernte er zu schätzen, dass er nichts mit dem Mann gemein hatte. Es war kein Zufall, dass Wills Nachkommen klein und schwer von Begriff waren und Thaddeus das genaue Gegenteil. Unzählige Male hatte seine Mutter ihn angefleht, vor Will den Trottel zu spielen. Es war Thaddeus’ wacher Verstand, der ihren bösartigen Gatten in den Wahnsinn trieb, nicht seine Größe oder die dunkle Farbe von Haut und Haar. Senke den Blick, sei still, hatte Eva ihn beschworen. Fordere ihn nicht heraus mit der Gewandtheit deiner Zunge oder der Geringschätzung, die dir aus den Augen blitzt. Er hat keine deiner Fähigkeiten, und das weiß er. Tu es für mich, wenn schon nicht für dich selbst.
Seiner Mutter gegenüber hegte Thaddeus gemischte Gefühle. Sie zeigte sich selten liebevoll, aus Angst vor Wills Eifersucht, doch wie sehr sie ihn brauchte, erkannte er an ihrem flehenden Blick und in der verzweifelten Art, mit der sie sich an seinen Ärmel klammerte, wenn sie Will nahen hörte. Jeden Tag rang sie Thaddeus das Versprechen ab, sie nicht zu verlassen, aber es ärgerte ihn, dass sie nie den Mut gefunden hatte, ihn gegen Wills Attacken in Schutz zu nehmen.
Sein ganzes Leben lang hatte er mit anhören müssen, wie man sie eine Hure nannte, und es fiel ihm schwer, sie in anderem Licht zu sehen. Als er zehn war, hatte er sie gefragt, wer sein wirklicher Vater war, aber sie hatte es ihm nicht sagen wollen. Will hätte es irgendwann aus ihm herausgeprügelt, und das hätte alles nur noch schlimmer gemacht. Die Wut ihres Gatten wäre unbezähmbar geworden, wenn er einen Namen gehabt hätte, über dem er hätte brüten können, anstatt zu glauben, Thaddeus sei das Ergebnis einer Vergewaltigung durch einen Unbekannten.
Ihre Antwort brachte Thaddeus auf den Gedanken, dass sein Vater Will bekannt sein musste. Er betrachtete sich prüfend in der gehämmerten Zinnplatte, die in Wills Hütte als Spiegel diente, und musterte dann die Züge jedes einzelnen Mannes in Develish, ob reich oder arm, auf der Suche nach einer Nase, einem dunklen Teint oder Augen, die den seinen glichen. Er fand jedoch keine Ähnlichkeiten, und mit der Zeit begann er dem Gerücht zu glauben, dass sein Vater ein ausländischer Seemann sei. Der Gedanke behagte ihm sogar. Ein Mann, der zur See fuhr, war achtenswerter als der Leibeigene eines Feudalherrn.
Was Thaddeus auf Sir Richards Gut für eine Stellung innehatte, war nie genau festgelegt worden. Als Evas Bankert hatte er kein Recht, Wills Pachtgrund zu erben – weder das Ackerland noch die Hütte, die dazugehörte –, doch als er den Priester fragte, was nach Wills Tod aus ihm werden sollte, hatte der Alte nur mit den Schultern gezuckt und ihm geraten, hart zu arbeiten und seine Fertigkeiten zu vervollkommnen. Solange Sir Richard seine Arbeit gutheiße, habe Thaddeus keinen Grund, sich Sorgen um die Zukunft zu machen. Selbst Sklaven wurden gut versorgt, wenn sie das Wohlwollen ihres Herrn besaßen.
Am liebsten verhöhnte Will Thaddeus damit, dass er ihn einen Sklaven nannte. Er behauptete, Thaddeus gehöre ihm mit Leib und Seele; ohne seine Obhut wäre der Junge längst in irgendeinem Straßengraben verreckt. Es schien ihm nicht in den Sinn zu kommen, dass die Leibeigenschaft selbst eine Form von Sklaverei war und dass der Treueid, den er Sir Richard geschworen hatte – Ich werde nicht heiraten oder dieses Land verlassen ohne die Erlaubnis meines Herrn, und ich binde meine Kinder und Kindeskinder an dieses Gelöbnis … –, ihn und seine rechtmäßigen Nachkommen in einer Weise an Develish fesselte, die für Thaddeus nicht galt.
Es war Lady Anne, die Thaddeus dies erklärt hatte, als er dreizehn Jahre alt war. An Mariä Verkündigung hatte sie ihn beiseitegenommen, während er gerade damit beschäftigt war, die Hühnerställe auszumisten, und ihn vor dem Büttel gewarnt. Gib Acht, dass er dich nicht zu fassen kriegt, hatte sie gesagt. Heute ist der Tag, an dem Sir Richard sich die Treuegelöbnisse vortragen lässt. Da du aber der Verpflichtung nicht unterstehst, die Will eingegangen ist, hüte dich besser davor, dich selbst in die Lehenspflicht zu begeben. Ohne Land oder Wohnstätte wirst du ganz und gar vom Wohlwollen meines Gemahls abhängig sein, und das ist kein Schicksal, das ich dir wünschen würde, Thaddeus.
Er begriff nicht, weshalb Lady Anne sich seiner annahm, aber er verdankte ihr mehr als jedem anderen, und nie hatte sie eine Gegenleistung verlangt. »Wenn ich dem Büttel dies Jahr entkomme, Milady, wird er mich nächstes Jahr finden.«
»Der Verwalter meines Gemahls ist krank und wird wohl kein weiteres Jahr überleben«, erklärte sie, »und er ist es, der dein Bleiberecht infrage stellt. Sir Richard wird die Sache nach einer Woche schon vergessen haben, und ein neuer Verwalter wird nichts von deiner Lage wissen. Jedes Jahr, das vergeht, ist ein gewonnenes Jahr der Ungebundenheit, vergiss das nicht.«
Thaddeus dachte an die Strafe, die er dafür erhalten würde, dass er seine Arbeit vernachlässigt hatte. Wenn der Büttel mit ihm fertig war, würde Will übernehmen. War es wirklich so viel Pein wert, einem Lippenbekenntnis der Dienstbarkeit zu entgehen? »Können Freie den Hunger besser ertragen als Leibeigene, Milady?«
Lady Anne lächelte. »Du weißt, dass dem nicht so ist, Thaddeus, doch ein Leibeigener wird immer vor seinem Herrn sterben. Wenn dir dein Leben lieb ist, gib Acht, ihm nicht zu leicht abzuschwören, und gib noch mehr Acht, in der Sache Schweigen zu bewahren. Wenn mein Gemahl im Voraus gewarnt wird, dass du dich mit Fug und Recht frei von ihm erklären kannst, wird er den Bischof zu Rate ziehen und das Kirchenrecht gegen dich geltend machen.«
Die Prügel, die er bezog, war so fürchterlich gewesen wie nur je, doch wie Lady Anne vorausgesagt hatte, starb der alte Verwalter, und die Frage war vergessen, ob ein Bankert durch den Treueid eines Mannes gebunden sei, der ihn nicht an Sohnes statt annahm. An Thaddeus’ Leben änderte sich wenig, nur, dass er allmählich begann, sich eine Zukunft außerhalb von Develish vorzustellen. Seine Träume waren zwangsläufig begrenzt durch seine Unwissenheit darüber, was jenseits des Dorfes lag, aber sie entfachten eine Hoffnung, die vorher nie da gewesen war. Er achtete mehr auf die Geschichten der Händler und Hausierer, die durch Develish zogen, und horchte gespannt darauf, was die Knechte erzählten, die Schafe auf andere Landgüter oder zum Markt trieben.
Am meisten faszinierten ihn Beschreibungen der See, die, wie er wusste, im Süden lag. Sein Ehrgeiz war geweckt, sie eines Tages zu erreichen und mit einem Schiff zu fernen Gestaden zu segeln, wo ihn keiner mehr als Eva Thurkells Bankert oder Will Thurkells Prügelknaben sehen würde. Im Winter, wenn die Bäume ihre Blätter abwarfen und er an den waldigen Hängen am Ende des Tals Feuerholz für die Kamine des Herrenhauses sammelte, konnte er die Hügel sehen, die sich bis zum Horizont erstreckten. In fernen Höhen verschwamm ihr Blau zu schimmerndem Violett, und er war überzeugt, dass jenseits davon sein Tor zu einer anderen Welt lag. Aber wie weit es bis dorthin war und wie lange er brauchen würde, um an jenen Ort zu gelangen, das wusste er nicht.
Eleanor riss sich von ihrer Mutter los, als sie das Haus betraten. »Sprecht nie wieder so mit mir vor einem Sklaven«, fauchte sie. »Thaddeus hat sich unbotmäßig benommen. Er hat die Schläge verdient.«
Lady Anne ging weiter, ohne sich nach ihr umzusehen. »Du bist es, die sich schlecht benommen hat, Tochter. Sei dankbar, dass ich dir weitere Beschämung erspart habe.«
Das Mädchen stürmte ihr nach. »Ihr seid es, die es zu den Knechten hinzieht, nicht ich oder Vater. Glaubt Ihr, ich sehe nicht, wie Thaddeus Euch verehrt? Wenn er sich vor Sir Richard verbeugt, dann nur, um Schläge zu vermeiden, aber Euch zollt er Respekt. Warum eigentlich?«
Lady Anne wunderte sich, dass ihre Tochter so scharfsichtig war. »Ich habe ihm ab und zu Salbe für seine Blutergüsse gegeben, als er noch ein Kind war. Er wird sich wohl daran erinnern.«
»Er bemitleidet Euch. Ich sehe es seiner Miene an.«
Lady Anne hielt vor der Küchentür inne. Dahinter war es ungewöhnlich still, als ob jede Dienerin drinnen dem Wortwechsel lauschte. »Dann siehst du falsch, Eleanor. Gott allein weiß, was in einem Menschen vorgeht.«
Das Mädchen verzog das Gesicht. »Thaddeus setzt sich mit Euch gleich, wenn er es wagt, Mitleid mit Euch zu haben. Ist das etwa keine Unbotmäßigkeit? Wird Vater auch sagen, ich hätte mich schlecht benommen, wenn ich ihm erzähle, dass Eva Thurkells Bankert sich die Rechte eines Freien anmaßt?«
Lady Anne musterte ihre Tochter einen Moment. »Nimm du dich lieber in Acht vor Sir Richards Unmut, wenn er merkt, wie sehr du dich für Thaddeus Thurkell interessierst, Eleanor. Auch deiner Miene ist nämlich allerhand anzusehen.«
(AUSZUG AUS LADY ANNES TAGEBUCH)
Der dritte Tag im Juli 1348
Sir Richard ist nach Bradmayne abgereist, begleitet von einem Tross aus zehn Männern und dem Büttel, Master Foucault. Sie haben das Gold mitgenommen, das ich so sorgsam für Eleanors Mitgift aufbewahrt habe. Ich frage mich, ob es der Mühe wert war, wenn sie mich in einem Atemzug dafür verflucht, nicht genug gespart zu haben, um einen besseren Gatten für sie zu kapern, und mich im nächsten beschuldigt, Sir Richard daran gehindert zu haben, es alles beim Glücksspiel zu verschwenden. Ohne Mitgift würde sie gar nicht heiraten können, und sie versichert mir, das würde sie bei Weitem einer Ehe mit Lord Peter vorziehen.
Tief in meinem Herzen hoffe ich, die Gerüchte von der Erkrankung des Jungen mögen wahr sein, denn ich sehe kein Glück für Eleanor in Bradmayne. Ihr Vater hat ihr so viele Lügen aufgetischt, dass sie ganz unvorbereitet ist auf das, was sie dort vorfinden wird. Es gefällt ihm, Lord Peter in ihren Augen herabzuwürdigen, weil er eifersüchtig ist, doch er zögert nicht, Bradmayne als einen Hort der Schönheit und des Wohllebens anzupreisen.
Solche Beschreibungen unterscheiden sich aber sehr von den Berichten, die Gyles Startout mir zukommen lässt. Wenn ich dächte, dass Eleanor mir glauben würde, täte ich mein Bestes, sie zu beraten, aber Sir Richard hat ganze Arbeit geleistet, sie zu überzeugen, dass ich verantwortlich für diese Verbindung bin. Alles, was ich sage, trifft auf taube Ohren, besonders meine Versuche, Lord Peter in milderem Licht zu zeichnen. Sollte es ihr gelingen, ihm einen Sohn zu schenken, so fürchte ich, dass dieses Kind im Hass empfangen und geboren werden wird.
Ich sprach noch einmal unter vier Augen mit Gyles, bevor Sir Richard aufbrach. Er ist loyaler, als ich und Develish es verdienen, und erduldet jeglichen Schimpf und Spott von meinem Gemahl und seinen Begleitern, nur um uns Kunde von der Welt draußen zu bringen. Ich habe ihn gebeten, die Dienerschaft in Bradmayne auszuhorchen, wie Eleanor sich am ehesten mit Milady of Bradmayne anfreunden könnte – allein schon zu wissen, dass Milady eine Schwäche für bunte Bänder hat, wäre von Nutzen. Ich fürchte, ohne eine Vertraute wird Eleanor dort unter großer Einsamkeit leiden.
DER VIERZEHNTE TAG IM JULI 1348
ZWEI
Bradmayne, Dorseteshire
Gyles Startout verlor schnell das Interesse an der Frage, ob Lady Eleanors zukünftige Schwiegermutter mit bunten Bändern zu umwerben sein würde. Weit mehr zu schaffen machte ihm die Frage, was er von der Lage der Dinge halten sollte, die er auf dem Nachbargut vorfand. Von früheren Besuchen her wusste er von dem feindseligen Verhältnis zwischen Milord of Bradmayne und seinen Leuten – Auspeitschungen waren an der Tagesordnung, die Steuern waren hoch, allenthalben herrschte Misstrauen –, aber die Kluft schien inzwischen noch tiefer geworden zu sein.
Seit Sir Richards Ankunft vor neun Tagen hatte Gyles immer wieder beobachtet, wie die Leibeigenen sich hitzig debattierend vor den Türen ihrer Hütten versammelten und zu dem verbarrikadierten Tor in der Mauer blickten, die das Herrenhaus umschloss. Sie wirkten unruhig und aufgebracht, auch wenn Gyles auf dreihundert Schritte Entfernung weder ihre Mienen erkennen noch hören konnte, was sie sagten. Niemand versuchte sich dem Tor zu nähern.
Nur der Verwalter, der Büttel und der Priester durften kommen und gehen, wie sie wollten. Der Priester ging zu Fuß, segnete einen jeden und empfing dafür Ehrerbietung; der Verwalter und der Büttel bewegten sich hoch zu Ross, der eine bellte Befehle, der andere setzte sie mit dem Ochsenziemer durch. Mehrmals sah Gyles ein paar Frauen zur Kirche hin deuten, die innerhalb der Mauer stand, ganz so, als fragten sie den Priester, wann sie ihn dort aufsuchen dürften, aber der Mann schüttelte immer nur den Kopf. Offenbar war alles, was innerhalb der Mauer vor sich ging, für die Bauernschaft tabu.
Gyles beobachtete das Treiben während der langen, öden Stunden der Untätigkeit, die er mit den Gefolgsleuten in einer offenen Scheune auf dem Vorhof absitzen musste. Jeder von Milord of Bradmaynes Gästen hatte seine eigene Entourage mitgebracht, und es herrschte drangvolle Enge. In der behelfsmäßigen Baracke lagerten an die fünfzig Gardeleute, und alle außer Gyles waren Franzosen. Er beherrschte ihre Sprache, hatte sonst aber nur wenig mit ihnen gemein. Es waren gedungene Söldner, die von der Heimat sprachen und kein Interesse an Dorseteshire und den Menschen dort hatten. Deren verwaschenes Kauderwelsch, so beklagten sie sich, verhindere jede Unterhaltung.
Die lastende Sommerhitze – noch verschlimmert durch Sir Richards Anweisung, dass die Männer die ganze Zeit ihre dicke wollene Livree zu tragen hätten – kostete Kraft. Bei jeder Bewegung rann den Männern ein Sturzbach von Schweiß über den Rücken. Da es aber nur zwei Brunnen innerhalb der Einfriedung gab und Mengen von geladenen Edelleuten mit ihrer Garde auf jedem Flecken verfügbaren Grundes lagerten, wurde das Wasser langsam knapp. Gyles war sich dessen bewusst, weil er hörte, was die Dienerschaft redete, doch die Franzosen, deren bevorzugte Getränke Dünnbier und saurer Wein waren, bekamen nichts davon mit.
Sie saßen unterm Scheunendach, vertrieben sich die Zeit mit Würfelspiel und machten sich über Gyles lustig, weil er lieber für sich allein im Schatten der Mauer lehnte. Sie nannten ihn »Grandpère«, wegen seiner fünfundvierzig Jahre und seines grauen Haupthaars, und verspotteten ihn dafür, den Soldaten zu markieren, ohne dazu gezwungen zu sein. Sie hielten ihn für beschränkt, weil er in Knechtschaft geboren war, und Gyles tat nichts, um ihre Meinung zu ändern. Er ertrug den Hohn der Männer schon so lange, wie er zu Sir Richards Gefolge gehörte.
Er war dabei, weil Lady Anne ihren Gatten überredet hatte, einen Leibeigenen von Develish in die Garde aufzunehmen, doch seine niedere Geburt brachte ihm keinen Respekt ein, ebenso wenig wie die Tatsache, dass eine Frau sich für ihn eingesetzt hatte. Selbst die Neulinge unter Sir Richards Gefolgsleuten blickten auf ihn herab, und die Aufgaben, die er zu erfüllen hatte, waren untergeordneter Art. Er beklagte sich nie. Seine Treue zu Lady Anne überwog bei Weitem die Demütigung, seinen Kumpanen als Stallbursche dienen zu müssen und seinem normannischen Herrn als Kübelleerer.
Während jeder Reise, auf der er ihren Gatten begleitete, war er Miladys Augen und Ohren, und die Kunde, die er heimbrachte, war für Develish von großem Nutzen. Lady Anne wollte wissen, wie andere Landgüter bewirtschaftet wurden, und hielt Gyles’ Berichte heimlich auf Pergament fest. Was sie dadurch lernte, nutzte sie im Stillen, um Sir Richards Verwalter zu beeinflussen, auch wenn sie nach außen hin vorgab, sich an seichten Beschreibungen von Banketten und Hahnenkämpfen zu ergötzen, die das Einzige waren, was Sir Richard je von seinen Besuchen mitbrachte.
Tatsächlich bezweifelte Gyles, dass Sir Richard überhaupt etwas anderes beschreiben konnte. Er war von schwerfälligem Geist, stets fleischlichen Gelüsten zugeneigt, und die Verwaltung seines eigenen Gutes interessierte ihn so wenig, dass er wohl kaum in der Lage war, an anderen Orten Fortschritte zu erkennen. Er konnte kaum seinen Namenszug unter die Briefe und Verfügungen setzen, die der Verwalter ihm vorlegte, und da er nicht lesen konnte, wusste er gar nicht, was er unterschrieb.
Das meiste von dem, was Gyles zusammentrug, erfuhr er, weil er mit den Knechten zu reden verstand. In Develish geboren und aufgewachsen, wurde er von den Leuten in Dorset als einer der ihren angesehen. Sie wussten von seiner Familie und vertrauten ihm, trotz seiner Rolle als Gardesoldat eines normannischen Herrn. Aber diesmal fand Gyles niemand in Bradmayne, der bereit gewesen wäre, mit ihm zu sprechen – nicht mal die, mit denen er sich bei früheren Besuchen angefreundet hatte. Die Dienerschaft schüttelte nur furchtsam den Kopf, und das verbarrikadierte Tor hielt die Bauern außer Reichweite.
Am dritten Tag trat er zu den Wachen, die am Tor aufgestellt waren. Er sagte ihnen wahrheitsgemäß, er habe eine Base, die mit einem aus Bradmayne verheiratet sei, und bat um die Erlaubnis, ins Dorf zu gehen, um sie für eine Stunde zu besuchen. Sie verweigerten es ihm, mit Hinweis auf die strikte Order ihres Herrn, dass sämtliche Gäste und ihr Gefolge innerhalb des Mauergevierts zu bleiben hätten. Als Gyles sich nach dem Grund dafür erkundigte, wurde ihm bedeutet, eine Sondersteuer habe Unruhe unter den Bauern ausgelöst.
Es war eine durchaus glaubwürdige Antwort. Die Festlichkeiten zur Feier der Allianz zwischen Bradmayne und Develish waren opulent und verschwenderisch, darauf abzielend, die Truhe mit Gold zu ergattern, die Sir Richard als Mitgift im Gepäck hatte. Wenn Bradmayne seine Gäste auf Kosten seiner Bauern bewirtete, würde es sicher als große Ungerechtigkeit empfunden werden.
Gyles achtete darauf, sich seine Missbilligung ob solcher Exzesse niemals anmerken zu lassen. Es war ihm zuwider, wie Sir Richard eine angebissene Rehkeule den Hunden vorwarf und volltrunken vom Stuhl fiel, während etliche der Leibeigenen hungerten, doch er durfte keine Miene verziehen, wenn er seine Stellung nicht aufs Spiel setzen wollte. Er wusste, dass die französischen Kumpanen ihn verraten würden, wüssten sie von seiner Verachtung für seinen Herrn – wenn nicht gar für die gesamte herrschende Zunft.
Die Edelleute lebten von der Arbeit der Bauern, die sie mittels Bestrafung zu immer mehr Leistung antrieben. Kein französischer Söldner wusste dies so gut wie Gyles, der viele Jahre auf den Feldern von Develish geschuftet hatte. Die unablässige Arbeit eines Leibeigenen war überaus mühevoll, und der Hungertod rückte in gefährliche Nähe, wenn es Missernten gab oder die Abgaben ohne Vorwarnung erhöht wurden. Gyles entsann sich seiner Wut, wenn der bescheidene Vorrat an Korn, den seine Familie angelegt hatte, von Sir Richards Verwaltern beschlagnahmt wurde, um in Tagen der Prasserei wie diesen hier vergeudet zu werden. Und doch begann er langsam daran zu zweifeln, dass eine Sondersteuer der Grund für den Unmut der Leute sein sollte. Als er sich einmal von seinem Posten entfernte, um das ganze Rund der Festungsmauer abzuschreiten, konnte er sehen, dass die Felder der Bauern im Westen noch gar nicht abgeerntet waren. Im Sommer waren die Steuern leichter zu verschmerzen, da es genügend Nahrung gab und Milords Ackerland im Süden mit Bohnen und reifem Weizen im Überfluss gesegnet war. Warum sollte er denn Unruhe unter seinen Leuten schüren, fragte sich Gyles, wenn er selbst noch reichlich Korn zur Verfügung hatte?
Am sechsten Tag ihres Aufenthalts wurde er gewahr, dass die Unruhe der Bauern in Angst umschlug. Immer öfter blickten die Frauen zum Herrenhaus hinüber, auf der Suche nach dem Priester. Sobald sie seiner schwarz gewandeten Gestalt vor dem Tor ansichtig wurden, fielen sie auf die Knie und streckten ihm flehend die Hände entgegen. Es sah aus, als erbäten sie von ihm Absolution als Gruppe, und die ausladenden Gesten, mit denen er das Kreuz schlug, ließen darauf schließen, dass er sie den Frauen erteilte.
Er trug eine Ledertasche, die wohl Phiolen mit Weihwasser, Salben und Arzneien enthielt, wie Gyles annahm. Wenn der Priester eine Hütte betrat, was er häufig tat, hielt er sich lange darin auf, und selbst ein Dummkopf hätte erraten können, dass er an Krankenlagern Beistand leistete. Wahrscheinlich, sagte sich Gyles, waren seine Salben und Segnungen wirksam, denn es wurden keine Leichen herausgebracht. Aber warum waren die Bauern dann so verängstigt? Anscheinend war die Krankheit, die sich in Bradmayne ausbreitete, ja doch nicht tödlich?
An diesem Morgen jedoch, dem neunten, änderte Gyles seine Meinung, als seine scharfen Augen einen frisch aufgeworfenen Erdhügel auf dem Gemeindeland im Osten erspähten. Es sah nach einem Grab aus, wenn auch ungewöhnlich groß für einen einzelnen Leichnam. Er konnte sich nicht erinnern, ob der Hügel am Vortag schon da gewesen war, und erkundigte sich, wann er denn gegraben worden sei. Über Nacht? Und wenn ja, warum in aller Heimlichkeit? Und mit welchem Recht verweigerte Milord of Bradmayne seinen Leuten ein christliches Begräbnis in geweihter Erde?
Krankheit war das Thema, das Sir Richard schon auf der Hinreise beschäftigt hatte. Weil es Gerüchte gab, dass Lady Eleanors Zukünftiger kränkeln solle, hatte er seine Männer angewiesen, sich umzuhören, ob jemand dies bestätigte. Er war überzeugt, man werde ihm Lord Peter mit rosig bemalten Wangen vorführen, um ihm einen Anschein von Gesundheit zu verleihen. Die Allianz zwischen Bradmayne und Develish wäre zwar vorteilhaft, aber nicht, wenn man Mitgift für eine zum Scheitern verurteilte Ehe zahlen musste, die keine Erben hervorbringen würde.
Wie nicht anders zu erwarten, war Sir Richard schon ein paar Stunden nach seiner Ankunft nicht mehr in der Lage, Peter of Bradmaynes Gesundheitszustand zu beurteilen – im Suff hätte er selbst einen einbeinigen Knecht als passenden Gemahl für seine Tochter angesehen –, aber Gyles konnte an dem jungen Mann nichts Besorgniserregendes feststellen. Er sah nicht weniger wohl aus als bei ihren früheren Besuchen. Von schmächtiger Statur und mit Pockennarben im Gesicht – von denen Sir Richard seiner Tochter hämisch berichtet hatte –, aber augenscheinlich ungeschminkt, aß und trank er genauso genüsslich wie seines Vaters Gäste.
Es war in Develish kein Geheimnis, dass Lady Eleanor sich dieser Verbindung entziehen wollte, und Gyles empfand ein wenig Mitleid mit Lord Peter. Er würde die Brautwahl seines Vaters noch bitter bereuen, wenn er erst Eleanors Launen ausgesetzt war. In Bradmayne würde es wenig geben, was ihr zusagte, wenn sogar ihr Gatte sie enttäuschte. Vielleicht, sagte Gyles sich in einer zynischen Anwandlung, würde es ihr gefallen, wie die Leibeigenen hier für jede Kleinigkeit ausgepeitscht wurden, aber sicherlich würde sie entsetzt sein von all dem Schmutz.
Die Männer schlugen ihr Wasser ab, wo sie gerade standen, die Frauen leerten die Kübel vor ihren Türen aus, und Hunde und Ratten wühlten im Unrat. Innerhalb der Mauer war es auch nicht besser. Am Haus entlang verlief ein offener Jauchegraben, aus dem es dermaßen stank, dass sogar Sir Richard es bemerkte. Zu den seltenen Gelegenheiten, da er nüchtern genug war, um aus dem Haus zu wanken, hielt er sich eine mit Gewürznelken gespickte Orange unter die Nase. Noch schlimmer aber fand Gyles die allgegenwärtige Rattenplage. Ihre Köttel fanden sich in der Küche und im Kornspeicher, doch es wurde nichts unternommen, um die Tiere zu verjagen. Milord of Bradmayne schien sich nicht darum zu scheren, dass Schmutz und Unrat von Fell und Pfoten in seine Nahrung gelangten.
Aus dem Augenwinkel sah Gyles den Priester wie jeden Morgen ans Tor kommen, und er wandte sich von seiner Betrachtung des Erdhügels ab, um zu beobachten, was nun geschehen würde. Der kurze Wortwechsel mit den Wachen gestaltete sich anders als an den Vortagen. Der Priester, unter seiner weiten Kapuze verborgen, schien gebeugt vor Müdigkeit, und die Wachen wichen erschrocken vor ihm zurück. Mit zitternden Händen schlug er das Kreuz über sie und hob dann selbst den Riegel, um sich mit schwankenden Schritten zum Dorf hin zu begeben.
Vom Verwalter und vom Büttel war nichts zu sehen, obwohl sie gewöhnlich jeden Morgen mit Sattel und Zaumzeug überm Arm die Einfriedung verließen. Ihre Pferde grasten friedlich mit denen von Milords anderen Gästen zusammen auf den Weiden außerhalb der Mauer. Waren die beiden denn noch im Bett, fragte sich Gyles, nachdem sie über Nacht das Ausheben der Grube beaufsichtigt hatten? Oder womöglich auch schon von Krankheit geschwächt, wie der Priester?
Er wartete bis zum Mittag, dann suchte er Pierre de Boulet auf, Sir Richards Gardehauptmann. Hätte er es nicht für nötig erachtet, mit dem Franzosen zu sprechen, hätte er seinen Verdacht für sich behalten; er konnte sich schon vorstellen, wie man ihn dafür abfertigen würde, dass er es wagte, eine Meinung zu äußern. De Boulet, der noch keine dreißig war und erst seit zwei Jahren Hauptmann, machte keinen Hehl daraus, wie sehr es ihm missfiel, dass ein englischer Knecht zu Sir Richards Garde gehörte.
»Was willst du?«, blaffte er auf Französisch, nachdem Gyles ein paar Minuten schweigend dagestanden und zugesehen hatte, wie der Hauptmann mit drei Kameraden auf dem staubigen Scheunenboden die Würfel rollen ließ.
Gyles antwortete in derselben Sprache. »Einen Moment Eurer Zeit, mon capitaine.«
»Ich bin beschäftigt.«
»Es ist wichtig, mon capitaine.«
»Sprich.«
»Unter vier Augen, bitte, mon capitaine. Es geht um Sir Richard.«
De Boulet, der gerade eine Pechsträhne hatte, funkelte ihn ärgerlich an. »Was unterstehst du dich! Milords Belange gehen dich nichts an.«
Gyles deutete eine Verbeugung an. »Soll ich mich lieber an Master Foucault wenden, mon capitaine? Als Büttel von Develish ist er es, der über Sir Richards Gold wacht.«
Mit saurer Miene wandte der Franzose sich vom Spiel ab und stand auf. Foucault war noch so einer, der de Boulets Recht infrage stellte, zu bestimmen, wer in Sir Richards Tross mitreiten durfte. Ein Büttel hatte gefälligst zu Hause zu bleiben und den Verwalter dabei zu unterstützen, die Befehle seines Herrn durchzusetzen; stattdessen war er hier, mit der Schatzkiste betraut, bis Sir Richard geruhte, sie an Milord of Bradmayne zu übergeben. Und aus welchem Grund? Nur damit Sir Richards Garde, von der Verantwortung befreit, jederzeit Spalier stehen konnte, wenn es dem noblen Herrn gefiel, vors Haus zu treten.
Gyles verstand de Boulets Kümmernisse besser, als der Franzose ahnte. Gardehauptmann bei Sir Richard zu sein hieß Unwürdigkeit ertragen. Die allgemeine Belustigung war nicht zu überhören, die wie eine Welle durch die offene Scheune schwappte, wenn er und seine Männer sich in Reih und Glied aufstellen mussten, sobald ihr betrunkener Herr in den Hof wankte, um in den Jauchegraben zu pissen. De Boulets Vorgänger hatten sich allesamt nicht lange gehalten. Lieber hatten sie sich anderswo verdungen, als Sir Richards demütigende Order ausführen zu müssen.
»Es steht dir nicht zu, vor anderen Leuten von Milords Gold zu sprechen«, fuhr de Boulet Gyles an, kaum dass sie draußen standen. »Wenn das noch einmal vorkommt, setzt es Stockhiebe. Also, was gibt’s so Wichtiges?«
»Ich weiß, dass Sir Richard die Mitgift bewachen lässt, bis er sich versichert hat, dass Lord Peter gesund ist, mon capitaine.«
De Boulets Augen verengten sich. »Hast du Grund zu der Annahme, dass er es nicht ist?«
»Nein, aber ich glaube, im Dorf geht eine todbringende Krankheit um, mon capitaine. Seit Tagen steht der Priester den Leidenden bei, und über Nacht ist in einem der Felder eine Grube gegraben worden.«
Der Franzose maß ihn mit zornigem Blick. »Du störst mich beim Würfelspiel, nur um mir zu sagen, dass Bauern sterben? Seit wann ist das eine Neuigkeit? In Pedle Hinton sind letztes Jahr zehn an Fieber und Durchfall gestorben.«
»Aber keinem wurde ein christliches Begräbnis verwehrt, mon capitaine. Wenn Ihr gen Osten zum Gemeindeland hinüberblickt, werdet Ihr einen Erdhügel sehen, groß genug für eine Menge Leichen. Die Grube wurde heimlich ausgehoben, während wir anderen alle schliefen. Offenbar will Milord of Bradmayne die Kirche ebenso den Toten verschließen wie den Lebenden.«
De Boulet blickte in die angegebene Richtung. »Und zu welchem Zweck?«
»Ich weiß es nicht, mon capitaine. Entweder fürchtet er, dass die Krankheit sich innerhalb der Mauer ausbreiten könnte, oder er will vermeiden, dass seine Gäste vom Sterben der Bauern erfahren. Vielleicht beides. Es wäre nicht in seinem Interesse, wenn Sir Richard erkrankte, bevor die Mitgift bezahlt ist … oder wenn er infrage stellt, ob er überhaupt noch zahlen soll.«
»Sir Richard ist um Lord Peters Gesundheit besorgt, nicht um eine Handvoll Bauern.«
Gyles neigte den Kopf, wie in respektvoller Zustimmung. »Sehr wahr, mon capitaine, aber der Erdhügel dort scheint dreißig Schritt lang und zwei Schritt breit zu sein – breit genug für dreißig Leichen nebeneinander. Oder mehr, wenn die Toten Kinder sind. Das ist mehr als eine Handvoll.«
»Man kann aus der Entfernung gar keine Größe abschätzen. Wer hat dir nur diesen Unsinn eingeredet?«
»Niemand, mon capitaine. Das Landvolk darf das Tor zum Anwesen nicht passieren, und die Dienerschaft will nicht mit mir reden. Die Länge des Erdhügels lässt sich an den Eichen zur Rechten davon abschätzen. Gefällt erstrecken solche Bäume sich auf gut sechzig Schritt, und das Grab ist mindestens halb so lang.«
Wieder blickte der Franzose zum Gemeindeland hin und sah, dass Gyles recht hatte. »Das geht uns nichts an. Krankheit drüben im Dorf stellt für uns keine Bedrohung dar. Unser Aufenthalt hier ist in drei Tagen zu Ende.«
Noch einmal neigte Gyles den Kopf, mehr um seine Irritation über de Boulets Selbstzufriedenheit zu verbergen, als um Respekt vorzutäuschen. »Der Priester sieht alles andere als wohl aus, mon capitaine, und der Büttel und der Verwalter sind heute Morgen nicht aus dem Haus gekommen. Wenn alle drei die Krankheit haben, ist sie bereits innerhalb der Mauer. Ich kann nicht sagen, um welches Leiden es sich handelt, aber es scheint sich sehr schnell auszubreiten. Die Anzahl der Leute, die auf den Feldern arbeiten, ist viel geringer als noch in der letzten Woche. Milord of Bradmayne hat vierhundert Leibeigene, doch heute Morgen habe ich kaum zehn Dutzend bei der Feldarbeit gesehen. Die Frauen, Kinder und Graubärte bleiben im Dorf, aber auch ihre Zahl scheint sich verringert zu haben.«
»Für einen Knecht scheinst du dich ja gut mit Zahlen auszukennen.«
Gyles hob den Kopf. »Ihr werdet sehen, dass ich recht habe, wenn Ihr selbst nachzählt, mon capitaine.«
»Na und? Das alles ist Milord of Bradmaynes Problem, nicht Sir Richards.«
»Sir Richard würde es als Problem sehen, wenn er davon wüsste, mon capitaine. Ohne Arbeiter verliert ein Anwesen schnell an Wert. Tote können keine Ernte einbringen oder fürs nächste Jahr säen, und Milord of Bradmayne wird sich schwertun, höhere Abgaben einzutreiben, wenn seine Leute ihm wegsterben. Unter diesen Umständen eine Verbindung mit ihm einzugehen wäre riskant.«
De Boulet war nicht beeindruckt. »Du täuschst ein Wissen vor, das du nicht hast.«
»Meine Sorge gilt ebenso Develish wie Bradmayne, mon capitaine. Wir erweisen unseren Leuten keinen Dienst, wenn wir eine Krankheit mit heimbringen. Wir sollten besser gleich aufbrechen, solange Sir Richard und seine elf Gefolgsleute noch gesund sind.«
»Unser Anwesen ist nicht gefährdet. Durch Gottes Gnade und die Reinheit unserer Luft sind wir mit guter Gesundheit gesegnet. Das verdanken wir Sir Richards Frömmigkeit.«
De Boulet unterlag der gleichen Selbsttäuschung wie Sir Richard, wenn er glaubte, Gottes Gnade sei so leicht zu gewinnen, doch Gyles machte sich seine Gutgläubigkeit zunutze. »Ganz recht, mon capitaine, und Milord of Bradmayne wird wohl wissen, dass er unserem Herrn an Tugend unterlegen ist. Sonst würde er nicht vertuschen müssen, was hier gerade passiert. Sollte man Sir Richard nicht davon unterrichten, bevor er sein Gold hergibt? Gottesfürchtige Männer verbünden sich nicht gerne mit solchen, die Gott zu strafen sucht.«
De Boulet wandte sich ab. Sein Widerwille, Sir Richard mit der Sache zu behelligen, war ihm deutlich anzusehen. »Ich werde mich nach dem Büttel und dem Verwalter erkundigen, obwohl ich bezweifle, dass du die Wahrheit sagst«, knurrte er. »Ihr Knechtsgesindel bildet euch doch immer irgendwelche Schauermärchen ein.«
Gyles sah ihm nach, als er auf das Eingangstor des Herrenhauses zuging, und nahm dann wieder seinen Platz an der Mauer ein. Er hoffte aufrichtig, dass de Boulet recht haben möge. Lieber wollte er sich wegen eingebildeter Ängste verspotten lassen, als eine Krankheit nach Develish einzuschleppen, die innerhalb einer Woche Dutzende dahinraffen konnte. Ob Lady Anne wohl schon von einer derart mörderischen Krankheit gehört hatte? Selbst der Hunger, die gefürchteten Pocken und die blutige Ruhr brauchten Zeit, bis sie die Leidenden so geschwächt hatten, dass sie zugrunde gingen.
Als die Sonne gen Westen sank und die Schatten länger wurden, kam eine Frau vom Dorf die Straße herauf. Sie weinte und rang die Hände, doch die Wachen befahlen ihr stehen zu bleiben, als sie noch ungefähr fünfzig Schritte vom Tor entfernt war.
»Vadder Jean hevt Help nodig«, rief sie verzweifelt und sank dabei auf die Knie. »De Beuln ans’n Nack sin uffplatzt un’r is hinnich. Milord muss’m z’Kirsch karre lasse.«
Einer der Torwächter hob den Bogen. »Hör auf mit dem Gebrabbel und geh zurück«, sagte er auf Französisch. »Ihr habt eure Befehle.«
»Aber Vadder Jean bruch sin Heem un sin Bedde. Je mut Milord um Gnad frach!«
Gyles stieß sich von der Mauer ab und ging auf das Tor zu. »Sie bittet um Hilfe«, rief er den Wächtern zu. »Sie sagt, Pater Jean sei zusammengebrochen, und bittet darum, Männer zu schicken, die ihn zur Kirche tragen sollen.«
»Was hat sie sonst noch gesagt?«
»Die Beulen an seinem Hals sind geplatzt. Er braucht sein Heim und sein Bett. Sie möchte, dass Ihr Milord bittet, ihm Gnade zu erweisen.«
Der Wächter machte ein Gesicht, als käme ihm die Galle hoch. »Zwecklos«, murmelte er. »Der Priester wird vor Anbruch der Dunkelheit tot sein. Er hat es heute Morgen schon gewusst. Die Beulen am Hals hat er unter der Kapuze verborgen, aber der Tod stand ihm schon ins Gesicht geschrieben. Wenn Ihr Euch der Frau verständlich machen könnt, sagt ihr, sie soll sich um ihn kümmern, so gut sie eben kann.«
Gyles überlegte einen Moment, erhob dann die Stimme und sprach die Frau in breitem Dorset-Dialekt an, den kein Franzose verstehen konnte: »Gute Frau, ich bin Gyles Startout, verwandt mit Aggy Bushrod. Diese Franzmänner haben zu viel Angst vor ihrem Herrn, um Gnade für den Priester zu erbitten. Ich sehe ein frisches Grab da drüben. Wie viele sind gestorben? Wie viele sind krank?«
Die Antwort, die sie gab, war ein Schock. Drei Dutzend Tote und ebenso viele mit Fieber und eitrigen Beulen am Hals und in der Leiste. Er fragte, ob sie wisse, was für eine Krankheit das sei, aber sie verneinte. So etwas habe keiner je gesehen. Das Blut werde schwarz, während der Körper absterbe, und alle, die es sähen, schlotterten vor Entsetzen.
Gyles fragte, wie und wann die Krankheit ausgebrochen sei, und sie berichtete, reisenden Händlern zufolge sei sie am Johannistag im Hafen von Melcombe ausgebrochen. Vor zwölf Tagen sei ein Kind in Bradmayne gestorben – wahrscheinlich an den Pocken –, doch aus Angst vor der Seuche habe Milord das Tor verriegeln lassen und den Bauern befohlen, sich fernzuhalten.
Der Priester wollte sie damit trösten, dass sie nichts von einer Krankheit in Melcombe zu befürchten hätten, aber er hatte unrecht. Kaum hatten droben im Herrenhaus die Festlichkeiten begonnen, fingen viele im Dorf an, über heftige Schmerzen und Fieber zu klagen. Die eitrigen Beulen wurden so dick wie Hühnereier, und keiner überlebte länger als drei Tage. Die Toten hatten zwischen den Lebenden gelegen, bis der Verwalter Milord überredet hatte, eine Grube ausheben zu lassen. Sie blieben zuversichtlich, solange Pater Jean noch wohlauf war und ihnen die Beichte abnehmen konnte, doch nun hatten sie keine Hoffnung mehr. Gott hatte ihnen diese Plage geschickt, um sie zu strafen.
Die Wächter wurden ungeduldig. Sie warnten Gyles, er gefährde die Frau, indem er sie so lange aufhielt; Milord habe strikt angeordnet, keinen Bauern in der Nähe des Hauses zu dulden. Gyles rief der Frau zu, sie solle sich entfernen, und fügte noch eine letzte Frage an: Welche Sünde die Bauern denn begangen hätten, um solche Strafe zu verdienen?
Sie wisse es nicht, rief sie verzweifelt. Stets hätten sie nach den Lehren der Kirche gelebt und ihr Treuegelöbnis befolgt, wie schlecht ihr Herr sie auch behandeln mochte. Er verachte sie, weil sie Engländer seien, und beschuldige sie, Unheil über sein Anwesen gebracht zu haben. Jetzt würde er sie erst recht verfluchen, wenn er erführe, dass der Priester krank sei.
Ihre Worte wurden von den zornigen Rufen der Wächter übertönt, und mit einem letzten verzweifelten Blick zum Tor raffte sie sich auf und ging mit schleppenden Schritten ihres Weges.
Der Wächter hinderte Gyles mit vorgehaltenem Bogen am Durchschreiten des Tors. »Ihr müsst Schweigen bewahren über das, was Ihr hier erfahren habt.«
Gyles zuckte die Achseln. »Die Wahrheit kommt ans Licht, ob ich schweige oder nicht. Die Vesperstunde naht, und Pater Jean ist nicht in seiner Kirche. Milords Gäste werden sich fragen, warum.«
Die weiteren Entwicklungen beobachtete er von seinem selbst gewählten Posten an der Mauer aus. Offenbar war Milord bereit, jedweden als Ersatz für den Priester zu akzeptieren, sogar Pater Jeans jungen Mesner, damit die Gäste nicht erfuhren, dass Bradmayne todgeweiht war. Der Junge – kaum sechzehn Jahre alt – stolzierte im Ornat seines sterbenden Lehrmeisters einher und empfing Milord und Milady an der Kirchentür.
Aber sein Knabengesicht zeigte nackte Angst.
Vielleicht wusste er, dass sein eigenes Ende nah war.
DREI
Die Nacht brach an, doch Gyles blieb, wo er war. Er war zu aufgewühlt, um Schlaf finden zu können. Die Hoffnung, dass es de Boulet gelingen würde, Sir Richard zu überzeugen, wurde zunichte, als der Hauptmann wieder aus dem Haus trat. Milord of Bradmaynes Kammerherr hatte ihm versichert, der Büttel und der Verwalter seien in aller Früh fortgeritten, und de Boulet weigerte sich, Gyles’ Bericht von den Schreckensnachrichten der Bauersfrau anzuhören. Er sei klug genug, meinte er, seinen Herrn nicht mit den Hirngespinsten blöder Bauern zu behelligen.
Gyles drängte ihn nicht weiter. Es gab zu viele Fragen, die noch nicht beantwortet werden konnten. Warum hatte Sir Richard denn gar keine Kunde von jener tödlichen Krankheit in Melcombe erhalten, bevor er hier eintraf? Es war elf Tage her, seit sie von Develish aufgebrochen waren, aber selbst während ihrer Reise hatten sie nichts davon gehört. Konnte so etwas tatsächlich innerhalb einer einzigen Woche von Melcombe auf Bradmayne übergreifen? War das der Grund, weshalb die Gäste hier ebenfalls ahnungslos waren?
Vor allem aber fragte sich Gyles, ob die Bauersfrau recht damit hatte, dass es eine gottgesandte Plage sei. Lady Anne würde solch eine Behauptung sicherlich von sich weisen, aber Gyles konnte sich keine andere Erklärung für schwarzes Blut und schwärende Beulen vorstellen. Lehrte denn nicht die Kirche, dass die Ungläubigen in Ägypten auch von derartigen Plagen heimgesucht worden waren?
Das Ächzen und Würgen eines Soldaten in der Scheune ließ Gyles das Blut in den Adern gefrieren, ahnte er doch, was die Ursache war. Es kam ihm vor, als wüchsen ihm selbst schon Beulen am Hals, und er hob eine bebende Hand, ihn zu betasten. Da er keinerlei Schwellung finden konnte, zwang er sich, in Ruhe nachzudenken. Milady hatte immer gesagt, der Aberglaube sei der Feind der Vernunft. Aus gutem Grund habe Gott den Menschen Verstand gegeben, und nur Ignoranten weigerten sich, ihn zu benutzen.
Als sie vor anderthalb Jahrzehnten als junge Braut nach Develish gekommen war, sah kaum jemand irgendetwas Bewundernswertes an ihr. Gerade erst vierzehn Jahre alt, blässlich und bescheiden gekleidet, wie sie war, zweifelte keiner daran, dass Sir Richard sie nur ihrer Mitgift wegen geheiratet hatte. Zwanzig Jahre älter als sie und so stattlich, wie ein Mann nur sein konnte, machte er keinen Hehl aus seiner mangelnden Zuneigung, bezeichnete sein Eheweib als sein Eigentum und beschimpfte sie ebenso hemmungslos wie seine Leibeigenen.
Was Lady Anne von ihrer Lage hielt, konnte man nur ahnen, da sie wenig sprach und eine unbewegte Miene zur Schau trug. Von ihrer Vorgeschichte war lediglich bekannt, dass sie mit sechs Jahren ins Kloster gesteckt worden war, als ihr Onkel das Gut ihres Vaters geerbt hatte, und ihre Unterwürfigkeit ließ darauf schließen, dass sie nichts weiter gelernt hatte als Gehorsam. Frei von den Zügeln, die eine temperamentvollere Frau ihm vielleicht angelegt hätte, frönte Sir Richard sorglos wie zuvor seinen Ausschweifungen auf Kosten seiner Bauern.
Schwer zu sagen, wann und wie Miladys Einfluss sich zu zeigen begann. Gyles’ Frau Martha sah es in der ruhigen Art, mit der sie allmählich den Haushalt übernahm und den Dienern immer wieder Schläge ersparte, indem sie ihre Fehler korrigierte, bevor Sir Richard davon erfuhr. Gyles sah es in der überraschenden Wahl eines englischen Verwalters – kurz nach Lady Eleanors Geburt –, der Latrinen an der windabgewandten Seite des Dorfes ausheben und ein Hospital mit drei Kammern zur Betreuung der Kranken errichten ließ.
Als die Knechte sich über die Mehrarbeit beklagten, die ihnen damit auferlegt wurde, sagte der Verwalter, es sei zu ihrem eigenen Besten, und wies ein Schreiben mit Sir Richards Signatur vor. Niemand glaubte, dass ihr Herr gewusst hatte, was er unterschrieb. Seine Gleichgültigkeit dem Wohlergehen anderer gegenüber und seine Unkenntnis der Schrift ließen darauf schließen, dass seine Frau ihn getäuscht hatte, denn Lady Annes Geschick im Umgang mit dem Federkiel war weithin bekannt.
Sie machte sich damit keine Freunde. Das Graben und Mauern war mühselig, und die Knechte grummelten voller Bitterkeit über die verrückten Ideen, die Lady Anne aus dem Kloster eingeschleppt hatte. Noch vernehmlicher wurde ihr Murren, als die Latrinen und das Hospital fertiggestellt waren und der Verwalter ihre Benutzung unter Androhung von Strafabgaben erzwang. Die Frauen verfluchten Miladys Einbildung, sie wüsste besser als sie, wie man Kranke pflegte, und die Männer scheuten sich davor, eine gemeinschaftliche Grube für ihre Notdurft zu nutzen. Es schickte sich nicht für ein halbwüchsiges Mädchen, fanden sie, den Erwachsenen vorzuschreiben, wie sie ihr Leben zu führen hätten.