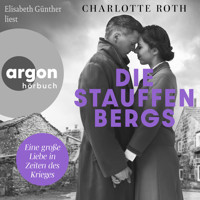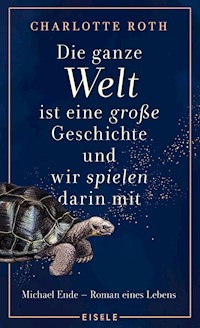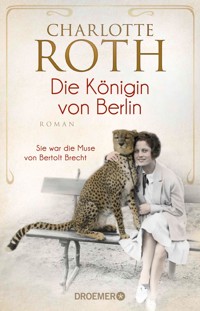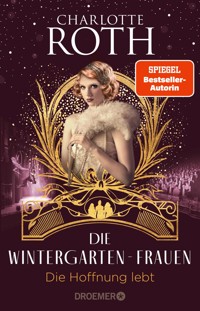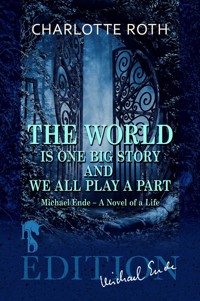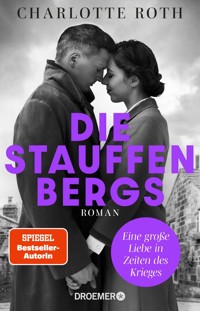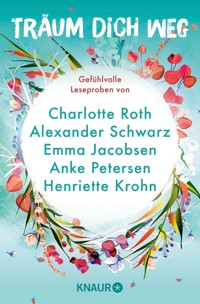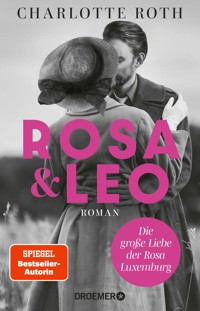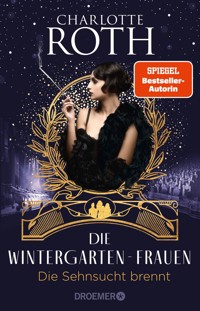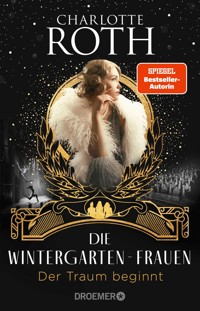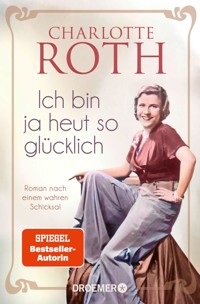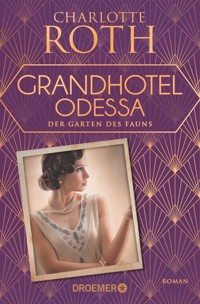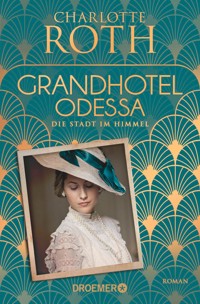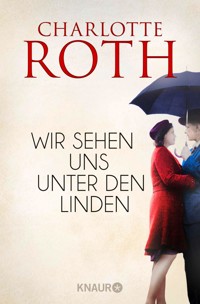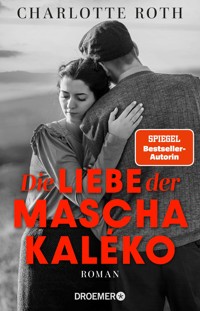
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Für wen schrieb Mascha Kaléko all ihre wunderbaren Liebesgedichte? Sie ist der Star der pulsierenden Dichter-Szene der 20er Jahre – aber wer ist sie, wenn das Rampenlicht erlischt? Bestseller-Autorin Charlotte Roth setzt in ihrem großen biografischen Roman einer der bedeutendsten Künstlerinnen des frühen 20. Jahrhunderts ein ebenso kluges wie leidenschaftliches Denkmal. Im Berlin der Zwanzigerjahre, das vor Leben überquillt, findet die junge Mascha Kaléko ihre Stimme. Sie wird sie weltberühmt machen. Mascha heiratet ihren Mentor Saul Kaléko, der ihr unbändiges Talent erkennt und eine Seelenverwandte in ihr sieht. Doch die Ehe wird nicht nur von den Vorboten der Nazi-Herrschaft überschattet: In Mascha brennt eine zutiefst menschliche Sehnsucht. Als sie dem Komponisten Chemjo Vinaver begegnet, bricht sich eine Liebe Bahn, die Mascha vor unausweichliche Dilemmata stellt. Ihre Kunst und ihr Herz ziehen sie in unterschiedliche Richtungen – bis Antisemitismus und der drohende Krieg sie zur Flucht zwingen. Von Berlin bis nach New York sucht Mascha nach einem Zuhause, das mehr Gefühl ist als Ort, während sie mit den Verlusten ringt, die ihre Entscheidungen fordern. Eine starke Frau zwischen den Stürmen der Geschichte, den Wirren der Liebe und dem Ruf der Kunst Mascha Kaléko war nicht nur eine überaus erfolgreiche Künstlerin, der ihre Gedichte praktisch aus den Händen gerissen wurden. Sie war auch eine Ikone der Frauenbewegung. Und eine Frau, die mit ganzem Herzen geliebt hat. »Die Liebe der Mascha Kaléko« ist ein kluger historischer Roman mit einer wunderschönen, dramatischen Liebesgeschichte. Entdecken Sie auch die anderen biografischen Romane in der historischen Reihe »Die großen Liebesgeschichten des 20. Jahrhunderts« von Bestseller-Autorin Charlotte Roth: - Rosa und Leo (Rosa Luxemburg und Leo Jogiches) - Die Stauffenbergs (Nina und Claus von Stauffenberg)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 556
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Charlotte Roth
Die Liebe der Mascha Kaléko
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Mascha Kaléko zwischen den Stürmen der Geschichte, den Wirren der Liebe und dem Ruf der Kunst
Auf den pulsierenden Straßen Berlins findet die junge Mascha Kaléko ihre Stimme, die sie weltberühmt machen wird. Dennoch bleibt etwas in der Dichterin, die als jüdisches Kind aus ihrer Heimat vertrieben wurde, wurzellos. Ihre Ehe mit ihrem Mentor Saul, der ihr unbändiges Wesen und ihr Talent liebt, wird von den Schatten der Nazi-Herrschaft und einer unstillbaren Sehnsucht überschattet. Als sie dem charismatischen Komponisten Chemjo begegnet, findet ihre Seele die Heimat, nach der sie ein Leben lang gesucht hat. Eine leidenschaftliche Liebe entbrennt und stellt sie vor ein unausweichliches Dilemma. Während die Schlinge des Hitler-Regimes sich um sie enger und enger zieht, kämpft Mascha mit ihrer ganzen Lebenskraft darum, ihr Liebstes zu retten und ihrem Herzen treu zu bleiben.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Zum besseren Verständnis zeitgeschichtlicher [...]
Widmung
Motto
Biografien mochte sie nicht.
Chrzanów, Galizien, Österreich-UngarnJuni 1907
1. Kapitel
Berlin, Dezember 1918
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Berlin, Februar 1926
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
Berlin, November 1932
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
Berlin, Dezember 1936
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
Glossar
Zum besseren Verständnis zeitgeschichtlicher Begriffe und Einrichtungen befindet sich am Ende dieses Romans ein Glossar.
Für Archie, Lennart und Steven,
die fehlen
»Vor fast vierzig Jahren wohnte ich hier.
… Zupft mich was am Ärmel, wenn ich
So für mich hin den Kurfürstendamm entlang
Schlendere – heißt wohl das Wort.
Und nichts zu suchen, das war mein Sinn.
Und immer wieder das Gezupfe.
Sei doch vernünftig, sage ich zu ihr.
Vierzig Jahre! Ich bin es nicht mehr.
Vierzig Jahre. Wie oft haben meine Zellen
Sich erneuert inzwischen
In der Fremde, im Exil.
New York. Ninety-Sixth Street und Central Park,
Minetta Street in Greenwich Village.
Und Zürich und Hollywood. Und dann noch Jerusalem.
Was willst du von mir, Bleibtreu?
Ja, ich weiß. Nein, ich vergaß nichts.
Hier war mein Glück zu Hause. Und meine Not.
Hier kam mein Kind zur Welt. Und mußte fort.
Hier besuchten mich meine Freunde
Und die Gestapo.
Nachts hörte man die Stadtbahnzüge
Und das Horst-Wessel-Lied aus der Kneipe nebenan.
Was blieb davon?
Die rosa Petunien auf dem Balkon.
Der kleine Schreibwarenladen.
Und eine alte Wunde, unvernarbt.«
Mascha Kaléko: »Bleibtreu heißt die Straße«
© Kaléko, »In meinen Träumen läutet es Sturm«, 1977 dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München.
Biografien mochte sie nicht.
Wenn sie nach der ihren gefragt wurde, gab sie sich scheu und wehrte ab, verwies auf ihre Gedichte, bat darum, ihr »Mystik statt Statistik« zu gewähren. Ich habe sie dennoch – oder deshalb? –immer aufspüren wollen, sie entdecken in den Steinen des Straßenpflasters, über das sie mit ihren flinken, kleinen Schritten gegangen ist, in den Mauern der Häuser, dem Schatten der Platanen, dem Sand des alten Kinderspielplatzes, auf den sie ihren kleinen Sohn in seinem Kinderwagen gefahren haben mag.
Warum sie?
Und warum ich?
Vielleicht weil ich dort, wo sie gewohnt hat, in der Charlottenburger Bleibtreustraße, auch gewohnt habe, weil ich dort, wo sie jung war und ihre Jahre leuchtend nannte, auch jung war, weil dort, wo ihr Kind zur Welt kam, auch meine zur Welt gekommen sind und aus dem kleinen Schreibwarenladen unter dem Petunienbalkon ihren ersten Tuschkasten bekamen. Wo ihre Freunde sie besuchten, besuchten mich meine – aber zu uns kam keine Gestapo, und unsere Kinder mussten nur deshalb fort, weil wir uns eines Tages aus freiem Willen entschieden, nicht länger in Berlin, sondern künftig in London zu leben.
Ihr Heimweh hieß Savignyplatz. Wenn sie davon schrieb, kam es mir vor, als meinte sie meines mit.
Mascha Kaléko, mit der ich auf merkwürdige Weise in meinen jungen Jahren ein Zuhause teilte, ließ ich zurück, aber losgekommen bin ich von ihr nie. Sie ist ein einziges Mal zurückgekehrt, um zu fragen: Was willst du von mir, Bleibtreu?
Ich bin oft zurückgekehrt und habe mich – vor allem im Frühling – nicht selten gefragt: Was willst du von mir, Mascha?
Warum tut es weh, als wäre deine unvernarbte Wunde jetzt meine?
Es hat den Anschein, als hätte ich jemanden gekannt, in meinen jungen Jahren in Berlin-Charlottenburg, mit dem ich nicht fertig bin, nicht fertig werde, nach dem ich noch einmal suchen muss, um ihm auf den Grund zu gehen – um seine Geschichte zu erzählen.
Ihre Geschichte.
Zumindest den Teil, den wir auf so unerklärliche Weise gemeinsam hatten – damals, in unseren jungen Jahren, in der Bleibtreustraße, ich mehr als ein halbes Jahrhundert später und von niemandem bedroht, sie in dem Augenblick, in dem die Welt unterging und ihr Leben mit sich riss.
Und dennoch.
Ihre Geschichte erzähle ich, weil sie zu meiner gehört. So verstiegen das klingt. Weil ihre wie meine hätte weitergehen sollen: aus freiem Willen.
Ihre verborgensten Geheimnisse lasse ich ihr trotzdem. Zum einen, weil sie mir die gar nicht preisgeben würde, zum andern, weil es eine Frage gegenseitigen Respektes ist. Ich erzähle nur das, was ich zu wissen glaube, was sich anfühlt, als hätte sie es mir anvertraut, als hätten wir es geteilt, im Sand des Spielplatzes, in dem wir unsere Kinder mit Eimer und Schaufel niedersetzten, damit sie spielen konnten und wir reden.
Dafür bitte ich um Verständnis. Was Sie zu lesen bekommen, ist nicht Mascha Kalékos Geschichte, sondern meine Geschichte von ihr, in der ich aus dramaturgischen Gründen Ereignisse ein wenig verschoben und aus persönlichkeitsrechtlichen hier und da einen verbürgten Menschen durch eine nachempfundene Figur ersetzt habe. Wenn Sie Ihre eigene Geschichte von ihr haben, dann hoffe ich, dass Sie sie eines Tages erzählen werden und dass ich sie dann lesen kann.
Mascha Kaléko ist viele Geschichten wert.
Und kein Vergessen.
Charlotte Roth, Sommer 2024
Nachsatz:
Falls Sie sich wundern, warum in diesem Buch Mascha Kalékos Gedichte zwar erwähnt, aber nicht zitiert werden: Dies ist aus rechtlichen Gründen geschehen, da der Abdruck ihrer Gedichte nur vollständig gestattet ist. Ich finde es schön, dass auch dann noch liebevoll auf das Werk einer Künstlerin geachtet wird, wenn diese es selbst nicht mehr kann, und ich bedanke mich beim dtv Verlag für die Erlaubnis, einige Gedichte im Ganzen in mein Buch einzubinden. Diese genügen hoffentlich, um in Ihnen den Wunsch auf mehr zu wecken. Neben der schön aufbereiteten Gesamtausgabe ihrer Werke und Briefe stehen im dtv Verlag zahlreiche Einzelbände zur Verfügung.
»Hätte ich einen Vater gehabt
Oder gar eine Mutter!
(…)
Vier waren in der Familie
Aber vier waren es beinahe nie.
Vater beständig auf Reisen
Und Mutter bei Tante Li.
(…)
Was ich mir wünschte
Bekam ich nie.
Aber auch darauf war kein Verlaß.
Das Beinahe war schlimmer als das Nein.
(…)
Hätte ich ein Heim gehabt
Oder gar eine Heimat,
Ich fremder Niemand aus Niemandsland.«
Mascha Kaléko:»Hätte ich einen Vater gehabt«
© Kaléko, »Heute ist morgen schon gestern«, 1983 dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München.
1
Die ist zu klein«, sagte die Goscha und legte das Kind beiseite wie einen Gegenstand, der ihr nicht gefiel. »Zehn Monate im Bauch und dann nur so’n Häuflein Elend und Knöchelchen. Die macht’s nicht lang. Der Herr hat’s gegeben. Der Herr hat’s genommen. Ist bei solchem Wurm, das keinen Vater hat, ja nicht das Schlechteste.«
»Der Fischel.« Roza keuchte wie eine uralte Frau, wie ihre Urgroßmutter Golda Gebirtig, die hundert Jahre alt war, und sie selbst war doch kaum älter als zwanzig. »Der Fischel ist mein Mann vor Gott, und wenn er wiederkommt, wird er’s auch auf dem Amt sein und vor allen Leuten.«
Die Goscha, die zänkische Hexe, wusste das doch selbst. Fischel Engel hatte sie, Roza Aufen, unter der Chuppa, vor dem Rabbiner der Großen Synagoge zur rechtmäßigen Frau genommen. Ein frommer Mann war er, stammte selbst von Rabbinern ab und war auf die Talmud-Schule gegangen. Aufs Amt wäre er auch mit ihr gezogen, doch er hatte in Geschäften fortgemusst, denn der Fischel war als Kaufmann tätig, so jung, wie er an Jahren auch noch war. An seiner ehrbaren Absicht bestand kein Zweifel, und das Kind würde er als seines anerkennen. Ansonsten hätte er ihr ja wohl kaum die Wohnung bezahlt, Küche, Stube und Kammer, im selben Haus, in dem die Eltern wohnten. Und schon gar nicht hätte er der Goscha, der Hebamme, noch Geld hingeblättert, damit sie zur Stelle war, wenn sein Kind auf die Welt wollte.
Das Kind.
Was war damit?
Die Goscha hatte es weggelegt, und es schrie nicht. Runia, das Neugeborene ihrer jüngsten Schwester, hatte geschrien wie am Spieß.
»Ist’s denn ein Junge?«, fragte Roza. Mit dem nächsten Atemzug fiel ihr ein, was die Goscha gesagt hatte: Die ist zu klein. Die macht’s nicht lang. Ein Mädchen also. Zehn Monate im Bauch, dann einen Tag und eine Nacht lang Schmerzen, als wäre ein Dämon in sie gefahren und wolle sie von innen her zerreißen.
Und der Lohn?
Nichts als ein Mädchen, von denen es in Rozas Familie mehr gab, als irgendwer brauchen konnte. Urgroßmutter Golda hatte vier Töchter, Großmutter Blumke hatte auch vier gehabt, und Manicha, Malka gerufen, Rozas Mutter, hatte immerhin drei. Rozas Schwestern hatten jede schon eine und wieder was unterwegs. Beide hatten sich gut verheiratet, die Mirjam als erste, obwohl sie die jüngste war.
Roza war die älteste. Hatte sich einen Jungen gewünscht. Einmal in der Familie nicht die Dienstmagd, das dumme Ding fürs Grobe sein, sondern etwas Besonderes.
Goscha nahm den Krug, goss etwas von dem Wasser, das fürs Kind gedacht gewesen war, in die Schüssel und wusch sich die Hände. Roza reckte den Kopf und sah zu, wie das Wasser sich erst rosa und dann zögerlich rot färbte. Wie am Schabbat, wenn ihr Vater den Kiddusch sprach und Wein mit Wasser mischte. Roten Wein. Seit im Winter die Sache am Brunnen auf dem Marktplatz geschehen war, nahm er weißen, damit niemand behaupten konnte, die Juden hockten beieinander und soffen Blut.
Was sich ins Wasser der Waschschüssel mischte, war aber Blut. Die Arme der Goscha waren beschmiert bis zu den Ellenbogen. Roza blickte an sich hinunter. Das weiße Betttuch, das bis über ihr Becken hochgerutscht war, war in Blut getränkt.
War das ihres?
Das des Kindes?
Wie konnte ein Mensch so viel Blut verlieren und noch immer leben?
Die Goscha hob jetzt das Kind auf, nahm’s in beide Hände wie Mosche Bergner, der Schlachter, einen Batzen Fleisch. Roza sah es flüchtig, ehe die Goscha es ins Wasser gleiten ließ, einen rosigen, blutigen Blitz mit einem pechschwarzen Haarschopf. Dann verließ sie die Kraft, und sie sank in die Kissen zurück. Vor dem Fenster begannen Vögel zu lärmen, und Roza glaubte zu spüren, wie sich so früh schon die Hitze zusammenballte. In den letzten Tagen war es für Juni ungewöhnlich heiß gewesen, was ihr die ohnehin beschwerliche Schwangerschaft zur Qual gemacht hatte. Das Licht, das sich durch den Spalt zwischen den Vorhängen zwängte, brannte ihr in den Augen.
Bei alledem dauerte es, bis sie das Kind hörte. Erst glaubte sie, es sei nur ein Vogel, der ein wenig leiser als die anderen Schreihälse zirpte. Aber es war das Kind. Kein Jammern, kein Wimmern, schon gar kein Schreien, sondern wirklich, als zirpe oder singe ein sehr kleines Tier.
Seltsam. Anders. Fremd.
Die Goscha trocknete es ab, griff nach den Kleidungsstücken, aus denen Mirjams Kind herausgewachsen war und die Roza für ihres bereitgelegt hatte. Alles weiß und blank gemangelt. Wenn Blut dran käme, wären die Sachen verdorben, und Mirjam würde sich ereifern, wie sie es immer gern tat. Aber daran war jetzt nichts zu ändern. Das Kind konnte schließlich nicht nackt bleiben.
»Und wie soll’s heißen?«, fragte die Goscha.
Roza überlegte. Ihr fiel nichts ein. Keren klang schön, aber niemand in der Stadt hieß Keren, und es sollte kein auffälliger Name sein. Als Jude war’s besser, nicht aufzufallen, erst recht nach dem, was am Brunnen passiert war. Keinen Namen zu haben, den jeder sich merkte. Golda nach der Urgroßmutter, die am Morgen die Stufen noch alleine hinunter-, aber am Abend nicht mehr hinaufkam. Oder Malka nach der Mutter, der Roza nichts recht machen konnte, der aber das vielleicht gefallen würde.
»Golda Malka.«
»Golda Malka Aufen«, konstatierte die Goscha. »Anmelden gehen musst du’s selber. Das nehm ich dir nicht ab.«
»Golda Malka Engel«, sagte Roza. »Der Fischel meldet’s an, wenn er wiederkommt.«
Die Goscha hatte das Kind fertig angezogen und betrachtete es. »Mit der ist was nicht richtig«, sagte sie. »Wenn die nicht stirbt, wird sie dir Kummer machen.«
»So was sagt man keiner Mutter.«
Eine lähmende Schwäche übermannte Roza. Sie hätte sich vor dem Licht und vor allem, was mit diesem Tag auf sie zukam, unter der Decke verkriechen wollen. Mit dem Fischel auszugehen, der Enge daheim und dem Spott der Schwestern zu entkommen, war das eine, und schwanger zu werden war das, was dabei eben passierte. Aber jetzt das Kind nehmen müssen und von heute an auf Gedeih und Verderb daran gefesselt sein, kam ihr vor wie etwas Riesengroßes, das sich über sie hinwegzuwälzen drohte. Ihr Vater gehörte nicht zu den Armen. Der Fischel gehörte auch nicht zu den Armen, und überhaupt hätte sich von den Armen ja keiner eine solche Wohnung leisten können. Aber mit dem Platz in der Gesellschaft war es wie mit den Stufen und Urgroßmutter Golda: Runter kam man alleine. Rauf aber nicht.
In Galizien – Urgroßmutter Golda wurde nicht müde, sie alle daran zu erinnern – starben winters Tausende am Hunger.
»Und ehe die andern dran sind mit dem Sterben, sind’s die Juden. Vergesst das nicht.«
Vielleicht war Roza ja mit dem Fischel gegangen, der einen russischen Pass hatte, weil er zu ihr gesagt hatte: »Mit mir brauchst du in Galizien nicht zu bleiben. Wir gehen aus diesem Rattenloch weg.«
Roza hatte darauf gehofft, hatte sich manchmal schon das Leben ausgemalt, das sie in einer der fremden Städten führen würde.
Aber jetzt?
Mit dem Kind, von dem die Goscha unkte, dass es Kummer brachte?
Ohne Vorwarnung beugte die Hebamme sich vor und legte Roza das Kind auf die Brust. Die schaffte es gerade noch, die Arme darum zu schließen, ehe es ihr auf den Bauch geglitten wäre, der höllisch schmerzte.
»Kannst mir schon glauben«, murmelte die Goscha. »Hab mehr auf die Welt geholt, als ich im Leben zählen könnte, und die, die ihren Eltern keine Freude bringen, erkenn ich am Gesicht.«
Sie wandte sich ab.
Roza sah auf das Kind hinunter.
Auf einen einzigen, ersten Blick wusste sie, was Goscha meinte, und wusste es doch nicht. Das Kind war winzig. Regelrecht verkümmert. Mirjams Runia kam ihr mindestens doppelt so kräftig vor, aber das Gesicht ihres Kindes, von dem sie die gerade erst ausgesuchten Namen schon vergessen hatte, wirkte im Gegensatz zu dem von der Runia reif, geradezu erwachsen, von einer Klugheit, die Angst machte. Es wimmerte noch immer nicht, sondern summte oder murmelte still vor sich hin und blickte aus runden Augen zu Roza auf.
Wie dunkel sie waren.
Hatte nicht ihre Mutter bei Runias Geburt erklärt, alle Kinder würden mit blauen Augen geboren, weil noch ein Stück Himmel darin gefangen war, das langsam verblich?
Was in den Augen ihres Kindes gefangen war, wollte Roza lieber nicht wissen. Zwei Stück glühende Kohlen. Ein Echo von Fremde.
Die Goscha hat recht, dachte Roza. Die wird uns keine Freude, sondern Kummer bringen, und wie man so ein Wesen erzieht, damit es einem nicht vom Weg abkommt, hat mir kein Mensch beigebracht.
Sie wusste, dass sie sich versündigte, weil sie kein Glück empfand. Jedes Kind war ein Segen, ein Zuwachs der Familie Israels. Roza aber wünschte sich auf einmal mit wilder Kraft, es hätte in ihrer eigenen Familie keinen Zuwachs gegeben und es wäre nicht ausgerechnet sie, die dafür die Verantwortung trug.
»Ausgesetzt
In einer Barke von Nacht
Trieb ich
Und trieb an ein Ufer.
An Wolken lehnte ich gegen den Regen.
An Sandhügel gegen den wütenden Wind.
Auf nichts war Verlaß.
Nur auf Wunder.
Ich aß die grünenden Früchte der Sehnsucht,
Trank von dem Wasser das dürsten macht.
Ein Fremdling, stumm vor unerschlossenen Zonen,
Fror ich mich durch die finsteren Jahre.
Zur Heimat erkor ich mir die Liebe.«
Mascha Kaléko: »Die frühen Jahre«
© Kaléko, »In meinen Träumen läutet es Sturm«, 1977 dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München.
2
In manchen Nächten träumte Mascha, sie hätte ihren Namen verloren. Sie war schon elf Jahre alt und träumte es immer noch.
Im Traum war es auch Nacht, alles stockfinster wie beim Lichtstreik. Die Mutter stieß die Tür auf, lud Mascha und Lea je einen Stapel mit Wäsche und Hausrat auf die Arme und schob sie ins Treppenhaus. »Schnell, schnell«, flüsterte sie. »Und kein Wort.«
Mascha ging vorsichtig, auf Zehenspitzen, um niemanden zu wecken, und hielt die Arme steif ausgestreckt, um nichts zu verlieren. Ihr Name in leuchtenden Buchstaben lag ganz oben auf den Suppentellern mit dem blauen Rand. Bei jedem behutsamen Schritt sah sie, wie die Lettern durchs Dunkel tanzten.
Dann rempelte Lea sie an.
»Ach. Verzeihung. Das war aus Versehen«, piepste sie mit ihrem winzigen Mir-kann-kein-Mensch-böse-sein-Stimmchen, aber doch so schrill, dass die Nachbarn, die hinter den Türen lauerten, gar nicht anders konnten, als Bescheid zu wissen.
Warum lauerten die da?
Warum war es wichtig, dass niemand hörte, wie die Familie Engel sich vor Tagesanbruch aus ihrer Wohnung schlich?
Die Erwachsenen verstummten, wenn ein Kind solche Fragen stellte, Fragnichtsoviel gehörte zu den Lieblingsworten der Mutter, aber Mascha wusste trotzdem genug: Sie waren die, die niemand wollte. Weder hier noch anderswo. Die, auf die niemand gewartet hatte, auf die Jagd gemacht wurde, wenn im Brunnen auf dem Marktplatz ein Kind ertrank, die bei Nacht und Nebel wegmussten, ins nächste Nirgendwo, zu anderen Nachbarn und zur Wobinichdennangst.
»Mit kommt nur, was wir tragen können, und was runterfällt, bleibt liegen«, hatte die Mutter sie angewiesen. Also behandelte Mascha alles, was sie trug, wie einen kostbaren Schatz, von dem nichts verloren gehen durfte, denn es war ja alles, was von ihrem Leben bei ihr blieb. Dann aber rempelte Lea sie an, und ihr Name fiel herunter. Lea hatte das mit Absicht gemacht. Sie machte alles mit Absicht, aber außer Mascha traute kein Mensch dem Leale mit den Engelsaugen ein getrübtes Wässerchen zu.
»Mein Name«, rief Mascha so laut, dass noch im Nachbarhaus jemand davon aufwachen würde. Sie ließ die Geschirrtücher und die Suppenteller fallen, sodass Letztere klirrend zerschellten, stürzte auf die Knie und versuchte verzweifelt, die Buchstaben ihres Namens in ihren Schoß zu sammeln, in den Rock des weißen Rüschenkleides, das die Mutter ihr anzog, weil sie darin wie ein braves Kind von treu sorgenden Eltern aussah. Aber die Buchstaben, so viele sie auch sammelte – ein A, ein M, ein G und dann ein F –, ergaben keinen Namen, den sie als den ihren erkannte, nur ein paar fremde, mit denen sie nicht gemeint sein konnte.
Wenn sie aus diesen Träumen aufschreckte, lag sie noch minutenlang still auf dem Rücken und hörte angsterfüllt zu, wie ihr Herz raste. Sie war sonst kein Kind, das leicht Angst bekam, weswegen die Mutter sich reihum bei allen möglichen Leuten beklagte: »Angst kennt sie ja nicht, macht mir mehr Sorgen als ein Junge, springt in reißende Bäche, um halb ertrunkene Katzen zu retten.«
Vor dem Herzschlag aber, der nach dem Traum so wild hämmerte, als wollte er ihr das Herz in Trümmer hämmern, hatte sie schreckliche Angst und war erst erleichtert, wenn er sich endlich beruhigte und vor dem Fenster die Sonne aufging. Überhaupt mochte sie den Tag lieber als die Nacht, aber die Sache mit dem verlorenen Namen setzte ihr manchmal auch am helllichten Tage zu.
Nach jeder Flucht, die die Mutter Umzug nannte, zeigte das Problem sich aufs Neue.
Als Erstes waren sie aus Chrzanów in Richtung Westen, in die Stadt Frankfurt am Main geflohen. Das war in dem Sommer gewesen, in dem der Krieg begonnen hatte. »Wartet’s nur ab«, hatte Ururgroßmutter Golda gesagt, die morgens früh einen Schemel die Stufen hinunter auf die Straße schleppte und sich abends samt dem Schemel all die Stufen wieder hinauftragen ließ. »Wenn jetzt Krieg kommt, sind’s einmal mehr die Juden, die als Sündenbock herhalten müssen.«
»Deine Sorgen möcht ich haben«, hatte die Mutter gezetert, obwohl Mascha ihr das nicht glaubte, weil die Mutter sich ständig beklagte, sie hätte der Sorgen viel zu viele. »Ihr alle hier seid fein raus, aber der Fischel ist russischer Staatsbürger. Wenn sie den einziehen, und er muss gegen unsere Leute kämpfen – was machen dann ich und die Kinder?«
Fischel hieß der Vater. »Meine Lea ist ja ein Engele, das alles tut, um ihrer Mamme Freude zu machen«, pflegte die Mutter zu erklären. »Aber die Große, die ist ein Vaterkind. Wenn die sich von überhaupt jemandem was sagen lässt, dann vom Fischel, im Leben nicht von mir.«
Ob das stimmte, war schwierig zu entscheiden, fand Mascha, denn der Fischel – ihr Vater – war ja ständig unterwegs. Vielleicht war also ein Vaterkind eines, das gar keinen Elternteil hatte oder nur einen ganz ferne? In der Stadt Frankfurt, in der sie ankamen, als der Krieg schon begonnen hatte, blieb der Vater auch nicht bei ihnen, sondern wurde gleich nach ihrer Ankunft ›interniert‹. Was das bedeutete, wollte ihr die Mutter nicht erklären.
»Er ist eben dem Pass nach Russe, das war bisher immerhin besser als Galizier, und dass es plötzlich ein Verbrechen ist, konnte schließlich kein Mensch ahnen.«
›Das Kroppzeug aus Galizien‹ oder ›das Russenpack‹,so nannten sie die Nachbarn in dem Haus nicht weit vom Fluss, wo sie eine Wohnung bezogen. Sie, das waren die Mutter, Lea, Mascha und ein stämmiges, semmelblondes Mädchen namens Ilse, das auf die Kinder achten sollte und in einer Sprache redete, die Mascha hinreißend fand.
Anfangs verstand sie kein Wort. Wenn Ilse den Mund aufmachte und loslegte, klang es, als würden die Absätze ihrer Schuhe mit der Wucht ihres beachtlichen Gewichts auf die Treppenstufen knallen: Habick, wolltick, mussick, dachtick.
Mit der Zeit aber wurden aus all dem Absatzknallen Worte, und Mascha fand einen Heidenspaß daran, sie nachzusprechen: »Hab icke mir doch gleich jedacht, datt ihr zwee Würmer keen richt’jet Deutsch verstehen tut. Da werd ick wohl ’n Wörterbuch brauchen, dacht ick so bei mir, bloß: Wat nimmt man denn da uff die Eile?«
In der Volksschule, in die Mascha mit sieben Jahren eingeschult wurde, kam ihr einmal mehr ihr Name abhanden, weil in der Liste, die Herr Lehmann, der Lehrer, am Pult stehend vorlas, keine Golda Engel vermerkt war, sondern nur eine Malka Aufen. Vor der Tafel mit der Aufschrift Mein erster Schultag konnte sie nicht wie die anderen Kinder fotografiert werden, weil niemand wusste, welcher Name dazuzuschreiben war. »Macht nichts, so ein Bild können wir uns sowieso nicht leisten«, murmelte die Mutter und zog sie weg. Mascha war enttäuscht. Sie hatte gehofft, sie bekäme für das Foto auch so eine große, bunte Zuckertüte in die Arme gedrückt, wie die anderen Mädchen sie hatten, und damit war es nun Essig. Doch die Enttäuschung legte sich gleich wieder. Alles, was die Schule betraf, war so neu und aufregend. Und als der Lehrer sie fragte: »Kleine Ostjüdin aus Galizien, richtig? Welcher Sprache, wenn überhaupt einer, bist du denn mächtig?«, da konnte sie ihm gradeheraus Antwort geben:
»Jiddisch, Deutsch und Berlinerisch.«
Und um’s zu beweisen, sagte sie gleich auf, was Ilse ihr beigebracht hatte:
›Icke, dette, kieke mal
Oojen, Fleesch und Beene.
Wenn de rennst, verlierste se.
Wieder krichste keene.‹
Lea konnte es sich nicht merken, aber Mascha war ganz begeistert davon, dass sich mit der Absatzklapper-Sprache Reime erzeugen ließen.
»Ganz schön kess«, sagte Lehrer Lehmann. »Aus Galizien kommen, aber eine kesse Lippe schieben – so was haben wir gerne.«
In Maschas Kopf ratterte es:
›Ick weeß nich, wie ick hess,
Doch ick bin janz schön kess.‹
Natürlich wusste sie, dass man aus ›heiß‹ nicht einfach ›hess‹ machen durfte, nur damit es sich reimte – nicht einmal auf Berlinerisch. Aber das mit dem Reimen musste eben geübt werden, und auf jeden Fall machte es Spaß. Es war eine Beschäftigung, mit der man sich ablenken konnte, statt sich Strafpredigten, Beschimpfungen oder Leas gepiepste Petzereien anzuhören, und es half auch ein bisschen, wenn man aus Angst vor den Träumen nicht einschlafen konnte:
›Ick liege hier im Dunkeln wach,
Und draußen scheint der Mond aufs Dach.‹
In der Schulpause sagte sie einmal eins von den Gedichten den Klassenkameradinnen auf, und alle lachten. Wollten mehr hören. »Mein Vater sagt, die Ostjuden aus Galizien können nicht mal lesen und schreiben«, erzählte ein spitznasiges Mädchen, das Pauline hieß.
»Meiner sagt, sprechen können die auch nicht«, behauptete eines namens Käthe.
Über ›die Ostjuden aus Galizien‹ trugen sie noch ein ganzes Kaleidoskop weiterer Fantastereien zusammen, aber das Gedicht hören, das von Lehrer Lehmann handelte, wollten sie alle. Fortan begegneten sie Mascha, ihrer Herkunft zum Trotz, mit einem gewissen Respekt wie etwa einem großen Tier, von dem man sich den Namen nicht merken konnte. In die Schule ging sie jetzt gerne. Zwar wetterte Lehrer Lehmann mindestens einmal in der Woche, er wolle ihren Vater einbestellen, wenn der endlich abkömmlich sei, doch es war ja Krieg, da waren Väter nicht abkömmlich, und dass der von Mascha sich nie blicken ließ, fiel nicht weiter auf.
Wenn der Vater wiederkam, wollte Mascha ihm erzählen, dass sie in der Schule immer als Erste den Finger in die Höhe streckte und dass sie die meisten Antworten schon wusste, ehe der Lehrer die Frage an die Tafel schrieb. Sie wollte ihm einige von ihren Gedichten aufsagen, vielleicht nicht die über den Lehrer, sondern andere, die nicht so kess waren. Schließlich war sie das Vaterkind. Schließlich war es möglich, dass der Vater sie verstand.
In Frankfurt, zu viert in zwei Zimmern in dem Haus nahe dem Fluss, blieben sie bis zu den Osterferien am Ende der dritten Klasse. Dann hieß es wieder: Schnell, schnell, und kein Wort. Mit kommt nur, was wir tragen können, und was runterfällt, bleibt liegen. Krieg war immer noch. Zu essen gab’s nur noch, was auf Papiermarken aufgedruckt stand, und die Ilse kam nicht mit. Die Stadt, in der sie aus der Bahn stiegen und wo sie zwei Zimmer in der Nähe vom Fluss bezogen, hieß Marburg, aber in der Nacht hatte Mascha das vergessen. Die Wobinichdennangst fiel über sie her, und ihren Namen verlor sie auch.
In den Schaufenstern der Geschäfte reihten sich Kisten mit gelben Rüben. Auch in der Milchhandlung. Und beim Schlachter. Nur Rüben, sonst nichts. Mit ihren Marken für die Woche ging die Mutter in den Kolonialwarenladen an der Ecke und kam im Handumdrehen wieder heraus, das Gesicht hochrot, das Einkaufsnetz noch immer leer. Nicht einmal Rüben waren darin.
»Auf diesem Kontinent darfst du kommen, woher du willst, sogar aus der Hölle, solange es nur nicht Galizien ist«, schimpfte sie, und Mascha erriet, dass sie aus dem Laden gejagt worden war. »Jude aus Galizien darfst du schon gar nicht sein. Als wär der galizische Jude nur erschaffen, um den Dreck unter anderer Leut’s Füßen abzugeben.«
Daheim befahl sie Lea und Mascha, ihre blütenweißen Kleider anzuziehen, und band ihnen blütenweiße Schleifen ins Haar.
In der Schule wurde Mascha zum Direktor zitiert, weil sie ihren Namen falsch angegeben hatte: »Engel würdest du wohl gern heißen, aber dazu muss man erst mal einer sein, hahaha.«
Der Direktor hieß May. November hätte besser gepasst.
Dennoch ging Mascha auch in diese Schule gern, saugte auf, was es zu lernen gab, wie ein Schwamm, den man ins Wasser tauchte. Statt Ilse kam Emma, um mit dem Haushalt und den Kindern zu helfen, die konnte auf Berlinerisch sogar singen:
›Juter Mond, du jehst so sti-hille
Durch die Abendwo-hol-ken dahin.‹
Und dann war eines Tages der Vater wieder da. Saß in der Wohnküche, wo der Herd vor Wärme bollerte, am Tisch und aß zu süßen Möhren einen Hering, wie Mascha seit einer Ewigkeit keinen mehr gesehen hatte. Sie war sich nicht einmal sicher, ob sie ihn erkannte. Den Vater, nicht den Hering. Aber ein Mann, der dünn und im grauen Anzug am Küchentisch saß und von Emma auch noch Zichorienkaffee hingestellt bekam, musste ja wohl der Vater sein.
»Still, still«, tuschelte die Mutter und versuchte, die Kinder aus der Küche zu schieben. »Der Tate muss sich ausruhen.«
Lea trollte sich artig, aber Mascha ließ sich nicht schieben. Schnurstracks spazierte sie an der Mutter vorbei und setzte sich zum Vater an den Tisch.
»Ich hab mir ein Gedicht ausgedacht, Tate«, sagte sie. »Ein Gedicht für dich. Ich kann’s auf drei Sprachen hersagen, auf Deutsch, auf Jiddisch und auf Berlinerisch.«
Der Vater blieb stumm, sagte nicht, was ihm am liebsten war. Also wählte Mascha selbst eine Sprache aus und fing an:
»Ick hab an Tate heut jedacht
Und een Jedicht für ihn jemacht …«
»So spricht man nicht«, unterbrach sie der Vater. »Wer bringt dir das bei? Das Kindermädchen?«
Emma, die am Herd stand und im Suppentopf rührte, drehte sich um: »Von mir hattse det nich.«
»Es ist ein Gedicht«, verteidigte sich Mascha. »Es geht noch weiter, hat zehn Zeilen, und immer zwei davon reimen sich. Pass auf …«
»Das ist Zeitverschwendung«, sagte der Vater. »Wir haben Krieg, da solltest du deiner Mutter helfen, nicht mit Firlefanz den Tag vertrödeln.«
»Die Malka macht mir viel Kummer«, sagte die Mutter, die wieder in die Küche getreten war. »In die Schule bin ich einmal mehr einbestellt worden, aber ich hab nicht hingehen können. Einer muss schließlich Geld ranschaffen.«
»Malka?«, fragte der Vater. »Ruft ihr sie nicht Golda?«
Die Mutter zuckte mit den Schultern. »Wie man sie auch ruft, sie folgt ja doch nicht.«
An diesem Abend packte Mascha eine Kindertasche, die sie noch aus den Tagen in Chrzanów besaß. Die Großmutter Malka, von der sie einen ihrer Namen hatte, hatte ihr die aus einer alten Kittelschürze genäht und mit rosaroten Blumen bestickt. Als Mascha etwa fünf Jahre alt gewesen war, hatte sie in diese Tasche ihren Schal, etwas Brot und den Topf mit Sirup gepackt und war losgezogen, um fortan im Wald, nah beim Fluss zu leben. An den genauen Anlass erinnerte sie sich nicht mehr, wusste nur noch, dass die Mutter gestöhnt und gesagt hatte, sie wünschte, sie hätte nicht zwei, sondern nur ein Kind bekommen, »und zwar das zweite, das der reinste Engel ist, nicht das erste, das sich beim besten Willen nicht erziehen lässt«.
Sie wusste auch noch, dass es schön im Wald gewesen war, recht kalt, aber als der schwarzblaue Himmel sich mit Sternen überzog, fand sie es nicht halb so dunkel wie des Nachts im Zimmer. Ein herunterhängender Ast an einem toten Baum ließ sich als Schaukel benutzen, auf dem saß sie und wippte und sang sich etwas vor. Der Fluss rauschte zum Rascheln der Blätter. Kurz darauf waren Leute mit Fackeln und Laternen gekommen, so gut wie sämtliche Nachbarn und zwei Männer von der Polizeiwache, um sie zurück nach Hause zu schleifen. Mascha wehrte sich, und dabei zerschellte der Siruptopf. In ihrer Tasche lief der Sirup aus, sodass die Mutter sie zusammen mit den Scherben auf den Müll werfen wollte.
Diese Drohung war schlimmer als die Strafe, die Mascha bekam. Die Großmutter aber nahm die Tasche an sich, wusch sie gründlich aus und hängte sie zum Trocknen ans Ofenrohr. Die aufgestickten Blumen hatten hinterher die Farbe gewechselt wie vom Sommer zum Herbst, doch ansonsten war die Tasche noch vollkommen in Ordnung. Seither hatte Mascha sie sich unter ihrem Mantel um den Hals gehängt, wenn sie nachts ›umzogen‹ und nur mitnehmen durften, was nicht herunterfiel.
Wider Erwarten hatte sie sie danach gar nicht mehr gebraucht. Eine grau-rosa Blumentasche war schließlich doch ein wenig kindisch für ein Mädchen, das in der Schule die Hauptstädte der Welt und das große Einmaleins lernte und nun schon zehn Jahre alt war. Jetzt aber brauchte sie sie. Es fühlte sich tröstlich an, sie in den Händen zu halten, dabei an die Großmutter zu denken und zu überlegen, womit sie sie packen wollte. Alles Brot im Kasten hatte der Vater aufgegessen, und Sirup war ihr ein für alle Mal verleidet, aber ihr Schal konnte von Nutzen sein. Sie würde wieder weggehen. Wohin, wusste sie nicht. An den Fluss vielleicht. Die Flüsse hatte sie in allen Städten gemocht, in denen sie gewohnt hatte und doch nicht zu Hause gewesen war.
Sie klappte die Lasche auf, mit der die Tasche sich verschließen ließ, und war so verblüfft, dass sie einen Moment lang zu atmen vergaß.
Mascha stand dort, in demselben rosaroten, jetzt vom Sirup braun gefärbten Garn wie die Blumen. Dass die Großmutter im Inneren der Tasche auch etwas eingestickt hatte, hatte sie vergessen, aber dort stand es und war nicht zu übersehen: Mascha. In all den Nächten, in denen sie gefürchtet hatte, sie hätte ihren Namen verloren, war er doch immer da gewesen, kaum eine Armeslänge von ihr entfernt.
Mascha.
Sie erinnerte sich. Die Großmutter hatte beschlossen, sie Mascha zu nennen, »weil es doch Unsinn ist, nach zwei Malkas zu rufen, wenn man nur von einer was will«.
Mascha.
Das bin jetzt ich, beschloss sie. Vorher war ich’s auch schon, aber jetzt erst weiß ich wieder, dass ich’s bin.
An diesem Abend vergaß sie, dass sie hatte fortgehen und am Fluss leben wollen. Sie war viel zu froh darüber, von jetzt an wieder Mascha zu sein. Dass die Mutter und der Vater die Neubenennung ignorierten und Lea sie weiter mit ihrem schrillen Engelsstimmchen einmal Goldaaa und dann wieder Malkaaa rief, machte ihr nichts aus. Sie selbst kannte ihren Namen und würde ihn nicht noch einmal verlieren.
Zwei Jahre später war Schluss mit dem Krieg. Sein Ende wirbelte Menschen und Besitztümer, Staaten und Grenzen in Europa durcheinander, als hätte jemand sie in Mutters Suppentopf geworfen und mit einem großen Löffel durchgerührt. »Jetzt, wo alles umgestürzt wird und die Leute nichts zu essen haben, geben sie wieder den Juden die Schuld«, sagte die Mutter und beschwor den Vater, aus Marburg wegzugehen.
Dem Vater war es recht. Er wollte nach Berlin, dort waren die Aussichten besser, und er plante, sich mit einem Geschäft zur Vergrößerung von Fotografien selbstständig zu machen. »Wo so viele nun aus dem Krieg nicht wieder heimkommen, werden ja Bilder gehütet wie der Heilige Gral.«
Mascha machte der Umzug dieses Mal nichts aus. Stattdessen freute sie sich schon darauf, in die neue Schule zu gehen und sich dort mit ihrem Namen vorzustellen. »Ich bin Mascha«, würde sie sagen.
Ob Engel oder Aufen war ihr egal.
3
Scheunenviertel hieß der Bezirk, in dem Maschas Vater für seine Familie eine Wohnung mietete.
In einer Straße namens Grenadierstraße, im Hochparterre. Wohnküche, Stube und drei Kammern. So viel Platz hatten die Engels nie zuvor gehabt.
»Etwas fürs Erste«, sagte der Vater, der das Geschäft darunter, im Souterrain, dazugemietet hatte, um dort seine Fotografien zu vergrößern.
Mascha fragte sich, was dann fürs Zweite käme. Sie hätte die Wohnung mit dem Korridor, von dem fünf Türen abgingen, gern gemocht, hätte sie sich nicht mit Lea ein Zimmer teilen müssen und ein einziges Pult unter dem Fenster zum Hof, an dem sie beide ihre Hausaufgaben machten. Mascha machte gern Hausaufgaben. Lea dagegen hasste sie, aber sie war ein braves Mädchen, und brave Mädchen bereiteten ihren Eltern nicht einmal in der Schule Kummer.
Lea also schwitzte stundenlang Blut und Wasser über ihren Heften, rollte sich die Enden ihrer Rattenschwänze um den Finger und zerkaute das Ende ihres gut gespitzten Bleistifts, während Mascha sich wünschte, allein hier zu sitzen, aus dem Fenster zu schauen und sich den Aufsatz, den sie für die Deutschstunde zu schreiben hatte, zusammenzuträumen.
»Die Malka ist faul und frech«, beklagte sich Lea, die wie Mascha in der Jüdischen Mädchenschule Berlin im Stadtteil Mitte eingeschult worden war, bitterlich bei der Mutter. »Aber die besseren Noten bekommt sie trotzdem, denn Frau Petersen mag sie lieber als mich.«
»Ach, Leale.« Die Mutter schloss ihre Kleine in die Arme. »Jetzt wein doch nicht. Wer fragt denn ein Mädchen, das so lieb und fleißig ist wie du, nach Schulnoten? Und wer dich nicht am liebsten hat, mein Feygele, der ist ein Dummkopf, der uns nicht zu kümmern braucht.«
Dabeizustehen, vier Schritte entfernt, am Ende des Korridors, und der Liebkosung zuzusehen, tat auf eine seltsam dumpfe Art weh. Als steche man sich eine Nadel in einen Körperteil, der eigentlich schon abgestorben war, der nicht mehr zu einem gehörte – und stellte dann schmerzlich fest, dass da doch noch etwas war. Hätte es Lea nicht gegeben, hätte Mascha angenommen, ihre Mutter sei eben anders als die Mütter ihrer Kameradinnen und hätte für Zärtlichkeit schlicht nichts übrig.
Wäre das leichter gewesen?
Mascha nahm es an. Es konnte sich gewiss nichts schwerer anfühlen, als ein Fremdling unter Vertrauten zu sein. Nicht dazuzugehören. Sich nach etwas zu sehnen, von dem man nicht einmal wusste, was es sein sollte und ob es das irgendwo gab.
War es ein Ort?
War es ein Mensch?
Mascha wusste es nicht, und dass sie nicht benennen konnte, was ihr fehlte und was sie sich wünschte, machte ihr die Kehle so eng, dass unmöglich genug Luft durchgehen konnte.
Draußen vor der Tür war es besser. Das Scheunenviertel hieß Scheunenviertel, weil hier früher einmal Scheunen gestanden hatten. Wegen der Feuergefahr waren sie vor der Stadtmauer errichtet worden, jedoch noch nahe genug für den Viehmarkt auf dem Alexanderplatz. Inzwischen gab es auf dem Alexanderplatz zwar kaum etwas, das es nicht gab, aber keinen Viehmarkt mehr, und im Scheunenviertel standen statt der Scheunen Wohnhäuser, die bis zur letzten Kellerkammer mit Menschen vollgestopft waren. Einst hatte ein preußischer König allen Juden, die kein Haus hatten, befohlen, sich hier anzusiedeln. Heute brauchten die Juden dazu nicht länger einen Befehl, und von Juden, die kein Haus besaßen, schien es auf der Welt zu wimmeln.
Von der Wohnungstür der Engels führte eine Reihe von Stufen über den Eingang vom Geschäft des Vaters hinweg auf die Straße. Auf die unterste Stufe setzte sich Mascha zwischen Schulschluss und Abendessen und sah das Leben des Viertels an sich vorbeitreiben. Hier war jeder fremd. Jeder anders. Hier war das Sammelbecken derer, die nie irgendwo ankamen, ein buntes Gewühl aus Nie-Gesehenem, das zum Bestaunen einlud und in dem sie sich verlieren konnte, ohne aufzufallen. Hier war es leicht, nicht dazuzugehören, denn niemand gehörte dazu – und damit gleichzeitig jeder:
Die beiden Talmud-Studenten mit langen Bärten und Schläfenlocken, die allmorgendlich mit feierlichem Ernst ihre Bücherstapel durch das Gewimmel trugen. Der bucklige Altwarenhändler in seinem Kaftan, der hinter ihm über den Boden schleifte. Die kleine Frau mit dem Kopftuch, die in zwei Körben lebende Hühner schleppte und in einer zornigen slawischen Wortflut auf einen Rattenschwanz von Kindern einschimpfte. Die Zeitungsjungen und Marktschreier, die um die Wette ihre Waren anpriesen, der Polizist, dem unter dem zu großen Helm die Angst im Kindergesicht stand, die Arbeiterkämpfer mit ihren Spruchbändern, die zum Umsturz aufriefen, die Journalisten, die ins Zeitungsviertel weiterhasteten, die Kartenspieler, die beschickert aus dem Krakauer Café taumelten, die Bettler mit ihren Hüten, die Leierkastenmänner, die Kriegskrüppel ohne Beine, die Neugierigen und die Verirrten. Aus allen Teilen Europas schienen sie angeschwemmt worden zu sein, um sich hier im Scheunenviertel zu einer gewaltigen Woge aus Treibgut zu sammeln.
Mascha sah zu, wie die Woge sich überschlagend zu Gischt zerbarst, und hatte zu viel im Kopf, um es sich zu merken. In einer dieser ersten Winterwochen in Berlin begann sie, ihre Gedichte oder das, was vielleicht einmal zu Gedichten werden sollte, aufzuschreiben.
Als schon die funzeligen Straßenlaternen brannten und der Vater aus dem Geschäft kam, saß Mascha immer noch da. Aus den Ärmeln des Wintermantels ragten ihre dünnen Handgelenke, und den linken Handschuh hatte sie verloren, aber hier, wo so heftig der Puls der Stadt schlug, fror sie höchstens ein wenig. Die vielen Menschen verströmten Wärme, sie streiften einander im Gehen, und doch war jeder von ihnen allein.
»Was machst du denn hier?«, fragte der Vater. »Hast du nicht deiner Mutter zu helfen?«
»Die Mutter hat ja Lea«, antwortete Mascha. »Und hier ist es schön.«
Der Vater blickte erst nach links, dann nach rechts die Straße hinunter. Ein uraltes Pferd zog einen zu schweren, turmhoch mit Trödel beladenen Karren, eine Frau mit traditioneller Perücke, dem Scheitel, schob ihren Kinderwagen daran vorbei, und drei Jungen mit Kippa folgten ihr wie eine Schar Entenküken.
»Schön?«, fragte der Vater. »Hier? Bei den Ostjuden? Ich glaube, ich höre nicht richtig. Im Scheunenviertel wohnt nur, wer eigentlich anderswo hinwill und hängen bleibt.«
»Sind wir denn nicht auch Ostjuden?«, rutschte es Mascha heraus. In der Schule hatte eine Kameradin sie so genannt und mit dem Finger auf sie gezeigt: »Seht mal, die Ostjüdin. Neben die setz ich mich nicht. Von dem Gestank wird mir schlecht.« Die Kameradin hieß Luise Schrader, trug ein Schürzenkleid und Haarschnecken aus blonden Flechten.
»Wir waschen uns.« Der Vater sah Mascha nicht an, und seine Stimme klang, als hätte er lieber ausgespuckt. »Wir legen Wert auf Bildung, sind keine Schieber und schlafen nicht beim Vieh. Wir gehen von hier weg. In der Synagoge bin ich zum Maschgiach ernannt, das bringt zusätzliches Geld ein.«
Die Synagoge stand in der Heidereutergasse, nur einen kurzen Fußweg von ihrer Wohnung, und war die größte Synagoge, die Mascha je gesehen hatte. Wenn der Vater dort Maschgiach war, musste er wohl ein bedeutender Mann sein, und bis zum nächsten Umzug würde es nicht mehr lange dauern.
Mascha sollte es recht sein, solange sie nicht allzu weit fort zogen und sie auf ihrer Schule bleiben durfte. Die Schule lag nur ein kurzes Stück vom Fluss entfernt, von der Spree, und ihre Lehrerin im Deutschen hieß Fräulein Petersen. Die las der Klasse Gedichte von Heinrich Heine vor und ließ sie als Hausaufgabe Aufsätze mit Überschriften wie ›Was ich mit meinem Leben anfangen will‹ schreiben.
Und Mascha schrieb. Wann immer sie den wackligen Tisch unter dem Fenster für sich haben konnte, kratzte ihre schon schief geschriebene Feder über das Papier. Blatt um Blatt füllte sich mit schräg gestellten, wie davongaloppierenden Buchstaben. Drängte sich Lea auf den Stuhl neben sie, rief die Mutter zum Essen oder bestand Minna, das neue Mädchen, darauf, dass das Licht gelöscht wurde, schichtete sie rasch alles ordentlich auf und legte Fibel und Rechenbuch zuoberst, damit niemand auf den Gedanken kam, einen Blick auf die beschriebenen Seiten zu werfen.
Ohnehin interessierten sich ja die Eltern nicht für das, was sie da zusammenkritzelte, und Lea, die neun Jahre alt und bei allem Eifer in der Schule keine Leuchte war, würde sich bestimmt nicht die Mühe machen. Dennoch ging Mascha lieber auf Nummer sicher. Noch vor einer kleinen Weile, in der Küche in Marburg, hätte sie dem Vater vielleicht gern von dem erzählt, was sie für Fräulein Petersens Hausaufgabe zu Papier zu bringen hoffte, aber das war vorbei, und sie war kein kleines Kind mehr, das nach einem Lob von den Eltern gierte.
Das, was sie geschrieben hatte, gehörte ihr allein, nicht den Eltern. Ihr allein und höchstens noch Fräulein Petersen, die vor der Klasse erklärt hatte: »Es ist eine neue Zeit, in der wir leben. Da kann es auch für ein Mädchen wichtig sein, sich über solche Fragen Gedanken zu machen.«
›Was ich mit meinem Leben anfangen will‹, hatte Mascha mit Schwung in die erste Zeile geschrieben.
Darunter stand nur ein wenig kleiner:
›Ich will eine Dichterin werden. Wie Heinrich Heine. Nur dass der kein Mädchen war.‹
Mascha wusste, dass man eine Dichterin nicht einfach werden konnte, sondern dass man klug sein musste, unablässig lernen, gute Noten erzielen und später eine Universität besuchen. All das wollte sie tun und beschrieb es in ihrem Aufsatz. Es gab nicht viele Mädchen, die es an die Universität schafften, aber sie wollte eines von ihnen werden. Bis es so weit war, wollte sie lesen, lesen, lesen und schreiben, schreiben, schreiben – aber das genügte nicht.
Um schreiben zu können, musste man auch etwas erlebt haben, gesehen, gerochen, gehört, auf der Haut, im Kopf und im Herzen gespürt. Wenn Mascha sich nach einem Tag, an dem ihr gar nichts geschehen war, an den Tisch setzte, um ein Gedicht zu schreiben, kam nicht die kleinste Zeile aus ihr heraus oder nur solche Zeilen, die sie in einem Buch gelesen hatte. Vielleicht stand deshalb in so vielen Büchern das Gleiche, weil der eine ein wenig umformuliert hinschrieb, was er beim anderen gelesen hatte. Wenn sie aber nichts schrieb, was frisch und neu und ganz und gar etwas Eigenes war, dann war das Schreiben Zeitverschwendung, wie der Vater gesagt hatte.
»Zeit ist Geld«, gehörte zu seinen Lieblingssprüchen.
Also musste Mascha des Öfteren ihre Arbeit am Tisch unterbrechen und hinausgehen, sich auf die Stufe setzen und dem Treiben auf der Straße zusehen, oder durch die Gassen spazieren, in die Läden spähen, in denen um Pfennige gefeilscht wurde, in die Wohnungen, in denen Menschen um den Tisch saßen und Suppe löffelten, in Streit gerieten und sich wieder vertrugen, sich anbrüllten und einander ins Ohr flüsterten. Manchmal genügte es auch, einem kleinen Hund zuzusehen, der an einem Zeitungskiosk sein Bein hob, oder einem braunroten Blatt, das wie vom Herbst vergessen in einer Schneewehe über das Pflaster trieb.
Manchmal reichte es aus, einer Erinnerung nachzuspüren oder sich die Zukunft vorzustellen, an eine Geschichte zu denken, die jemand ihr erzählt hatte, oder an eine Randnotiz in der Zeitung. Nie aber war es genug, einfach schreiben zu wollen und nichts zu haben, an dem die Worte sich verfingen.
All das schilderte sie in den Zeilen ihres Deutschaufsatzes, fühlte, wie mit gewaltigen Kräften Sehnsucht in ihr aufstieg, und gab sich Mühe, ganz ruhig dabei zu bleiben, der Sehnsucht zuzusehen und sie zu beschreiben. Das war das Wichtigste am Dichten: in Worte zu fassen, was man selbst sah, sodass ein anderer es auch sehen konnte. Mit der Welt verbunden zu sein, auch wenn man allein war, als schiebe man kleine Zettel mit Botschaften über einen Bindfaden, wie die Klassenkameradinnen es zwischen den Schulbänken machten.
Vom Dichten wurde die Sehnsucht nicht still, aber wie eine Katze, die den Kopf neigte und sich streicheln ließ.
An einem Nachmittag, an dem Lea bei einem Nachbarsmädchen zur Geburtstagsfeier eingeladen war, wurde Mascha mit ihrem Aufsatz fertig. Ihr blieben noch zwei Tage Zeit, ehe sie ihn abgeben musste, und die wollte sie nutzen, um ihn ein letztes Mal zu lesen und da und dort etwas zu schärfen oder zurechtzufeilen. Aber nicht mehr heute. Sie ging hinaus, um sich allein einen Spaziergang die Grenadierstraße hinauf und hinunter zu gönnen, und fühlte sich rundum wohl in ihrer Haut.
Am nächsten Tag belegte Lea den Schreibtisch mit Beschlag und jammerte dabei so laut über all die unerträglichen Aufgaben, zu denen sie verdonnert worden war, dass man es in der gesamten Wohnung hörte. Also kam Mascha erst am Tag darauf dazu, sich ihren Aufsatz noch einmal vorzunehmen. In der knappen Zeit konnte die Bearbeitung natürlich nicht so gründlich ausfallen, wie sie es sich gewünscht hatte, aber trotzdem war sie mit ihrem Werk zufrieden. Es hatte Schärfe, es sagte, was sie sagen wollte, aber es hatte auch Witz und machte beim Lesen Spaß. Als Minna an die Tür hämmerte und lautstark »Licht aus!« forderte, fiel es ihr schwerer denn je, sich aus der Welt ihrer eigenen Sprache herauszureißen. Widerstrebend kroch sie in ihr Bett und lag unter der Decke still, bis sie das leise Schnorcheln vernahm, das verriet, dass Lea im Bett gegenüber eingeschlafen war. In ihrem Kopf wirbelten Gedanken herum, als schlüge Minna sie mit ihrem Sahnequirl.
Kaum war sie sicher, dass ihre Schwester fest schlief, schwang sie sich aus dem Bett und schnappte sich vom Schreibtisch Bleistift und Papier. Alsdann tappte sie so leise, wie sie nur konnte, über die Dielen in den Korridor, durch die Hintertür hinaus ins Treppenhaus und von dort auf den Abtritt. In all den Wohnungen, in denen sie seit ihrer Geburt gelebt hatte, hatten sie das stille Örtchen mit mehreren Parteien geteilt. Gegen den Gestank hatte Oma Malka in Chrzanów ein Rezept gewusst: »Nimm ein Heftchen Streichbeine mit. Wenn du dich niedersetzt, um dein Geschäft zu verrichten, streichst du eines an und hältst’s in die Höhe. Dann das nächste. Und wenn du lange brauchst, noch eins. Am Ende lässt du das Heftchen für den liegen, der nach dir kommt, denn besonders wenn’s ein Mann ist, kannst du kaum drauf hoffen, dass der selbst daran denkt, eins mitzunehmen.«
Die Methode funktionierte. Der ein wenig benebelnde, aber nicht unangenehme Geruch der Schwefelhölzer tilgte den anderen, den niemand beim Namen nannte. Maschas Mutter war, was Gerüche anging, so empfindlich, dass sie gleich nach dem Einzug in diese Wohnung einen Stapel Streichholzbriefchen erstanden und auf dem Sims des stillen Örtchens deponiert hatte.
Einen Zettel mit der Aufschrift ›Bitte benutzen‹ legte sie daneben und ermahnte ihre Töchter: »Passt auf, dass der nicht runterfällt. Männer kommen sonst nicht drauf. Die merken’s nicht, wenn sie zum Himmel stinken.«
Dass offenbar wirklich kein Mann die Briefchen benutzt hatte und noch genügend da waren, kam Mascha jetzt zugute. Sie setzte sich auf die Klobrille, strich ein Hölzchen an und begann, im Licht der aufzuckenden Flamme ein Gedicht zu schreiben. Der Aufsatz war gut. Aber in einem Gedicht wirkte alles intensiver, zugespitzter. Nach zwei Zeilen brauchte sie ein neues Hölzchen, und als das Briefchen leer war, war auch das Gedicht fertig. Mascha atmete auf. Sie fühlte sich befreit. Das Gedicht war auf dem Papier, es konnte ihr nicht mehr verloren gehen, und womöglich war es das Beste, was sie bisher geschrieben hatte.
Am nächsten Morgen ging Mascha beschwingten Schrittes zur Schule, weil sie es kaum erwarten konnte, ihren Aufsatz abzugeben. Ein paar Tage, vermutlich bis nach dem Wochenende, würde es dauern, bis Fräulein Petersen ihn gelesen hatte, und Mascha hatte keine Ahnung, wie sie es so lange aushalten sollte.
Am Freitag holte die Mutter Mascha und Lea von der Schule ab. Das geschah selten, die Mutter hatte schließlich genug zu tun, und die halbe Stunde Wegs gingen die Schwestern vom ersten Tag an alleine, aber Lea hatte sie so sehr gebettelt, dass sie es ihr schließlich versprach. In drei Tagen war Leas Geburtstag, und schon jetzt betrug sie sich, als brenne die ganze Welt auf nichts anderes, als ihr alle Wünsche zu erfüllen.
Als die Schulglocke läutete und die Schülerinnen aus dem Gebäude strebten, stand die Mutter bereits wartend am Tor. Lea rannte los, flog ihr mit wehenden Zöpfen entgegen und warf sich in ihre Arme. Mascha trug keine Zöpfe. Ihr Haar wurde von Jahr zu Jahr lockiger, ließ sich nicht mehr auskämmen und schon gar nicht flechten. »Als würde das krause Zeug, das du im Kopf hast, nach außen wachsen«, hatte die Mutter gesagt.
Sie hielt Lea umschlungen. Von irgendwoher tauchte Fräulein Wolfram, die Direktorin der Schule, auf, über das Gesicht ein Lächeln gebreitet, das die blasse Frühlingssonne in den Schatten stellte.
»Wer hätte das gedacht, liebe Frau Engel«, sagte sie zur Mutter, die Lea in den Armen hielt. »Sie haben in Ihrer Familie ja eine kleine Künstlerin.«
Verwirrt blickte die Mutter auf, und Maschas Herz begann, schneller zu schlagen. Sie näherte sich langsam, Schritt um Schritt, als ginge das Gespräch sie nichts an. In Wahrheit aber lauschte sie angespannt, um sich keine Silbe entgehen zu lassen.
»Tatsächlich?«, fragte die Mutter, noch immer unsicher, wovon eigentlich die Rede war.
»Aber gewiss doch.« Fräulein Wolframs Lächeln wurde breiter. »Ihre Tochter hat uns schließlich gerade wissen lassen, dass sie später einmal studieren und unter die Dichter gehen möchte. Es ist schön, und wir begrüßen es an dieser Schule sehr, wenn ein junges Mädchen einen Ehrgeiz an den Tag legt. Und nach dem prächtigen Aufsatz zu urteilen, den Ihre Tochter abgeliefert hat, hält unser Fräulein Petersen sie durchaus für talentiert.«
»Meine Tochter?« Die Miene der Mutter hellte sich schlagartig auf. »Sie meinen, Sie sind zufrieden mit ihr, sie bringt gute Leistungen?« Ehe die Direktorin ihr Antwort geben konnte, sprach die Mutter schon weiter: »Sie müssen nämlich wissen, wir sind keine gewöhnlichen Galizier, gehören nicht zu den Ostjuden, wie Sie sie hier kennen, und in der Grenadierstraße wohnen wir nur vorübergehend. Meine Kinder sind aus guter Familie, mein Mann ist Kaufmann, wir legen bei unseren Kindern auf Kultur und Bildung viel Wert.«
Sie wird es erlauben, jubelte Mascha innerlich. Sie wird mir helfen, damit ich auf die Universität gehen kann, und sie wird dieses Mal stolz auf mich sein.
»Daran hege ich nach der Lektüre von Leas Aufsatz keinen Zweifel, liebe Frau Engel«, sagte die Direktorin. »Man merkt ihrer Art zu schreiben an, dass sie aus einem gebildeten Elternhaus stammt, und es ist eine Freude, sie zu unterrichten. Dass sie in diesem oder jenem Fach ein paar Schwierigkeiten hat, stellt kein Problem dar, sie ist ja schließlich kein Junge. Sie können wirklich stolz auf Ihre Lea sein, und wir als ihre Lehrerinnen sind es auch.«
Lea reckte den Kopf aus der Umarmung der Mutter wie eine kleine Schlange. Mascha hätte sich nicht gewundert, wenn über ihre Lippen eine gespaltene Zunge gezuckt wäre, doch stattdessen kamen zuckersüße Worte: »Nun weißt du, warum ich mich all die Tage so sehr angestrengt habe, Mamme. Ich wollte dich stolz machen. Dich und Tate. Und deshalb solltest du mich heute auch abholen.«
Auf dem Heimweg machte die Mutter beim Obsthändler halt und kaufte eine Tüte kandierte Früchte, von denen Lea den Zucker leckte, bis ein glitzernder Rand ihren Mund umrahmte. Zu Hause befahl sie Minna, die Zutaten für Leas Lieblingskuchen einzukaufen und den selbigen für ihren Geburtstag am Montag zu backen. Erdbeertorte. Der Jahreszeit wegen mussten es eingemachte Erdbeeren sein, die der Mutter zufolge kosten durften, »was sie wollen«. Mascha hingegen wurde am Montagmorgen, noch vor Schulbeginn, zur Direktorin zitiert.
»Du bist also eine Plagiatorin, Golda Aufen«, sagte Fräulein Wolfram und wies mit ihrem Zeigestock auf Mascha, als wolle sie ihr die Brust durchbohren. »Kennst du gar keine Scham? Das Werk einer anderen für dein eigenes auszugeben, dich mit fremden Federn zu schmücken? Man muss sich fragen, wie lange du das schon praktizierst und auf diese Weise Noten erzielst, die man dir niemals zutrauen würde. Deine Tat wird noch schändlicher durch den Umstand, dass die kleine Lea Engel, von der du deine Hausaufgabe abgeschrieben hast, wie ich gerade erfuhr, deine Schwester ist.«
4
Zwei Tage später flog der Schwindel auf. Es erfolgte keine Entschuldigung, aber Fräulein Petersen nahm Mascha vor der Pause beiseite.
»Ich habe Direktorin Wolfram von Anfang an meine Bedenken mitgeteilt«, sagte sie und legte den Arm um Mascha, obwohl diese sich steif machte. »Meiner Ansicht nach konnte der Aufsatz nicht von Lea stammen, die weder Neigung noch Begabung zum Schreiben zeigt. Ich habe darin deinen Ton vernommen, der ganz unverkennbar ist. Es ist gerade dieser eigene Ton, der Talent verrät, selbst wenn die Schreiberin noch ungeübt ist und erst beginnt, ihre Flügel zu spreizen.«
Mascha wagte kaum zu atmen, wollte nur auf Fräulein Petersens Worte lauschen und auf das Echo, das darauf aus ihrem Innern drang. Fräulein Petersen war eine kleine, zierliche Frau mit feinen Gesichtszügen und großen, wachen Augen hinter runden Brillengläsern. Sie trug ihr kastanienfarbenes Haar am Hinterkopf zu einem Dutt gesteckt, wie es mit Maschas Haarmassen niemals möglich gewesen wäre, und Mascha fand sie hübsch. Ihr war zumute, als hätte sie auf einmal eine Freundin gefunden, eine Gefährtin, die ihr auf alle Zeit genug sein würde.
Lea hatte unzählige Freundinnen, die ständig wechselten, einen bunten Kreis, der sich um sie herum in einem unentwegten Reigen drehte. Die meisten Mädchen, die Mascha kannte, sammelten Freundinnen wie die Jungen Zigarettenbildchen, doch sie selbst stand dabei meist am Rand und wusste nicht, wie sie es hätte anfangen sollen.
Dabei war sie nicht schüchtern. Im Gegenteil. Die meisten Lehrer und Mitschüler hielten sie für vorlaut, forsch und frech. Es war auch nicht so, dass sie sich keine Freundin wünschte, sie spürte ja jetzt, wo sie eine gefunden hatte, wie sehr es ihr in all den Jahren gefehlt hatte. Ein einziger Mensch, ein einziger Vertrauter hätte ihr genügt, denn wenn man einen hatte – wozu brauchte man dann noch reihenweise andere? Einem Schiffbrüchigen wie Robinson Crusoe genügte eine einzige Insel, um sich aus der Seenot zu retten, und nach einer solchen Insel hatte Mascha sich gesehnt. Sie hatte nur nie begriffen, wie man sich einen Menschen zum Freund oder zur Freundin machen sollte, wenn man ihn gar nicht verstand und sich von ihm nicht verstanden fühlte.
Fräulein Petersen verstand sie. Sie hatte erkannt, dass Mascha keine Lügnerin und Plagiatorin war, ohne dass diese es auch nur mit einem Wort hätte abstreiten müssen. Zu einem solchen Wort wäre sie ohnehin nicht in der Lage gewesen: sich verteidigen, der Direktorin widersprechen, wenn die ihr eine solche Abscheulichkeit zutraute – statt es auch nur zu versuchen, hatten sich Maschas Lippen verschlossen. Sie hatte stumm vor der erzürnten Frau gestanden und alles auf sich genommen, nicht um Lea zu schützen, sondern um so zu tun, als wäre sie, Mascha, gar nicht da. Sie war in all diesen Tagen, seit Lea ihre Arbeit gestohlen hatte, gar nicht da gewesen, war sich selbst abhandengekommen, aber jetzt hatte Fräulein Petersen sie wiedergefunden.
»Anfangs ließ Direktorin Wolfram sich nicht überzeugen«, fuhr Fräulein Petersen fort. »Ich habe aber noch einmal mit ihr gesprochen, habe ihr Beispiele aus Leas Arbeiten wie aus den deinen gezeigt, und auf Nachfragen hat Lea die Tat schließlich gestanden. Der Geografielehrer ist dir auch zu Hilfe gekommen.«
»Der Geografielehrer?« Geografie war Maschas schlechtestes Fach, und dem grimmigen Herrn Fendrich, der es unterrichtete, konnte sie nichts recht machen.
Fräulein Petersen lächelte. »Er hat Direktorin Wolfram erklärt, er habe dir einen Tadel ins Klassenbuch eintragen müssen, weil du unter dem Pult Verse in dein Heft geschrieben hast.«
»Das war nur ein einziges Mal!«, rief Mascha, wobei ihr sofort einfiel, dass das gelogen war.
»Zerbrich dir darüber nicht den Kopf, ich habe in deinem Alter nicht viel anderes getan, und es half ja schließlich, Frau Wolfram zu überzeugen, dass die Dichterin nur du sein konntest. Ich hoffe, du hast dir diesen unschönen Vorfall nicht allzu sehr zu Herzen genommen, Mascha. Er sollte dir den Stolz auf deine Leistung nicht trüben.«
Mascha konnte nicht fassen, wie viel Zeit ihre Lehrerin für sie aufgebracht hatte. »Sie fanden also meinen Aufsatz gelungen?«, fragte sie vorsichtig.
»Aber ja doch, Mascha.« Fräulein Petersen lachte. »Ich bin richtig angetan davon, ich hätte noch seitenlang weiterlesen können.«
Mascha schob eine Hand in ihre Schürzentasche und ertastete den knisternden Zettel. Im Grunde hatte sie das nächtliche Klobrillen-Gedicht für Fräulein Petersen geschrieben – war es da nicht nur recht und billig, dass diese es zu lesen bekam?
»Würden Sie …« Auf einmal fühlte Mascha sich doch schüchtern – jedenfalls nicht im Geringsten mehr frech und forsch. »Mögen Sie vielleicht ein Gedicht von mir lesen? Eins, in dem es auch um diese Sache mit dem Dichten geht?«
Fräulein Petersen warf einen Blick auf die Uhr, die sie ganz modern an einem schicken Armband um ihr Handgelenk trug. »Heute geht es nicht, Mascha. Ich muss in eine Besprechung und bin schon spät dran. Aber morgen können wir in der Pause zusammen einen Spaziergang machen, wenn du magst. Dann liest du es mir vor.«
Viel zu lange zog sich der Tag.
Von dem teuren Erdbeerkuchen, der streng eingeteilt wurde, damit er drei Tage lang reichte, hatte Mascha zur Strafe für ihre vermeintliche Missetat nichts essen dürfen. Es machte ihr nichts aus, jeder Bissen von Leas Kuchen wäre ihr ohnehin im Hals stecken geblieben, aber die Ungerechtigkeit wurmte sie. Als niemand in der Stube war, wo der Kuchenrest auf seiner Platte auf der Anrichte thronte, sprang sie flugs hin, schnitt ein mächtiges Stück ab und wickelte es in ihr Taschentuch.
Auf diese Weise schlug sie zwei Fliegen mit einer Klappe: Ihrer ungerechten Sippe ging ein Batzen von ihrem kostbaren Kuchen verloren, und sie hatte etwas, um sich bei Fräulein Petersen zu bedanken. Sie schob sich die Süßigkeit in die Schürzentasche ihrer Schuluniform und hoffte, ihre Lehrerin würde sich darüber freuen. Über die Minna konnte man sagen, was man wollte, aber ihr Erdbeerkuchen war nicht von schlechten Eltern.