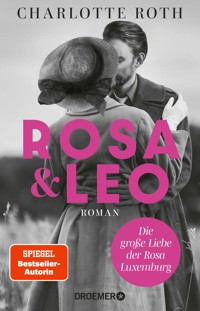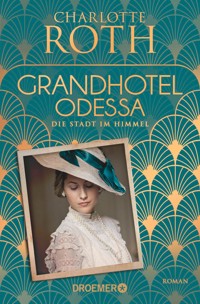9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Grandhotel-Odessa-Reihe
- Sprache: Deutsch
Der zweite Band der großem Hotel- und Familiensaga von Bestseller-Autorin Charlotte Roth und eine große Liebesgeschichte. Odessa 1920 – 1935. Sie scheinen alles zu besitzen, von dem andere im Weltensturm der Zwanziger Jahre träumen: Nach außen hin schwelgen Oda und Belle, die Wahl-Schwestern des Grandhotel Odessa, in Schönheit, Reichtum, Glamour und Liebesglück, doch was im Innern an ihnen nagt, bekommt niemand zu sehen. In den blutigen Jahren des Bürgerkriegs gelingt es der ewig kämpfenden Oda, das Hotel als Oase fern des Alltags zu erhalten. Auch die Vielvölkerstadt Odessa hat sich gegen alle Bestrebungen etwas von ihrem Charme erhalten und wird zu einem Geheimtipp für europäische Abenteurer, künstlerische Avantgarde und politische Querdenker. Der Springbrunnen über dem schwarzen Marmorfaun sprudelt unbeirrt weiter, und rings um ihn dreht sich das Karussell der Liebe und der Intrigen von neuem. Mit Nadeshda Mandelstam, der Frau des bedrohten Dichters Ossip teilt Oda den Mut, den bedingungslosen Kampf für das, was ihr wichtig ist. Aus dieser Gemeinsamkeit entwickelt sich eine lebenslange Freundschaft. Doch hinter der glanzvollen Fassade lauern Gefahren, die Oda vor immer neue Herausforderungen stellen. Dramatische Liebesgeschichte und glanzvolle Familien- und Hotelgeschichte – in ihrem neuen Roman verwebt Charlotte Roth beides auf unnachahmliche und Weise miteinander. Band 1: "Grandhotel Odessa: Die Stadt im Himmel" Band 2: "Grandhotel Odessa. Der Garten des Fauns"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 783
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
Charlotte Roth
Grandhotel OdessaDer Garten des Fauns
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Odessa 1920–1935. Sie scheinen alles zu besitzen, von dem andere im Weltensturm der Zwanzigerjahre träumen: Nach außen hin schwelgen Oda und Belle, die Wahl-Schwestern des Grandhotel Odessa, in Schönheit, Reichtum, Glamour und Liebesglück, doch was im Innern an ihnen nagt, bekommt niemand zu sehen. In den blutigen Jahren des Bürgerkriegs gelingt es der ewig kämpfenden Oda, das Hotel als Oase fern des Alltags zu erhalten. Auch die Vielvölkerstadt Odessa hat sich gegen alle Bestrebungen etwas von ihrem Charme erhalten und wird zu einem Geheimtipp für europäische Abenteurer, künstlerische Avantgarde und politische Querdenker. Der Springbrunnen über dem schwarzen Marmorfaun sprudelt unbeirrt weiter, und rings um ihn dreht sich das Karussell der Liebe und der Intrigen von Neuem. Mit Nadeshda Mandelstam, der Frau des bedrohten Dichters Ossip, teilt Oda den Mut, den bedingungslosen Kampf für das, was ihr wichtig ist. Aus dieser Gemeinsamkeit entwickelt sich eine lebenslange Freundschaft. Doch hinter der glanzvollen Fassade lauern Gefahren, die Oda vor immer neue Herausforderungen stellen.
Dramatische Liebesgeschichte und glanzvolle Familien- und Hotelgeschichte – in ihrem neuen Roman verwebt Charlotte Roth beides auf unnachahmliche Weise miteinander.
Band 1: »Grandhotel Odessa: Die Stadt im Himmel«Band 2: »Grandhotel Odessa. Der Garten des Fauns«
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Odessa
Berlin und Odessa
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
Berlin und Odessa
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
Odessa und Berlin
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
Odessa und Berlin
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
Glossar
Leseprobe »Die Liebe der Mascha Kaléko«
Für Martina.
Für unseren Tantenklub, den so schnell nichts unterkriegt,
und für unsere Kinder, die Helden und Riesen sind.
»Damals war Odessa noch eine Königin. Dann wurde der Wald lichter und lichter, aber ich möchte, dass es so ist wie in meiner Kindheit. Ein Wald, und von allen Seiten die Rufe von Matrosen, Bootsführern, Schauerleuten, und wenn ich näher dran wäre, würde ich das schönste Lied der Menschheit hören: hundert Sprachen.«
Vladimir Jabotinsky: Die Fünf
1919
Odessa
Portal
»Und noch einmal schwellen Knospen,
Treibt der Spross und quillt das Grün,
Doch dein Rückgrat liegt gebrochen,
Meine Zeit, du – elend schön.«
Ossip Mandelstam: Mitternacht in Moskau
Manon
Das Kind wusste, dass hinter ihm das Meer lag und dass das Meer kein Ende hatte. Der Himmel hatte auch kein Ende und erhob sich über ihm. Beides, Meer und Himmel, verband die Treppe, an deren Fuß sie standen und die der Vater Himmelsleiter genannt hatte. Für die Augen mochte die Treppe so wenig ein Ende haben wie der Himmel und das Meer, doch das Kind wusste, dass an ihrem Ende das Grandhotel Odessa und damit sein Zuhause stand.
Das Kind hieß Manon. Von dem Vater war ihr nur noch wenig im Gedächtnis: Er war die Himmelsleiter heruntergerannt, um an schönen Sommertagen Manon und ihre Mutter vom Strand abzuholen, und er hatte an Igors Bude für sie alle Schaschliks gekauft, dazu Kirschsaft, den Manon liebte, und Bier, von dem die Eltern lustig wurden.
Mit alledem war es jetzt vorbei. Mit Schaschlik und Kirschsaft, mit der Treppe, die scheinbar in den Himmel, in Wahrheit aber in ihr hell erleuchtetes Zuhause führte, und mit Eltern, die lustig waren. Alle anderen feierten. Sie tanzten die Hafenstraße entlang zur Musik von Pawlo, der mit seiner süßen Mädchenstimme zur Bandura sang, und johlten vor Freude, weil die Deutschen aus Odessa abzogen. Manons Cousins – der schöne, ihr so vertraute Maxim, der griesgrämige Edvard und der kleine Clown Hanno – schlugen sich mit gebackenem Fisch und Syrniki mit Himbeerkompott die Bäuche voll, und die Erwachsenen tranken Wodka und georgischen Wein und fielen einander schwankend in die Arme.
Nur sie, Manon, gehörte nicht mehr dazu.
»Deutsche raus!«, brüllten die Tanzenden, die sich Wein aus Krügen in die Kehlen schütteten. »Deutsche raus!«, stand auf den Flaggen und Bannern, die sich die Leute aus Odessa vor die Fenster hängten.
Sie wollten die Deutschen nicht mehr haben, die Leute aus Odessa, und sie wollten auch Manon und ihre Mutter nicht mehr haben.
»Aber warum müssen wir denn weg?«, hatte Manon ihre Mutter gefragt, ehe sie am Morgen aufgebrochen waren, hatte die Finger in den samtigen Stoff ihres Kleides gegraben und sich darin festgekrallt.
Die Mutter hatte sich ihr hübsches, helles Haar zurückgestrichen, hatte sich zu Manon hinuntergebeugt und gesagt: »Ja, warum wohl, Prinzesschen auf der Erbse? Weil wir Deutsche sind. Da hilft nun auch kein Weinen.«
Von der Antwort war Manon so verblüfft gewesen, dass sie das Samtkleid der Mutter losgelassen hatte. Bis zu diesem Morgen hatte es die Deutschen und die Odessiten gegeben. Die Deutschen, das waren die Männer in den grauen Uniformen, die im Stechschritt durch die Straßen marschierten, obwohl sie nicht hierhergehörten, und denen Manons Freunde alles Böse auf der Welt an den Hals wünschten. Die Odessiten dagegen, das waren die anderen. Die, die ihre Vorhänge zuzogen, wenn die Deutschen vorbeistampften, und die Straßenseite wechselten, ohne zu grüßen.
Bis zu diesem Morgen war Manon sicher gewesen, eine Odessiterin zu sein, eine von denen, die bleiben würden, wenn man die Deutschen endlich zum Teufel schickte. Jetzt aber gehörte sie selbst auf einmal zum Teufel, und ihre Cousins, ihre Tanten, ihre Freunde, die sie gestern noch im Kreis herumgeschwenkt hatten, sprachen von ihr, wenn sie grölten: »Deutsche raus!«
Sie war keine Odessiterin, hatte ihre Mutter gesagt. Eine Deutsche war sie doch aber auch nicht, denn wie konnte man etwas sein, das man überhaupt nicht kannte? Sie war ihres Vaters Schneewittchen gewesen und hatte an Igors Bude von seinem Schaschlik probiert. Sie war Manon gewesen, der die fliegenden Händler auf der Strandpromenade Kusshände zuwarfen und Tütchen mit Semechki – Sonnenblumenkernen – schenkten. Wer war sie jetzt? Und wie schrecklich war das Land, in das sie und die Mutter vertrieben wurden, wenn dort der Teufel wohnte und Männer in grauen Uniformen unentwegt die Straßen hinauf- und hinunterstampften?
Manon sah sich um. Über dem Meer verlosch das Licht, und entlang der Promenade glommen bunte Laternen. Die Menschen tanzten und lachten. Ihre drei Cousins, die sie sonst umschwirrten wie Motten eine Gaslaterne, hüpften im Kreis, ohne zu bemerken, dass sie fehlte. Die Kälte des Märzabends und der scharfe Wind schienen ihnen nichts auszumachen. Manon blickte wieder nach vorn, die lange Treppe hinauf. Die Schar Menschen, mit denen sie gekommen war, scherte sich nicht mehr um sie und hatte sie vergessen. Sie war allein. Zum ersten Mal in ihrem Leben.
Oben war ihre Mutter, die ihre und Manons Sachen zusammenpackte, um mit Herrn Oberleutnant von dem Knesebeck nach Deutschland zu gehen. Manon konnte Herrn Oberleutnant von dem Knesebeck nicht leiden, aber von nun an würde sie zu ihm und seiner grauen Uniform gehören, nicht mehr zu all denen, die sie lieb hatte.
Tante Oda, Tante Lene, Tante Tessa, die lustige Lidija mit den Klunkerketten, Eduard, der Portier in seiner hübschen Livree, Sebastien, der Empfangschef, und Andreja, die in der Küche stand und Meerestiere aus Teig knetete – wo waren sie alle jetzt, da Manon sie brauchte?
Es war niemand mehr da.
Niemanden kümmerte es mehr, was mit Manon geschah. Sie sollte weg. Wie die Deutschen. Morgen früh mit dem ersten Zug.
Die Himmelsleiter war leer. Es kam ihr vor, als wäre der Platz mit dem Hotel verschwunden, als gäbe es zwischen Himmel und Meer ihre vertraute Welt nicht mehr, sondern nur noch Endlosigkeit. Brennende Tropfen schossen ihr in die Augen. Wer sie sah, musste glauben, dass Manon Albus nicht nur eine Deutsche, sondern obendrein eine Heulsuse war. Aber es sah sie ja niemand. Sie war allein. Sie setzte einen Fuß auf die unterste Stufe und begann, die Treppe hinaufzusteigen. Nach ein paar Schritten begannen ihre Waden zu schmerzen, doch sie hielt nicht an. Weg, nur weg von den Tanzenden und der schönen Stimme zur Bandura, von dem Fest, zu dem sie nicht eingeladen war. Das Geräusch, leise Schritte, die nicht von der Hafenstraße heraufkamen, hielt sie zunächst für Einbildung. Dann aber blickte sie auf und sah, dass ihr tatsächlich jemand entgegenkam.
Ein kleines Kind kletterte die Treppe herunter und winkte mit beiden Armen. »Manon, Manon!« Das Stimmchen war rau, und das Kind sprach Manons Namen so aus, wie es die Deutschen taten: mit einem harten »n« am Ende, das ein bisschen knallte. Ihre Mutter sagte es nie so, auch nicht, wenn sie mit Manon deutsch sprach. Vielmehr pflegte sie zu seufzen und zu erklären: »Französisch ist die Sprache der vornehmen Welt, und ich habe dir einen französischen Namen gegeben, weil ich dir ein vornehmes Leben wünschte. Wie es stattdessen dann gekommen ist, konnte ja kein Mensch ahnen.«
»Manon!«, rief das Kind noch einmal und kam die Treppe so eilig herunter, dass Manon Angst hatte, es könnte stolpern. »Da bist du ja, Manon! Ich hab dich überall gesucht.«
Manon erkannte das Kind nun. Es war die kleine Clara, die Tochter von Onkel Bodo und Tante Valerie, die nur zu Besuch hier waren. Sie straffte den Rücken und wischte sich hastig mit dem Handrücken über die Augen. Die kleine Clara war wirklich noch klein. Erst vier war sie, im Vergleich dazu war Manon mit ihren bald acht Jahren schon so gut wie erwachsen. Auf keinen Fall würde sie sich vor ihr verheult und jämmerlich zeigen. Im Gegenteil. Die Kleine sollte glauben, Manon ginge aus freier Entscheidung nach Deutschland und könne gar nicht schnell genug von hier wegkommen.
»Ach, du arme, arme Manon!« Auf der letzten Stufe, ehe sie Manon erreichte, stolperte Clara doch noch und fiel geradewegs gegen sie. Sie trug einen unschönen, kratzigen Mantel aus Wollpopeline, hatte sich ihre komische, zu große Russenmütze vom Kopf gezogen, und ihre kurzen Ärmchen schlangen sich um Manons Mitte.
»Oben gibt’s Pfannküchlein«, murmelte Clara. »Mit allem Möglichen drauf. Kirschmarmelade, Zuckerwasser, echte Sahne. Aber weil du nicht da warst und weil du so traurig warst, hat’s mir gar nicht geschmeckt.«
Verdutzt schob Manon sie ein Stück von sich weg und betrachtete sie. Die Kleine hatte ein nahezu vollkommenes Mondgesicht und auf dem Kopf ein Haargestrüpp in einer Farbe, die Manons Mutter Straßenköterblond genannt hatte. Ihre hellen Augen waren fast so rund wie ihr Gesicht und vollkommen offen, als könne man in Clara hineinsehen.
»Ich bin gar nicht traurig«, log Manon.
»Ach doch«, sagte Clara. »Das hab ich dir angemerkt. Du bist traurig, weil du nicht mit uns nach Berlin fahren, sondern hierbleiben willst.«
Wie konnte die Kleine das gespürt haben, wie konnte sie etwas davon verstehen? Sie war doch kaum mehr als ein Wickelkind, nicht älter als Hanno, der Manon oft schrecklich auf die Nerven ging. Und überhaupt – was verstand so ein Knirps schon von Traurigkeit?
Clara musste zwar auch nach Deutschland, aber sie hatte ja dort ihr Zuhause. Sie hatte eine Mutter, die sie nicht wegschob, wenn sie mit ihr reden wollte, sondern ihr zuhörte, und obendrein hatte sie ihren Vater bei sich. Onkel Bodo. Einmal hatte Manon sich bei dem Wunsch ertappt, Onkel Bodo möge auch ihr Vater sein. Sie hatte sich hinterher dafür geschämt, weil ihre Mutter ihr schließlich oft genug versicherte, sie hätte den besten Vater auf der Welt gehabt. Aber davon ging der Wunsch nicht weg. Ein Vater, von dem man nichts als Schaschliks in Erinnerung hatte, war ein bisschen wenig, um sich daran festzuhalten, und der verblichene Schaschlik-Vater würde sie auch nicht davor schützen, in ein wildfremdes Land verschleppt zu werden.
Manon schluckte hart. In ihren Augen sammelten sich schon wieder die verhassten Tränen.
Etwas berührte ihre Hand, stupste sie an wie eine Hundeschnauze. Claras Hand war so nass geschwitzt wie die ihre. Ohne es zu wollen, schlossen Manons Finger sich um die der Kleinen. Sie hielten sich aneinander fest. Begannen langsam, Stufe für Stufe, die Himmelsleiter hinaufzusteigen. Hinter ihnen verhallten Stimmen und Gelächter.
»Warum kratzt dich das denn, dass ich traurig bin?«, fragte Manon.
»Weil ich dann auch traurig bin«, antwortete Clara ernst und stapfte weiter. »Weil ich deine Freundin sein will.«
»Du bist meine Cousine.«
»Cousine brauch ich nicht. Freundin ist besser. Am liebsten hätte ich eine Schwester, aber Freundin ist fast genauso gut.«
»Du bist zu klein«, sagte Manon, ohne Claras Hand loszulassen. »Freundinnen müssen im selben Alter sein. Wenn ich dich einmal dringend brauche, kannst du mir ja gar nicht helfen.«
»Kann ich doch«, sagte Clara.
»Wieso?«
»Weil ich dir schon geholfen habe.« Clara schnaufte ein bisschen, trat auf die oberste Stufe und zog Manon hinterher. Ihre Beine waren kurz, aber offenbar erstaunlich kräftig. Der kleine Hanno, der genauso alt war, hätte niemals die ganze Himmelsleiter allein hinaufsteigen können, und Manon, die älter und hochbeinig war, keuchte selbst ein bisschen.
Vor ihnen erstreckte sich der Platz mit dem Denkmal, und zur Rechten erhob sich schneeweiß das Hotel mit seinen Türmen, den Fenstern und Balkonen, die aufs Meer hinausgingen. Hinter den Fenstern brannte immer Licht, und wenn Manon auf das Portal zueilte, stand dort Eduard, der Portier, lächelte zu ihr hinunter und schob für sie die gläserne Drehtür an, die in die Empfangshalle führte.
Das Hotel war das schönste Haus in Odessa.
Für sie, für Manon Albus, war es das schönste Haus auf der Welt.
»Wie willst denn du mir geholfen haben?«, fragte sie Clara. Ihr konnte ja niemand helfen, und wenn die Kleine ihr etwas von ihrem Spielzeug schenken wollte, wäre das kein Trost. Die Kleine konnte sich doch nicht einmal vorstellen, wie Manon sich fühlte:
Alle Menschen, die Clara lieb hatten, lebten weit weg, in Deutschland.
Aber alle Menschen, die Manon lieb hatten, lebten hier, in Odessa.
»Ich hab meinem Papa erzählt, dass du traurig bist«, sagte Clara. »Ich hab ihm gesagt, er muss mit Tante Belle reden und ihr erklären, dass du nicht weggehen willst.«
Tante Belle war Manons Mutter. Onkel Bodo, Claras Vater, war Belles Bruder. Wenn Manon oder sonst jemand zu ihr sprach, hörte Manons Mutter meist nicht hin, begann, an ihren Haaren oder der Spitze in ihrem Ausschnitt zu spielen und in die andere Richtung zu starren. Wenn dagegen ihr Bruder zu ihr sprach, stand sie auf, nahm ihn am Ärmel und raunte ihm mit rauchiger Stimme zu: »Lass uns das nicht hier besprechen, Bo. Gehen wir irgendwohin, wo nicht die halbe Welt mithört.«
Hatte sie das auch diesmal gesagt? Hatte sie Onkel Bodo ausreden lassen, ohne die Spitze in ihrem Ausschnitt zwischen den Fingern zu zwirbeln und abwesend in die andere Richtung zu schauen? Und selbst wenn sie ihm zugehört hatte – was sollte das bewirken? Die Antwort, die sie ihm gegeben hatte, war bestimmt nicht viel anders ausgefallen als die, die Manon auf all ihr Weinen und Betteln erhalten hatte: »Jetzt sei schon still. Ich schlepp dich ja nicht in die Hölle. Du kriegst eine Schwester und ein eigenes Kinderzimmer, wie’s bei reichen Leuten üblich ist, das ist ja wohl so schlecht nicht. Und außerdem, mein Erbsenprinzesschen, ist deine Mutter ein armer Schlucker und hat gar keine andere Wahl. Also heb dir das dramatische Gejammer für solche Momente auf, in denen du was damit erreichst.«
»Du musst nicht weg aus Odessa.«
Manon zuckte zusammen. Sie war in Gedanken bei ihrer Mutter gewesen und sah erst jetzt wieder Clara an, die im aufglimmenden Licht der Gaslaternen vor ihr stand.
»Was?«
»Du musst nicht weg aus Odessa«, wiederholte Clara. »Mit uns und dem doofen Knesebeck nach Berlin, das musst du nicht. Ich hab zu Papa gesagt, er soll nicht nur mit Tante Belle, sondern besser auch gleich mit Tante Oda reden, weil Tante Belle oft gar nicht hinhört, wenn einer was sagt.«
Wie konnte die Kleine das wissen? Ihr Cousin Hanno wusste kaum, wie alt er war, aber Clara kam Manon in diesem Augenblick schlauer vor als so mancher Erwachsene.
»Das hat er dann getan«, fuhr Clara fort. »Mein Papa tut immer, was ich mir wünsche, weil er was gutmachen will. Tante Oda hat gesagt, von ihr aus kannst du gern bei ihr bleiben, und Tante Belle hat gesagt, wenn dann endlich Ruhe ist, gibt sie in Gottes Namen ihren Segen dazu.«
»Sie hat gesagt, ich kann bei ihr bleiben?«, platzte Manon heraus. »Tante Oda hat gesagt, ich kann bleiben, und meine Mutter hat es erlaubt?«
Tante Oda, die Mutter von Hanno, Edvard und Maxim, war keine richtige Tante. Aber dann wieder doch. Ihr gehörte das Hotel, sie trug nur Blau, Weiß und ein wundervoll schillerndes Türkis, damit sie zur Einrichtung passte, und Manon war fest entschlossen, eines Tages genauso zu werden wie sie.
Clara nickte, dass das zottige Haar auf und nieder wippte. »Ich bin sehr traurig darüber, denn ich habe gedacht, dass wir in Berlin in derselben Straße wohnen und wie Schwestern immer zusammen sein können.«
»Es macht dich traurig, aber du hast es trotzdem für mich getan?«
Clara nickte noch einmal. »Eine Freundin tut so was doch. Sonst wär sie ja keine Freundin.«
Der Wind pfiff vom Meer herauf, und die sich senkende Dunkelheit wartete mit noch mehr Kälte auf, doch Manon wurde warm. Sie schlang die Arme um Clara und zog ihren kompakten kleinen Körper an sich. »Wir sind jetzt mehr als Freundinnen«, sagte sie. »Die Tochter vom Oberleutnant von dem Knesebeck, die meine Schwester werden soll, will ich nicht, aber du hast mich gerettet. Du bist jetzt meine Schwester.«
»Wirklich?« Clara befreite ihren kugeligen Kopf aus der Umarmung und blickte wieder zu Manon auf.
»Ganz wirklich.« Manon nahm ihr die komische Russenmütze ab und zog sie ihr dann zum Schutz vor dem Wind bis über die Ohren. »Wir sind Manon und Clara, die Himmelsleiterschwestern, und wenn du schreiben gelernt hast, können wir uns Briefe schicken.«
»Schreiben kann ich schon.«
»Umso besser.« Manon wunderte jetzt nichts mehr.
»Und im Sommer komm ich wieder, ja?«
Manon dachte an den Sommer in Odessa, an Eis und Schaschlik auf der Promenade, an Sandburgen, Eselsritte und das sich bäumende Meer, in das man hineinlaufen konnte, und ihr Herz wurde so weit, dass ihre Brust sich eng anfühlte. »In jedem Sommer«, sagte sie zu Clara, der sie verdankte, dass sie im Sommer noch hier sein würde. »Du kommst in jedem Sommer zu Besuch nach Odessa, und vor dem Hotel stehe ich dann und warte auf dich.«
1932
Berlin und Odessa
Empfang
»Wie sehr möcht ich das Spiel noch weiterspielen,
Mich im Gespräch verlieren, nur die Wahrheit reden,
Und alle Schwermut nun zum Teufel schicken,
Um irgendwessen Hand zu greifen: Sei mir Freund,
Wir gehen noch zusammen ein Stück Weg.«
Ossip Mandelstam: Mitternacht in Moskau
1
Clara
Vergiss das nie«, hatte der Vater zu Clara gesagt, als er sie an ihrem ersten Schultag bis ans Tor begleitet hatte. »Vergiss nie, dass du Clara Schneider-Arndt bist. Lass dir von keinem erzählen, was du nicht kannst. Du kannst alles, was du willst.«
Clara hatte es nicht vergessen. Damals war ihr trotz der übergroßen Zuckertüte in ihrem Arm zum Heulen gewesen, und sie hatte sich dafür geschämt, weil sie doch Clara Schneider-Arndt war, die alles konnte, was sie wollte. Ihr Vater aber hatte gesagt, Clara Schneider-Arndt könne auch heulen, wenn sie das wollte, denn das ändere nichts daran, dass sie das stärkste kleine Mädchen auf der Welt war.
Daheim hatte er ihr Bildergeschichten von einer Clara gezeichnet, die mit Flügeln an den Fesseln fliegen konnte und mit dem Kopf voran durch Wände stürmte. Jetzt stand sie wieder hier an einem Schultor, an dem des Luisengymnasiums, das sie die letzten sechs Jahre lang täglich durchquert hatte, und diesmal war es ihr Vater, der mit dem Heulen kämpfte.
»Das macht nichts«, sagte Clara. »Bodo von Arndt kann auch heulen, wenn er das will. Er ist trotzdem der stärkste kleine Vater auf der Welt.«
Sie grinsten sich an.
»Ich kann nicht glauben, dass du heute tatsächlich dein Reifezeugnis bekommst. Du hast doch gerade erst gelernt, dich an der Küchenanrichte hochzuziehen und Radieschen zu stibitzen.«
»Als ich das gelernt habe, warst du nicht da«, erwiderte Clara. Sie sagte es nicht, um ihm wehzutun oder weil Sentimentales zwischen ihnen keinen Platz hatte, sondern weil es ihnen in diesen drei Jahren zum ungeschriebenen Gesetz geworden war, einander die Wahrheit nie schuldig zu bleiben.
Er schluckte tapfer und fing sich. »Trotzdem, ganz so hättest du dich nicht zu beeilen brauchen«, sagte er. »Deine Freundinnen gehen alle noch mindestens ein Jahr zur Schule.«
»Ich war eben schon immer von der schnellen Truppe«, entgegnete Clara lapidar. In Wahrheit war sie beim Lernen losgeprescht wie einer der modernen Eilzüge, die ihren Vater in Begeisterung versetzten, weil sie es in der Schule nicht mehr ausgehalten hatte. Sie war immer gern hingegangen, hatte voll Neugier Wissen in sich aufgesogen, doch seit jenem Tag vor drei Jahren war es ihr vorgekommen, als vergeude sie Zeit, die sie nicht hatte. Die Schule war Spiel gewesen, Vorbereitung, Teil des seligen Wolkenkuckucksheims, in dem sie mit ihren Eltern gelebt hatte. Jetzt war alles anders, die Jahre des Spielens vorbei. Clara hatte eine Klasse übersprungen und mit gerade siebzehn Jahren die Reifeprüfung am Luisengymnasium abgelegt, weil es für sie an der Zeit war, Ernst zu machen.
»Ich denke, ich gehe dann wohl besser das Zeugnis holen«, sagte sie, wieder um den flachsenden Ton bemüht, der zwischen ihnen üblich war. »Nicht dass Rektor Krankemann denkt, ich will es nicht haben, und es jemand anderem gibt.«
»Kommt nicht infrage. Ehre, wem Ehre gebührt.« Ihr Vater ließ die Hand, die er an ihren Ellbogen gelegt hatte, sinken und trat kaum merklich zurück. Eine ähnliche Geste hatte sie beim Vater von Saskia aus ihrer Zeichenklasse beobachtet, als er seine Tochter zum Altar geführt hatte, weil eins der männlichen Aktmodelle sie geschwängert hatte. »Ich warte dann also bei Tannerauf dich. Ich allein. Wie du’s wolltest.«
Er hatte eine Schar ihrer engsten Freunde in ihr Stammlokal einladen wollen, um das bestandene Abitur zu feiern, aber Clara hatte ihn gebeten, darauf zu verzichten. Sie fühlte sich in dem bunten Haufen ihrer Freunde wohl und genoss für gewöhnlich ihre Feste, aber heute war ihr nicht danach zumute. Ihr Vater hatte sich widerspruchslos gefügt. Sie würden nur zu zweit, an einem Fenstertisch, eins der kühlen, blitzsauberen amerikanischen Menüs genießen, die der aus Boston stammende Tanner zubereitete, begleitet von amerikanischer Jazzmusik, die er auf Platten aus New York importierte: Duke Ellingtons Creole Love Call mit James Bubber Mileys Trompetensolo oder Singin’ the Blues mit dem Kornett von Bix Beiderbecke, die beide auch kühl und blitzsauber waren, aber in den Spitzen nicht ohne Schmelz und gerade wehmütig genug, damit es wehtat.
Ein bisschen.
Manchmal auch mehr als das.
Wenn ihr Vater ihr erlaubte, zum Essen einen Manhattan mit mehr Whisky als süßem Vermouth zu trinken.
Beide – Miley wie Beiderbecke – waren keine dreißig geworden, gestorben an Entkräftung, an Alkoholsucht oder am Leben, das war so genau vermutlich nicht zu unterscheiden.
»Mach’s gut, mein Mädchen.« Claras Vater presste die Lippen zu einer schmalen Linie. Clara war klar, was er dachte, denn sie dachte das Gleiche. »Sie wär verdammt stolz auf dich. Das weißt du, oder?«
»Ja, Paps. Das weiß ich.«
»Stolz wär sie sowieso. War sie immer. Wär sie auch dann, wenn du gemacht hättest, was du eigentlich wolltest. Weiter zeichnen. Kunst studieren. Einen Beruf draus machen.«
»Sicher«, sagte Clara.
»Aber das willst du nicht?«
»Nein«, sagte Clara. »Das will ich nicht.«
Sie hatte jahrelang nichts anderes gewollt. Aus den rasch entworfenen Bildergeschichten von Super-Clara mit den Flügeln an den Füßen, die Vater und Tochter an verregneten Sonntagen auf die Rückseiten von Bahnfahrplänen gekritzelt hatten, waren mehrbändige Epen geworden, dicke Kladden, Skizzenbücher voller gezeichneter Geschichten.
Dass sie dabei immer besser wurde, bemerkte sie selbst. Was sie zeichnete, lebte, besaß Witz und Ausdruck und hatte mit den krakeligen Blumenbildern, die ihre Altersgenossen zum kürzlich eingeführten Muttertag anfertigten, nichts gemein.
»Du hast Talent«, sagte ihr Vater, der bei der Reichsbahn in seinem Element war, aber selbst welches hatte.
»Mich dürft ihr bekanntlich nicht fragen, aber was unser Karikaturist für die Sonntagsausgabe macht, sieht bestimmt nicht besser aus als die Bilder von Clara«, sagte ihre Mutter, die nichts von Kunst verstand.
Vater und Mutter berieten sich und fuhren mit Clara auf ein Familienwochenende in ein Hotel nach Leipzig, um mit ihr die Staatliche Akademie für Graphik und Buchkunst zu besuchen. Der Karikaturist, der wie Claras Mutter für den Vorwärts tätig war, hatte das empfohlen, nachdem er sich ein paar von Claras Zeichnungen angesehen hatte. Er selbst hatte dort studiert. Clara liebte es, mit ihren Eltern in Hotels zu übernachten, und sie liebte die Staatliche Akademie. Den Lichthof, in dem etliche Frauen mit Skizzenblöcken saßen und zeichneten. Die Wandelgänge, in denen Frauen paarweise auf und ab schlenderten und ihre Arbeiten verglichen. Das Institut war 1905 die erste Kunstschule gewesen, die Frauen aufnahm, und kurz vor dem Krieg hatten dort bereits mehr Frauen als Männer studiert.
Clara wollte eine von ihnen sein. Sie wollte Geschichten zeichnen, in Bildern von der Welt berichten. Ihre Eltern gingen mit ihr in Museen, ließen sie jahrhundertealte byzantinische Manuskripte und japanische Tuschezeichnungen betrachten, um ihr zu zeigen, dass die Idee der Bildergeschichte uralt war, dass sich seit Urzeiten Menschen mit Bildern behalfen, weil ihre Empfänger nicht lesen konnten oder ihre Sprachen nicht verstanden.
»Sprache ist auch ein Mittel zur Festigung von Macht«, sagte ihre Mutter, deren Werkzeug die Sprache war. »Bilder sind klassenlos und international. Es ist kein Wunder, dass der Film wie ein Komet zum Medium der Demokratie avanciert ist.«
Das war gewesen, bevor Ton und Sprache in den Film einzogen. Clara begann davon zu träumen, eines Tages einen Film zu zeichnen.
Es gab heilige Bücher in Bildern ebenso wie politische Kampfschriften, uralte Beschwörungsformeln und moderne Satiren, gegen die die Nazis, so sagte ihre Mutter, wutschnaubend vor Gericht zogen.
Und es gab Krazy Kat. Den Comicstrip um eine vertrottelte Katze und ihre unerwiderte Liebe zu einem Mäuserich, den der Zeichner George Herriman erfunden hatte, ließ sich Claras Vater von einem amerikanischen Freund für sie schicken. Clara war hingerissen, sie versank wochenlang in den Katzengeschichten, und als sie wieder auftauchte, hatten sich ihre Zeichnungen verändert.
Das wollte sie auch: Tiere zeichnen, die sich so töricht und zickig, eitel und heuchlerisch wie Menschen verhielten, gegen die jedoch niemand vor Gericht ziehen konnte, weil es schließlich nur Tiere waren, erfundene Figuren zur Erheiterung von Kindern.
Nichts ganz Wirkliches. Nichts, das man an sich heranlassen musste, wenn man nicht wollte.
Ihr Vater erzählte ihr, dass er Feldpostkarten voller Strichmännchen gezeichnet hatte, um ihrer Mutter vom Krieg zu berichten, weil er es in Worten nicht vermochte.
»Mit den Strichmännchen ging es. Was Strichmännchen erleben, kann man aushalten. Man kann so tun, als hätte es nichts mit einem selbst zu tun.«
Clara zeichnete Sidonie, eine Spinne, die ein Riesennetz unter Berlins Straßen spann und darin Fliegen fing, die niemals wieder auftauchten. Erich Ohser, Mutters Karikaturistenkollege vom Vorwärts, sah sich die Zeichnungen an und sagte zu Clara: »Dein Name passt zu dir. Clara, die Klarsichtige. Du siehst hin und benutzt zum Zeichnen dein Hirn. Wer das draufhat, kann in ein paar Strichen die Welt beschreiben.«
Er schenkte ihr ein Buch mit Gedichten von Erich Kästner, die er illustriert hatte, und ein Original seiner Zeichnungen: Adolf Hitler, der sich hinter einem Bild von sich selbst versteckte, weil es ihn vor seinem Anblick graute. Clara war begeistert. In Krazy Kat hatte die Katze sich einen Baum gezeichnet, um sich dahinter zu verstecken. In der Wirklichkeit war das unmöglich. Aber mit Bildergeschichten machte man eine Wirklichkeit sichtbar, die sich hinter der Wirklichkeit verbarg.
Sie hatte Blut geleckt und war voller Neugier gewesen, hatte lernen und immer besser werden wollen. Ihre Mutter hatte sie zu Zeichenkursen an der Kunstschule am Askanischen Platz angemeldet, die vom Verein der Berliner Künstlerinnen betrieben wurde.
Ihr Vater winkte ihr damals nach, als sie mit ihrer Zeichenmappe unter dem Arm hineinging. »Vergiss nie, dass Clara Schneider-Arndt alles kann, was sie will.«
Dann aber hatte es die Mutter von einem Tag auf den anderen nicht mehr gegeben, und Clara hatte begriffen, dass sie doch nicht alles konnte, was sie wollte. Sosehr ihr Vater es sich für sie wünschen mochte.
Jetzt stand er vor ihr und konnte sich noch immer nicht entschließen, sie gehen zu lassen. Wäre sie ihre Zeichenmitschülerin Saskia vor dem Altar gewesen, wäre das männliche Aktmodell sicher längst geflüchtet. So aber zogen nur ein paar Schülerinnen in kniekurzen Röcken an ihnen vorüber und stolperten mit verdrehten Köpfen weiter.
Claras Vater war ein Frauenschwarm. Groß, blond, klassische Züge, Schultern, um das Leben darauf zu balancieren. Das ganze Programm. »Als wir Anfang zwanzig waren, war ich rund um die Kasernen von Lübben die einzige Frau, die sich nicht nach ihm verschmachtet hat«, hatte ihre Mutter erzählt. »Vermutlich hat er mich deshalb angebettelt, ihn zu heiraten.«
Mit Mitte vierzig hatte sich daran nichts geändert. Die Frauen des swingenden, kämpfenden, Cocktails trinkenden, auf Barrikaden kletternden Berlin verschmachteten sich nach ihm und würden es vermutlich auch noch tun, wenn er Ende sechzig war. Wohl das Anziehendste an seinem Charisma war, dass er nicht zu bemerken schien, dass er es besaß. Aber das war lediglich eine Spekulation von Clara. Was sie von dem verstand, was sich zwischen Mann und Frau abspielte, hätte für eine Bildergeschichte nicht ausgereicht.
Ihr Vater achtete nicht auf die schmachtenden Blicke der Mädchen, die an ihren Rocksäumen zupften. Er hatte nur Augen für Clara, und in diesen Augen stand, dass er sich mit der Wirklichkeit, wie sie nun einmal war, noch immer nicht abfinden konnte: Er hatte die Liebe seines Lebens verloren. Und er wollte um keinen Preis hinnehmen, dass seine Tochter darüber ihre Zukunft verlor.
Die Zukunft, die sie wie drei Verschwörer zusammen erdacht und der sie entgegengefiebert hatten wie Pferde im Startblock. Claras Comicstrips auf Siegeszug von Berlin bis nach Tokio und New York. Sie hatten es vor sich gesehen. »Die Welt ist Clara Schneider-Arndts Auster.«
»Erich Ohser hat mich angerufen.« Ihr Vater trat von einem Bein aufs andere. »Er hat gesagt, wenn du mit ihm noch einmal über alles sprechen möchtest …«
»Möchte ich nicht«, sagte Clara, drückte seine Hand und ließ sie gleich wieder los. »Ich studiere Jura, Paps. Ich habe mich nun einmal dazu entschlossen, ich bin immatrikuliert, und dabei bleibt es auch.«
»Die deutsche Justiz«, hatte ihre Mutter gesagt, »ist auf dem rechten Auge blind. Wenn sie daran nichts ändert, wird man ihr eines Tages das linke ausstechen.«
»Und jetzt gehe ich«, sagte Clara.
»Warte noch einen Augenblick.« Ihr Vater streckte die Hand aus, ließ sie dann jedoch sinken, ohne sie zu berühren. »Nein, keine Sorge, ich versuche nicht noch einmal, dich von deinen Plänen abzubringen. Du bist Clara Schneider-Arndt, du tust, was du dir in den Kopf gesetzt hast, und von einem alten Mann lässt du dir nicht dreinreden.«
»Du bist kein alter Mann.«
Natürlich war er das nicht. Aber ein wenig erschrak sie darüber, dass man den alten Mann, der er einmal werden würde, in seinem klar geschnittenen Gesicht auf einmal erahnen konnte.
»Der alte Mann hat eine Überraschung für dich«, sagte er. »Bevor du dich in dein Jurastudium stürzt und darin zweifellos glänzen wirst wie in allem, was du anfängst, machst du noch einmal Ferien. Genau gesagt: wir beide zusammen. Und Tante Belle kommt auch mit, samt Malwine und Georgchen. Wir fahren nächste Woche, unser Zugabteil habe ich bereits reserviert.«
Claras Herz vollführte einen winzigen Satz. Jahr für Jahr, Sommer für Sommer, hatten sie zusammen Ferien gemacht, immer in derselben Stadt am Meer, in derselben Suite mit Blick auf den Hafen, und diese endlosen Sommer, deren Sand sie in ihren Schuhen mit nach Hause trugen, kamen ihr wie die Seele, wie der Kern ihrer Kindheit vor. Sie hatte ihre Freundin dort. Die zweite Seite ihrer Medaille. Wer eine Bildergeschichte über Clara zeichnen wollte, musste eine Manon zeichnen, die sich dahinter versteckte. Und umgekehrt. Vielleicht hatte sie auch deshalb die langen Sommer in der Ferne so genossen, weil sie dort vollständig gewesen war.
Claraundmanon.
Manonundclara.
Zwei in einem Atemzug.
Ein einziges Mal, vor drei Jahren, waren sie schon im Frühling hingefahren, weil sie nach der Stadt am Meer, nach ihren Alleen mit den Akazien und ihrem Markt voll exotischer Düfte solche Sehnsucht hatten. Diese drei Wochen bildeten Claras letzte Erinnerung an das sorglose Glück ihrer Familie. An eine Zuversicht, die auf dem festen Glauben beruhte, dass das Leben ihnen wohlgesonnen war.
Zehn Tage später war die Mutter gestorben, und seither waren sie nicht mehr dort gewesen. Ohne die Mutter hielte er es in der Stadt nicht mehr aus, hatte der Vater gesagt, und Clara hatte ihn verstanden, auch wenn sie getrennt von Manon ein Ruf ohne Widerhall war, eine Krazy Kat ohne Ignatz Mouse. Sie hatte aufgehört, Manon zu schreiben, weil Briefe zwischen zweien, die sich nicht wiedersahen, etwas Pathetisches und vor allem Sinnloses hatten. Sie hatte Manons Foto von der Frisierkommode in ihrem Zimmer entfernt, weil sie nicht wollte, dass jemand hereinkam und fragte: »Wer ist das?«
Meine Himmelsleiterschwester.
Manchmal träumte sie von Manon. In den Träumen saß sie vor der Frisierkommode, die sie nie zum Frisieren benutzte, und im Spiegel tauchte Manon an ihrer Seite auf.
»Wohin fahren wir denn?«, fragte sie ganz leise und fürchtete einen Augenblick lang, ihr Vater könne sie in irgendeinem dieser neuerdings modernen Ferienorte an der Riviera oder der Côte d’Azur eingebucht haben, der mit ihnen beiden nichts zu tun hatte.
»Wohin schon?«, fragte er zurück, und ihre Blicke trafen sich noch einmal, ehe er sich endlich zum Gehen wandte. »Dorthin, wo wir immer waren. Nach Odessa. In Odas Grandhotel.«
2
Oda
Es war einer dieser Tage, an denen Oda Liebenthal selbst jetzt noch in der Frühe erwachte und als Erstes dachte: Was immer geschehen ist und was noch geschehen wird – es gibt keinen Menschen, mit dem ich tauschen möchte.
Die Zeiten waren schwierig. Aber sie waren schon viel schwieriger gewesen. Und wenn Sommer war, so wie jetzt, bewies die Stadt Odessa einmal mehr ihr außerordentliches Talent, alle Zeiten samt ihren Schwierigkeiten zu ignorieren. Oda stand auf, durchquerte ihr Schlafzimmer und trat vor die bodentiefe Fenstertür mit dem geschmiedeten Geländer. Der Blick war ihr Kapital. Um diesen Blick zu genießen, überwanden Europas Reiche und Schöne jegliche Ressentiments gegen den kommunistischen Superstaat und fragten nicht nach dem Preis für eine Suite mit Balkon und Sonderbehandlung.
Entlang der Flanke von Odessas berühmter Himmelstreppe führten die in fünf Terrassen angelegten Gärten des Hotels. Wo sie endeten, erstreckte sich die Hafenstraße, vor der sich der Wald der Schiffsschornsteine erhob und die Molen ins Meer ragten. An Tagen wie diesem machte das Meer seinem Namen Ehre und glänzte ölschwarz mit goldenen Sprenkeln.
Das Hafengelände war nicht mehr so schön wie auf den Stichen in den Rauchzimmern, nicht mehr so nostalgisch und verträumt mit seinen alten Silos und den Hütten der Zollbeamten, vor denen junge Burschen auf Säcken saßen und träge auf Arbeit warteten. Die neuen Gebäude waren zweckmäßig und modern, aber wenn man die Straße in Richtung Westen hinunterging, geriet man vom zackigen Schreiten automatisch ins Schlendern, sobald man die Strandpromenade mit ihren belaubten Akazien und den Verkaufsbuden unter ihren weiß und bonbonfarben gestreiften Dächern erreichte.
Hier war das alte Odessa noch so gut wie unverändert. Das Odessa der Eiswaffeln und des Sandspielzeugs, der Wasserbälle und Badekabinen, der jüdischen Fischgerichte und griechischen Süßigkeiten, der flanierenden Damen in Pariser Sommergarderobe und der Kinder, die quietschend vor Glück ins Meer rannten. Odessa an einem hellen Sommertag war ein blauer Edeltopas, der von allen Seiten funkelte. Odessa war eine Nische.
Wie sehr es Menschen nach diesen Dingen verlangte, hatte Odas Vater Philipp Liebenthal erkannt, als er vor bald fünfzig Jahren alles – sein Erbe, seine Ehre, sein Lebensglück – geopfert hatte, um an dieses Ufer, über Odessas Bucht sein weißes Hotel zu bauen. »Wer durch die Tür meines Hauses tritt, soll vergessen, was auch immer da draußen wütet«, hatte er gesagt. »Von mir aus kann er vergessen, wer er ist, und für die Dauer seines Aufenthalts werden, wer immer er sein will.«
Philipp Liebenthal hatte sein Hotel in eine Bühne verwandelt, über die die Worte aus Shakespeares Sturm zu hallen schienen: »Wir sind aus solchem Stoff, wie Träume sind …« Das Licht der Empfangshalle war golden, die Musik sanft und die Luft erfüllt vom zartesten Duft nach Minze und Rosenknospen. Das Grandhotel Odessa zwang nichts auf, doch es schloss auch nichts von dem aus, was Menschen sich erträumten.
Die Plakate von Intourist, die Oda in der Empfangshalle hatte aufhängen müssen, gaben von alledem nichts wieder. Sie waren so, wie Werbung für die Lebensart der modernen Sowjetunion eben zu sein hatte: klare, knallige Farben und Formen, kein Pastell, keine weiche Schattierung, kein überflüssiger Strich. »Es ist nicht nur ein Urlaub«, stand in zackigen Lettern unter dem Bild. »Es ist eine Reise in eine neue Welt.«
So lautete jetzt eben das Gebot der Stunde: Alles musste neu sein – die neue Welt, die neue Ordnung, der neue Mensch. Dass es aber für wahre Ferien, für völlige Entspannung und Erholung erlaubt sein musste, ein wenig im Altbekannten zu verharren, zwischen der vertrauten Behaglichkeit des Alten und dem abenteuerlichen Neuen hin- und herzutaumeln, das verkannten die beflissenen Werbefachleute von Intourist.
Die Plakate mit ihrem grellen Rot und Gelb und dem albernen Slogan waren Schandflecke in einem Raum, in dem sonst alles mit Harmonie und Unaufdringlichkeit im Sinn gestaltet worden war. Die Farben des Grandhotel Odessa waren das Weiß und die verschwimmenden Blautöne des Meeres, in deren Schönheit ein Gast eintauchen und sich verlieren konnte. Solche Farben taten der erschöpften Seele gut, so wie das Meer ihr guttat, weil es einfach da war und sie einlud, ohne etwas von ihr zu verlangen.
Das aber einem dienstbeflissenen Sowjetkommissar zu erklären, wäre verlorene Liebesmüh gewesen, und sich verlorene Liebesmüh zu sparen, hatte Oda gelernt. So wie ihre Gäste gelernt hatten, über die hässlichen Plakate hinwegzusehen. Vielleicht bestand ja darin das ganze Geheimnis eines guten Lebens in schwierigen Zeiten: das Mögliche auszuschöpfen und das Unvermeidliche zu ignorieren. Und das Geheimnis des Grandhotel Odessa, das ein Stück Belle Époque in eine auf Nüchternheit setzende Gegenwart rettete, mochte darin bestehen, dass es von einem Schwärmer gegründet worden war, jedoch von einer Pragmatikerin geleitet wurde.
Pragmatismus war ein höchst nützliches Werkzeug, wenn man ein Luxushotel in einer Zeit führen wollte, in der allein das Wort Luxus als Insignie des Teufels galt. Alles in ausreichender Menge aufzutreiben, was die Standards des Odessa erforderten, glich an den meisten Tagen einem Hindernislauf, bei dem der Streckenverlauf sich im Minutentakt änderte. Erschwerend hinzu kam, dass ein Hotel wie dieses sich nicht rentabel betreiben ließ, solange es nicht den größten Teil des Jahres über zu mindestens zwei Dritteln ausgebucht war. Die Jahre, in denen Oda sich die Gäste hatte aussuchen können, waren vorbei. Inzwischen musste sie sie nehmen, wie sie kamen, und über so manche hinwegsehen wie über die geschmacklosen Plakate.
Nicht immer war das einfach gewesen. Anfangs, gleich nach der Revolution, waren in den Balkonsuiten Rotarmisten einquartiert worden, die ihre Füße in Knobelbechern auf Chintzpolster legten, Zigaretten in Pflanzkübeln ausdrückten und jahrzehntealten Wein wie Wasser soffen. Kurz darauf war die Tscheka gekommen und hatte ganze Flure mit Zimmern beschlagnahmt, um Verdächtige zu internieren. Wo zuvor Europas vom Glück begünstigte Klasse ihre glamouröse Sommerfrische genossen hatte, wurden jetzt über Nacht Entrechtete eingeschüchtert und verhört.
Wegzuhören, die Gänge mit den versiegelten Räumen zu meiden und den Gästen, die auf der Sonnenterrasse ihr Frühstück einnahmen, einen schönen Tag zu wünschen, hatte Oda all ihre Kraft gekostet. Dass ausgerechnet der Mensch, von dem sie mehr als von jedem anderen hatte verstanden werden wollen, dazu nicht in der Lage gewesen war, hatte sie zusätzlich zermürbt:
»Wie kannst du lächelnd Schlehenkonfitüre auffüllen und so tun, als wenn nichts wäre? Die armen Schweine da oben erleben nie wieder einen schönen Tag!«
»Ich bin keine Heldin, Bodo. Ich führe ein Hotel.«
Er hatte seine Heldin geheiratet, die bereit gewesen war, für die Rechte armer Schweine zu sterben. Oda wollte leben und für die kämpfen, die ebenfalls leben wollten. Natürlich brauchten die Menschen in dem von Krieg und Seuchen und Umwälzung gebeutelten Kontinent Brot und Medikamente dringender als einen Luxusurlaub. Aber die Aussicht auf einen Luxusurlaub machte so manchen Berg, der unüberwindlich erschien, erklimmbar.
»Verurteile mich nicht, Bodo.«
»Dazu habe ich kein Recht.«
Das Karussell der Gäste drehte sich weiter. Nach den Rotarmisten kamen die Deutschen, von der Entente geduldet, um das Gespenst des Kommunismus aufzuhalten. Sie hausten im Grandhotel wie die Herren der Welt, und als nach ihrer Vertreibung die Odessiten eine Nacht lang ihre Freiheit feierten, stand die Rote Armee schon wieder vor der Tür.
Maria Peters, das Faktotum, das von Rechts wegen Lidija Petrowna Bezborodko hieß und seit der Revolution von 1905 im Grandhotel Odessa logierte, sagte zu Oda: »Wenn man morgens nicht weiß, wer einen abends regieren wird, lohnt es sich nicht, sich deswegen Kopfschmerzen einzuhandeln.«
Die Roten allerdings machten diesmal Ernst. Und keinen Hehl daraus, dass sie gekommen waren, um zu bleiben. Das störrische, freiheitsliebende Odessa sollte gezähmt und enteignet werden, seine Bewohner nicht mehr an Besitz behalten als pro Kopf drei Unterhosen und ein zweites Hemd für den Sonntag. Keinen Schmuck, kein Fahrrad, keine Familienbibel, weder ein Schnitzmesser noch eine Ladenkasse, keine Töpferscheibe, kein Butterfass und erst recht kein weißes Hotel über Odessas Küstenlinie.
Sie hätten es jeder Familie entreißen wollen, denn Familien mit Privateigentum sollte es ja nicht länger geben. Umso zorniger, ja hasserfüllter hatten sie es jedoch auf den Besitz derjenigen Odessiten abgesehen, die sie als die Deutschen schmähten, auch wenn diese – von Katharina der Großen ins Land gerufen – seit der Gründung der Stadt in Odessa lebten. Familien wie die Liebenthals. »Solchen wie euch lassen wir nicht einmal die Fetzen auf dem Leib«, hatte Anselm Fleißer, der beauftragte Politkommissar, ihr ins Gesicht geschleudert, und die Tatsache, dass Anselm selbst Schwarzmeerdeutscher war, spielte dabei keine Rolle.
An das Gefühl würde sich Oda ihr Leben lang erinnern. Sie hatte sich gezwungen, stehen zu bleiben und Anselm die Stirn zu bieten, doch während sie ihrem Körper das Zittern verbot, spürte sie tatsächlich, wie sich ihr das Haar im Nacken sträubte.
Maria Peters hingegen war gelassen geblieben. »Von all den törichten Spruchweisheiten, die einem im Laufe des Lebens um die Ohren geblasen werden, hat nur eine sich als wahr erwiesen«, hatte sie gesagt. »Wie man sich bettet, bleibt man ja nicht liegen, und Unrecht Gut gedeiht in den meisten Fällen. Aber es wird nur verschwindend selten etwas so heiß gegessen wie gekocht.«
Ganz so einfach war es allerdings nicht. Aber das wusste Maria Peters aus der Zeit, als sie noch Lidija Petrowna Bezborodko geheißen hatte, selbst. Sie hatte schließlich eine Revolution – die von 1905 – hinter sich, und wie sie die überlebt hatte, hatte sie Oda in all den Jahren ihrer Freundschaft nie erzählt.
Vermutlich nicht viel anders als ich die von 1917, dachte Oda und erzählte das, was sie getan hatte, um die Leitung des Hotels nicht zu verlieren, ebenfalls keinem Menschen. Sie fand, sie hatte keine Wahl gehabt: Das Bristol, ihr Konkurrent in der noblen Puschkinstraße, war geschlossen und erst zehn Jahre später unter dem Namen Krasnaja – Rot –wieder aufgemacht worden, und das pompöse London führten Beauftragte der Partei, die es zugrunde richten würden. Das Odessa hingegen war noch immer das, was es gewesen war, und seine Zügel lagen in den Händen von Menschen, die es liebten. Das war den Einsatz wert, konstatierte Oda und zog unter das Ganze einen Strich. Über die Angst, die sie in jenen Tagen gehabt hatte, hatte sie gedacht: Die halte ich einmal aus und dann nie wieder. Wenn ich noch einmal solche Angst haben muss, wird mir davon das Herz zerspringen.
Aber die Angst war vergangen, die Politkommissare waren abgezogen, und das, was unvorstellbar erschienen war, war zum Alltag geworden. Inzwischen kamen ins Odessa wieder vorwiegend Menschen, um die schönste Zeit des Jahres hier zu verbringen, die paar kurzen, unwiederbringlichen Wochen, die ihnen allein gehörten. Hinzu gesellten sich einige, die sich auf längere Zeit einmieteten, um zu arbeiten, sich von der Arbeit zu erholen oder beides zugleich. Vorwiegend Künstler, ein Fotograf und wechselnde Dichter und Schriftsteller, die regelrechte Zirkel bildeten. Es bereitete Oda Freude, trotz der Widrigkeiten für sie alle zu sorgen, denn es war die Aufgabe, für die sie geboren war.
Auf die zweite Terrasse der Hotelgärten, inmitten eines Labyrinths, hatte ihr Vater einen Springbrunnen mit einem Faun aus schwarzem Marmor gebaut, der dort sprudeln sollte, solange das Hotel bestand. Der Sinn von Odas Leben war es, dafür zu sorgen, dass der Brunnen des Fauns immer sprudelte, bis sie ihn eines Tages in die Obhut eines ihrer Kinder übergeben würde.
Die Sowjetunion kämpfte noch immer an allen Fronten darum, zwischen Versorgungsengpässen und lokalen Aufständen ein Bein auf den Boden zu bekommen, aber manches beruhigte sich und spielte sich ein. »Das Leben ist leichter, es ist fröhlicher geworden«, verkündete Stalin, der nach Lenins Tod das Ruder des schlingernden Staatsschiffs übernommen hatte, in einer Rede, die sämtliche Zeitungen abdruckten, und von der Hand zu weisen war das nicht.
Das Leben hatte diese Tendenz, fand Oda. Es musste nach jeder Tragödie, jeder Katastrophe, jedem Zusammenbruch irgendwann wieder fröhlich werden, weil der Drang dazu im Menschen steckte: Er wollte in der knapp bemessenen Zeitspanne, die ihm auf der Welt vergönnt war, nichts so sehr, wie ab und an fröhlich sein.
Stalin war gewitzter und kaltblütiger als Lenin, er scheute sich nicht, sich alles zunutze zu machen, wovon er sich etwas versprach. Sein sozialistischer Staat brauchte Devisen, wenn er auf lange Sicht überleben wollte, und Hotels, die Besucher aus dem Ausland dazu verführten, mit vollen Händen Geld auszugeben, schafften diese Devisen ins Land. Oda Liebenthals Odessa war die reinste Devisenfalle. Also ließen Stalins Leute sie machen und fragten nicht allzu genau nach. Wenn das Politbüro in Moskau Abordnungen in die verhasste Ukraine entsandte, logierten sie selbst gern im Odessa, und Oda sorgte dafür, dass roter Sekt von der Krim in Strömen floss.
Ja, es ist gut gegangen, hielt sie fest. Wir sind noch einmal davongekommen, und dass uns das Grauen, das uns fast zu Fall gebracht hätte, in den Knochen sitzt, hat auch sein Gutes. So schnell schreckt uns nichts mehr. Ein wenig Stolz verspürte sie durchaus. Sie hatte nicht nur ihr Hotel, sondern auch ihre Familie, die sie sich so zahlreich gewiss nicht gewünscht hatte, durch die Stürme gesteuert. Dass nicht jedes Mitglied sie liebte, nahm sie in Kauf, denn ihr selbst erging es nicht anders. Gleiches Blut machte Menschen nicht zu Freunden, und auch auf Dankbarkeit legte Oda keinen Wert. Man schützte seine Familie, nicht weil man von edlen Instinkten geleitet war, sondern weil man es eben so machte, ein wildes Tier tat nichts anderes. Ihre Familie brachte ihr Respekt entgegen, selbst solche Angehörige wie Mascha Vitalyewna, Tante Tessas Tochter und Odas Cousine, die einst an ihrem Grab keine Träne vergießen würde.
Das genügte ihr.
Anselm Fleißer zählte sie allerdings nicht zur Familie, obwohl er und sie blutsverwandt waren. An Anselm Fleißer dachte sie ohnehin nur, wenn es sich überhaupt nicht vermeiden ließ, und da Anselm in seiner Funktion die meiste Zeit fern von Odessa verbrachte, gestaltete sich das mit dem Vermeiden nicht allzu schwierig. Zumindest tagsüber, wenn sie alle Hände voll zu tun hatte. Anselm hatte einmal geschworen, ihr das Liebste zu nehmen, was sie besaß, und daran, dass er es erneut versuchen würde, hegte Oda keinen Zweifel. Er war kein Niemand, sondern konnte ihr gefährlich werden, doch sie hatte gelernt, was gegen eine Trumpfkarte half: ein noch höherer Trumpf. Den hatte sie sich verschafft und dafür gesorgt, dass er in ihrem Ärmel blieb. Seither schlief sie zwar nicht gerade friedlich und entspannt, aber immerhin lange genug, um halbwegs erfrischt zu erwachen.
Ihre Ehe war wohl kaum das, was ein junges Mädchen wie Manon sich erträumte. Aber es war ihr immerhin gelungen, mit Leo Ullrich, dem Mann, den sie aus einer Notlage heraus geheiratet hatte, eine Art von Freundschaft aufzubauen, von der sie beide profitierten. Sie ließen sich gegenseitig sämtliche Freiheiten und wohnten auch nicht zusammen, weil sein Schlaf- und Arbeitsrhythmus dem ihren nicht entsprach. Wenn Oda ehrlich war, wusste sie gar nicht, ob Ullrich überhaupt je arbeitete. Er hatte vor dem Krieg einen einzigen, sehr erfolgreichen Roman herausgegeben und anschließend noch ein paar Artikel und Kritiken verfasst, doch von späteren Veröffentlichungen war ihr nichts bekannt.
Ihr war es egal. Sie mischte sich nicht in seine Angelegenheiten, und er nicht in ihre. Geld spielte keine Rolle. Von dem beträchtlichen Vermögen, das er als Mitglied des baltendeutschen Adels vor dem Zugriff der Revolution hatte retten können, hatte er einbehalten, was er zum Leben brauchte, und den Rest Oda überschrieben. Das Zimmer, das er gemietet hatte, als er vor gut zwanzig Jahren nach Odessa gekommen war, bewohnte er noch heute, während Oda in einem Schlafzimmer der Familienwohnung schlief, in der auch ihre Kinder untergebracht waren.
Auf diese Kinder empfand sie vielleicht den größten Stolz. Sie hatte sich nie welche gewünscht, hatte die Verzweiflung, die ihre kinderlose Cousine Mascha umtrieb, nie nachvollziehen können, und hatte für drei der fünf, die sie mehr oder weniger zufällig bekommen hatte, jahrelang keine Liebe empfinden können. Dennoch hatte sie ihr Bestes gegeben, um sie vor allem Übel zu behüten und mit höchster Sorgfalt großzuziehen. Dass sie ihr im Laufe der Jahre ans Herz gewachsen waren, hatte sie kaum bemerkt. Nicht alle im gleichen Ausmaß zwar, aber doch alle hoffentlich ausreichend, um sie für ihr Leben zu rüsten.
So sehr wie bei den eigenen Eltern verlangte man nach Liebe womöglich nie wieder von einem Menschen, und der Mangel daran blieb ein Leben lang spürbar. Oda selbst konnte davon ein trauriges Lied singen, und nicht selten hatte sie gefürchtet, das, was ihr angetan worden war, an das eine oder andere ihrer Kinder weiterzugeben. Alle fünf aber waren zu Menschen herangewachsen, derer sich niemand zu schämen brauchte. Nicht alle waren mit der Veranlagung zum Glücklichsein geboren, was ihr zuweilen Sorge bereitete, doch soweit es ihrer Natur entsprach, schienen sie stabil und zufrieden zu sein.
Alle fünf. Vier Söhne und ein Mädchen, das nicht ihre Tochter war. Auch einer der Jungen, Maxim, war nicht ihr leibliches Kind, und seltsamerweise waren es diese beiden, die sie mit beinahe schmerzlicher Inbrunst liebte. Hätte Anselm Fleißer ihr eines ihrer Kinder rauben wollen, um sie zu vernichten, hätte er eines von diesen beiden auswählen müssen. Maxim und Manon waren wie das Hotel – sie konnte sich nicht vorstellen, wie sie weiterleben sollte, wenn einem von ihnen etwas geschah.
Aber ihnen würde nichts geschehen. Weder Anselm noch irgendein anderer wäre auf den Gedanken gekommen, dass Oda Liebenthal den Sohn einer Küchenhilfe, den sie in Odessas Katakomben gefunden und großherzig aufgezogen hatte, oder das Mädchen, das ihre zur Mutter ungeeignete Wahlschwester Belle ihr hinterlassen hatte, mehr liebte als ihre drei eigenen wohlgeratenen Söhne:
Edvard, ihr Erstgeborener, der unglaubliche zwanzig Jahre alt wurde.
Hanno, die Frohnatur der Familie, der, obwohl mitten im Krieg geboren, als Hans im Glück zur Welt gekommen und inzwischen siebzehn war.
Und Kasimir, der Jüngste, der völlig überraschende Nachzügler, der 1920 geboren war, als sie sich reichlich naiv in der trügerischen Sicherheit gewiegt hatte, keine Kinder mehr zu bekommen. Auch er war mittlerweile schon zwölf Jahre alt.
Manon war einundzwanzig, volljährig, aber noch immer von kindlicher Anhänglichkeit und Verträumtheit, und Maxim war noch ein Jahr älter, ein Dichter, Schwärmer und Rebell, den es mit Macht in die Welt zog und der doch den Absprung noch nicht gefunden hatte.
Möge er ihn nie finden!, wagte Oda ein hastiges Stoßgebet, das sie gleich darauf bereute. Natürlich musste ein junger Mann seinen Weg gehen, sich erproben dürfen, sich die Hörner abstoßen, und sie hatte Maxim mehr als einmal versichert, dass sie ihn in allem, was er beschloss, unterstützen würde. Dennoch konnte sie sich insgeheim nicht der Hoffnung erwehren, dass es Maxim sein würde, der sich letzten Endes entschloss, hierzubleiben, ein odessitisches Mädchen zu heiraten und das Odessa weiterzuführen.
Ein odessitisches Mädchen.
War sie aufrichtig zu sich selbst, so meinte sie damit keine andere als Manon.
Dass es die beiden zueinander zog und zwischen ihnen eine ungewöhnliche Zärtlichkeit erwuchs, war Oda nicht entgangen. Zudem war Manon keine, die mit ihren Gefühlen hinterm Berg hielt. »Maxim ist ein Märchenprinz, findest du nicht auch?«, hatte sie Oda gefragt, nachdem sie zu Neujahr mit ihm in der zugefrorenen Bucht zum Schlittschuhlaufen gegangen war. »Wie der aus dem Märchen mit der Zauberweide.«
Oda hatte ihr nicht gesagt, dass sie an die meisten Märchenprinzen nicht glaubte und die wenigen, die es gab, für gefährlich hielt. Stattdessen hatte sie sie mit gebührender Strenge darauf hingewiesen, dass sie allmählich zu alt für solche Geschichten wurde und sich in einem sozialistischen Staat wohl auch besser nicht ausgerechnet nach einem Prinzen umsehen sollte. Nicht zum ersten Mal fürchtete sie, dass ihre hoffnungslos romantische Ader Manon zum Verhängnis werden könnte. Den Spitznamen Schneewittchen hatte ihr Vater ihr seinerzeit so treffend verliehen, und ihr väterliches Erbe konnte sie nicht verleugnen, was sie für Oda nur noch kostbarer machte.
Ganz von der Hand weisen ließ sich die Feststellung der jungen Frau trotzdem nicht:
Manon und Maxim waren auf eine altmodische, eine märchenhafte Weise schön. Wenn sie zusammen durch Odessas Flaniermeile, die Deribasowskaya, gingen, drehten die Leute sich nach ihnen um, selbst die, die sonst zynisch und verhärtet auf die ganze Welt blickten. Hätte man ein Paar von Darstellern gesucht, um das Märchen von der Zauberweide zu verfilmen, so hätten die beiden spielend das Rennen gemacht. In der Sowjetunion wurden jedoch andere Filme gedreht, und weder Maxim noch Manon hätten die nötige Zähigkeit besessen, um im modernen Filmgeschäft zu bestehen.
Und dennoch – dieser Sommer war von einem Märchenfilm, wie es sie nicht mehr geben sollte, nicht allzu weit entfernt. Das Wetter war seit Wochen herrlich, der Himmel wolkenlos, das Meer von Tag zu Tag wärmer. Das Odessa war ausgebucht bis Ende September, die vorwiegend ausländischen Reisenden würden Geld hereintragen und Oda nach langer Dürrezeit einen Winter des Aufatmens verschaffen. Die kleinen Badekarren, die sie traditionsgemäß mit weißen Ponys bespannen ließ, zuckelten von früh bis spät hin und her, um Hotelgäste morgens zum Badevergnügen an den Strand und abends müde, sonnenverbrannt und salzverkrustet wieder zurückzubringen. Maxim war noch hier, sie waren alle noch hier, und was zwischen ihm und Manon nicht war, konnte womöglich in diesem Zaubersommer noch werden.
Und die, die nicht hier waren – der Rest der Familie, den Oda drei Jahre lang mehr vermisst hatte, als sie sich eingestehen wollte –, würden heute eintreffen! Sie würden noch einmal alle zusammen einen Sommer verleben wie in den Jahren, als die Kinder gepunktete Spielhosen getragen und Schlösser aus Sand gebaut hatten. Noch einen Sommer in Odessa, ehe womöglich alles auseinanderstrebte, noch einen Sommer, den man später Jugend nennen und verklären würde, als ließe die ganze Strapaze des Heranwachsens sich in sechs sonnigen Wochen wie in einem Brennglas einfangen.
Sie würde ihre Turnübungen machen, sich anziehen und mit Tessa und Andreja abklären, dass es für das abendliche Meeresfrüchtebüfett an nichts fehlte, ehe sie zum Bahnhof nach Holovna fuhr, um ihre Familie abzuholen.
Belle, ihre Stieftochter Malwine und ihren kleinen Sohn Georg, der so klein nun auch nicht mehr, sondern wie ihr eigener Nachkömmling Kasimir zwölf Jahre alt war. Und Bodo und Clara. Von denen sie manchmal befürchtet hatte, sie nicht wiederzusehen.
Oda nahm sich nur in Ausnahmefällen ein paar Stunden frei, aber heute hatte sie mit ihrer Tante Tessa vereinbart, dass diese sie am Nachmittag vertreten würde. Die gewonnene Zeit würde sie zu schätzen wissen wie ein Juwel: Sie wollte mit ihren Besuchern auf der hinteren Terrasse sitzen, über den Faunenbrunnen hinweg auf das Meer blicken und feiern, dass sie einander auch dieses Mal nicht verloren hatten.
»Komm noch einmal hierher. Sind wir nicht deine Familie, sind wir das nicht immer gewesen?«
»Und wenn ich es nicht aushalte?«
»Dann halten wir es zusammen nicht aus. Du bist nicht der Einzige, dem dieser Weltenbrand etwas entrissen hat, Bodo.«
Er würde kommen. Er saß mit seinem Clan in seiner geliebten Eisenbahn und wäre in knapp drei Stunden schon hier. Bodo. Mit den Brüdern war es womöglich wie mit den Söhnen: Denen, die man sich selbst gewählt hatte, war man stärker verbunden als jedem Verwandten im Blut.
Nein, es gab wirklich keinen Menschen, mit dem Oda, die am Fenster ihres Schlafzimmers stand und ihren Blick in die Weite schweifen ließ, an diesem Morgen hätte tauschen mögen. Natürlich würden sie auch weiter mit Problemen zu kämpfen haben. Die Missernte des letzten Jahres und die Gesetze zur Zentralisierung führten zu Engpässen, wie sie sie in der Zeit der Neuen Ökonomischen Politik kaum erlebt hatten, und die Wirtschaftskrise, die die ganze Welt erfasst hatte, tat ein Übriges. Ihre Gäste aber würden davon nichts merken, sondern sorglos den Sommer auskosten können. Um dafür zu sorgen, war sie schließlich da. Oda öffnete das Fenster weit, um die frische, salzige Morgenluft hereinzulassen, und begann, ihre Glieder zu dehnen.
In diesem Augenblick – dem einen heiligen, den sie tagtäglich für sich allein reservierte – klopfte es an der Tür.
3
Oda
Es tut uns leid, Sie zu stören, Frau Liebenthal.«
Oda hatte sich ihren Morgenmantel übergeworfen, ehe sie Jurij die Tür öffnete. Der Assistent des Empfangschefs wirkte außer Atem. Einen halben Schritt hinter ihm stand Mitja, einer der Jungköche, der sich besonders herausgemacht und es vor Kurzem zum Rôtisseur gebracht hatte. Die jungen Leute zu fördern war wichtig. Sergej, ihr Küchenchef, dessen Kunst der Küche des Hotels weit über Odessa hinaus seinen Ruf verschafft hatte, wurde gebrechlich, ihre ganze alte Garde, die noch für ihren Vater gearbeitet hatte, wurde gebrechlich, und ein wenig graute es Oda davor, Ersatz für sie alle finden zu müssen. Was sie brauchte, hatte Seltenheitswert: Leute, die sich als so verlässlich, so loyal und so unbezahlbar erweisen mussten wie jene, die mit ihr und dem Hotel durch Krieg und Revolution gegangen waren.
Einer von ihnen war Sebastien, der Empfangschef, der im Nebel irgendeiner Vorzeit aus einer Stadt namens Bayonne ans Schwarze Meer gekommen war und mit seiner Grandezza, seinem französischen Schick, seiner eleganten Haltung all das repräsentierte, wofür das Odessa stand. Wenn die Gäste ihn in seinem tadellos sitzenden Frack in der Halle stehen sahen, wenn sie hörten, wie er sie formvollendet in sämtlichen Weltsprachen begrüßte, fiel etwas von ihnen ab. Sie wussten ihre Ferien in kompetenten Händen, wussten, sie hatten bei ihrer Wahl Geschmack und Stil bewiesen, und fingen im selben Augenblick an, sich zu entspannen.
Aber le grand Sebastien, einer ihrer Männer der ersten Stunde, baute zusehends ab. Er wurde so dünn, dass der Frack trotz ständiger Änderungen an ihm schlackerte, und auch wenn er es niemals eingestanden hätte, bereitete ihm jeder der schnellen Gänge, die er früher nebenher erledigt hatte, Mühe und schmerzende Gelenke.
Jurij, sein Assistent, den er sich selbst ausgebildet hatte, hatte von einem Zwischenfall während der Revolution einen steifen Arm zurückbehalten, was ihn daran hinderte, eine annähernd elegante Figur zu machen. Er war ohnehin nicht der Typ, sondern im Vergleich zu dem imposanten Sebastien eher unscheinbar, aber er war ein Arbeitstier ohnegleichen.
Für das Hotel wie für die Familie wäre er durchs Feuer gegangen, daran bestand kein Zweifel, denn er hatte es bereits unter Beweis gestellt. Das zerschossene Schultergelenk war die Folge davon. Oda hatte in einem der wahnwitzigsten Augenblicke ihres Lebens die Frau gerettet, die Jurij liebte, und Jurij war ein Elefant: Er würde versuchen, ihr diese Tat zu vergelten, bis er starb. Oda war sicher, es kränkte ihn, dass das Triumvirat der Damen – Tessa, sie selbst und Maria Peters – zwar begonnen hatte, von Sebastiens Nachfolge zu sprechen, dass sein Name dabei jedoch nicht fiel.
Was sollte sie tun?
Um als Empfangschef das Hotel zu repräsentieren, fehlte ihm das Entscheidende: die Unversehrtheit. Den Leuten, die hierherkamen, hatte der Krieg ihre Unschuld und ihr Gottvertrauen geraubt. Sie wollten an diesen Krieg nicht länger denken, und jedes entstellte Gesicht, jedes fehlende oder versehrte Glied rief die verhasste Erinnerung wach.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: