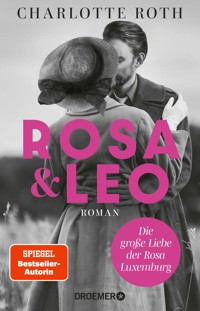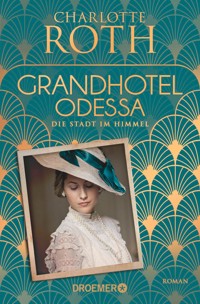9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Wintergarten-Saga
- Sprache: Deutsch
Die Wunderweiber swingen sich durch Berlins wildeste Zeit … Die Geschichte um das berühmte Varieté Wintergarten geht endlich weiter! »Die Sehnsucht brennt« ist der 2. historische Roman aus Charlotte Roths Trilogie »Die Wintergarten-Frauen« um drei Freundinnen und das Berliner Varieté-Theater Wintergarten in den 20er- und 30er-Jahren. Berlin 1927. Es sind die Goldenen Zwanziger, und die Hauptstadt tanzt auf dem Vulkan. Wir amüsieren uns zu Tode – so lautet das Motto der heißen Nächte im berühmten Varietétheater Wintergarten. Hier präsentiert Nina Veltheim ihre Wunderweiber, und ihr Star ist die "Schlangenfrau" Jenny Alomis, die auf den Fußsohlen Champagner balanciert und sämtlichen Männern den Verstand raubt. Privat scheint Jenny bei Ninas Bruder Carlo ihr Glück gefunden zu haben, doch die Tänzerin im Sturm birgt ein dunkles Geheimnis, das sie nicht einmal Nina anvertraut. Sie will das Grauen vergessen, vor dem sie aus ihrer Heimatstadt Riga floh. Doch eines Tages fordert die Vergangenheit ihren Tribut … Champagner und kurze Nächte, hochfliegende Hoffnungen und Stürze ins Bodenlose: Niemand fängt die schillernde Atmosphäre im Berlin der Zwanziger Jahre so fesselnd ein wie Bestsellerautorin Charlotte Roth! Wie sich Jennys Freundin Nina von Veltheim gegen den Widerstand der Männer ihren Traum erfüllt, Theater-Intendantin zu werden, erzählt der historische Roman »Der Traum beginnt«, Teil 1 der Trilogie »Die Wintergarten-Frauen«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 557
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Charlotte Roth
Die Wintergarten-Frauen
Die Sehnsucht brennt
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Berlin 1927. Es sind die Goldenen Zwanziger, und die Hauptstadt tanzt auf dem Vulkan. Wir amüsieren uns zu Tode – so lautet das Motto der heißen Nächte im berühmten Varietétheater Wintergarten. Hier präsentiert Nina Veltheim ihre Wunderweiber, und ihr Star ist die »Schlangenfrau« Jenny Alomis, die auf den Fußsohlen Champagner balanciert und sämtlichen Männern den Verstand raubt. Privat scheint Jenny bei Ninas Bruder Carlo ihr Glück gefunden zu haben, doch die Tänzerin im Sturm birgt ein dunkles Geheimnis, das sie nicht einmal Nina anvertraut. Sie will das Grauen vergessen, vor dem sie aus ihrer Heimatstadt Riga floh. Doch eines Tages fordert die Vergangenheit ihren Tribut …
Inhaltsübersicht
Zum besseren Verständnis zeithistorischer [...]
Widmung
Motto
»Und nun zum zweiten [...]
Auftakt
1. Kapitel
Erste Nummer
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
Zweite Nummer
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
Dritte Nummer
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
Glossar
Zum besseren Verständnis zeithistorischer und lokaler Begriffe enthält dieser Roman am Ende ein Glossar.
Für die aus Riga
»Alles andere findet sich. Oder auch nicht. Solange man am Leben bleibt, Herzing, ist der Unterschied gar nicht so groß.«
Jenny Alomis
»Und nun zum zweiten Mal, meine Damen und Herren, mein höher als hoch verehrtes Publikum – willkommen in der Welt der Wunder!«
Das ist ein Zitat aus dem ersten Band meiner Wintergartenfrauen. Direktor Neugebauer begrüßt damit nach der Pause die Gäste in seinem Varieté.
Ich hoffe, Sie alle haben die Pause gut überstanden, Ihnen wurden Getränke serviert und Sie haben sich angeregt unterhalten. Dass Sie den zweiten Roman meiner Wintergarten-Reihe gekauft haben, freut mich immens, denn das muss ja wohl bedeuten, dass Sie den ersten gemocht haben (oder dass Sie ihn gar nicht gelesen haben und dieser hier Ihnen aus Versehen unter die Einkäufe gerutscht ist, aber diese Möglichkeit lasse ich jetzt mal außer Acht).
Dieses Varieté hat die Pause ebenfalls überstanden, denn dazu sind Varietés schließlich da. Sie sind die Stehaufmännchen der Unterhaltungswelt und haben keinen anderen Zweck, als Sie zum Staunen zu bringen, Sie aus den Widrigkeiten Ihres Alltags zu reißen und Sie gnadenlos zu amüsieren. Falls morgen die Welt untergeht, wollen wir heute immerhin noch einmal unseren Spaß gehabt haben.
Diesen Spaß möchte ich Ihnen gerne bereiten. Bitte lassen Sie mich wissen, ob es mir gelungen ist – und wenn ja, was Sie besonders erfreut hat, und wenn nicht, was Ihnen mehr Vergnügen gemacht hätte. Auf Instagram, Twitter und Facebook sowie auf meiner Website www.charlotte-lyne.com freue ich mich jederzeit über Ihren Besuch.
Wen aus der Schar, die ich vor Ihnen aufmarschieren lasse, es tatsächlich gegeben hat und welches Kaninchen ich aus meinem eigenen Hut gezaubert habe, lasse ich Sie dieses Mal selbst herausfinden. Sie sind ja clever, haben zweifellos Google und Nachschlagewerke zur Hand, und ein bisschen Geheimniskrämerei passt zur magischen Aura des Varietés.
Eine aber hat es gegeben und gibt es jetzt nicht mehr:
Christine Steffen-Reimann.
Sie war meine Lektorin, meine Mentorin, meine Freundin und eine der großartigsten Frauen, die ich kannte. Ja, dieses Varieté hat die Pause überstanden, aber es ist nicht länger vollzählig. Die Frau, die es ins Leben gerufen hat, ist nicht mehr da.
Können wir einen Herzschlag lang zusammen schweigen und der Erinnerung Raum geben, ehe wir uns ins Vergnügen stürzen?
Ich danke Ihnen von Herzen.
Und damit geht der Vorhang auf.
Charlotte Roth,
London, Frühling 2023
Auftakt
Irgendwo in den Untiefen eines Europa,
das sich verloren hat
und Generationen brauchen wird,
um sich neu zu erfinden.
1
Also standen sie wieder dort. Noch ein letztes Mal, auch wenn der vertraute Ort nicht länger derselbe, sondern fast nicht mehr zu erkennen war.
Fort war das Geschäftige, das ständig Bewegte, das Riga ausgemacht hatte, eine Stadt, die stolz auf alles gewesen war, was sie im Laufe ihrer fast acht Jahrhunderte langen Geschichte erreicht hatte, und umso stolzer entschlossen, in der Zukunft noch weit mehr zu erreichen. Sie war ein Bienenhaus, ein Verschiebebahnhof von einer Stadt gewesen und war jetzt still, verwaist, wie unbewohnt. Nur hin und wieder hastete eine graue Gestalt vorüber, die in einem der wenigen geöffneten Geschäfte ein paar der noch erhältlichen Waren eingekauft hatte und sie in höchster Eile heimtrug, darauf bedacht, von niemandem gesehen zu werden.
Am Ufer des Flusses war ihr Treffpunkt gewesen, dort, wo der Lauf des Wassers sich teilte, sich aus den Wohngebieten hinausschlängelte und die Prachtstraßen der Vorstadt mit ihren malerischen Fassaden und schmiedeeisernen Toren hinter sich ließ. Im Schneetreiben standen sie einander gegenüber, er auf seinem Pferd und sie in ihrem einstmals eleganten Mantel, die Hände in den Taschen vergraben und dennoch zitternd vor Kälte. Alles, was sie auf der Welt noch besaß, steckte unter diesem Mantel, und über dem Bauch bekam sie ihn nicht mehr zu, doch sie trug ihre wollene Stola und ließ die Enden wie zufällig über der Knopfleiste baumeln.
Im Kaschieren war sie immer schon gut gewesen, auch wenn Madame Mireille, die Erbarmungslose, ihren Elevinnen gepredigt hatte, dass Kaschieren sinnlos war, weil auf Dauer nichts, auch nicht die kleinste Schwäche verborgen blieb. Dabei hatte die Meisterin selbst immerhin jahrelang verbergen können, dass sie nicht umhüllt von französischem Flair, sondern mit dem Namen Miroslawa zur Welt gekommen war – zumindest vor einer Hühnerschar kleiner Ballettschülerinnen, die zu viel Angst vor ihr hatten, um auch nur ein einziges ihrer geheiligten Worte anzuzweifeln.
»Schenja«, sagte er. Er musste vom Pferderücken zu ihr herunterrufen, um sich trotz des Abstands zwischen ihnen Gehör zu verschaffen. Das kleine Wort kam ihr vor wie ein Spielball, der auf seiner weißen Atemwolke tanzte.
»Nenn mich nicht mehr so«, sagte sie, wohl wissend, dass es sinnlos war und im Grunde ja auch keine Rolle spielte.
»Ich will nicht, dass du gehst, Schenja. Es ist zu gefährlich.«
»Hierzubleiben wäre gefährlicher.«
»Hier kann ich dich schützen«, sagte er. »Ich nehme dich mit ins Quartier, irgendeine Möglichkeit, dich dort unterzubringen, wird sich schon finden.«
»Zu deinen Genossen?« Sie warf den Kopf auf und wunderte sich darüber, dass sie lachen wollte, obwohl nichts komisch war. »Ich nehme an, die sind ausgehungert genug, um darüber hinwegzusehen, wenn das Flittchen, an dem sie sich schadlos halten, eine Deutsche ist.«
»Schenja!« Seine Hand fuhr an den Sattelknauf. Er sah aus, als wollte er vom Pferd springen, sie an den Schultern packen und schütteln, bis all die Worte, die ihn empörten, aus ihr herauspurzelten, damit sie sie nicht länger aussprechen konnte.
Aber das hatte keinen Sinn mehr. Nichts hatte mehr Sinn. Sie fand nicht einmal die Kraft, zu ihm aufzublicken und ihm durch den fallenden Schnee ins Gesicht zu sehen. Sie musste nur eines: von hier wegkommen. Das hatte sie sich vorgenommen, hatte es sich die ganze Nacht hindurch eingehämmert: Du darfst ihn nicht wiedersehen. Musst von hier weg und nie mehr zurückkehren, musst alles andere verdrängen, bis du irgendwo in Sicherheit bist und es dir leisten kannst, zusammenzubrechen. Sie hatte so viel von der Stimme des Blutes reden hören, hatte sich darüber lustig gemacht und nicht gewusst, was damit gemeint war, aber jetzt wusste sie es, weil die Stimme des Blutes zu ihr sprach: Zum Teufel, beeil dich – du musst hier weg.
Er zügelte sein Pferd, seinen tänzelnden fuchsroten Wallach vom Don, wie um sich selbst am Riemen zu reißen. »Bei mir würde dir nichts geschehen, das weißt du«, sagte er mühsam beherrscht. »Ich würde niemandem erlauben, dich anzufassen, ich würde jeden töten, der es versucht.«
Sie blickte jetzt doch auf. »Kommt eigentlich irgendwann der Tag, an dem ihr genug getötet habt?«, fragte sie. »Oder bezahlen wir unaufhörlich weiter jeden Tod mit noch einem Tod, bis keiner mehr übrig ist – keiner, der das Töten erledigt, und keiner, den man noch töten kann?«
Sie spürte die Kälte, die sich wie ein Grab um sie schloss. Sie wusste, dass er die gleiche Art von Kälte spürte, wann immer sie so mit ihm sprach, und dass er ein Recht dazu hatte.
»Es war Notwehr, Schenja«, zischte er. »Du weißt es doch – wer sonst, wenn nicht du? Ich habe ihm zugeschrien, wer ich bin, ich habe mir die Mütze heruntergerissen, damit er mich erkennt, aber er war wie taub und blind und hat gezielt.«
Etwas in ihrem Innern, unter dem Mantel, der sich nicht schließen ließ, tat so sehr weh, dass ihr für kurze Zeit die Luft wegblieb. Sie musste sich vornüberbeugen und streckte die Hand nach dem Laternenpfahl aus, dessen Laterne nie gebrannt hatte, sooft sie hierhergekommen waren.
Sie hatten sie »unsere Laterne« genannt.
»Heute Abend an unserer Laterne.«
»Wenn es dunkel ist?«
»Wann denn sonst? An unserer Laterne ist es doch immer dunkel.«
Über was für alberne, hohle Dinge man lachte, wenn man verliebt war, wenn man jung war, wenn man glaubte, dass Furcht und Sorgen für andere Leute da waren, während sich für einen selbst jeder Stolperstein in Wohlgefallen auflöste.
»Wie auch immer«, sagte sie zu ihm. »Es lässt sich ja nichts mehr ändern. Ich muss hier weg. Zumindest für ein paar Tage. Mit meinen Leuten kann ich nicht gehen, sie würden mich eher erschlagen, als mich in ihrer Nähe zu dulden. Und falls ich noch hier bin, wenn eure Nachhut einrückt, blüht mir wohl kaum ein besseres Schicksal.«
»Nicht alles, was geredet wird, ist wahr, Schenja.«
Sie glaubte zu spüren, wie der Schnee die Schichten ihrer Kleider durchdrang, wie die eisige Nässe ihr bis auf die Haut sickerte. Sie wollte nach Hause, egal, wo das war. Unter ein Dach, in ein Bett, hinter eine Tür, die sie verriegeln konnte, mehr war von ihrer Vorstellung von einem Heim nicht übrig geblieben.
»Ja, eine Zeit lang kann es zu Unruhen kommen«, fuhr er fort. »Wo gehobelt wird, fallen Späne, aber die Bolschewiki sind hier, um für das Volk zu kämpfen, nicht dagegen. Die Lage wird sich beruhigen. Nicht lange, dann können die Leute in ihre Häuser zurück.«
Sofern die Häuser noch stehen, dachte sie. In Riga hatte man stets in verschwenderischer Üppigkeit mit den herrlichen Hölzern der Gegend gebaut, die wie Seide schimmerten, wenn Lettlands blasses Sonnenlicht darauf fiel, und wie Zunder brannten, wenn eine Granate in den Dachstuhl schlug.
»Ich bin nicht das Volk, Kirjuscha«, entfuhr es ihr, obwohl sie seinen Namen nicht mehr in den Mund hatte nehmen wollen. »Für meinesgleichen kämpfen deine Bolschewiki nicht, das weißt du besser als ich. Sollte sich die Lage tatsächlich beruhigen, wie du sagst, werde ich ja davon erfahren, und dann werden wir sehen, was sich machen lässt. Für den Moment aber muss ich zusehen, dass ich davonkomme, solange man mich noch gehen lässt.«
Schnee schlug ihm ins Gesicht, blieb in dem sandfarbenen Gestrüpp seines Bartes hängen. »Und wo willst du hin?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Richtung Litauen. Kaunas. Zu Verwandten.«
Sie hatte im ganzen Baltikum und darüber hinaus keinen Verwandten mehr, dessen Tür ihr offen stand, und vermutlich war ihm das klar.
»Und wie willst du hinkommen? Es gibt keine Züge, keine Wagen, nicht einmal Postverkehr.«
Trocken schluckte sie. Jetzt kam es darauf an. »Gib mir dein Pferd.«
»Bist du verrückt?«
»Falls ich es bin, bist du daran nicht ganz unschuldig, oder?«
»Was, glaubst du, wird mir passieren, wenn ich zurück ins Quartier komme und erkläre, ich hätte unterwegs mein Pferd verloren?«
»Du bist Bataillonskommandeur, richtig? Dir wird schon keiner mit der Knute die Haut abziehen.«
Sie sah, wie er zögerte, überlegte. Flugs spannte sie die Schultern an und fügte hinzu: »Außerdem war ich der Meinung, dass du kein Feigling bist. Dass du zumindest hilfst, den Dreck, den du verursacht hast, aufzuwischen.«
Er überlegte noch immer. Aber sie hatte ins Schwarze getroffen.
»Du kannst nicht reiten«, wandte er ein, doch sie schüttelte den Kopf. Sie mochte es nie gelernt haben, doch bisher hatte es nichts gegeben, das sie ihrem Körper nicht abverlangen konnte. Reiten durfte nicht ausgerechnet das Erste sein.
»Ich bin in keiner Lage, in der ich mir erlauben darf, etwas nicht zu können«, sagte sie. »Ich bin als Kind geritten. Mit Georg und Johann.«
Auch dieser Schuss traf ins Schwarze. Mit einem tiefen Atemzug hob und senkte sich sein Brustkorb. »Jetzt gleich?«
Sie nickte.
Er beugte sich vor und berührte kurz die Grube zwischen Kiefer und Hals des Tieres. »Avgini, mein Pferdchen«, flüsterte er in seiner Muttersprache. »Ich darf es nicht tun, also gib du dein Bestes, um sie mir zu behüten.« Es klang wie ein Gebet. Dann packte er den Knauf des Sattels und sprang ab. Mit ein paar Griffen prüfte er die Satteltaschen, nahm sein Geschirr und eine Schachtel mit Munition heraus. Den blechernen Kranz mit Hammer, Stern und Schwert, das Emblem der Roten Lettischen Schützen, riss er vom Leder.
»Lass mir den Proviant«, sagte sie. »Kann sein, dass ich eine Weile unterwegs sein muss.«
»Viel ist es nicht. Tee. Zwieback. Ein bisschen Büchsenfleisch.«
Sie nickte. Dann überwand sie sich, trat so dicht an ihm vorbei, dass sie die Wärme seines Körpers spürte, und hob einen Fuß in den Steigbügel. Ihr Körper protestierte, wehrte sich, als versuche sie, eine Puppe in eine Stellung zu zwingen, für die sie nicht gemacht war. Dieser Körper begehrte endlich auf, nachdem sie ihn von früh bis spät, alle Tage und Nächte lang gedreht und gedehnt, gekrümmt und verbogen hatte, ohne dass ihm ein Wehren gestattet gewesen wäre.
Die Stimme des Blutes.
Wie unglaublich das war.
Es geschah, was sie hatte vermeiden wollen und was doch unvermeidlich war: Seine Hände schlossen sich um ihre Taille, um ihr in den Sattel zu helfen. Sie streckte den Rücken durch, versteifte sich, schrie leise auf.
»Ich bin kein Unmensch«, sagte er verletzt, stemmte sie hoch und ließ sie gleich wieder los. »Hilft es dir, mich wie einen zu behandeln?«
Sie suchte Halt in den Steigbügeln, die zu lang für sie waren, versuchte, sich daran zu erinnern, wie man am sichersten auf einem Pferd saß. Was er bei seinem Zugriff gespürt hatte, konnte sie nicht wissen, er, der ihre Taille Hunderte von Malen mit seinen Händen umspannt hatte und sie besser kennen musste als seine eigene. Mit starren Fingern nahm sie die Zügel auf und schloss die vor Kälte steifen Schenkel um den Leib des Pferdes.
»Alles Gute«, sagte sie.
Der Fuchswallach setzte sich in Schritt, trug sie langsam, gegen den Wind und das Schneegestöber, den Uferweg hinauf.
»Wo auch immer du hingehst, Schenja!«, rief er ihr hinterher. »Ich komme und hole dich zurück.«
Sie hatte die verlassene Straße erreicht, versuchte panisch, mit hackenden Stiefelabsätzen, das Pferd in Trab zu treiben.
»Wir werden wieder zusammen sein«, rief er. »Du und ich. So wie immer. Uns kann nichts trennen, Schenja. Ich erlaube es nicht.«
Erste Nummer
In der eine Ente einen Walzer quakt und manch anderer einen Tanz aufführt.
2
Nina
Und? Was sagen Sie? Ist das nicht großartig?« Direktor Ernst-Egon Neugebauer richtete sich zu voller Größe auf und ließ den Westenknopf los, an dem er fortwährend wie an einem Lichtschalter gedreht hatte. »Sie wissen ja: Bei uns im Wintergarten bieten wir vom Guten nur das Beste. Aber diesmal, das müssen Sie zugeben, haben wir uns selbst übertroffen.«
Nina von Veltheim nickte lediglich. Sie hatte nichts dagegen, dergleichen zuzugeben, wenn es Direktor Neugebauer den Tag verschönte. Zwar bezweifelte sie, dass der überlebensgroße Programmdirektor des Varietés bei dem umfangreichen Umbau, den die neuen Inhaber in Auftrag gegeben hatten, eine relevante Rolle gespielt hatte, aber sie wusste, dass Neugebauer das anders sah. Fragte man ihn, so war er für jedes einzelne Detail, dem der Wintergarten seine Stellung als eins der führenden Varietés Berlins verdankte, persönlich verantwortlich. Ob es um die Gestaltung der Terrasse mit den exklusivsten Plätzen, die Ausleuchtung eines Schwebeaktes auf der Vorbühne oder die Beschwörung einer indischen Brillenschlange ging – Ernst-Egon Neugebauer war überzeugt, der Mann zu sein, bei dem all diese Fäden zusammenliefen.
Nina störte sich nicht daran. In den bald fünf Jahren, die sie beim Wintergarten unter Vertrag stand, hatte sie sich an Neugebauer und seine Eigenheiten gewöhnt. Solange dieser sich mit ein bisschen Bauchpinselei zufriedengab und ihr in ihr eigenes Handwerk nicht hineinpfuschte, kamen sie friedlich miteinander aus.
»Es ist wirklich beeindruckend«, lobte sie. »Der Umbau hat sich gelohnt. Wie viele Zuschauer finden jetzt Platz, sagten Sie?«
»Dreitausend!«, rief Direktor Neugebauer begeistert. »Das sollen uns die Banausen von der Scala erst einmal nachmachen!«
Die Scala im ehemaligen Eispalast der Martin-Luther-Straße war ihr größter Rivale, das einzige Varieté in der vor Vergnügungsstätten sprudelnden Hauptstadt, das sich mit dem Wintergarten messen konnte. Aus sicherer Quelle wusste Nina, dass in der Scala ebenfalls dreitausend Zuschauer Platz fanden, aber warum hätte sie dem stolzgeschwellten Neugebauer deswegen in die Suppe spucken sollen?
Sie hatten sich zusammengerauft. Das war anfangs nicht leicht gewesen, doch inzwischen hatten sie gelernt, einander so zu nehmen, wie sie waren. So wenig Ähnlichkeiten sie sonst auch aufwiesen, hatten sie eines immerhin gemeinsam: Sie liebten den Wintergarten. Wenn auch aus unterschiedlichen Gründen.
Für Neugebauer war das Varieté der Ort, wo er seinen Hunger nach Ruhm stillen konnte, sich im Glanz des Rampenlichts sonnte und eine Wichtigkeit verspürte, die ihm in anderen Bereichen seines Lebens versagt blieb. Er war mit der Erbin einer New Yorker Bankiersfamilie verheiratet, die Gerüchten nach unter seinem Dach ein strenges Regiment führte. Für die Schmach, sich als Pantoffelheld zu fühlen, trat er dafür im Wintergarten wie Gottvater persönlich auf.
Für Nina hingegen war der Wintergarten der Ort, an dem sie ihren Traum ausleben konnte. Als kleines Mädchen hatte sie Handpuppen, Hauskaninchen, Nachbarskinder und ihren talentlosen Bruder Carlo dazu verdonnert, in ihren extravaganten Inszenierungen die Schauspieler zu geben, und in gewisser Weise tat sie das bis heute. Nur verfügten die Künstler, die sie inzwischen auf die Bühne brachte, über mehr Begabung. Ihr eigenes Ensemble, Die Wunderweiber, das sie buchstäblich aus dem Nichts aufgebaut hatte, gehörte zu den Kompanien, um die sich sämtliche Etablissements rissen. Und die handverlesenen Talente, die sie darüber hinaus als Künstleragentin betreute oder aus dem Ausland anwarb, sorgten ausnahmslos für Furore.
Vor allen anderen vertrat sie ihre beiden Freundinnen, sozusagen ihre besten Pferde im Stall: Jenny Alomis und Sonia Spielmann, die Schlangenfrau und die Schnellmalerin, die jeder in der nach Sensationen süchtigen Stadt kannte.
Über Jenny schrieben die Kritiker der Zeitungen, sie treibe mit ihrer Darbietung Kraft und Schönheit über die Grenze des Möglichen – und in solcher Euphorie überschlugen sich selbst die Snobs, die über die Niederungen des Varietés für gewöhnlich die Nase rümpften.
Dass Neugebauer sich Jenny erbeten hatte, um auf der neu ausgebauten Bühne einen Probe-Auftritt hinzulegen, war kein Wunder. Jenny war wie ein Kaleidoskop, ihre Persönlichkeit ein Geheimnis in tausend Facetten, das in glitzernde Splitter zerfiel, um sich gleich darauf zu einer strahlenden Lohe neu zusammenzusetzen. Jenny konnte auf den Zehen eines Fußes Spitze tanzen, während sie auf der Sohle des anderen ein Glas Champagner balancierte. Ohne einen Tropfen zu verschütten, versteht sich, und ohne die Zigarettenspitze aus dem Mund zu verlieren.
Aber das war nicht alles. Mit ihrer Ausstrahlung schaffte sie es spielend, den erweiterten Bühnenraum – angeblich den größten Europas – zu füllen. Dabei war sie, in ihren eigenen Worten, nicht mehr als »eine mit Glitzerpailletten beklebte Frau, die sich verbiegt«. Sie war eine Kontorsionistin, eine Künstlerin, die ihren Körper in flüssiges Eisen verwandelte und atemberaubende Skulpturen daraus schmiedete. Sie war eine Tänzerin, der weder die eigenen Knochen noch die Gesetze der Schwerkraft Grenzen zu setzen schienen, und wohl darin bestand der Kern ihres Zaubers.
Jenny verkörperte die Grenzenlosigkeit, von der das taumelnde Berlin träumte, die Weigerung, etwas als nicht menschenmöglich hinzunehmen.
Im Augenblick absolvierte sie ein sogenanntes spanisches Netz, einen Akt, der hoch über der Bühne stattfand. Das Gerüst, an dem die Scheinwerfer befestigt waren und das ihr zum Aufstieg diente, war vollständig hinter einem Vorhang aus schwarzem Samt verborgen. Mit einer Hand hielt sich Jenny an der Schlaufe eines unsichtbaren Seils, das von der Decke hing, fest und bog ihren schwerelosen Körper zu Shimmy-Rhythmen, die nur sie selbst hörte. Es war unglaublich schön. Selbst für Nina, die sich rühmen durfte, Jenny entdeckt zu haben, und die sie seit sieben Jahren kannte – auch verkatert im uralten Morgenmantel, mit einer waffenscheinpflichtigen Kodderschnauze und beim Verzehr von fingerdick bestrichenen Leberwurststullen. Solange sie tanzte, war die durch und durch diesseitige, prosaische Jenny nicht von dieser Welt, sondern schien geradewegs aus dem Sternenhimmel aufzutauchen.
Aus dem Sternenhimmel des Wintergarten.
Der war ebenfalls rundum erneuert worden, weil die alte Konstruktion durchgerostet war und kurz vor einem lebensgefährlichen Zusammenbruch gestanden hatte. Wochenlang hatte Nina gebangt und war nun heilfroh, dass das neue künstliche Himmelszelt genauso funkelnd, unwirklich und wundervoll war wie das alte.
»Goldene Lügen im himmelblauen Nichts« – so hatte irgendein Zeitungsschreiber die mit unzähligen Glühbirnen bestückte, blau bemalte Glaskuppel über dem Wintergarten bei der Eröffnung genannt, und präziser hätte er es nicht ausdrücken können: Der echte Himmel blieb ausgesperrt, weil der falsche so viel strahlender, sensationeller und schlichtweg überwältigend war.
»Überwältigend«, murmelte jetzt auch Direktor Neugebauer, der zu Jenny und dem Flechtwerk ihrer Gliedmaßen hochstarrte. »Atemberaubend, wirklich atemberaubend, meine liebe Freiin.« Ninas Titel war wie so vieles mit dem Ende des Kaiserreichs hinfällig geworden, doch Direktor Neugebauer ließ sich nicht davon abbringen, ihn zu benutzen. »Ich denke, zur Eröffnung sollten wir mit Frau Alomis wieder einmal eine ganz neue Nummer einstudieren, meinen Sie nicht auch?«
Direktor Neugebauer studierte keine Nummern ein, und Jenny hätte sich schlichtweg geweigert, auch nur eine einzige Probe in seiner Gegenwart zu absolvieren. Auch das gehörte jedoch zu den Dingen, die sich stillschweigend ignorieren ließen, um das Schnürchen, an dem alles lief, nicht zu gefährden. Das Leben war schön in diesem zehnten Jahr der Republik, die verfeindeten Kräfte hatten sich zusammengerauft wie Ernst-Egon Neugebauer und Nina von Veltheim, Kultur und Künste blühten, und so sollte es gefälligst bleiben.
»Wir haben bereits etwas in Vorbereitung«, erklärte sie dem Direktor. »Ich melde mich in den nächsten Tagen bei Ihnen, um Einzelheiten zu besprechen.«
»Erfreut, das zu hören, meine Liebe. Höchst erfreut. Lassen Sie sich von Fräulein Haselsteng einen Termin geben. Sie kennt meinen Kalender besser als ich, haha.«
»Ich bedanke mich.«
Nina wollte sich Jenny zuwenden, um ihr in der Zeichensprache, die sich zwischen ihnen entwickelt hatte, zu bedeuten, dass sie in ihrer Stammkneipe, dem Salamander, auf sie warten würde. Zwar hatte sie Anton versprochen, rechtzeitig daheim zu sein, wenn er von seiner dreiwöchigen Tournee durch Deutschland nach Hause kam, aber für einen Drink mit Jenny musste einfach immer Zeit sein. Gerade in diesem Moment kam allerdings ein junger Mann mit weizenblonder Bürstenfrisur aus der Tür gefegt, die den Trakt mit den Garderoben, Lagerräumen und Büros vom Bühnenraum trennte. Seinen Gebärden nach wollte er eindeutig etwas von Nina.
Emil, der Laufbursche.
Er war schon so lange Laufbursche im Wintergarten, dass sich vermutlich niemand mehr daran erinnerte, wie er im Alter von fünfzehn Jahren hier angefangen hatte. Aber Nina erinnerte sich, denn sie hatte ebenfalls zu jener Zeit im Wintergarten anfangen wollen, war abgewiesen worden, und der kleine Emil hatte zu der Handvoll Menschen gehört, die sie getröstet hatten. Er würde wohl noch hier sein, wenn sein blondes Haar grau wurde, und so wie niemand bemerkt hatte, dass er vom Jungen zum Mann geworden war, würde auch niemand bemerken, wenn aus dem Mann ein Greis wurde.
»Fräulein von Veltheim?«, rief er außer Atem. »Der Herr Generaldirektor tät Sie gern sprechen wollen. Er empfängt Sie in seinem Büro, zweiter Stock, in den neuen Räumlichkeiten. Ich tät Sie hinbringen können, wenn Sie wollen.«
»Der Herr Generaldirektor?«, fragte Nina verwirrt. »Aber der ist doch hier.«
»In der Tat.« Neugebauer räusperte sich und drehte am obersten Knopf seiner Weste.
»Nicht der vom Wintergarten«, erklärte Emil eilfertig. »Der neue Herr Generaldirektor vom Central-Hotel. Der Herr Aschinger.«
»Und was will der von mir?«
Das Hotel, dessen imposantes, sich über hundert Meter erstreckendes Gebäude den Wintergarten beherbergte, hatte einer obskuren, kaum je in Erscheinung tretenden Gesellschaft namens Hotelbetriebs-AGgehört, die sich finanziell offenbar verkalkuliert hatte. Zwar war Berlin eine Weltstadt, in die neuerdings sogar wieder fremde Staatsoberhäupter zu Besuch kamen, aber die Konkurrenz war einfach zu groß. Unter den Luxushotels war das Central an der geschäftigen Friedrichstraße zwar noch immer das größte, aber den Rang als erstes Haus am Platz hatten ihm der Kaiserhof und vor allem das elegante, weltoffene Adlon längst abgelaufen.
Anders stand es um den Wintergarten. Der war eine Goldgrube und würde es in der brandneuen Aufmachung umso mehr sein. Die Hotelbetriebs-AGhatte sich die aufwendige Modernisierung der maroden Gebäudeteile nicht leisten können, der gesamte Komplex war unter den Hammer gekommen, und zugegriffen hatte der Erbe der Aschingers, die um die Jahrhundertwende die Hauptstadt mit ihren Stehbierhallen und Billigrestaurants überzogen hatten.
Wer je als Habenichts nach Berlin gekommen war, um hier sein Glück zu machen, hatte garantiert mehr als einmal Aschingers Löffelerbsen genossen, hatte sich von den Schrippen, die es umsonst dazu gab, in jede Manteltasche eine gestopft und damit einen weiteren Tag dem Hungertod getrotzt. Jenny, Nina und Sonia hatten es in ihrer ersten Zeit in Berlin darin zu wahrer Meisterschaft gebracht und verwandten auf Aschingers Restaurationen auch heute noch manch liebevollen Gedanken.
Mit dem Prunk des Central-Hotels und dem Glamour des Wintergarten waren die verrauchten, überfüllten, nach billigem Fleisch und verbranntem Fett miefenden Speisehallen allerdings schwer in Einklang zu bringen. Offenbar strebte der Erbe, der nach dem frühen Tod der beiden Gründer zum alleinigen Inhaber geworden war, nach Höherem: Er hatte bereits das Bristol und weitere Hotels der Luxuskategorie in seinen Besitz gebracht und versuchte es nun mit dem traditionsreichen Central.
Nina war das alles herzlich gleichgültig. Sie erwartete von der neuen Hoteldirektion, dass sie sich in die künstlerische Arbeit des Wintergarten so wenig einmischte wie die alte und Entscheidungen dessen Direktor – Ernst-Egon Neugebauer – überließ. Der wiederum überließ das Wesentliche Nina. Zwar musste sie ihm ab und an gestatten, aufzutrumpfen und auf seinen Rang zu pochen, doch das kratzte sie wenig, solange sie alles, woran ihr gelegen war, durchsetzte.
Dass jetzt dieser Aschinger sich hier, im neuen Verwaltungstrakt des Varietés, ein Büro eingerichtet hatte und dass er sie obendrein postwendend in jenes zitierte, schmeckte ihr nicht. Und es gab noch eine, der es nicht schmeckte oder die zumindest auf der Stelle misstrauisch wurde: Jenny Alomis, die Schlangenfrau mit den Elefantenohren. Was ihr entging, das entging der Welt.
Mit einem Rückwärtssalto löste sie sich von der unsichtbaren Schlaufe und landete so sacht auf ihren Füßen, dass man kaum einen Aufprall hörte. Sie war eine hochgewachsene Frau mit prachtvollem schwarzen, zu einem Helm geschnittenen Haar, gertenschlank, obwohl sie ständig Nahrungsmittel in sich hineinstopfte, und ihr Gang war so geschmeidig, als könne sie gar nicht anders als tanzen. Selbst jetzt, wo sie zu Nina hinüberhechtete und herausplatzte: »Der Aschinger? Was will denn der von dir?«
Dass Menschen die Spucke wegblieb, wenn sie vor ihnen stand, konnte Nina niemandem verdenken. Ihr Kostüm, das aus einer schwarzen Balletthose für Männer und einem schwarzen, mit Pailletten besetzten Trikot bestand, umschloss ihren Körper wie das Fell eines schönen Raubtiers, und die laszive Sinnlichkeit ihrer Ausstrahlung war ganz und gar nichts für Feiglinge. Sie entsprach dem modernen Typ Frau, der androgyn war, der das Reizvollste beider Geschlechter in sich vereinte, sie konnte fluchen wie ein Mann, und nur ein Lebensmüder hätte versucht, ihr die Butter vom Brot zu klauen. Aber dessen ungeachtet war sie durch und durch Frau. So intensiv und so ungeniert, dass Direktor Neugebauer, der sie seit sieben Jahren kannte, in ihrer Nähe hektische Flecken im Gesicht bekam.
»Keine Ahnung, was er von mir will«, beantwortete Nina ihre Frage. »Wenn ich nicht dumm sterben möchte, gehe ich lieber und finde es heraus.«
»Soll ich auf dich warten?«, fragte Jenny. »Vermouth bei Alfred?«
Alfred war der Wirt des Salamander, wo sie einander in einer eisigen Frühlingsnacht des Jahres 1921 kennengelernt hatten.
»Muss aber ein schneller sein«, antwortete Nina. »Anton kommt mit dem Abendzug aus Hamburg, und ich habe ihm versprochen, ein Festmahl zu kochen.«
»Kochen? Du?« Jenny hob die geschwungenen Brauen. »Bist du sicher, dass Anton das überlebt?«
»Frau Brenneisen kocht«, gab Nina zu. »Aber ich hatte zumindest geplant, Kerzen auf den Tisch zu stellen, nach Art der liebenden Hausfrau Blumen zu arrangieren und mich in Schale zu schmeißen.«
Frau Brenneisen war die Haushälterin, die Anton in ihre Beziehung eingebracht hatte. Sie hatte sich geweigert, ihn zu verlassen, weil sie fürchtete, er werde verhungern.
Jenny verzog den Mund zu einem wölfischen Grinsen. »Die Art der liebenden Hausfrau würde ich mir schenken, und dein Anton steht auf dich ohne Schale mehr als mit. Das mit den Kerzen machst du mit links, also bleibt massig Zeit für unseren Vermouth.« Sie warf Nina einen Luftkuss zu und wirbelte herum. »Ich halt dir deinen kühl.«
Verfolgt vom Blick aus Direktor Neugebauers Stielaugen, schwebte Jenny aus dem Saal, während Nina einen knappen Gruß murmelte und hinter Emil aus der Tür ging.
3
Der schmale Korridor, der sich hinter dem Durchgang auftat, hatte bis vor Kurzem zu sämtlichen Verwaltungsräumen und Garderoben des Varietés geführt. Seit dem Umbau aber verteilten sich diese Bereiche über drei Etagen, und es gab einen brandneuen Lift. In dem fühlte sich Nina zwar, als hätte man sie in den Speisenaufzug gequetscht, aber laut Emil war das Ding »rasant wie eine Mondrakete« und sauste im Nullkommanichts in den zweiten Stock.
»Bitte sehr, die Dame. Da wären wir schon.« Emil verbeugte sich und wies nach links in einen frisch renovierten Gang, in dem noch der Duft nach Tapetenkleister hing. »Halt!«, rief er, als Nina weitergehen wollte. »Der Chef von’t Janze sitzt gleich hier, hinter der ersten Tür.«
Die war gewaltig und aus wuchtiger Eiche. Sie schüchterte ein und war vermutlich genau zu diesem Zweck an diesem Raum in die Angeln gehängt worden. Nina aber war auf einem Brandenburger Rittergut aufgewachsen, wo nicht nur solche Türen gang und gäbe waren. Sie hatte den Niedergang von all dem Geplustere und Gehabe miterlebt und war mit Schein ohne Sein nicht zu beeindrucken. Ohne anzuklopfen, drückte sie die Klinke herunter. »Danke, Emil! Man sieht sich.«
»Oh!« Der Mann hinter dem Schreibtisch erschrak und sprang auf. Nina hatte ein wahres Ungetüm von Möbelstück erwartet, wie es sich Direktor Neugebauer in sein Empfangszimmer hatte stellen lassen, doch die Einrichtung dieses Raums war zweckmäßig und modern. »Zweckmäßig und modern« hätte als Beschreibung auch auf den Mann gepasst, der weder groß noch klein war, weder breit noch schmal und weder blond noch dunkel. Er trug einen Straßenanzug, der in einem eigentümlich metallischen Grau glänzte, und das schüttere, leicht gewellte Haar war eher praktisch als militärisch kurz geschnitten.
»Freiin von Veltheim? Angenehm. Fritz Aschinger.« Er kam um den Tisch und streckte ihr die Hand entgegen.
»Fräulein Veltheim tut’s auch«, erwiderte Nina lapidar und ergriff die Hand, die überraschend weich und wie eine Kinderhand gepolstert war.
»Das soll mir recht sein«, sagte Aschinger. »Meiner persönlichen Ansicht nach zählt das, was ein Mensch sich erarbeitet. Nicht das, was er ererbt.«
Aha, dachte Nina und ließ die Hand des Mannes los, der eines der größten Vermögen der Stadt geerbt hatte. »Darf ich fragen, was ich für Sie tun kann?«, erkundigte sie sich.
»Oh, eine ganze Menge«, antwortete Aschinger. »Aber setzen wir uns doch.« Er wies auf einen niedrigen Tisch unter dem Fenster, auf dem eine Karaffe mit Wasser und zwei Gläser bereitstanden. Die beiden Stühle dazu wirkten unbequem.
»Um ehrlich zu sein, ich bin ziemlich in Eile«, sagte Nina. »Ich bin heute nur vorbeigekommen, weil Herr Direktor Neugebauer mit meiner Künstlerin die neuen Bühnenvorrichtungen ausprobieren wollte, aber ich werde bereits anderswo erwartet.«
Fritz Aschinger, der im Begriff war, sich zu setzen, hielt inne und drehte sich zu ihr um. »Das ist interessant. Sie werden anderswo erwartet?«, fragte er und ließ eine seiner feinen Brauen zucken. »Nun, dann werden die Leute, die Sie anderswo erwarten, sich wohl daran gewöhnen müssen, dass Sie künftig andere Prioritäten haben. Ich bin von jetzt an Ihr Chef, werte Freiin. Und während ich mich für einen Mann halte, der in den meisten Fragen mit sich reden lässt, missfällt es mir erheblich, wenn man es mir gegenüber an Respekt fehlen lässt.«
Nina wollte ihn stehen lassen und gehen. Dafür, dass sie sich und die Frauen, die sie vertrat, von niemandem kleinmachen ließ, stand sie ein, darauf konnten ihre Leute bauen. Sie alle hatten sich viel zu lange geduckt, hatten sich von Männern, die weit weniger Talent und Esprit zu bieten hatten, auf die hinteren Plätze verweisen und sich mit Almosen abspeisen lassen.
Von Jenny hatte Nina gelernt, dass man auf diese Weise nicht weiterkam. »Wenn dir einer ein Plätzchen am Bühnenrand anbietet, sag ihm, du willst das ganze Theater«, lautete ihre Devise. Die Wunderweiber waren begehrt, konnten es sich leisten, Forderungen zu stellen, aber Nina hatte verinnerlicht, dass man eine solche Position gar nicht erst erreichte, wenn man seinen eigenen Wert nicht kannte.
Sobald ein Mann versuchte, seine Macht auszuspielen, hieß es, ihm eine Abfuhr zu erteilen. Ein anderes Engagement für ihr Ensemble bekam sie im Handumdrehen. Jules Marx von der Scala rief laufend bei ihr an, ließ seinen nicht unbeträchtlichen Charme spielen und überbot die Gagen, die Neugebauer ihnen zahlte, um Längen.
Aber das hier war nicht irgendein Engagement.
Es war der Wintergarten.
Ihr Wintergarten. Das Schatzkästchen unter dem Sternenhimmel, in dem die zusammengewürfelte Schar von Frauen sich neu erfunden hatte und seither in ihrem Element war. Ihren Namen, ihren Ruf, ihren Zauber verband man mit diesem Veranstaltungsort, und zuweilen kam es Nina so vor, als liege irgendwo unter dem spiegelnden Parkett eine geheime Quelle verborgen, aus der ihre Kraft sich speiste.
Aber das spielte keine Rolle. Wer glaubte, sie wie ein Lehrmädchen behandeln zu können, musste sich eine Dümmere suchen. Außerdem war das letzte Wort nicht gesprochen. Dieser kleine Gernegroß, der nicht viel älter als sie selbst sein mochte, würde zur Besinnung kommen, um Entschuldigung bitten und in Zukunft den Betrieb des Wintergarten wieder Neugebauer überlassen.
Ihr Herz klopfte trotzdem. Sie war schon fast an der Tür, als er sie zurückrief. »Würden Sie mir bitte mitteilen, wo Sie jetzt hinwollen, Fräulein Veltheim?«
»Das habe ich Ihnen doch gesagt«, antwortete Nina. »Ich werde anderswo erwartet. Und nur, um das klarzustellen: Mein Chef sind Sie keineswegs. Ich bin eine freiberufliche Künstleragentin und Dramaturgin, ich suche mir meine Kunden aus, und wenn ich mit jemandem einen Termin vereinbare, dann kann er sich darauf verlassen, dass ich ihn einhalte.«
»Oho.« Dem jungen Herrn Wichtigtuer geschah etwas, das Nina so noch nie beobachtet hatte: Er lief tiefrot an. Dass er verlegen dabei lächelte, verlieh ihm etwas beinahe Sympathisches. »Wenn ich Sie gekränkt habe, tut es mir leid«, versicherte er. »Sie haben natürlich recht. Ich bin noch nicht Ihr Chef, allerdings würde ich es gern werden. Herbestellt habe ich Sie, weil ich vorhabe, Ihnen ein Angebot zu machen, das Sie unmöglich ablehnen können.«
»Unmöglich?« Nina furchte die Stirn.
»Wollen wir uns nicht bitte doch setzen? Ich verspreche, ich halte Sie nicht länger als unbedingt nötig auf.«
Nina hätte ihn ganz gerne noch etwas zappeln lassen, doch sie war inzwischen neugierig geworden. »Fünf Minuten«, warnte sie und setzte sich ihm gegenüber auf einen der unbequemen Stühle. »Länger kann ich meinen Kunden nicht hinhalten.«
»Das spricht natürlich für Sie. Aber es soll Ihr Schaden nicht sein.« Er strich sich über die Stirn, während die tiefe Röte nur langsam aus seinem Gesicht wich. »Sie haben ja heute gesehen, was wir aus den altersschwachen Räumlichkeiten dieses Etablissements gemacht haben, nicht wahr? Eine Bühnenöffnung von sechsundzwanzig Metern, wie man sie in ganz Europa nicht findet. Vierhundert Quadratmeter, auf denen Ihre Artisten sich austoben können, dazu modernste Beleuchtung, eine Dampfmaschine, Wassersprinkler, einen Apparat zur Projektion von Wolken – es gibt nichts, was es im neuen Wintergarten nicht gibt. Ihre Künstler haben Garderoben mit voll ausgestatteten Duschräumen auf drei Ebenen zur Verfügung, kaltes und warmes Wasser, und die Stallungen für Tiere sind vollständig belüftet. Kurzum – wir haben aus einer langsam verfallenden Sentimentalität das modernste Varieté des Kontinents gemacht. Nur eines ist nicht modern, und das missfällt mir. Das missfällt mir sehr.«
»Und was wäre das?«, fragte Nina, darauf gefasst, eine weitere ausufernde Tirade zur Antwort zu bekommen.
»Direktor Neugebauer«, kam es wie aus der Pistole geschossen. »Der Mann gehört meinetwegen in ein Museum, aber nicht auf die Bühne einer Weltstadt.«
Streng genommen hatte er damit nicht einmal unrecht, aber trotzdem konnte Nina die Schmähung nicht auf Neugebauer sitzen lassen. Der Mann hatte auch sie schon zur Weißglut getrieben, doch daran war Rudolf Kante schuld gewesen, nicht Neugebauer selbst. Er besaß das Urteilsvermögen einer Blindschleiche, aber niemand konnte ihm vorwerfen, dass er das Varieté nicht mit ganzer Seele liebte und ihm alles gab, was er besaß. »Direktor Neugebauer führt den Wintergarten bereits seit zehn Jahren, und das Haus ist allabendlich ausverkauft«, sagte sie. »Besucher aus dem Ausland lassen sich ihre Karten auf Monate im Voraus reservieren – ich wüsste also nicht, was Sie an der Arbeit des Direktors auszusetzen haben.«
»Geschenkt, geschenkt.« Aschinger winkte ab, als verscheuche er einen kompletten Schwarm Fliegen. »Ich bin darüber informiert, dass der Mann privates Geld in die Finanzierung der Aufführungen steckt und dass man ihn daher nicht absägen sollte. Meiner persönlichen Ansicht nach ist Geld immer ein gutes Argument. Also sägen wir ihn nicht ab, sondern stellen ihn kalt, indem wir ihm einen Intendanten vor die Nase setzen. Jemanden, der für die gesamte Programmgestaltung verantwortlich ist, sie mit mir abspricht und sich vom werten Herrn Neugebauer letztendlich nur noch eine Art Stempel abholt.«
Nina hatte das Gefühl, als krieche ihr etwas den Rücken hinunter. Meinte der Mann das ernst? Wollte er ihnen, den Leuten, die den Wintergarten besser kannten als ihr eigenes Innenleben, wirklich jemanden aufs Auge drücken, der entweder vom bürgerlichen Theater herstammte und daher von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte, oder womöglich gar aus der Bier- und Wurstwelt von Aschingers Schnellrestaurants kam? Das Leben eines Varietés war ein fragiles Gebilde, weil es fragile, kapriziöse, hoch komplizierte Geschöpfe waren, die sein Gerüst bildeten. Aber es funktionierte, wenn man ein Gespür dafür hatte, es funktionierte für sie selbst schon seit mehr als fünf Jahren!
Der Mann, den Aschinger ihnen schicken wollte, würde wie ein Elefant in ihren Porzellanladen trampeln und nichts als Scherben hinterlassen.
»Sie sehen aus, als wäre Ihnen nicht ganz wohl, Fräulein Veltheim«, sagte er.
»Mir ist auch nicht wohl«, erwiderte Nina unverblümt. »Ich mache mir Sorgen darum, was mit diesem Theater geschieht, wenn hier ein Intendant eingesetzt wird, der – mit Verlaub – von der Materie nichts versteht.«
»Oh, keine Sorge.« Wieder wedelte Aschinger seinen unsichtbaren Fliegenschwarm fort. »Der Intendant, den ich einzusetzen gedenke, versteht jede Menge von der Materie.«
»Und darf ich auch noch erfahren, wer dieser illustre Intendant ist?«, blaffte sie.
»Aber natürlich, Fräulein Veltheim«, antwortete er galant. »Deshalb habe ich Sie ja hergebeten, nachdem mein Bekannter, der Ihnen höchst zugetane Regisseur Rudolf Kante, diesbezüglich eine Empfehlung aussprach. Der Intendant sind Sie.«
4
Die beiden armlangen, elfenbeinfarbenen Kerzen brannten in den hohen Silberleuchtern und tauchten den Raum, das viel geliebte Berliner Zimmer, das die Wohnung in zwei Hälften teilte, in ein dramatisch flackerndes Licht. Frau Brenneisen hatte den uralten Tisch in die einzige blütenweiße Damastdecke des Haushalts gehüllt und die kalten Delikatessen, die sie vorbereitet hatte, mit silbernen Hauben abgedeckt. Nina hatte auf dem Heimweg rasch an Gehrkes Blumenstand gehalten und überteuerte Treibhaus-Gladiolen gekauft, die in der ebenfalls silbernen Vase, die sie im Wandschrank gefunden hatte, überraschend viel hermachten.
Keiner der leicht verstaubten und verbeulten Gegenstände, deren Schadstellen das Dunkel gnädig verbarg, gehörte ihnen. Die Wohnung in der Jerusalemer Straße, sechs Zimmer zwischen Seitenflügel und Hinterhaus, war das im Grundbuch eingetragene Stockwerkseigentum der Offizierswitwe Elfriede Rottenheimer. Zumindest behauptete Friedel Rottenheimer, die Witwe eines Offiziers zu sein und die Wohnung von dem verblichenen Gatten, der einmal Carl und dann wieder Theodor oder auch Herrmann hieß, geerbt zu haben. Dass das nicht ganz stimmen konnte, hatten Nina und Jenny schnell herausgefunden, aber es gehörte zu den ungeschriebenen Gesetzen ihrer Gemeinschaft, das, was ein Mensch über sich erzählte, hinzunehmen und keine überflüssigen Fragen zu stellen.
Schließlich stimmte bei so manchem von ihnen nicht alles. Berlin war ein Sammelbecken. Nachdem der Krieg Europa in Brocken zerschlagen hatte, war eine Flutwelle darüber hereingebrochen und hatte aus sämtlichen Himmelsrichtungen Menschen angeschwemmt. Was sie getan hatten, um mit heiler Haut davonzukommen, hatte mit dem, was sie für gewöhnlich taten, oft kaum etwas gemein. Nicht wenige hatten gute Gründe, vor die Welt, aus der sie gekommen waren, einen undurchsichtigen Schleier zu ziehen.
Leute wie Ninas Bruder Carlo, die klar wie Quellwasser waren und ihr ganzes Leben auf Gut Neu-Mahlen in der weltentfernten brandenburgischen Uckermark verbracht hatten, konnten so etwas nicht verstehen.
»Was könnte es denn geben, das sie vor mir verbergen muss?«, hatte er Nina mehr als einmal gefragt und dabei natürlich von Jenny Alomis gesprochen. »Sie wird schon niemanden umgebracht haben – und bei allem anderen wüsste ich nicht, wo das Problem sein sollte.«
Aber Nina wusste es. Sie hatte es in den Jahren, seit sie nach Berlin gekommen und in Friedel Rottenheimers Wohnung ein Zimmer gemietet hatte, gelernt. Wenn ihre Vermieterin eine Offizierswitwe sein wollte statt einer zähen Frau, die sich mit allerlei wenig salonfähigen Tätigkeiten durchs Leben geschlagen hatte, dann war sie eben eine Offizierswitwe, und Nina war die Letzte, die daran rütteln würde. Und Jenny war Jenny. In einer kalten Frühlingsnacht war sie in Ninas Leben geschneit, als hätte sie geahnt, dass in Ninas Leben nichts so sehr fehlte wie eine Jenny.
Alles andere war nebensächlich. Woher sie kam, was sie hierhergetrieben hatte und wer sie vorher gewesen war. Das Leben, das zählte, war das Hier und Jetzt, der Augenblick, der sich nur auskosten, nicht aber festhalten ließ. Jenny war eine Meisterin darin, und wenn Carlo sich in ihrem atemlosen Rhythmus, der keinen Blick zurück erlaubte, nicht zurechtfand, war ihrer Liebe auf Dauer kein Glück beschieden.
Und was ist mit meiner Liebe?, fragte sich Nina.
Sie ließ ihren Blick über den formidabel gedeckten Tisch schweifen. Für gewöhnlich aßen sie und ihr Liebster nicht derart aufwendig zu Abend. Anton Wendland gehörte zu den gefragtesten Schauspielern der Republik, und sie selbst wünschte sich häufig, ihr Tag hätte achtundvierzig Stunden. Sie hatten kaum je Zeit und noch weniger Ruhe, stopften meist im Stehen irgendetwas in sich hinein, im Vorübergehen, wobei sie einander küssten und zuwinkten. Anton hatte des Öfteren seine Bereitschaft erklärt, daran etwas zu ändern, und Nina hatte jedes Mal versprochen, darüber schnellstmöglich nachzudenken, doch bisher war alles geblieben, wie es war.
»Ich vermisse dich«, pflegte er ihr durchs Telefon ins Ohr zu raunen. Sie vermisste ihn auch, aber zwischen ihrem Leben und seinem schien ein drittes – ihr gemeinsames – nicht mehr als einen halben Fußbreit Platz zu haben.
Warum es ihr so wichtig gewesen war, heute Abend anlässlich seiner Rückkehr den Tisch zu decken wie in einem großbürgerlichen Heim, war ihr selbst nicht ganz klar. Wäre Jenny hier gewesen, hätte sie vermutlich gefragt: Was willst du damit beweisen – und vor allem, wem?
Dass sie ihn liebte, benötigte keinen Beweis, denn das wusste er, nicht anders als sie. Allerdings hatte er um ihrer Liebe willen weit mehr aufgegeben. Weil Nina in der Wohnung in der Jerusalemer Straße um jeden Preis hatte bleiben wollen, hatte er seine gekündigt und war zu ihr gezogen. Von den Gagen, die sie inzwischen bezogen, hätten sie sich spielend ein eigenes Haus leisten können, aber weil Nina an diesem Provisorium als Frau Rottenheimers Untermieterin hing, hatte er kurzerhand die ganze Wohnung gemietet. Seine Haushälterin, Frau Brenneisen, die mit ihm eingezogen war, hatte sich mit Frau Rottenheimer angefreundet. Ein wenig betrugen sich die beiden wie Ninas Oma Hulda, die über das Gebaren der Jugend zwar gelegentlich die Stirn in Falten legte, auf einen Kommentar aber nicht ihre Zeit vergeudete.
Oberflächlich betrachtet ging es bei ihnen nicht viel anders zu als in einer Familie. Aber sie waren keine. Wenn das für Nina kein Problem war, so wiesen mehr und mehr Anzeichen darauf hin, dass es für Anton eines zu werden drohte.
Die Türglocke schellte. Anton hatte natürlich einen Schlüssel, den er brauchte, um die Durchfahrt des Vorderhauses aufzuschließen, aber er liebte es, wenn Nina ihm nach einer Zeit der Trennung an der Tür entgegenkam.
Sie liebte es auch.
Sie hatte das elfenbeinfarbene Seidenkleid angezogen, das sie gemeinsam gekauft hatten, und trug ihr wildes Haar offen, wie Anton es am liebsten mochte. Während sie zur Tür lief, kam es ihr vor, als wehe alles hinter ihr her.
Er hatte schon aufgeschlossen, als sie in den Windfang stürmte, lächelte und breitete die Arme aus. »Nina.« Sein Gesicht war von der Kälte gerötet, das dunkle Haar zerzaust, und den Hut hielt er in der Hand.
Sie verliebte sich neu in ihn. Jedes Mal, wenn sie ihn wiedersah. Vielleicht nahm sie deshalb ihre Trennungen leichthin in Kauf, weil diese Wiedersehen sie so glücklich machten. Er war ein schöner Mann. Ihr schöner Mann. In seinen Augen spiegelte sich ihr Lachen, und während sie ihm in die Arme flog, kannte sie einen Moment lang auf der Welt keine Sorge. Sie küssten sich lange und innig, ehe er sein Gepäck in die Wohnung zerrte, und falls Frau Rottenheimer und Frau Brenneisen hinter ihren Zimmertüren lauschten, so gönnte Nina es ihnen von Herzen.
Er ließ den Koffer unausgepackt, machte sich nur rasch im Bad ein wenig frisch, ehe er zu ihr ins Berliner Zimmer kam.
»Was für eine Pracht«, konstatierte er verwundert. »Es fiel mir schon bei der Begrüßung auf – haben wir etwas zu feiern?«
Nina hatte eine Flasche Champagner, den ihr irgendein Verehrer hatte zustellen lassen, aus dem Kühler genommen und wollte ihn entkorken. Sie hielt inne, sah das plötzliche Leuchten in Antons Augen und erschrak.
»Nina. Meine liebste Nina. Gib das her, lass mich das machen.« Er umschlang sie von hinten und nahm ihr die Flasche weg. »Von heute an werde ich dich auf Händen tragen, hast du gehört? Und wenn es dir auf die Nerven geht, wirst du dich gefälligst damit abfinden müssen.«
Er rupfte die Silberfolie vom Hals der Flasche und drehte den Draht vom Korken.
»Lieber Himmel, Anton.« Sie wandte sich in seinen Armen um. »Es ist nicht, was du denkst. Ich bekomme kein Kind.«
Es war, als hätte sie einen Schalter umgelegt, damit ein Licht erlosch. Sie sah ihn schlucken, sah ihn die Hände ineinander verschränken, wie es seine Gewohnheit war, wenn er verzweifelt versuchte, sich zu fangen und zu beherrschen. Er war Schauspieler. Und zwar einer der besten. Keinen Herzschlag später zog er sich seine Enttäuschung wie eine Maske vom Gesicht und setzte das Lächeln wieder auf. Für dieses Lächeln lagen ihm Scharen von deutschen Theaterzuschauerinnen zu Füßen, sahen sich seinetwegen expressionistische Kuriositäten von Autoren wie Barlach und Toller an, von denen sie nie zuvor gehört hatten, und hätten zweifellos ihr letztes Hemd gegeben, um an Ninas Stelle zu sein.
Ihr tat es weh. Er machte es ihr so einfach, stellte keine Forderungen, hatte kaum je Wünsche – und diesen einen, großen, den er hegte, erfüllte sie ihm nicht.
Er griff wieder nach der Flasche, die er auf den Tisch gestellt hatte, drehte an den Resten des Drahtes, obwohl der Korken längst freilag. »Nun ja«, sagte er. »Was nicht ist, kann schließlich noch werden, oder nicht?« Es war nicht seine Art, Plattitüden von sich zu geben, doch Nina erkannte unschwer, wie hart er um Worte rang.
Der Gedanke an ein Kind war irgendwann im Zuge des Glücksrauschs, durch den sie taumelten, als eine Art Schnapsidee aufgekommen. Ging es ihnen nicht blendend? Die politischen Verhältnisse hatten sich stabilisiert, auch wenn seit dem Tod von Reichspräsident Ebert der konservative und zudem halb vergreiste Hindenburg auf dessen Stuhl saß. Beruflich flogen sie von einem Erfolg zum nächsten. Anton konnte sich die Rollen aussuchen, konnte spielen, was immer ihn reizte, und bei seiner Ablehnung, einen Film zu drehen, bleiben. Trotzdem verdiente er noch immer weit mehr, als sie brauchten, und Nina erging es nicht anders. Sie waren gefragt, waren, ohne es zu merken, in die Reihen der begehrten Leute in Deutschlands Republik aufgestiegen. Mit ihren zwei Ersatzmüttern, die sich rührend um sie kümmerten, teilten sie sich eine Zimmerflucht, die die herrlichste in ganz Berlin sein musste. Und was das Wichtigste war:
Sie liebten sich.
Sie stürmten Abend für Abend nach Hause, um einander in den Armen zu liegen, und konnten noch immer kaum einen Blick tauschen, ohne sich zu wünschen, übereinander herzufallen. Ihre Nächte waren pure Seligkeit, und wenn sie nicht gerade Liebe machten, redeten sie. Nina wie ein Wasserfall und Anton wie ein ruhiger Strom, in den der Strudel sich mit Lust hineinstürzte. Manchmal taten sie auch beides gleichzeitig, und zwischendurch aßen sie in Würfel geschnittenen Käse und tranken französischen Rotwein aus dem größten Glas, das Friedel Rottenheimers Vitrine hergab.
Oder sie mixten Mojitos, die jedoch nie so gut gelangen wie die, die ihnen Hieronymus Haase im Wintergarten servierte.
Das Leben war schön.
Und wie ein Abend im Varieté, der von Nummer zu Nummer erregender wurde, verlangte es nach einem Höhepunkt. Es war nach der Premierenfeier von Ninas Frühjahrsprogramm gewesen, nach einem grandiosen Erfolg, bei dem ihre Wunderweiber darauf bestanden hatten, sie auf die Bühne zu zerren und wie eine Trophäe in die Luft zu heben. Dem Sternenhimmel entgegen. Auf der Feier hatte es einen Champagnerbrunnen gegeben – prickelndes Gold, das an einer kopfstehenden Eisskulptur von Jenny herabperlte, einer Jenny, die immer dünner, immer ätherischer wurde und sich schließlich in Luft auflöste. Die Gäste, nicht zuletzt Jenny selbst, hatten sich königlich amüsiert.
Für die Heimfahrt hielt ihnen Anton eine Taxe an, obwohl sie beide kaum zum Trinken gekommen waren.
»Fahren kann ich nicht mehr. Ich bin wie besoffen von dir.«
»Und ich kann mich an dir nicht satt trinken.«
Schon im Windfang begannen sie, sich zu lieben, stolperten ineinander verschlungen in ihr Schlafzimmer, in das ein Nachtlicht vom Hof schien, und fielen im Höhepunkt auf das Bett. Hinterher lagen sie atemlos still, Nina auf dem Rücken, alle Glieder von sich gestreckt, und Anton über sie gebeugt, sein Blick unverwandt auf ihrem Gesicht ruhend.
»Bin ich verrückt?«, hatte er sie gefragt. »Oder haben wir gerade ein Kind gemacht?«
»Du bist verrückt«, hatte Nina gesagt. »Aber ich bin es auch.«
Die Idee, mit ihm ein Kind zu haben, das wie Jennys Viktor mit ihnen allen aufwachsen würde, hatte in jenem Augenblick einen Zauber ausgeübt, dem sich keiner von ihnen beiden entziehen konnte. Sie hatten Pläne geschmiedet, in denen sie mit ihrem Kind um die halbe Welt reisen wollten und aus ihrer Zweisamkeit eine Dreieinigkeit wurde. Als Nina ein paar Wochen später festgestellt hatte, dass sie doch nicht schwanger war, war sie enttäuscht gewesen, und Anton hatte sie getröstet.
»Für mich ist es trotzdem, als wäre unser Kind schon ein bisschen bei uns«, hatte er gesagt. »Weil mir jetzt klar ist, wie sehr ich mir wünsche, es kennenzulernen, und weil du es dir auch wünschst.«
Sie hatten flüchtig davon gesprochen, zu heiraten, und Nina war glücklich gewesen, weil er das wollte: sich zu ihr und ihrem Kind bekennen, ganz zusammengehören. In der bürgerlichen Gesellschaft galt es noch immer als Schande, ein uneheliches Kind zur Welt zu bringen, aber in ihren eigenen Kreisen aus Künstlern, Gauklern und Freigeistern kannte sie etliche Frauen, die ein Kind ohne Vater aufzogen. Die meisten von ihnen waren von irgendeinem Schnösel im Stich gelassen worden, als es ihm zu ernst und zu eng wurde. Noch immer, allem Kampf um die Frauenrechte zum Trotz, hinderte niemand einen Mann daran, sich derart aus der Affäre zu stehlen.
Anton hingegen lag solches Verhalten fern. Er wünschte sich ein Kind mit Nina und ein Leben mit ihnen beiden. Nina freute sich darauf. Ihre Liebe war eine Kette wunderbarer Abenteuer gewesen, die jedem von ihnen halfen, sich zu entwickeln und seinen Weg zu gehen. Dieses neue Abenteuer nun würde das aufregendste von allen werden.
Aber das Abenteuer ließ auf sich warten. Allem Wünschen und jeder Menge Nächte voller Liebe zum Trotz stellte sich keine Schwangerschaft ein.
Es hatte andere Ereignisse gegeben, die sie ablenkten, fesselten, für sich beanspruchten. Erfolge, Herausforderungen, Tourneen, Premieren. An manchen Tagen hatte Nina das Kind vergessen, und in letzter Zeit hatten sich diese Tage gehäuft. Heute war einer dieser Tage. Sie war nicht einmal auf den Gedanken gekommen, dass Anton mit der Möglichkeit rechnete, sie könne schwanger sein.
»Du hast dir mit dem Essen solche Mühe gemacht«, sagte er noch immer mit jenem Lächeln, das auf seinen Zügen nicht recht haften wollte. »Also sollten wir es nicht verderben lassen. Und den Champagner schon gar nicht. Immerhin haben wir ja unser Wiedersehen zu feiern. Ist das etwa kein Grund? Für mich ist es Grund genug. Ich liebe dich.«
Er zog sie an sich, ließ seine Hände ihren Rücken hinuntergleiten und küsste ihre Lider.
»Das Essen hat Frau Brenneisen gemacht«, sagte sie, als seine Lippen sich von ihren lösten. »Der Champagner ist ein Geschenk von Dehmel, aber dass du wieder da bist, ist auch für mich genug Grund zum Feiern. Und vielleicht habe ich ja noch einen weiteren Grund. Ich bin mir nicht ganz sicher.«
»Erzähl.« Verblüffend langsam ließ er den Korken aus dem Flaschenhals gleiten, hielt die Flasche dann sofort über eines der Gläser und füllte es, ohne einen Tropfen zu verschütten. Galant rückte er Nina einen Stuhl zurecht und stellte das Glas vor sie hin.
Auf einmal überwältigte es sie. »Es tut mir so leid, Anton«, rief sie, sprang noch einmal auf und zog ihn an sich. »Es tut mir so furchtbar leid.«
Ein wenig überrumpelt schloss er die Arme um sie. »Es ist doch nicht deine Schuld. Und es ist auch nicht das Ende der Welt. Wir sind noch nicht alt, du sowieso nicht und ich höchstens ein bisschen angegraut. Wenn es diesem Herrn Sohn oder dem Fräulein Tochter von uns gefällt, sich noch ein bisschen zu zieren, dann werden wir uns eben noch eine Zeit lang in Geduld üben müssen.«
»Ich weiß nicht, Anton.« Er hatte sich von ihr gelöst, um sich selbst ein Glas zu füllen, und sie setzte sich wieder. »Vielleicht ist es ja doch meine Schuld. Manchmal denke ich, ich bekomme kein Kind, weil der Wintergarten mein Kind ist.«
»Dass das Unsinn ist, weißt du, oder?« Er hob sein Glas und stieß es sachte gegen ihres. »Zu unserem Glück leben wir in einem Zeitalter, in dem die Wissenschaft solchen frauenfeindlichen Humbug ausschließen kann.«
»Bist du dir sicher, dass es Humbug ist?«, fragte sie, weil sie sich selbst nicht mehr sicher war.
»Nina«, sagte er und hob die Haube von einer Platte mit kresseverziertem Eiersalat. Die Kresse zog Frau Brenneisen in Wattebetten auf ihrem Fensterbrett. »Tu mir einen Gefallen und vergiss das Ganze. Lass dir dein Abendessen schmecken. Ich habe mich getäuscht und war schneller mit dem Mund als mit dem Hirn, aber das sollte uns das Wiedersehen nicht verderben.«
Nina ließ sich die Platte zuschieben und nahm eine Portion, bediente sich an Käse, kaltem Fleisch und Schillerlocken, sagte jedoch kein Wort.
Anton nahm sich nichts, sondern verschränkte die Hände über seinem Teller. »Wir beide kennen jede Menge Frauen, die in ihrem Beruf erfolgreich sind und Kinder aufziehen«, sagte er. »Jenny ist eine davon. Else Lasker, Käthe Kollwitz, Asta Nielsen – keine von ihnen hat die Mutterschaft an ihrer Arbeit gehindert. Meine Mutter dagegen kümmerte sich mit all ihrer Fürsorge um nichts als meinen Vater und den Haushalt, und dennoch musste sie zwanzig Jahre warten, ehe sie schließlich doch noch ein Kind bekam. Wir versuchen es erst seit einem Jahr. Es wird schon passieren, wenn es so weit ist, ohne dass du dir deswegen Sorgen machen musst. In Ordnung?«
Nina sah ihn an, ohne etwas zu sagen.
»Und jetzt will ich wissen, was du heute zu feiern hast.«
Sie trank Champagner. »Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher. Ich habe ein Angebot bekommen. Und ich weiß nicht, ob ich mich in der Lage fühlen werde, obendrein an ein Kind zu denken, wenn ich es annehme.«
Er sah sie ebenfalls an. Als eine Weile lang nichts weiter von ihr kam, sagte er: »Ich warte.«
»Fritz Aschinger will mich als Intendantin für den Wintergarten«,sprudelte sie heraus. »Er will Ludwig Schuch für Verwaltung und Finanzen und mich für den gesamten künstlerischen Bereich.«
»Ludwig Schuch?«, fragte Anton nach. »Aber der ist doch an der Scala.«
»Nicht mehr«, erwiderte Nina. »Aschinger zufolge gab es dort ›Querelen mit dem Judenvolk‹, weshalb Schuch ausgeschieden ist.«
»Mit dem Judenvolk meint er Jules Marx?«, fragte Anton verwundert. »Ich hätte nicht gedacht, dass Schuch ein Antisemit ist.«
»Vielleicht ist er ja keiner, sondern hat für seinen Weggang ganz andere Gründe«, sagte Nina. »Fest steht jedenfalls: Aschinger ist einer. Er ist ein Rassist, wie er im Buche steht, aber einer, der eine Registrierkasse verschluckt hat. Solange er die in seinem Bauch klingeln hört, ist ihm alles egal.«
»Und für so einen Menschen willst du arbeiten?«
Nina zuckte die Schultern. »Ich arbeite ja so oder so für ihn. Es war mir nur nicht bewusst, dass bei diesem Männchen von höchstens dreißig in Zukunft die Fäden zusammenlaufen. Dass ich ihm unseren Wintergarten nicht allein überlasse, steht für mich fest. Die Frage ist nur: Will ich von Programm zu Programm um jeden gewagten Schritt, den meine Frauen sich einfallen lassen, kämpfen, oder setze ich mich an die Spitze der Pyramide, streiche ein dickes Gehalt ein und bestimme selbst, wie die Puppen tanzen.«
Anton schwieg eine Weile mit noch immer verschränkten Händen. »Ich kenne diesen Aschinger gar nicht«, sagte er dann. »Kannst du mir erklären, warum es mir trotzdem vorkommt, als höre ich gerade ihn sprechen und nicht dich?«
»Das ist ungerecht«, fuhr Nina auf. »Du warst nicht dabei, du weißt nicht, worüber wir geredet haben.«
»Dann erzähl es mir.«
»Ich habe ihm gesagt, dass ich Evelyn Dove im Wintergarten haben will«, sagte Nina.
»Die schwarze Britin, die singt wie Josephine Baker?« Anton pfiff durch die Zähne.
Nina nickte. »Ich will ihre Chocolate Kiddies und meine Wunderweiberzu einem einzigen großen Spektakel mischen, einem ineinanderfließenden Schachbrett, dass den Leuten die Augen übergehen. Aschinger habe ich meine komplette Vision davon ins Gesicht geschleudert, weil ich ihn provozieren, ihm beweisen wollte, dass ich nicht die Art von Frau bin, die er als Intendantin will. Ihm sind die Züge entgleist, als stünde er kurz davor, mir sein Frühstück vor die Füße zu spucken, aber gleich darauf hatte er sich wieder in der Gewalt. ›Mir schmeckt das nicht‹, hat er gesagt. ›Meiner persönlichen Ansicht nach kann ein Mensch mit gesundem Empfinden an diesen äffischen Visagen nichts anziehend finden, aber wissen Sie was? Wenn es Geld bringt, soll es mir recht sein. Solange Sie sich merken, dass Geld für mich ein gutes Argument ist, kommen wir blendend miteinander aus.«
»Äffische Visagen?« Anton schob die Platte mit dem Fisch, von der er sich eben hatte bedienen wollen, von sich weg. »Und das hast du so stehen lassen? Ausgerechnet du, die mit ihrer Arbeit die unzähligen Facetten von menschlicher Schönheit feiert, die in jedem ihrer Programme herausstellt, was uns bei aller Verschiedenheit verbindet?«
»Ich habe ihm gesagt, was ich von seiner persönlichen Ansicht halte«, erwiderte Nina gereizter, als sie beabsichtigt hatte. »Aber im Gegensatz zu dir bin ich für eine ganze Menge Menschen verantwortlich. Ich kann nicht riskieren, dass deren Einkommen von heute auf morgen wegfällt, weil ich dem neuen Inhaber ins Gesicht gesprungen bin. Außerdem hat niemand etwas davon. Wenn ich dagegen Evelyn Dove herhole und die Berliner ihr zu Füßen liegen, könnte das genau die Wirkung haben, die Leute wie Aschinger vermeiden wollen.«
»Und dafür akzeptierst du, dass er reizende Leute wie Jules Marx und seine Geschäftspartner als Judenvolk beschimpft, ihnen die Mitarbeiter wegkauft und ihnen womöglich den Ruf ruiniert?«