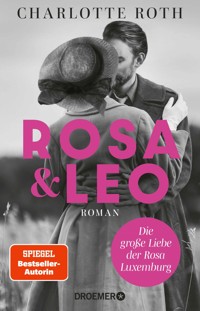14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein biografischer Roman, der Sie zu Tränen rühren wird: Die wahre Geschichte über die große Liebe der Stauffenbergs. Bestseller-Autorin Charlotte Roth erzählt in ihrem historischen Roman eine der schönsten und traurigsten Liebesgeschichten, die das Leben schrieb: eine Geschichte von Anstand und Courage, und von Hoffnung inmitten tiefster Verzweiflung während des Zweiten Weltkriegs. Sie ist die Tochter des fränkischen Generalkonsuls und einer baltischen Freifrau. Er ist der jüngste Spross eines schwäbischen Adelsgeschlechts mit einer vielversprechenden militärischen Karriere. Als Nina und Claus von Stauffenberg sich 1929 auf einem Ball kennenlernen, sind sie verliebte junge Menschen auf dem Weg in ein märchenhaftes Leben. Doch der furchtbare Lauf der Geschichte will es anders: Aus der Mutterkreuzträgerin und dem Wehrmachtsoffizier werden Regimegegner und Verschwörer. Das Schlimmste für ihn: Deutschlands Zusammenbruch. Für sie: der Verlust ihres geliebten Mannes. Trotzdem lässt Nina von Stauffenberg ihrem Claus die Freiheit, zu tun, was er tun muss. Doch das bedeutet, dass sie ihn nach dem 20. Juli 1944 nie wiedersehen und alles verlieren wird … »Die Stauffenbergs« ist fesselnde zeitgeschichtliche Unterhaltung für Leser*innen von Brigitte Glaser oder Peter Prange. In Charlotte Roths Reihe über die größten Liebesgeschichten des 20. Jahrhunderts finden Sie weitere bewegende Romane, die zu Herzen gehen: - »Rosa & Leo« - »Die Liebe der Mascha Kaleko«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 506
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Charlotte Roth
Die Stauffenbergs
Eine große Liebe in Zeiten des KriegesRoman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Sie ist die Tochter des fränkischen Generalkonsuls und einer baltischen Freifrau, er der jüngste Spross eines schwäbischen Adelsgeschlechts mit einer vielversprechenden militärischen Karriere. Als Nina und Claus von Stauffenberg sich kennenlernen, sind sie verliebte junge Menschen auf dem Weg in ein märchenhaftes Leben. Doch der Lauf der Geschichte entschied es anders: Aus der Mutterkreuzträgerin und dem Wehrmachtsoffizier wurden Regimegegner und Verschwörer. Das Schlimmste für ihn: Deutschlands Zusammenbruch. Für sie: der Verlust ihres geliebten Mannes. Sie ließ ihm aber die Freiheit zu tun, was er tun musste. Und das bedeutete, dass sie ihn nach dem 20. Juli 1944 nie wiedersah und alles verlor …
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Anmerkung
Widmung
Bevor die Geschichte beginnt
Motto
Zitate aus einem Rundfunkinterview
1. Kapitel
Erster Teil
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
Zitate aus einem Rundfunkinterview
12. Kapitel
Zweiter Teil
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
Zitate aus einem Rundfunkinterview
24. Kapitel
Dritter Teil
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
Zitate aus einem Rundfunkinterview
38. Kapitel
Zum Gedenken
Glossar
Quellenangaben
Zum besseren Verständnis zeitgeschichtlicher und selten verwendeter Begriffe befindet sich am Ende dieses Romans ein Glossar.
Für meinen eigenen Klaus,
in Liebe.
Bevor die Geschichte beginnt
Dieser Roman ist vor allem eine Liebesgeschichte.
Natürlich ist die Frage gestattet, warum ich mir gewünscht habe, die Geschichte der Stauffenbergs als Liebesgeschichte zu erzählen. Sie mir zu stellen, ist jedoch sinnlos, denn die einzige Antwort, die ich geben kann, ist der Roman, den Sie in den Händen halten.
Liebe ist immer der Ort in uns, an dem wir verwundbar werden. Wenn wir es zulassen, werden wir an demselben Ort empfänglich für die Verwundbarkeit anderer Menschen. Und wenn wir noch einen Schritt weitergehen, begreifen wir von diesem Ort aus, dass wir als Menschen miteinander verbunden sind.
Ich hoffe sehr, Sie werden an keiner Stelle das Gefühl haben, ich hätte es an Respekt noch lebenden oder verstorbenen Menschen gegenüber fehlen lassen. Sollte dies doch der Fall sein, so bitte ich Sie herzlich, mir das mitzuteilen, damit ich darauf reagieren kann. Auch ansonsten freue ich mich jederzeit über Ihr Feedback auf Facebook und Instagram oder über meine Website www.charlotte-lyne.com.
Aus dramaturgischen Gründen habe ich nicht nur private Ereignisse im Leben der Menschen um Nina und Claus von Stauffenberg zeitlich oder räumlich verschoben, sondern auch verschiedene Nebenfiguren erfunden, verändert, gestrichen oder zusammengezogen. Auch die Figur meiner Chronistin Hetty Klötzke habe ich erfunden. Ich weise darauf hin, dass sie alle ebendies sind: Figuren. Zwar Menschen nachempfunden, die gelebt haben, aber das trifft vermutlich auf die Figuren eines jeden Romans zu. Den Anspruch, eine Biografie zu schreiben, hatte ich als Romanautorin nicht. Wohl aber den Wunsch, zu erreichen, was dem Romanautor, der Romanautorin im besten Fall gegeben ist: durch Erfundenes Wahres sichtbar machen. Ob das gelungen ist, liebe Leserin, lieber Leser – entscheide nicht ich, sondern das entscheiden Sie.
Und da ich mir vor allem gewünscht habe, dass dies ein ehrliches Buch wird, folgt noch ein Nachsatz, ein Geständnis: Um jener Ehrlichkeit willen habe ich, als ich anfing, dieses Buch zu planen, gedacht, ich kann es nicht für die Familie von Stauffenberg schreiben. Ich muss meinen eigenen Weg damit gehen, ohne an die Familie von Stauffenberg zu denken, und was die Familie von Stauffenberg am Ende von meinem Buch hält, darf keine Rolle spielen.
Jetzt bin ich am Ende angekommen. Und stelle fest, dass ich mich von ganzem Herzen freuen würde, wenn der Familie von Claus und Nina von Stauffenberg, dieser großen Schar Nachkommen, die Hass und faschistische Mordgier nicht auslöschen konnten, mein Buch gefällt.
Vielen Dank Ihnen allen.
Charlotte Roth,
Dezember 2023
»There was truth and there was untruth. And if you clung to the truth even against the whole world, you were not mad.«
George Orwell, 1984.
Hetty KlötzkeZitate aus einem Rundfunkinterview
1
In Geschichten ist das manchmal so, oder nicht?
Dass man sich an die Figuren noch Jahre später erinnert, obwohl man die Geschichte selbst längst vergessen hat.
Aber bei dem, was Sie hier von mir hören wollen, ging’s ja um keine Geschichte, sondern ums richtige Leben. Und an die kleine Nina werd ich mich noch an dem Tag erinnern, an dem ich das Zeitliche segne.
Nicht wegen dem, was später passiert ist, sondern weil sie schon als Kind was Besonderes war. Eine richtige Prinzessin. Und damit mein ich nicht, dass sie verwöhnt war oder verzärtelt, denn die Eltern Lerchenfeld haben schon darauf geachtet, dass ihr Mädel mit beiden Füßen auf dem Teppich blieb, und die Nina lief ja den ganzen Sommer in zerrissenen Röcken und uralten Reitstiefeln rum. Aber sie hatte Klasse. Charakter. Wenn sie, so klein, wie sie war, sich einmal zu etwas entschlossen oder wenn sie zu einer Sache eine Meinung gefasst hatte, dann stand sie dazu, und nichts und niemand hat sie davon abgebracht.
Angst machen lassen hat sie sich von keinem Menschen, aber sie hatte daheim, bei den Lerchenfelds, wo jeder sie liebte, ja auch keinen Grund dazu. Ein kleiner Springinsfeld war sie und hat immer so gerne gelacht.
Und der Claus?
Na, in den waren wir ja alle gleich verschossen, als er in dem Sommer auf einmal mit seinem Auto vor der Tür stand und die Nina samt den Eltern einpacken wollte, um sie seiner Familie vorzustellen. Das war einer von diesen Männern ganz alter Schule, wenn Sie wissen, was ich meine – irgendwie aus einer anderen Zeit. Ganz am Anfang hab ich mal zur Nina gesagt: Ach Gott, gnädiges Fräulein, der Herr Graf – ist der denn nicht viel zu ernst für Sie?
Aber sie hat nur gelacht und gerufen: Aber nicht doch, Klötzchen, so ernst ist er gar nicht. Sein Humor ist nur ein bisschen schreckhaft und traut sich noch nicht richtig raus.
Und so war’s ja wohl auch. Wenn sie zusammen waren und wie in ihrer eigenen Welt, dann sahen sie plötzlich aus, als hätten sie gerade gelacht, die Nina und ihr Claus.
Ob der ein Nazi war?
Ach Gott, da fragen Sie mich was. Über solche Sachen, Politik und dergleichen, redete man ja nicht mit einer, die im Elternhaus der Verlobten das Hausmädchen war. Und außerdem waren damals doch alle Nazis. Genau genommen könnte man sagen, einer war ein Nazi oder hat so getan, als ob er einer wär, oder er war tot.
Was nun genau der Claus war, weiß ich nicht, denn darüber hat er mit mir ja, wie gesagt, nicht geredet. Aber dass er tot ist, weiß ich, und das wissen Sie auch, denn seien wir mal ehrlich: Sonst wären Sie ja nicht hier und würden mir diese ganzen Fragen stellen.
Erster Teil
»Du bist da. Und das, was ich nie verlor.«
Kurt Tucholsky
2
Wenn sie in diesen Tagen nach Hause kam, beschleunigte sie ungewollt ihre Schritte. Eine Angst, für die es keinen Grund gab, zwang sie zur Eile. In der Stadt, an den Türen der öffentlichen Gebäude, hingen Zettel mit den Namen der Gefallenen. Davor versammelt standen Frauen, die vor Furcht zitterten, auf jenen Zetteln die Namen ihrer Söhne zu entdecken. Carolines Söhne aber waren noch zu jung, um ihr weggeholt zu werden. Sie waren sicher und geborgen daheim bei Miss Berry, der Kinderfrau, die nur Englisch sprach und sich deswegen mit den Jungen nicht länger vor die Tür wagte.
Dennoch eilte Caroline mit langen Schritten die Allee hinunter. Hier, auf dem Weg zu dem einstigen Verwaltungsgebäude, das den Stauffenbergs als Dienstwohnung zur Verfügung stand, war man früher oft Württembergs König begegnet, der ein bescheidener Mann war, seinen Hund ausführte und freundlich seinen Hut zum Gruß zog. Seit Krieg herrschte, führte jedoch nicht einmal ein König mehr seine Hunde aus. Atemlos stürzte Caroline zur Tür herein, schob selbst Hasso und Nero, ihre geliebten Hunde, beiseite und lief in ein paar Sätzen die Treppe hoch zum Kinderzimmer. Als könnten in der kurzen Zeit ihrer Abwesenheit die Rekrutierer des Kaisers in ihr sicheres Haus eingedrungen sein, um ihre drei kleinen Jungen an die Front zu schaffen.
Der Gedanke, so absurd er angesichts des zarten Alters ihrer Kinder war, drehte ihr den Magen um. Es durfte nicht sein. Niemals. Sie hatte doch schon einen verloren, einen von vieren, ihren kleinen Konrad, der einen Tag nach der Geburt gestorben war.
Sie hatte ihn im Arm gehalten. Claus und Konrad, ihr zweites Paar Zwillingssöhne, hatten bei ihr gelegen, einer links und der andere rechts, während Konrad seinen letzten Atemzug tat. Die Mütter, die sich vor den Anschlagtafeln versammelten, hatten ihre Söhne nicht im Arm halten dürfen, während diese ihren letzten Atemzug taten. Sie waren bei ihnen gewesen, als sie auf die Welt kamen, aber nicht, als sie sie wieder verließen, und ob von den zarten, perfekten Körpern, die ihre Mütter einst geboren hatten, noch etwas übrig war, das wussten sie nicht.
Wie sollte eine Mutter so etwas ertragen?
Und dabei hatte doch eine Frau, die in einer Familie wie der von Caroline Söhne bekam, keine andere Wahl, als es zu ertragen. Familien wie die ihren bekamen Söhne, damit sie dem Kaiser und dem Vaterland dienten.
Heldensöhne, Heldenmütter.
Carolines Herzschlag beruhigte sich erst, als sie die oberste Stufe erreichte und aus dem Zimmer mit der angelehnten Tür die lebendigen, noch kindlichen Stimmen ihrer Söhne vernahm. Sie blieb stehen, um Atem zu holen, hielt sich am Geländer fest.
»Ich melde mich gleich, wenn ich sechzehn Jahre alt werde«, hörte sie Berthold erklären, den Erstgeborene ihres älteren Zwillingspaares, der für gewöhnlich den Wortführer des Dreigespanns gab. »Oder schon mit fünfzehn vielleicht. Das ist nicht mehr so lang hin. Bei einem, der groß und sportlich ist, nehmen sie’s mit dem Alter nicht so genau. Schon gar nicht, wenn er wie ich aus einer der richtigen Familien stammt, denn solche braucht es ja, um unser Deutschland zu verteidigen.«
Aus einer der richtigen Familien.
Carolines Mann Alfred, den sie Schlaggi nannte und der ein so gelassenes, pragmatisches Gemüt hatte, war Oberhofmarschall und Major am württembergischen Hof. Die lange Reihe derer von Stauffenberg, der er entstammte, gehörte dem Ministerialadel an und war für ihre Dienstbarkeit und Treue in den Grafenstand erhoben worden. Ein Graf von Stauffenberg verweigerte seinem Fürsten nichts, was dieser von ihm verlangte, weder sein Leben noch das seiner Lieben. Ein Graf von Stauffenberg schwor Eide und starb lieber, als sie zu brechen.
Um ihre eigene Familie war es kaum anders bestellt: Die von Uexküll-Gyllenbands, baltendeutsche Uradelige mit seit dem Hochmittelalter verbürgten Verdiensten, standen den Stauffenbergs in nichts nach. Feldmarschall von Gneisenau, der das preußische Heer reformiert hatte, war lediglich der berühmteste von Carolines Vorfahren, und einer ihrer Onkel hatte ihre Brüder gelehrt, dass Menschen ebenso wie Pferde für bestimmte Verwendungszwecke gezüchtet wurden: »Der Bauer verpflegt sein Land. Der Edelmann stirbt für es.« Vermutlich musste Caroline sich glücklich schätzen, weil ihr Mann mit seinen fünfundfünfzig Jahren seine aktive Militärzeit lange hinter sich hatte und zum Sterben nicht länger gebraucht wurde.
Aber ihre Söhne!
Die hatten noch alles vor sich.
Berthold, der kleine Gernegroß, der ihr als Erster geschenkt worden war, wurde im nächsten Frühling zehn Jahre alt und sollte im September auf das Eberhard-Ludwigs-Gymnasium wechseln. Er spielte Klavier, parlierte wie selbstverständlich auf Französisch und Englisch, las unter der Bettdecke Seefahrerromane. Wie konnte er davon sprechen, sich an die Front zu melden? Hatte nicht der Kaiser in Berlin verkündet, zu Weihnachten sei der Krieg bereits gewonnen und vorbei? Bis zu Weihnachten aber waren es nur noch zwei Wochen, ganz Stuttgart lag unter einer Schneedecke, und die Zirkel der Offiziersgattinnen hatten begonnen, Berge von Wolle zu verstricken, damit den Kämpfenden nicht Hände und Füße erfroren. Vom Ende des Krieges war nicht länger die Rede, und Berthold, dessen Stimme kaum noch kindlich und piepsig klang, prahlte weiter:
»Stauffenberg. Das hat seinen Klang. An meiner Haltung und Vaterlandstreue wird bestimmt niemand zweifeln, und dass ich ein fabelhafter Reiter bin, werde ich im Nullkommanichts bewiesen haben.«
»Ich auch«, fiel Alexander, sein Zwillingsbruder, ein. »Wenn du dich meldest, komme ich mit.«
»Du wirst vielleicht ein wenig warten müssen«, beschied ihn Berthold gönnerhaft. »Ein paar Monate, bis ich gezeigt habe, dass die Stauffenberg-Söhne keineswegs zu jung sind, um ihrem Land zu dienen, weder zu jung zum Kämpfen noch zu jung zum Sterben. Wenn aber das einmal geklärt ist, hole ich dich nach.«
Caroline konnte ihre Söhne nur hören, doch sie glaubte, vor sich zu sehen, wie Claus voll Verehrung zu Berthold aufblickte. Er vergötterte seine älteren Brüder, wünschte sich nichts sehnlicher, als von ihnen anerkannt zu werden. Claus, ihr Kleinster. Der, der ihr von ihrem jüngsten Zwillingspaar geblieben war und von dem sie sich insgeheim wünschte, er möge langsamer als die zwei anderen wachsen. Das Haar hatte sie ihm jahrelang in dichten Locken bis auf die Schultern fallen lassen wie einem Fürstenkind aus vergangener Zeit. Es passte zu seinen feinen, fast mädchenhaft hübschen Zügen und den seelenvollen Augen, doch seit der Krieg begonnen hatte, bestand er auf einem militärisch kurzen Haarschnitt, wie seine Brüder ihn trugen.
Nur war eben Claus nicht wie seine Brüder. Er war zart. Nicht allein, was seine Gesundheit und körperliche Konstitution anbelangte, sondern ebenso an Seele und Gewissen. Wenn die Geschwister sich stritten, hatten Alexander und Berthold den Anlass eine Stunde später schon vergessen, während Claus sich quälte, bei Nacht nicht schlafen konnte und erst Ruhe fand, wenn er sich bei den zwei Älteren für jeden Fehler entschuldigt und mit ihnen Frieden geschlossen hatte.
Von Berthold und Alex erwartete er, dass sie sich ebenfalls entschuldigten. Mit seinem scharfen Bewusstsein für Gerechtigkeit war es ihm unbegreiflich, dass es sie nicht dazu drängte, und er fühlte sich davon so tief gekränkt, dass Caroline Mühe hatte, ihn zu trösten. »Aber sie müssen es doch gutmachen wollen!«, rief er unter Tränen. »Nur ein Wort, und alles wäre vergessen.«
Die Brüder wussten meist nicht einmal mehr, worum es ging, aber Claus plagte sich noch tagelang damit. Seine häufigen Erkrankungen – Angina, Bräune, Drüsenfieber – erschienen Caroline manchmal weniger gefährlich als diese Empfindsamkeit der Seele. Er stand ihr näher als die zwei anderen, auch wenn sie das nie offen eingestanden hätte. Er bedurfte ihres Schutzes, und es bereitete ihr Angst, dass er diesem entwuchs.
»Und mich holst du auch nach«, rief er jetzt mit einem solchen Eifer, einer solchen Inbrunst, dass sich ihr Herz zusammenzog. »Mich soll unser Deutschland auch brauchen!«
Nein, soll es nicht!, schrie es in Caroline. Ich brauche dich, ich habe dich doppelt lieb, weil diese Liebe in mir für zwei gedacht war. Dein Bruder ist mir geraubt worden, und dich darf mir nicht auch noch jemand rauben. Deutschland schon gar nicht. Es hat doch schon so viele, weshalb muss es also noch meinen Clausi bekommen, der mir zu meinem Geburtstag ein Gedicht geschrieben hat und auf seiner Mundharmonika Alle Vögel sind schon da spielt, wann immer er glaubt, dass ich traurig bin?
»Du?«, fragte Berthold von oben herab. »Du taugst nicht dazu, Kleiner. Der Krieg ist doch kein Sandspielplatz, auf dem sich Siebenjährige tummeln.«
»Ja, jetzt bin ich sieben«, begehrte Claus auf, und nur seine Mutter hörte die Tränen, die schon in dieser trotzigen Stimme lauerten. »Aber in zwei Jahren bin ich genauso alt, wie Alex und du heute sind!«
»Das liegt in der Natur der Sache«, erwiderte Berthold altklug wie ein Oberlehrer. »Aber du bist nicht so kräftig wie wir. Im Krieg werden heldische Menschen benötigt. Einer wie du, der beim kleinsten Windhauch krank wird, ist da nur eine Last.«
»Aber als ich im Frühling krank war, hat Dr. Wernecke gesagt, ich bin ein Held!«, rief der arme kleine Claus verzweifelt. »Er hat gesagt, er kennt keinen anderen Jungen, der sich einen Abszess aus dem Hals schneiden lässt, ohne zu weinen, und ich mache meiner Familie Ehre.«
»Ach, Cläuschen klein.« Berthold lachte. »An der Front, wo unsere tapferen Truppen Tag und Nacht unter Beschuss des Feindes stehen, geht es doch nicht um einen lächerlichen Abszess in deinem Hals.«
Es war ein vereiterter, ganz und gar nicht lächerlicher Abszess gewesen, an dem Claus um ein Haar gestorben wäre. Er war wirklich ein Held, denn obwohl er empfindlicher und schwächlicher war als seine Brüder, gab es kein störrisches Pferd, keinen steilen Albfelsen zum Klettern und keinen noch so gefährlichen Skihang, vor dem er zurückschreckte. Es war, als stachle sein kränkelnder Körper ihn nur umso mehr an, sich das Härteste abzuverlangen und auf seine Konstitution keine Rücksicht zu nehmen.
»Du bleibst besser hier und spielst bei der Mami mit Püppchen«, stürzte sich nun auch Alexander ohne Erbarmen auf den kleinen Bruder. »Das tust du doch so gerne. Im Grunde bist du ja Mamis kleines Mädchen, wie sie sich’s gewünscht hat, oder etwa nicht? Und ihr kleines Mädchen zu verlieren, das könnte die arme Mami nicht auch noch aushalten.«
Caroline glaubte, Claus’ Schmerz im eigenen Herzen zu spüren. Sie konnte es ihren Söhnen nicht übel nehmen, Jungen waren eben so, die Großen trieben ihren Spott mit den Kleinen, aber gerade Berthold kümmerte sich oft liebevoll um Claus und spielte stundenlang mit ihm. Dennoch blieb Claus nun einmal der Zwilling, der allein war, der Bruder, dem sein Bruder fehlte. Dass er ihm Blumen und Lichter aufs Grab stellte und dass die Mutter ihm erklärte, der kleine Konrad sei im Himmel, half ihm nicht. Einmal hatte er sich auf dem Friedhof an Caroline festgeklammert und beteuert, in den Himmel wolle er niemals, denn dann könne er ja nicht mehr bei ihr, bei seiner »lieben, lieben Duli« bleiben.
Jetzt hörte sie ihn aufschluchzen. Die verhassten Tränen hatten gesiegt und zwangen ihn, sich eine weitere Blöße zu geben. »Ich bin ein Bub!«, rief er. »Genau wie ihr! Und wer für Deutschland der größere Held wird, das werden wir ja sehen!« Damit stieß er die Tür auf, stürmte hinaus in den Korridor und landete geradewegs in Carolines Armen.
»Ist ja gut, mein Liebling. Ist ja doch alles gut.« Sie hob den kleinen Kerl mit seinem tränenüberströmten Gesicht auf die Arme und trug ihn davon, hinüber in ihr Schlafzimmer, damit er sich vor seinen Brüdern nicht noch mehr schämen musste. »Alex und Berthold sind älter, und die Älteren haben nun einmal ihren Spaß daran, die Jüngeren zu ärgern. Das ist nur Gefrotzel unter Brüdern und nicht bös gemeint.«
Caroline hatte sich auf den Bettrand gesetzt, hatte Claus auf ihren Schoß gezogen und wischte ihm behutsam die Tränen von den Wangen. Dass er im Grunde schon zu groß dafür wurde, war ihr bewusst, aber wer konnte von einer Mutter verlangen, dass sie in keiner von all diesen Lebenslagen Schwäche zeigte?
»Ach Duli.« Herzzerreißend begann Claus von Neuem zu schluchzen und warf ihr seine dünnen Ärmchen um den Hals. »Ach, meine liebe, liebe Duli.«
Den Namen hatte er für sie erfunden. Praktisch von dem Tag an, an dem er der Sprache mächtig gewesen war, hatte er sie ›du liebe Mami‹ und manchmal auch nur ›du Liebe‹ genannt, bis er irgendwann von heute auf morgen beschlossen hatte, das sei zu lang und werde daher ab sofort zu ›Duli‹ verkürzt. Caroline liebte es. In ihrem Claus vereinten sich ihr eigenes zärtliches, überschwängliches Wesen und der praktische Sinn seines Vaters. Sie wiegte ihn ein wenig, bis der vom Schluchzen bebende Rücken sich beruhigte.
»Soll ich den beiden den Hintern versohlen, weil sie so hässlich zu dir sind?«, fragte sie ohne allzu viel Ernst.
»Aber nein!« Mit einem Ruck hob Claus den Kopf und eroberte sich trotz der Tränenspuren seine Würde zurück. »Das darfst du nicht, Duli. Berthold und Alexander sind doch zwei deutsche Helden und keine kleinen unartigen Kinder mehr.«
»Ach, den großen unartigen Helden würde es vielleicht ab und zu gar nicht schlecht bekommen«, murmelte Caroline gedankenverloren. Dann lachte sie und zerzauste ihm sein viel zu kurzes Haar. »Aber wenn du so heldenhaft für die Rabauken eintrittst, lasse ich Gnade vor Recht ergehen.«
Claus strahlte. Carolines Schwester Aja hatte schon vor Jahren gesagt: »Der Kleine hat ein Lächeln, als ob nach einer tiefen Winternacht die Sonne aufgeht.«
»Nicht wahr, Duli? Du glaubst auch, dass ich für Deutschland im Krieg nützlich und ein Held sein kann, nicht wahr?«
»Nun ja«, begann Caroline. »Ich will doch nicht hoffen, dass der Krieg noch so lange dauert, bis du achtzehn bist und dich melden kannst.«
»Achtzehn?«
Caroline nickte. »Deine Brüder sind zwei kluge Köpfe, aber das hindert sie nicht, manchmal ziemlichen Unsinn zu reden. Ja, es soll Jungen geben, die ihren Familien davonlaufen und bei der Musterung über ihr Alter lügen, aber so etwas tut doch kein Stauffenberg.«
»Nein, ein Stauffenberg nicht«, wiederholte Claus.
Im Innern atmete Caroline auf. Sie schien sich herausgewunden, die scharfe Klippe ohne Schaden umschifft zu haben.
Claus aber war mit dem Thema noch nicht fertig. »Lügen werd ich nicht«, setzte er neuerlich an. »Aber wenn ich dann alt genug bin, wirst du mich doch gehen und ein Held sein lassen, nicht wahr, Duli? Weil ich ja nämlich dein Bub bin und nicht dein Mädchen, egal, was Berthold und Alexander sagen. Du hast dir doch nicht wirklich statt mir und Konrädchen zwei Mädchen gewünscht, oder doch?«
»Nein«, sagte Caroline. »Natürlich nicht.« Wie hätte sie sich denn statt seiner jemand anderen wünschen können? Wenn eine Mutter ein Kind in den Armen hielt, war dieses eine Kind das einzige, das es gab, und erfüllte jeden Wunsch. Nur nicht den, es in Sicherheit zu wissen, dachte sie. Geschützt vor dem Zugriff jener, die keine Kinder bekamen, sondern Weltgeschichte schrieben.
Er schmiegte sich an sie und drückte ihr einen Kuss auf die Wange. »Und du versuchst nicht, mich zurückzuhalten, weil du’s nicht aushältst?«
Fieberhaft überlegte Caroline, doch sie konnte ihrem Sohn nichts anderes als die Wahrheit sagen. »Es wäre ja der Vater, der darüber die Entscheidung hat«, brachte sie schließlich heraus. »Und nein, ganz sicher würde dein Vater nicht versuchen, dir auszureden, wozu dein Gewissen dich treibt.«
»Aber du, meine Duli!«, rief Claus, von ihrer Antwort hörbar enttäuscht. »Du musst es auch gutheißen und wenn ich losziehe, in Lautlingen vor der Haustür stehen, bei der Blutbuche, und mir fröhlich winken.«
Schloss Lautlingen auf der Schwäbischen Alb war der Familienbesitz ihres Mannes. Die Stauffenbergs verbrachten ihre Sommer dort. Schlaggi züchtete Artischocken, die Jungen halfen bei der Heuernte, und Claus liebte das Anwesen wie ein Märchenkönig sein Reich.
»Das mit dem Winken kann ich dir nicht versprechen«, sagte Caroline lahm.
»Doch, das musst du!«, rief Claus. »Damit alle Welt sieht, dass nicht wahr ist, was Alexander sagt. Dass du es nämlich sehr wohl aushältst, wenn ich ein Held werde und mein Vaterland verteidige. Weil doch das, was gut für alle ist, wichtiger sein muss als das, was gut für nur einen ist. Und weil du eine Stauffenberg bist. Eine Heldenmutter. Versprich mir das.«
Caroline wollte keine Heldenmutter sein. Sie wollte eine Mutter sein, die ihre Söhne im Bollerwagen über die Wiesen von Lautlingen zog und ihnen höchstens nachwinkte, wenn sie auf selbst geschnitzten Steckenpferden davongaloppierten. Sie wollte, dass Lautlingen in einer sonnigen Zukunft mit ihren Enkeln bevölkert war und dass diese Enkel Väter hatten. Aber darüber mit Claus zu reden, wäre falsch gewesen, denn was blieb Claus anderes übrig, als eines Tages ein Mann und ein Stauffenberg zu sein?
»Ja, ich verspreche es dir«, sagte sie. »Wenn du irgendwann einmal dein Land verteidigen musst, werde ich deine Heldenmutter sein und es aushalten.«
Weil mir so wenig eine Wahl bleibt wie dir, fügte sie in Gedanken hinzu. Weil wir uns alle nicht aussuchen, an welchen Platz wir gestellt werden, und weil darüber kein Nachdenken lohnt. Nur über den richtigen Weg, um diesen Platz auszufüllen, aber dafür hast du noch Zeit, mein Clausi. Lauf zum Spielen in den Park und vergiss, dass Krieg ist. Bilde dir noch für ein paar kurze Jahre ein, du wärst frei.
3
Sie waren geritten. Erst in gesittetem Trab aus der Stadt hinaus und dann über die Weite des Brachlandes bis an den Waldrand. Im Handgalopp. Zügel frei schießen lassen und nichts mehr denken. Nina und ihr Vater. Nina trug ein Kleid, was nicht eben bequem war, aber dass sie zum Reiten in Hosen stieg, hätte ihr Vater nie gestattet.
»Du bist ja keins von diesen Flapper Girls«, hatte er gesagt. »Du bist eine von Lerchenfeld.«
»Ich bin nicht eine«, hatte Nina erwidert. »Ich bin Nina.«
Auf seine ernste, besonnene Weise hatte der Vater eine Weile nachgedacht und dann den Mund auf eine Art verzogen, die Nina zeigte, dass ihre Antwort ihm gefiel.
Er war ein lieber Vater. Viel lieber als die Väter ihrer Freundinnen, auch wenn er nicht lachte, mit ihr herumalberte oder einfach fröhlich war. Er war früher fröhlich gewesen, sagte die Mutter. Früher, in ihrem ersten Zuhause, das Nina vergessen hatte, weil sie damals, als sie von dort fortgemusst hatten, noch zu klein gewesen war. Der Vater redete nicht darüber, und selbst die Mutter, die sonst wie ein Springbrunnen sprudelte, beantwortete Fragen dazu nur, wenn es sich nicht vermeiden ließ.
Sie hätte eben fortgemusst, die Mutter mit den Kindern, hatte allein mit der Hilfe von Hetty und dem Kutscher den ganzen Haushalt zusammenpacken und aufbrechen müssen, um in Bamberg ein neues Zuhause zu finden.
Mit den Kindern.
Das war eine jener Formulierungen, die Nina signalisierten, dass sie besser keine weiteren Fragen stellte, sondern ein Thema anschnitt, über das ihre Mutter, die Frohnatur, lieber sprach. Von den Kindern nämlich war bei der Ankunft in Bamberg nur noch eines übrig gewesen. Sie selbst.
Das Erstgeborene, ihr Bruder, war mit fünf Jahren gestorben. Nina wusste über ihn so gut wie nichts, obwohl sie bei seinem Tod bereits auf der Welt gewesen war und sich hätte erinnern müssen. Auf dem Kaminsims im Salon, wo sich dicht an dicht die Familienbilder drängten, stand keines von ihm. Ihre Mutter hatte ihr immerhin verraten, dass er Ludwig geheißen hatte, ihr Vater dagegen schwieg dazu, als hätte es den Bruder nie gegeben.
Auch auf Ninas wiederholte Frage, wo der Vater denn gewesen sei, als sie mit ihrer Mutter aus dem ersten Zuhause weggemusst hatte, hatte er nie etwas anderes getan als geschwiegen. Aus den Antworten der Mutter hatte Nina sich schließlich ein dürres Gerüst von Fakten zusammengebastelt: Ihr Vater war Diplomat, und ihr erstes Zuhause, in Litauen, das damals zum Russischen Reich gehört hatte, war seine Wirkungsstätte gewesen. Den Namen ›Nebelland‹ hatte Nina gehört, und im Nebel lag es auch für sie. Als zwischen Deutschland und Russland der Krieg ausbrach, war ihr Vater verhaftet und auf eine Festung nach Sankt Petersburg verschleppt worden. Von den Russen sprachen die Erwachsenen, die Nina kannte, im gleichen Ton wie von Nosferatu, der Schreckensgestalt auf den Kinoplakaten. Also konnte sich Nina zumindest dunkel vorstellen, wie es für ihren Vater gewesen sein musste, im Kerker von diesen Nosferatu-Russen gefangen zu sein.
»Dort hat er seine Fröhlichkeit verloren«, hatte ihre Mutter gesagt. »Als er schließlich nach Bamberg kam, musste er sich zur Ruhe setzen, weil ihm die Kraft für seine Arbeit fehlte. Ich werde es nie begreifen. Kein Mensch hat das Recht, einen kaiserlichen Generalkonsul, der diplomatischen Schutz genießt, so einfach verhaften zu lassen, auch ein Zar von Russland nicht.«
Das war alles.
Nina war es genug.
Sie kannte ihren Vater nicht anders als ernst und ein wenig in sich gekehrt wie ein Pullover nach der Wäsche, aber sie liebte ihn deshalb nicht weniger. Er war still und las ihr keine Geschichten vor, spielte mit ihr und ihrer Mutter nicht Quartett. Aber er hatte sie das Reiten gelehrt und teilte seine Liebe zu Pferden mit ihr. Wenn er sie so wie heute in der Frühe wissen ließ, dass er nach dem Frühstück mit ihr ausreiten wollte, freute sie sich auf die Zeit, die nur ihnen beiden gehörte.
Sie ritten beide, bis sie genauso erschöpft waren wie ihre Pferde, dann lockerten sie die Sattelgurte, ließen sie am Waldsaum grasen und setzten sich zwischen die hohen Halme, um ihre Vesper zu verzehren. Wenn es dabei schweigend zuging, war es Nina recht, obwohl sie sonst eine ziemliche Plaudertasche war. War sie mit ihren Cousinen oder ihren Freundinnen zusammen, kam ihr langes Schweigen beunruhigend vor, als stünde etwas im Raum, das man voreinander verbarg. Bei ihrem Vater aber fühlte sie sich im Schweigen geborgen, biss herzhaft in ihr Brot mit Leberwurst und hörte zu, wie er seines verzehrte.
Zusätzlich zur Wegzehrung nahmen sie häufig auch ihre Zeichenblöcke auf die Ausritte mit, und wenn sie dann Rast machten, zeichnete der Vater Pferde. Niemand konnte so hervorragend Pferde zeichnen wie Ninas Vater, und er zeichnete nie irgendeines, sondern immer ein bestimmtes: seinen Fuchswallach Kaiser zum Beispiel oder Venus, ihre braune Stute. Das Unglaublichste war, dass man auf den Zeichnungen des Vaters stets erkennen konnte, welches Pferd er gezeichnet hatte, denn er hielt jede Einzelheit fest. Einen Wirbel am Ansatz der Mähne, einen herausragenden Widerrist, eine Verdickung am Sprunggelenk.
»Dazu ist das Zeichnen hilfreich«, hatte er Nina erklärt. »Es hilft dir, die Vorzüge und die Schwächen eines jeden Pferdes genau zu erkennen.«
Weil sie beide Pferde liebten und weil ihr Vater ein so phänomenaler Pferdezeichner war, hatte auch Nina schon früh mit dem Zeichnen von Pferden begonnen. In der Schule der Englischen Fräulein, die sie besuchte, war sie für ihre Zeichnungen häufig gelobt worden, doch ihr Vater blieb unbeeindruckt.
»So sieht doch kein Pferd aus«, hatte er trocken bemerkt, als sie ihm das Bild eines prächtig gesattelten und aufgezäumten Schimmels überreicht hatte, das sie in ihren sämtlichen Lieblingsfarben schraffiert hatte. Aus seiner Westentasche hatte er den Stift gezogen, den er an seiner Uhrkette bei sich trug, und mitten hinein in den Leib des herrlichen Rosses dessen Knochengerüst entworfen, sodass sie zu sehen bekam, dass der Körperbau hinten und vorne nicht stimmte.
Das erste und vielleicht auch noch das zweite Mal war Nina wütend gewesen, war davongestampft und hatte sich vorgenommen, für den Vater, diesen Banausen, nie wieder etwas zu zeichnen. Als sie ihrer Freundin Bruni davon erzählte, hatte die jedoch gesagt: »Du hast es gut! Für meinen Vater sind meine Zeichnungen Kinderkram, und für so was hat er keine Zeit. Dein Vater nimmt dich ernst. Er behandelt dich, als wenn du eine Erwachsene wärst. Oder wenigstens ein Sohn.«
Sie hatte recht. Zwar brachte der Vater Ninas Zeichnungen nicht die erhoffte Begeisterung entgegen, aber er nahm sich unendlich viel Zeit, um ihr geduldig immer wieder zu erklären, wie sie ihren Stift führen musste, damit das Pferd am Ende doch noch als ein solches zu erkennen war.
Und dabei bin ich kein Sohn, dachte Nina, als sie jetzt in der Augustsonne neben ihm saß und den Pferden beim Grasrupfen zusah. Einen Sohn hatte der Vater ja nicht, denn der einzige, den er gehabt hatte, war gestorben. Spontan lehnte sie ihren Kopf an seine Schulter. Ein wenig erstaunt wandte der Vater das Gesicht von seiner Zeichnung und sah auf sie hinunter, aber er schien sich an der ungewohnten Zärtlichkeit nicht zu stören. Nach einer Weile schob er die Zeichensachen ganz beiseite, legte den Arm um sie, und sie blickten beide in dieselbe Richtung, über die Wiese und die müden Pferde hinweg zu den Dächern und Türmen der Stadt.
Es war friedlich und schön. Irgendwann aber drängte die Frage aus ihr heraus. »Väterchen«, sagte sie, weil sie ihn so am liebsten nannte. »Macht es dich traurig, dass du nur eine Tochter hast und keinen Sohn und Erben?«
Was es bei ihm zu erben gab, wusste sie nicht. Da war das hübsche Bamberger Stadthaus mit dem noch hübscheren Garten, und sicher besaß der Vater auch Kapital, denn er war lange Zeit ein wichtiger Mann gewesen, und es fehlte ihnen an nichts. Außerdem stellten ja alle Männer ihre Jungen so vor: Hier habt ihr meinen Sohn und Erben, und dabei bebten ihre Stimmen ein wenig vor Stolz.
Ihr Vater sah sie kurz an und dann wieder in die Ferne, um zu überlegen. Nina mochte das an ihm: Er war nie schnell mit einer Antwort bei der Hand, sondern wog alles ab. »Ich bin ja kein Rittergutsbesitzer«, sagte er endlich. »Und dafür, dass der Name Lerchenfeld weitergetragen wird, haben die anderen Zweige der Familie bereits reichlich gesorgt. Außerdem wird es bei der einen Tochter ja nicht bleiben, sondern da werden doch wohl Enkel kommen.«
»Und wenn nicht?«, entfuhr es Nina. »Wenn ich deine einzige bliebe – wäre ich dir genug?«
Sie hatte das nicht fragen wollen. Hetty, von ihrer Mutter das ›Mädchen für alles‹ genannt, sagte immer, man solle keine Fragen stellen, solange man nicht sicher war, dass man die Antwort hören wollte. Wie üblich dachte ihr Vater nach, ehe er etwas sagte, und dieses eine Mal fiel es Nina schwer, nicht vor Ungeduld zu zappeln.
»Man wird als Mann ja so aufgezogen«, sagte er endlich. »Von klein auf lernt man, was man für Pflichten zu erfüllen hat, wenn man einmal erwachsen ist, und eine der ersten Pflichten lautet: Du hast einen Sohn zu zeugen. Wenn der Sohn dann auf der Welt ist, wird man beglückwünscht, als hätte man einen Orden erhalten oder wäre befördert worden. Das hat seinen Sinn, denkt man. Ein Mann braucht einen Erben. Aber wo du mich jetzt so fragst – die Zeiten haben sich ja geändert, und wenn ich es mir recht überlege, fällt mir nicht genau ein, wozu für mich nun so dringend ein Erbe nötig ist.«
Ihr Vater machte eine Pause und strichelte mit seinem Stift am Schweif des Pferdes herum. Dass er freiwillig so viel redete, war Nina nicht gewohnt, und sie glaubte schon, er sei fertig. Dann aber blickte er wieder auf und setzte noch einmal an:
»Also ja«, sagte er langsam. »Ich denke schon, dass du mir genug wärst, wenn nicht alle Welt dazu ihre Meinung abgeben würde. Dass man einfach froh und dankbar sein könnte, ein liebes Kind zu haben und mit seiner Familie in Frieden zu leben.«
Wieder strichelte er noch ein wenig auf dem Papier herum, dann betrachtete er seine Zeichnung von allen Seiten und reichte sie Nina.
»Für dich. Deine Venus. Damit du sie in guter Erinnerung behältst, während du nicht hier bei ihr sein kannst.«
Nina betrachtete das Bild. Es war eines von seinen besten, und das, was er zu ihr gesagt hatte, war noch besser. Es kam ihr vor wie ein Geschenk. »Warum soll ich denn nicht hier bei ihr sein können?«, fragte sie.
»Darüber habe ich mit dir sprechen wollen«, erwiderte ihr Vater. »Auf die Schule der Englischen Fräulein bist du gern gegangen, nicht wahr? Obwohl du die einzige Protestantin auf einer katholischen Klosterschule warst?«
Nina nickte. Wenn sie ehrlich war, spielte die Religion weder in ihrem Leben noch in dem ihrer Familie eine wesentliche Rolle, und mit ihren Mitschülerinnen war sie immer gut ausgekommen. Es hatte ihr gefallen, ein wenig anders, ein wenig besonders zu sein und dennoch dazuzugehören. Sie hatte die überladene Pracht des alten Barockklosters lustig gefunden und in dem weitläufigen Innenhof gerne gespielt.
»Deine Mutter und ich haben uns darüber beraten, wie es für dich nun nach den Ferien weitergehen soll«, sagte ihr Vater. »Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das Lyzeum hier in Bamberg nicht das Richtige ist. Es gilt als äußerst konservativ, den neuen Entwicklungen in der Mädchenerziehung gegenüber nicht aufgeschlossen, und wir haben Sorge, dass du darin nicht gut aufgehoben bist.«
»Aber alle meine Freundinnen und die Cousinen gehen dorthin!«, rief Nina erschrocken.
»Ich weiß«, sagte ihr Vater. »Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, und vielleicht wärst du besser dran, wenn wir mehrere Kinder und daher gar keine Zeit gehabt hätten, uns all diese Gedanken zu machen. Wie dem aber auch sei, wir haben beschlossen, dass du nach Wieblingen auf das Landerziehungsheim des Fräuleins von Thadden gehen sollst, die einen modernen Erziehungsstil pflegt.«
»Und wo ist dieses Wieblingen?« Obwohl sie gerade erst Wurstbrote gegessen hatte, breitete sich in Ninas Magen eine Leere aus, die ihr Angst machte.
»Bei Heidelberg«, sagte ihr Vater. »Mit dem Zug vier Stunden von hier, doch zu den Ferien werde ich dich mit dem Automobil abholen.«
»Vier Stunden von hier?« Nina sprang auf. »Aber ich will das nicht, Papi! Ich will hier bei euch sein, bei dir und Mami und Hetty und den Cousins und Cousinen!«
Jäh blickte sie hinüber zu den Häusern der Stadt, die an diesem wolkenlosen Sommertag auf einmal wie in Nebeln zu verschwinden schienen.
»Das verstehe ich.« Ihr Vater stand ebenfalls auf, legte den Arm um Nina und zog sie behutsam an sich. »Fort von denen zu sein, die man liebt, ist hart, aber man muss es lernen, und besser, man tut es auf die sanfte Art. Zu jeden Ferien hole ich dich nach Hause, das verspreche ich dir. Und die Mami wird dir schreiben. Und dich vielleicht sogar besuchen.«
»Aber warum muss ich denn auf diese Schule in Heidelberg gehen?«, rief Nina hilflos. »Ich will doch keine Gelehrte werden, ich will nur hier bei euch und unseren Pferden sein und genau so weiterleben, wie wir es immer getan haben.«
»Ja, meine Nina. Das wäre schön.« Sacht nahm ihr Vater sie am Ellbogen und führte sie hinüber zu den Pferden. »Aber weil das vielleicht nicht möglich ist und weil die Zeiten sich schneller ändern, als ein alter Zausel wie ich ihnen folgen kann, ist es mir wichtig, dich nicht im Althergebrachten festzuhalten. Dich auf eine Schule zu senden, wo sie dir dein Rückgrat und deinen eigenen Kopf lassen. Du bist mein einziges Kind, und für mich wirst du immer etwas Besonderes bleiben. Wenn aber auch das Leben etwas Besonderes in dir sieht und dir Besonderes abverlangt, dann will ich, dass du dafür gerüstet bist.«
4
Endlich wieder in Bamberg, endlich wieder zu Hause!
Nina war keines der Mädchen gewesen, die in den Jahren im Internat bitter litten, sondern hatte sich auf Schloss Wieblingen rasch eingelebt und ebenso rasch Freundschaften geschlossen. Die Schule war fortschrittlich, reformpädagogisch ausgerichtet. Niemand verübelte es einer Schülerin, wenn sie lieber Pferde als Kleiderpuppen zeichnete und als Bettlektüre Winnetou und Die drei Musketiere dem Trotzkopf vorzog. Sie hatten Sport getrieben, moderne Tänze von Charleston bis Lindy Hop gelernt und französische Konversation studiert und waren auf ihren Klassenfahrten bis nach Venedig gelangt. Elisabeth von Thadden, die Schulleiterin, hatte auf diesen Reisen mehr die ältere Freundin als die gestrenge Rektorin herausgekehrt und bei dem, was ihre Schützlinge trieben, beide Augen zugedrückt.
Alles in allem ließ sich gegen die Schulzeit in Wieblingen, so dicht bei der hübschen Stadt Heidelberg gelegen, also nichts sagen. Der Vater hatte klug für Nina gewählt, und als Rektorin von Thadden ihr im Festsaal des Schlosses das Zeugnis der Mittleren Reife überreicht hatte, waren Nina ebenso wie all den anderen flüchtig die Tränen gekommen. Dann aber war sie von der Bühne gesprungen, in die Arme ihrer wartenden Eltern geeilt und hatte sich so leicht und befreit gefühlt wie vielleicht zum letzten Mal als Kind.
Befreit nicht von der Bürde der Schulzeit, durch die sie zwar nicht gerade mit Glanz und Gloria, aber doch ohne sonderliche Mühen gesegelt war, sondern vom Gewicht des Heimwehs, das sich manchmal, vor allem in der Stille einer Winternacht, angefühlt hatte wie ein Wackerstein auf ihrer Brust.
So eine seltsame Angst war das gewesen, düster, wie Nina es bei Tag nicht von sich kannte, als könnte das Haus in Bamberg, wenn sie dorthin zurückkam, auf einmal nicht mehr da sein. Auch ihr erstes Zuhause war auf einmal nicht mehr da gewesen, so ganz und gar nicht mehr da, dass sie sich beim besten Willen nicht daran erinnern konnte. An ihren Bruder, den Ludwig, konnte sie sich auch nicht erinnern, obwohl ohne die Erinnerung doch nichts von ihm übrig war, und all das machte ihr in solchen dunklen Nächten Angst.
Nina konnte der Dunkelheit nichts abgewinnen. Sie liebte Licht, Sonnenschein, strahlende Tage, und vor allem liebte sie Menschen. Am liebsten hatte sie so viele wie möglich um sich, sodass sie in ihren Lärm und ihren Trubel eintauchen und sich darin aufgehoben fühlen konnte. Ihre Familie in Bamberg bildete den Pulk ihrer Lieblingsmenschen: der Vater, die Mutter, die Schar der Onkel und Tanten und das laute, lebhafte Gewirbel der Cousinen und Cousins.
»Kein Wunder, dass die Nina an ihren Basen und sogar an diesen wilden Vettern so sehr hängt«, hatte vor Jahren die alte Großtante Friedel bemerkt. »Kinder zieht’s nun einmal zu Kindern, und Geschwister hat sie ja keine, das arme, einsame Ding.«
Als einsames Ding fühlte Nina sich keineswegs, aber ansonsten hatte die Großtante nicht unrecht. Ohne die Vielzahl von Kindern in der Familie wäre es in ihrem Leben vielleicht allzu still und allzu erwachsen zugegangen. Stattdessen hatten sich ihre Verwandten jedes Mal, wenn sie in den Ferien heimgekommen war, überschlagen, um ihr einen nicht enden wollenden Reigen von Kindergesellschaften, später Tanztees und schließlich Bällen zu bieten. »Damit das Mädele etwas erlebt«, pflegte ihre Tante Künßberg zu sagen und veranstaltete die schönsten und aufwendigsten dieser Zusammenkünfte gleich selbst. Tante Künßberg wurde von allen, die sie kannten, beim Familiennamen genannt, weil sie mit dem Vornamen Hertha hieß wie ihre Tochter, Ninas Lieblingscousine. In der Verwandtschaft gab es noch weitere Herthas, und um die Verwirrung in Grenzen zu halten, hatte sich für die Tante das Künßberg eingebürgert, meist zu einem liebevollen ›Künßi‹ verkürzt.
Tante Künßi und ihr Mann hatten am Rand von Bamberg ein stattliches Anwesen erworben, zu dem ein mehrstöckiges Lagergebäude gehörte. Da die beiden keine Landwirtschaft betrieben, hatten sie sich dieses zu einem Festsaal ausbauen lassen, in dem spielend eine Hundertschaft von Gästen Platz fand. Hier gab Tante Künßi ihre Festlichkeiten ›für die Jugend‹, welche mit ein paar diskret platzierten Aufsichtspersonen unter sich bleiben durfte, während die älteren Generationen sich im Wohnhaus vergnügten.
Nina hatte all diese Gesellschaften von Herzen genossen. Sie tanzte gern, liebte Musik und war glücklich, weil so viele ihrer Lieben um sie herumtollten. Ein winziger Tropfen Wehmut war in dem bunten Cocktail aus Frohsinn jedoch mitgeschwommen, weil sie ja gewusst hatte, dass die anderen in Bamberg bleiben würden, während sie selbst binnen Kurzem wieder abreisen musste. Diesmal aber würde es solche trüben Gedanken nicht geben. Sie war zu Hause, ihre Schulzeit abgeschlossen, ihr Nachttisch und Spind auf Schloss Wieblingen leer geräumt. Zwar sprachen ihre Eltern davon, sie für eine Weile nach Lausanne zu schicken, damit sie ihr Französisch aufbessern konnte, doch das war noch Zukunftsmusik, und in diesen schönen Frühlingstagen brauchte sie sich damit nicht zu befassen.
Es gab ja so viel anderes, an Ablenkung herrschte kein Mangel. Seit einer halben Woche war Nina erst hier, und seit dem Moment ihrer Ankunft waren ihre Cousinen ihr kaum einen Augenblick von der Seite gewichen. Sie belagerten sie von morgens bis abends und überhäuften sie mit Neuigkeiten. Da sie nun alle keine Kinder mehr waren, drehte es sich bei diesen Neuigkeiten vor allem um jüngst erworbene Kleider, jüngst im Rundfunk gehörte Musik, angesagte Filmstars und junge Männer.
Bamberg war Garnisonsstadt. An jungen Männern gab es somit, wie Tante Künßi sich ausdrückte, einen unerschöpflichen Zufluss. Zumindest hatte es den gegeben, ehe der verlorene Krieg Deutschland gezwungen hatte, sein Heer auf einen nicht nennenswerten Rumpf zu reduzieren. Nach Bamberg aber strebten selbst jetzt noch reichlich Offiziere und Anwärter, um Aufnahme in die Reitereskadronen unter Oberst Zürn zu erlangen. Und über diese Neuankömmlinge wusste niemand besser Bescheid als Cousine Hertha, die zwei ältere Brüder hatte und diese wie eine Spionin aushorchte. Wer bei welcher Eskadron eingetroffen war, wer auf welcher Gesellschaft erwartet wurde und bei wem es sich lohnte, sich offiziell vorstellen zu lassen – ihren gespitzten Ohren entging nichts. »Fragen Sie Fräulein Hertha«, alberte Nina. »Unsere einzigartige Bamberg-Führerin für heiratswillige junge Damen.«
»Bist du denn das jetzt, Nina? Eine heiratswillige junge Dame?« Die Frage kam von Amelie, einer Cousine entfernteren Grades, die zwei Jahre älter und bereits einmal haarscharf an der Verlobung mit einem Oberleutnant der Kavallerie vorbeigeschrammt war. »Zu Weihnachten hatte ich noch den Eindruck, du hättest an gut gebauten Pferden mehr Interesse als an den Buben, die auf ihnen sitzen.«
Die Schar der Cousinen – mit Nina sechs an der Zahl – lümmelte auf Bett und Sesseln verteilt in Herthas Schlafzimmer, das in ihr Ankleidezimmer überging. Noch ein wenig schwatzen, albern, Gedanken und Gerüchte austauschen, dann würden sie einander helfen, pastellfarbene Frühlingskleider über Unterröcke und Mieder zu streifen, Frisuren zu richten und Haken und Ösen an Schmuckstücken zu schließen. Drüben im Festsaal erwartete sie Tante Künßis neuester Streich, ein Frühlingsball ›für den jungen fränkischen Adel‹, und mit jeder Minute, die verstrich, wuchs die wundervolle kribbelnde Erregung, die oft schöner war als die Veranstaltung selbst.
Über Amelies Frage dachte Nina nach. War sie eine heiratswillige junge Dame? Um sogleich aufs Heiraten zu zielen, war sie noch reichlich jung, und bei dem Gedanken, sich an einen Einzigen für immer zu binden, wurde ihr ein wenig mulmig im Bauch. Ein paar Männer, deren Gesellschaft sie genossen hatte, waren ihr durchaus schon begegnet, aber woher sollte sie wissen, ob einer der Richtige war, ob er sie noch in zwanzig oder gar in dreißig Jahren lieben würde, und sie ihn am besten auch? Wie ließ sich vorhersagen, dass man einander nicht überdrüssig würde, den Anblick, die Stimme, selbst den Duft des andern nicht sattbekäme und sich miteinander langweilte? Nina brauchte eine Pause beim Denken. Aus ihrer Ballhandtasche zog sie ein zerknautschtes Päckchen der Marke Juno, klopfte eine Zigarette heraus und zündete sie sich an.
Die Augen der Cousinen, bald so groß wie die Scheinwerfer von Automobilen, brachten sie zum Lachen. »Nun fragt schon«, rief sie übermütig. »Ehe ihr vor Neugier platzt.«
»Du rauchst?«, sprudelte Hertha heraus. »Ach, ich möchte ja auch so gern, aber meine Frau Mama …«
»Du solltest es versuchen«, sagte Nina und hielt der Cousine das Päckchen hin. »In der Abschlussklasse in Wieblingen haben wir es alle ausprobiert, aber nur ich bin dabei geblieben.«
»Warum?«, fragte Amelie.
»Weil es mir schmeckt.«
Irgendwie tat es das tatsächlich, zumindest seit sie sich daran gewöhnt hatte. Wenn sie ehrlich war, hatte sie jedoch damit angefangen, weil ihr das Bild von sich selbst mit der Zigarette im Mund gefiel. Auch jetzt betrachtete sie sich klammheimlich im Spiegel über Herthas Toilettentisch. Der Anblick glich in nichts mehr dem braven, blond bezopften Mädchen auf den Fotografien, die gerahmt in ihrem Elternhaus auf dem Kaminsims standen. Mit ihrem nachgedunkelten, fesch auf Kinnlänge geschnittenen Haar und der Zigarette auf den Lippen war sie ohne Zweifel eine Frau, und zwar eine, zu der ihr auf Anhieb Geschichten einfielen.
Wenn das hier eine Geschichte wäre, dachte Nina, dann würde mich heute Abend ein umwerfender Feuerkopf von den Füßen fegen und entführen. Ein Tunichtgut natürlich, einer, dessen Namen die Leute hinter vorgehaltener Hand flüsterten. Bei der Vorstellung musste sie lachen. Dass Tante Künßi einen feurigen Tunichtgut auf ihren gediegenen Adelsball einlud, war alles andere als wahrscheinlich.
Unterdessen griff Cousine Hertha zögerlich nach der angebotenen Zigarette, zog sie halb aus dem Päckchen und schob sie gleich wieder zurück. »Ach, ich würde ja so schrecklich, schrecklich gern«, bekundete sie. »Aber da ist eben meine Frau Mama …«
»Papperlapapp«, beschied Nina sie. »Deine Frau Mama ist kein Hausdrachen, sondern meine liebste Tante Künßi. Außerdem ist sie zurzeit gar nicht hier und kann, soweit ich weiß, nicht durch Wände sehen.«
»Darum geht es nicht«, fiel Amelie ihr ins Wort. »Herthas Mutter ist genau wie die meine der Ansicht, dass sich das Zigarettenrauchen für Damen nicht gehört. Ein junger Mann von Stand wird sich daran stören, wenn eine Dame nach Rauch riecht, und du hast nicht einmal ein zierliches, damenhaftes Etui. Ich denke, du lässt es heute Abend besser bleiben, Nina. Zumindest wenn du dich inzwischen wirklich als heiratswillig betrachtest und die Absicht hegst, jemanden, der infrage käme, kennenzulernen.«
»Jemanden wie den Claus.« Margarete, die jüngste der Cousinen, schlang die Arme um sich selbst und verdrehte schwärmerisch die Augen.
»Was für einen Claus?«, fragte Nina.
Einen Herzschlag lang herrschte ein Schweigen von der Art, in der man sicher war, verstohlenes Kichern und Tuscheln zu vernehmen. Claus, dachte Nina. Immerhin ein erfreulicher Name, aparter als die ewigen Ottos, Fritze und Hänse. So wie Nina. In ihrem gesamten Kreis kannte sie niemanden, der Claus hieß, und die einzige Nina war sie selbst.
»Claus Schenk Graf von Stauffenberg«, beantwortete Hertha, die Expertin, schließlich Ninas Frage. »Einer von den neuen Offizieren im Siebzehnten. Nach allem, was man hört, ein Adonis und Charmeur vor dem Herrn.«
Amelie ließ sie kaum ausreden, sondern kam noch einmal auf ihr Thema zurück. »Als Mädchen aus unseren Kreisen kann man sich einfach keinen Fauxpas erlauben«, erklärte sie. »So gut wie unseren Müttern ergeht es uns schließlich nicht. Die hatten die freie Auswahl unter den Offizieren des kaiserlichen Heers, und mit dem Patent kamen Ansehen und Auskommen. Uns hingegen bleiben nur die kümmerlichen Überbleibsel eines Rumpfheers, das schlecht bezahlt wird und dank Versailles auch bei niemandem mehr Respekt genießt.«
»Aber dem Claus!«, rief Margaretchen dazwischen, obwohl Amelie sichtlich noch nicht fertig war. »Dem Claus muss man doch einfach mit Respekt begegnen, so galant und manierlich und obendrein noch so hübsch, wie er ist. Ich glaube ganz gewiss, alle Welt hat ihn gern.«
»Vom Gernhaben kannst du dir kein Haus kaufen«, schnauzte die Ältere sie an. »Und dein Claus, Drittgeborener aus Dienstadelsfamilie und erst Leutnant, dürfte dir frühestens nach sieben Jahren einen Antrag machen. Bis dahin bist du ein spätes Mädchen, und selbst dann musst du deinen Haushalt von einem Hungerlohn bestreiten.«
»Von einem Hungerlohn wohl kaum«, unterbrach Elsbeth, die sich gern politisch gab und behauptete, Sympathien für die Sozialisten zu hegen. »Die Scharen von Menschen dort draußen, denen die Wirtschaftskrise das Nötigste zum Leben raubt, würden mit einem Claus von Stauffenberg sicher liebend gern tauschen.«
Wenn das hier eine Geschichte wäre, dachte Nina, dann wäre dieser heiß umstrittene Claus, der sich an meinen Zigaretten stört, mir von meinen Eltern zugedacht, und der andere, der feurige Tunichtgut, der mir das Herz gestohlen hat, müsste mich zu meiner Rettung noch heute Nacht entführen. Wieder verspürte sie Lachlust. Das war allzu schmalzig. Außerdem waren ihre Eltern die liebsten und besten und hätten ihrer Tochter nie irgendeinen Claus aufgezwungen, den sie nicht wollte.
»Ich würde auf einen wie den Claus sieben Jahre warten«, schwärmte das tapfere Margaretchen unberührt weiter. »Der hat so etwas – so etwas Ritterliches, wisst ihr, was ich meine? Bei dem wäre man beschützt, was immer in der Welt auch geschieht, da käme es aufs Geld nicht an. Und dann sieht er auch noch so romantisch aus. Und tanzt wie ein Gott.«
Mehrere andere fielen ein und schwatzten durcheinander. Nina stand auf, strich sich das Unterkleid glatt und betrachtete ihre Beine, die in den zarten Strümpfen auf einmal äußerst erwachsen wirkten. »Zankt euch nur weiter, ihr Schnattergänse«, sagte sie. »Ich für meinen Teil werde mich jetzt hinüber in den Festsaal schleichen und all die romantischen Cläuse, oder wie sie heißen, abstauben, denn von euch ist ja keine da.«
Hertha sprang ebenfalls auf und warf ihr Haar in den Nacken. »Im Unterzeug, Ninchen?« Sie lachte.
»Wenn du mir nicht gleich hilfst, mich in Schale zu werfen, sogar das.« Nina drehte sich ein wenig und fühlte sich federleicht.
»Also schön«, sagte Hertha und trottete zum Tagesbett, wo Ninas Kleid bereitlag. »Du hast heute so etwas Strahlendes an dir, da haben wir anderen ohnehin verloren. Fast so, als wärst du schon verliebt.«
Bin ich, dachte Nina und drehte sich in ihrem Unterkleid einmal um die eigene Achse. Verliebt in mich selbst. Und verliebt in mein Leben. Die Zeiten ihrer Mütter mochten besser gewesen sein, aber die jetzigen gehörten niemandem als ihnen. Und wenn das hier eine Geschichte war, dann war es wundervoll, dass sie das Ende noch nicht kannten.
5
Tante Künßis illustrer Festhalle war von ihrer Vergangenheit als Lagergebäude nichts mehr anzumerken. Die Reihen von hohen Fenstern, die Onkel und Tante hatten einziehen lassen, verliehen dem Bauwerk eine klassische, erhabene Fassade, und die Beleuchtung aus unterschiedlich hoch befestigten Kronleuchtern ließ die gesamte Weite des Raumes erstrahlen. Erhalten geblieben waren nur die ungewöhnlich hohe Decke, die für eine phänomenale Akustik sorgte, und eine Besonderheit, die Tante Künßi so gut gefallen hatte, dass sie entschlossen gewesen war, sie sich zunutze zu machen.
An der Längsseite führte eine Treppe hinauf zu einer Tür auf die Galerie. Jene Galerie und ebenso die Treppe hatte Tante Künßi verbreitern lassen und zugleich eine ebensolche Treppe im Innern in Auftrag gegeben, die nun mit weiten Stufen hinunter in den Saal führte.
Der Effekt war atemberaubend: Eintreffende Gäste konnten in großem Stil angekündigt werden, und sämtliche Blicke wandten sich ihnen zu, während sie die Stufen hinunterschritten. Nina liebte es, wie der Rock ihres Kleides sich zu bauschen schien, sobald der Ruf des Zeremonienmeisters ertönte: »Nina, Freiin von Lerchenfeld.« Als hätte das Kleid ein eigenes Leben und sie wäre gewichtslos und würde von dem schwebenden Kleid hinuntergetragen, in eine Welt voller Glanz und Musik.
Alles, worüber sie eben noch geredet hatten, löste sich auf. Rumpfheere, Wirtschaftskrisen, Arbeitslose, Nöte von Menschen, deren Existenzen Nina höchstens aus weiter Ferne erahnte und die es in dieser glitzernden Welt nicht gab. Die Kapelle spielte einen Walzer, der ein wenig angestaubt war, jedoch an diesen Ort passte. Märchen waren schließlich auch angestaubt und machten an manchen Tagen mehr Spaß als die Wirklichkeit.
Die zahlreichen Uniformen, die sich zwischen den schillernden Roben der Damen und ihrem funkelnden Schmuck bewegten, hatten auch etwas Märchenhaftes. In einem Land, in dem es keinen Kaiser und keinen Krieg mehr gab, diente das Heer ja im Grunde nur noch der Dekoration. Das zu Pferd allemal, denn was war dekorativer als ein Reitersmann? Schon als kleines Mädchen hatte Nina die Kavalleristen bestaunt, die in ihren Paradeuniformen vorüberritten und bei denen sie an die Zinnsoldaten denken musste, die seit dem Tod ihres Bruders in seiner Spielzeugkiste schliefen.
Aber an den Tod wollte Nina heute nicht denken, sondern leben, in vollen Zügen leben! Am Fuß der Treppe wartete ihr Cousin Rudolf auf sie, der schon die Arme ausbreitete, um sie in den Tanz zu führen. Ob sie eine gute Tänzerin war, vermochte Nina nicht zu beurteilen, aber eine beliebte Tänzerin war sie, eine, die sich vor Bewerbern nicht retten konnte. Vielleicht weil sie einen solchen Heidenspaß daran hatte und ein paar unbeholfene Püffe oder Tritte nicht krummnahm, sondern darüber lachte. Auf ihren Vetter Rudolf folgte ihr Vetter Max, dann die Freunde der Vettern und Freunde von Freunden, eine vielgliedrige Kette von Tänzern, die nicht abriss. Nina flog von Arm zu Arm, glaubte, den einen kaum noch vom andern unterscheiden zu können.
Es schien die Nacht der Komplimente zu sein.
»Sie sehen bezaubernd aus, verehrte Freiin.«
»Da schau her – ehe man sichs versieht, ist die kleine Nina Lerchenfeld zu einer Schönheit erblüht.«
»Hat Ihnen schon einmal jemand gesagt, dass dieser zarte Elfenbeinton Ihnen die Erscheinung einer Königin verleiht?«
Manche gaben sich Mühe, aber große Wortkünstler waren sie alle nicht, und die meisten sagten immer das Gleiche. Für gewöhnlich machte Nina das Geschwafel nichts aus, sondern amüsierte sie. Heute aber, inmitten der unzähligen Lichter, die sich wie Goldregen um sie versprühten und eigens für sie zu glitzern schienen, spürte sie unvermittelt Leere und Erschöpfung. Das Fest hatte gerade erst begonnen, noch war nicht einmal das Büfett eröffnet, und doch war ihr plötzlich, als wäre schon alles zu Ende, die Tänze ausgetanzt, die Dekoration zu ein paar Fetzen zerfleddert und die Musik verklungen.
»Bitte entschuldigen Sie mich«, bat sie höflich ihren Kavalier, als er sie nach dem Walzer aus seinen Armen entließ. »Ich brauche einen Augenblick oder zwei für mich allein.«
Das klang immerhin besser als die übliche Behauptung, man müsse sich die Nase pudern. Ninas Nase brauchte keinen Puder, aber ihr Kopf, der heute allzu oft verrückt spielte, vielleicht ein Glas Champagner. Im Vorbeigehen nahm sie sich eines von dem Tablett, das ein Kellner umhertrug, blieb dann abrupt stehen und lehnte sich an einen Pfeiler. Sie schenkte ihrem Blick wie einem Vogel die Freiheit, ließ ihn schweifen, hatte jedoch das Gefühl, als bekäme sie gar nichts zu sehen, weil jede scharfe Kontur vor ihren Augen verschwamm.
Wenn dies also wirklich eine Geschichte wäre, dachte sie, dann hätte das alles eine Bedeutung, die wir erst begreifen, wenn die Geschichte fertig erzählt ist. Sie stellte ihr Glas auf einen Beistelltisch, zog eine Zigarette aus der Schachtel, die sie in einer Tasche des Kleides verborgen hielt, und zündete sie an. Falls sie damit tatsächlich heiratsfähige Männer vertrieb, sollte es ihr heute Abend recht sein. Sie hatte für Männer gerade gar keine Kraft, für heiratsfähige schon gar nicht. Mitten im Lichtermeer hatte sie das Dunkel angesprungen, und sie wusste nicht, warum.
Alle vertrieb sie jedoch offenbar nicht. Einer kam auf sie zu, ein Reiteroffizier, den sie noch nicht kannte, groß, glatt rasiert, das Haar recht dunkel, die Schultern breit im Rock der Uniform. Seine Gesichtszüge waren klar, wie in Glas geritzt. Und wer wäre der jetzt in meiner Geschichte?, fragte sich Nina, konnte aber nicht lachen: der feurige Tunichtgut oder der manierliche Claus?
»Sie gestatten?«, fragte der Mann und blieb vor ihr stehen.
»Oh, ich bitte Sie!«, entfuhr es Nina. »Nicht schon wieder tanzen. So leid es mir tut, ich brauche eine Pause.«
»Ich auch«, sagte er. »Um zu tanzen, bin ich nicht gekommen. Sie machten auf mich nur den Eindruck, dass Sie gerade jetzt nicht gern alleine wären.«
»Tatsächlich?«
»Tatsächlich. Wir brauchen auch nicht zu reden. Ich würde, wenn es recht ist, nur gern derjenige sein, der ein wenig hier mit Ihnen steht.«
Seine Stimme war schön. Kraft lag darin, obwohl sie nicht laut war, Kraft, die ausgereicht hätte, um quer über das Brachland, über das Nina mit ihrem Vater geritten war, ein durchgehendes Pferd zurückzurufen.
»Und warum?«, fragte sie und sah ihn sich an. Er war kein Junge mehr, sondern ein richtiger Mann, sicher fünf oder sechs Jahre älter als sie. Und er roch gut. Sehr sauber, sehr gepflegt und trotzdem nach Pferd.
»Weil es Ihnen nicht gut geht«, sagte er.
»Woher wollen Sie das wissen?«
»Ich habe es Ihnen angesehen, weil es mir manchmal genauso geht.«
Nina zog an ihrer heruntergebrannten Zigarette. In seiner Stimme hörte sie, dass es zutraf, dass das, was ihm manchmal geschah, das Gleiche war wie bei ihr. Und wenn sie sich noch so sehr beschwor, sich keinen Unsinn einzureden, sondern auf dem Teppich zu bleiben.
»Aber warum um alles in der Welt wollen Sie hier bei mir stehen, statt zu tanzen?«, fragte sie. »Und das, wo Sie noch nicht einmal etwas zu trinken haben?«
Jetzt wird er mir eine dieser Banalitäten zur Antwort geben, die ich schon den ganzen Abend höre, dachte sie. Er wird mir erklären, dass er von meiner Schönheit geblendet oder der Ansicht ist, ich würde mit den Lichtern im Saal um die Wette strahlen. So etwas zu hören, hat ja auch seinen Reiz. Aber wenn in mir diese Dunkelheit ist, erreicht es mich nicht, und ich fühle mich inmitten von hundert Menschen allein.
Der Mann sah sie an. Eine Sekunde lang kamen seine Augen ihr blau vor, dann entdeckte sie, dass sie grau waren. Regengrau. Schillernd. Ein Teil von ihr verlor sich in ihnen, als werfe sie etwas, das ihr lieb war, in die Tiefe eines Brunnens. Als Kind hatte sie das getan. Es war ein Anhänger an ihrem Armband gewesen, ein goldenes Herz, das ihr die Großmutter geschenkt hatte, und auf einmal hatte sie diesen Zwang verspürt, es von sich zu werfen, obwohl es ihr liebster Schmuck gewesen war.
Die Brauen des Mannes waren schwarz und dicht wie Balken. Nina zog an ihrer Zigarette, wusste nicht, wohin sie den Rauch blasen sollte.
»Sie wollen wissen, warum ich derjenige sein will, der hier mit Ihnen steht?«, fragte er.
»Allerdings.«
»Weil ich Sie vorhin gesehen habe, als Sie die Stufen heruntergekommen sind«, sagte er. »Und weil ich mir dabei gedacht habe: Ich möchte, dass diese Frau die Mutter meiner Kinder wird.«