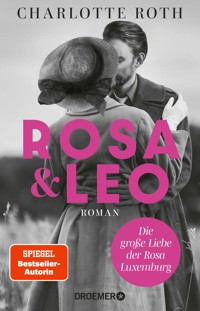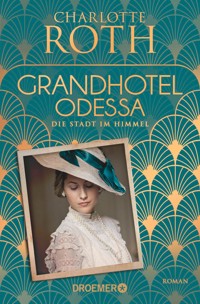
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Grandhotel-Odessa-Reihe
- Sprache: Deutsch
Die glanzvolle Saga über ein Grandhotel am Schwarzen Meer und eine groß angelegte Familiengeschichte von der Bestsellerautorin Charlotte Roth. Eine Liebesgeschichte aus einer Welt, die für immer verschwunden ist. Odessa im Jahre 1910. Mit einem großen Ball soll im Grandhotel der 21.Geburtstag von Oda, der Tochter des Hotelgründers, gefeiert werden. Es soll ein Fest werden, von dem man in der Stadt, nein, im ganzen Land, noch lange sprechen wird. Oda aber erwartet voll Ungeduld vor allem zwei Gäste: Belle, die Berliner Patentochter ihres Vaters, und Karel Albus, gefeierter Ballett-Tänzer an Odessas neuem, prunkvollem Opernhaus. Schon immer war Oda eifersüchtig auf Belle, da sie befürchtete, ihr Vater könne diese mehr lieben als die eigene Tochter. Trotzdem vertraut sie ihr auf dem Ball ihr großes Geheimnis an: Sie ist bis über beide Ohren in Karel verliebt und hat vor, mit ihm, den ihr Vater als nicht standesgemäß für sie erachtet, noch am selben Abend durchzubrennen. Doch Karel taucht nicht am verabredeten Treffpunkt auf, und Odas Leben nimmt eine unerwartete Wendung … Dramatische Liebesgeschichte und glanzvolle Familien- und Hotelgeschichte – in ihrem neuen Roman verwebt Charlotte Roth beides auf unnachahmliche Weise miteinander und beschwört Glanz und Elend einer versunkenen Welt und den Glamour eines Grandhotels.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 737
Veröffentlichungsjahr: 2020
Sammlungen
Ähnliche
Charlotte Roth
Grandhotel OdessaDie Stadt im Himmel
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Odessa im Jahre 1910. Mit einem großen Ball soll im Grandhotel der 20. Geburtstag von Oda, der Tochter des Hotelgründers, gefeiert werden. Es soll ein Fest werden, von dem man in der vor Leben brodelnden Metropole noch lange sprechen wird. Oda aber erwartet voll Ungeduld vor allem zwei Gäste: Belle, die Berliner Patentochter ihres Vaters, und Karol Albus, den gefeierten Balletttänzer an Odessas neuem, prunkvollem Opernhaus. Schon immer war Oda eifersüchtig auf Belle, da sie befürchtet, ihr Vater könne diese mehr lieben als die eigene Tochter. Trotzdem vertraut sie ihr auf dem Ball ihr großes Geheimnis an: Sie ist bis über beide Ohren in Karol verliebt und hat vor, mit ihm, den ihr Vater als nicht standesgemäß für sie erachtet, noch am selben Abend durchzubrennen.
Inhaltsübersicht
Widmung
Ein paar Wegweiser, um sich in der schönen, fernen Stadt nicht zu verlaufen
Odessa
Das Kind wusste [...]
Odessa
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Odessa
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
Odessa und Berlin
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
Odessa
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
Odessa und Berlin
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
Odessa
37. Kapitel
38. Kapitel
Odessa im Weltensturm
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
Glossar
Für Maren,
immer vermisst.
Und für Taika Waititi.
Tausend Dank für all die Geschichten.
Ein paar Wegweiser, um sich in der schönen, fernen Stadt nicht zu verlaufen
Die in meinem Roman erwähnte Konditorei und Confiserie Seibman hat, wie zahlreiche andere erwähnte Lokale, Hotels, Vergnügungsstätten und Geschäfte in Odessa, tatsächlich existiert. Sie wurde von einer deutschen Familie geführt, bot deutsche Gebäckspezialitäten und Süßigkeiten an und erfreute sich großer Beliebtheit. Zu trauriger Berühmtheit brachte es Seibman, als im Jahr 1905 ein anarchistischer Bombenanschlag auf das Kaffeehaus verübt wurde.
Seibman erholte sich jedoch und verkaufte bald wieder Süßes auf Odessas Flaniermeile. Das Gebäude, in dem die Familie ihr Geschäft betrieb, steht noch heute.
Nur hießen Geschäft und Familie nicht Seibman, sondern Libman.
Den Namen habe ich geändert, um allzu große Ähnlichkeit mit dem Familiennamen meiner Hauptdarsteller zu vermeiden, und bitte dafür um Verständnis.
Nach längerer Überlegung habe ich mich entschieden, auf den bis zur Russischen Revolution noch bestehenden Unterschied zwischen dem julianischen und dem gregorianischen Kalender in meinem Roman nicht einzugehen. Die kalendarische Frage hat auf meine Geschichte keinen Einfluss, also erzähle ich sie, als würde es diesen Unterschied nicht geben, um Leser nicht unnötig zu verwirren. Dabei fand ich als Kind diesen Unterschied ziemlich schick … Mein Großvater, der mit dem julianischen Kalender aufgewachsen war, hatte beim Umzug nach Deutschland sein Geburtsdatum angleichen lassen, seine Zwillingsschwester hingegen nicht. Und ich erzählte jahrelang stolz unter meinen Freunden herum, dass es auch Zwillinge gibt, bei denen einer im Mai geboren ist und einer im Juni …
Das weltberühmte Zitat des britischen Außenministers Edward Grey am Vorabend des Ersten Weltkriegs ist erst im Nachhinein – in den 1950er-Jahren durch die Publikation seiner Memoiren – der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Ich habe mir dennoch erlaubt, es zu verwenden, weil es mir als Prophezeiung dessen, was geschehen sollte, ohne Vergleich scheint.
Teilen meines Romans habe ich Zitate von Vladimir Jabotinsky vorangestellt, weil beide in Odessa geboren sind und getan haben, was ich – auf meine bescheidene Weise – auch gern tun wollte: eine Welt besingen, die es nicht mehr gibt.
»Ich bin ein Sohn der Zeit, in der wir alles hatten.
Elend und Glanz, ich kenne Schmutz und Licht.
Ihr Sohn bin ich und lieb auch ihre Schatten.
Ihr ganzes Gift lieb ich.«
Vladimir Jabotinsky: Die Fünf
»Damals war Odessa noch eine Königin. Dann wurde der Wald lichter und lichter, aber ich möchte, dass es so ist wie in meiner Kindheit. Ein Wald, und von allen Seiten die Rufe von Matrosen, Bootsführern, Schauerleuten, und wenn ich näher dran wäre, würde ich das schönste Lied der Menschheit hören: hundert Sprachen.«
Vladimir Jabotinsky: Die Fünf
1893
Odessa
Rezeption
Das Kind wusste, dass hinter ihm das Meer lag und dass das Meer kein Ende hatte. Der Himmel hatte auch kein Ende und erhob sich über ihm. Beides verband die Treppe, an deren Fuß sie standen und die der Vater Himmelsleiter nannte. Vor den Augen des Kindes aber hatte die Treppe so wenig ein Ende wie der Himmel und das Meer.
Das Kind hieß Oda. Seit das andere Kind zu Besuch war, nannten es alle Oda Odessa, lachten darüberund klatschten dabei in die Hände. Oda Odessa trug einen himmelblauen Mantel, fand aber, dass Himmelblau eine scheußliche Farbe war. Als die Mutter ihr an diesem Morgen den neuen Mantel hatte anziehen wollen, hatte sie sich losgerissen, war zu Katjuša in die Küche geflüchtet und hatte sich an deren weichen Leib mit der Schürze, die nach Pyroschky-Teig duftete, festgehalten.
»Ich kann dir doch nicht helfen, Zainka, mein armes schwarzes Häschen.« Katjuša hatte sich auch an Oda festgehalten und war mit ihr von einem Bein aufs andere geschaukelt wie eins der bauchigen, großen Schiffe, die in der Bucht vor der Stadt lagen. »Wenn deine Mutter kommt, dann wird sie schimpfen.«
Die Mutter kam nicht, aber der Vater. Er hatte Oda gefunden und von Katjuša losgerissen. »Du hast deine Arbeit zu tun«, hatte er Katjuša angewiesen, »Fräulein Oda muss gehorchen lernen, es tut ihr nicht gut, wenn du sie verziehst.«
Zu Oda hatte er gesagt: »Zieh den Mantel an, benimm dich nicht albern. Warum freust du dich denn nicht, dass du einen neuen Mantel bekommst, so wie Belle?«
Belle hieß das andere Kind. Seit sie da war, nannten alle sie Belle Berlin, lachten darüber, klatschten dabei in die Hände und küssten sie auf den blonden Schopf. Jetzt standen beide Kinder nebeneinander am Fuß der endlosen Treppe zwischen Meer und Himmel, wie der Vater sie hingestellt hatte. »Belle Berlin und Oda Odessa.« Er lachte, ohne zu klatschen. Oda hasste das Kind, das Belle hieß und in seinem himmelblauen Mantel allerliebst aussah.
»Nehmt euch an den Händen«, sagte der Vater.
Belle streckte schüchtern, vielleicht sogar ängstlich ihre Hand nach Oda aus.
Oda behielt ihre Hand bei sich und verschränkte die Arme, sodass Belle nicht drankam. Sie erwartete, einen Klaps zu bekommen und am Arm gezerrt zu werden, bis Belle ihre Hand doch noch fassen konnte, aber nichts dergleichen geschah.
Stattdessen wies der Vater nach oben, dorthin, wo sich die endlose Treppe im Blau des Himmels verlor. »Ihr zwei steigt jetzt zusammen die Treppe hinauf«, sagte er. »Ihr seid Wahlschwestern. Wenn ihr euch fest an den Händen haltet, schafft ihr es bis ganz nach oben in den Himmel, oder wohin auch immer ihr sonst wollt.«
Die anderen, die darum herumstanden, lachten. Odas Mutter, die sonst nie lachte, Belles Mutter, die mit ihrer bleichen Haut und den blassblonden Haaren wie eine Porzellanpuppe aussah, Belles Bruder, der einen Kopf größer und ein lästiger Flegel war, die schöne Tante Tessa und ein Kreis von erlesenen Gästen aus dem Hotel.
Das war das Schlimmste. Was der Flegel und die Puppe dachten, war Oda egal, Tante Tessa verachtete sie ohnehin, und ihre Mutter zählte nicht, doch vor den Gästen wollte sie sich nicht blamieren. Vor dem Vater auch nicht. Entschlossen trat sie vor und setzte an, die erste Stufe zu erklimmen. Ihr Herz hämmerte wie eine Faust an eine verschlossene Tür. Die Stufe war viel zu hoch für ihre kurzen Beine. Zu ihrem Entsetzen wäre sie um ein Haar hintenübergekippt, bis sie den Fuß doch noch aufsetzte und ihr Gewicht hinterherschwang.
Sie blickte nicht auf. Starrte stur auf den Sandstein zu ihren Füßen. Die Treppe kannte jeder in Odessa. Von oben sah sie aus, als hätte sie gar keine Stufen und als könne man einfach hinuntergleiten wie im Winter auf der Rodelbahn. Von unten aber reihte sich Stufe an Stufe, ohne Ende. Es konnte unmöglich dieselbe Treppe sein. Odas Vater hatte sie getäuscht. Er hatte sie eine Treppe hinaufgeschickt, die ins Nirgendwo führte, um sie loszuwerden, weil sie ein struppiges, störrisches Kind war, das niemand mochte.
»Weiter, weiter«, hallte die Stimme des Vaters in ihrem Rücken. »Das wird euch beide verbinden. Fürs ganze Leben.«
Schweiß troff ihr in die Augenbrauen, die wie zwei schwarze Balken auf ihrer Stirn saßen. Für einen Kosaken angemessen, doch bei einem Mädchen unfein, hatte Belles blassblonde Mutter gesagt. Als nutzlos erwiesen sie sich obendrein: Die brennenden Tropfen rannen Oda in die Augen, und wer ihr Gesicht sah, musste glauben, dass sie weinte.
Aber es sah sie ja niemand. Sie war allein. Sie setzte den Fuß auf die nächste Stufe und spürte einen ziehenden Schmerz in den Waden. Ihre Beine waren zu kurz, aber Oda zwang sich einfach weiter.
Noch eine Stufe und noch eine. Keuchend stieg sie hinauf, bis ihre Brust so schmerzte wie die Waden und sie innehalten musste, um nach Luft zu ringen. Mit dem Atem kehrte die Hoffnung zurück: Ihr Vater konnte schließlich nicht wollen, dass sie im Nirgendwo verschwand. Er würde stolz auf sie sein, wenn sie es geschafft und den Himmel erreicht hatte. Oda, nicht Belle. Lang konnte die Treppe nicht mehr sein, sie war schließlich schon so weit gekommen. Zögernd riskierte sie einen Blick und erschrak wie niemals zuvor.
Die Treppe war überhaupt nicht kürzer geworden. Der Platz mit dem Denkmal, an dessen rechter Seite das Hotel stand, war nicht zu entdecken, und die endlosen Stufen führten wahrhaftig ins Nirgendwo. Flüssigkeit strömte ihr aus den Augen, und sie fürchtete, gleich hier auf den Steinen umzufallen und sich nicht mehr aufrappeln zu können. Um keinen Preis hätte sie gewagt, sich umzudrehen und einen Blick in die Tiefe zu werfen.
Vielleicht war nicht nur der Platz mit dem Hotel verschwunden, sondern ebenso die Hafenstraße, die die Treppe vom Meer getrennt hatte. Vielleicht gab es zwischen Himmel und Meer gar keine Welt mehr, nur noch Endlosigkeit.
Etwas berührte ihre Hand, stupste sie an wie eine Hundeschnauze. Belles Hand war so nass geschwitzt wie die ihre. Ohne es zu wollen, schlossen Odas Finger sich um Belles. Sie hielten sich fest. Begannen langsam, mühsam, Stufe für Stufe ihren weiteren Aufstieg. Von weit her drangen ihnen Stimmen und Gelächter entgegen. Oda und Belle sahen sich nicht an und sprachen auch nicht miteinander. Sie konzentrierten all ihre Kräfte aufs Atmen und aufs Gehen.
Dass die anderen – der Vater, die Puppe, der Flegel und der Rest – an ihnen vorbei hinaufgelaufen waren, hatten sie nicht bemerkt. Vielleicht war der ganze Haufen auch mit der Droschke durch den botanischen Garten kutschiert, denselben Weg, den sie vorhin gemeinsam hinuntergefahren waren. So oder so – sie standen lachend und mit ausgestreckten Armen am Absatz, als Oda und Belle das Ende der Treppe erreichten. Vor Erschöpfung zitternd und die verschwitzte Hand der anderen umklammernd, erklommen die Kinder die letzte Stufe und brachen zweistimmig in Geheul aus. Hinter den lachenden Gestalten der Erwachsenen erstreckte sich der Platz mit dem Denkmal, und zur Rechten erhob sich das Hotel.
»Ach Gott, mein süßes Mädchen mit den Zauberaugen!«, rief Odas Vater und hob Belle hoch über seinen Kopf. »War es wirklich so schlimm? Aber dafür seid ihr jetzt echte Wahlschwestern, für immer verbunden, und du kommst jeden Sommer zu uns.«
Oda war im Grunde zu klein gewesen, um sich an all das zu erinnern, vielleicht drei oder vier Jahre alt, doch sie hatte nichts davon vergessen. Schon gar nicht, dass sie an jenem Tag beschlossen hatte, nie wieder Himmelblau zu tragen, dass sie danach nie mehr heulte und dass Belle Berlin fortan in jedem Sommer auf Besuch zu Oda Odessa kam.
1910
Odessa
Rezeption
1
Wonach wir uns sehnen, ist immer Zeit.
»Wenn du einen Menschen vermisst«, sagte Lidija Petrowna Bezborodko zu Oda, »vermisst du in Wahrheit nicht den hochnäsigen Rotzlöffel, der dir längst nicht mehr ins Ohr flüstert, dass du seine liebste und süßeste Maminka bist, und erst recht nicht die Handvoll vermoderter Knochen, die etliche Werschock tief unter der Erde liegen. Du vermisst die Seligkeit, die du mit einem Menschen, den es nicht mehr gibt, erlebt hast, und das schlanke Zauberwesen im Spiegel, das du selbst einmal gewesen bist.«
Sie seufzte kehlig, lehnte sich in ihrem Sessel zurück und zog an der dünnen, schwarzen Zigarette. Der Sessel stammte aus Paris, war mit rot gemustertem Atlasbrokat bezogen und ein Einzelstück. Die meisten Einrichtungsgegenstände im Raum waren Einzelstücke. Odas Vater hatte sich bei der Ausstattung der Royal Suite nicht lumpen lassen, und Lidija Petrowna hatte sich mit erlesenstem Geschmack noch dieses und jenes dazu auserbeten, ohne das eine Frau ihres Standes keinesfalls ihr Leben fristen konnte. Ihre Zigaretten hingegen ließ sie sich von einem der Liftboys in Odessas Unterleib, der Moldawanka, besorgen und stopfte das Kraut zu zwanzig Kopeken, das Gauner, Gaukler, Krämer und Langfinger rauchten, in ihre Zigarettenspitze aus Elfenbein. Andere schmeckten ihr nicht. Sie wolle rauchen, keine Veilchendrops lutschen, hatte sie erklärt, als Oda sie danach fragte.
Ihrer Stimme war die Tabakleidenschaft bereits anzuhören. Sie klang wie ein düsteres Echo, das durch Odessas Katakomben hallte.
Frauen, die rauchten, waren Oda natürlich schon früher begegnet. In einem Hotel mit Gästen aus aller Welt sah man manches, das anderswo als Kuriosität galt. Nur waren die Frauen für gewöhnlich keine russischen Fürstinnen, und sie rauchten auch keinen Tabak, der wie ein Fabrikschornstein qualmte.
»Mais ma belle demoiselle, um so etwas zu begreifen, sind Sie ja noch viel zu jung«, wechselte die Fürstin aus dem Russischen ins Französische und vom Du zum Sie. »In Ihrem zarten Alter …«
»In meinem zarten Alter sehnt man sich durchaus auch!«, fuhr Oda ihr beherzt in die Rede. Dass sie sich so etwas bei den Gästen herausnahm, hätte ihr Vater nicht gutgeheißen. Andererseits war jedoch auch ihrem Vater klar, dass Oda sich bei den Gästen würde durchsetzen müssen und dass sie das nicht auf seine, sondern nur auf ihre eigene Weise tun konnte. Oda liebte das Hotel, sie liebte es gewiss nicht weniger als er selbst, aber die Gäste waren für sie nichts als Mittel zum Zweck. Auch ein Zuckerfabrikant konnte schließlich seine Raffinerie lieben, ohne sich daheim, am privaten Teetisch, viel aus Zucker zu machen.
Mit Lidija Petrowna verhielt es sich allerdings anders. Zum Ersten war die Fürstin kein gewöhnlicher Gast, der bestenfalls einen Monat lang blieb, sondern gehörte sozusagen zum Image des Hotels. Zum Zweiten bekam wenig dem Ruf eines Hotels so gut wie eine Fürstin, die darin logierte, und zum Dritten fühlte sich Oda in Lidija Petrownas Gesellschaft merkwürdig wohl. Vertraut fühlte sie sich, nicht aus der Art geschlagen, nicht so, als müsse sie die meisten ihrer Gedanken für sich behalten, damit ihr Gegenüber nicht vor Entsetzen aufkreischte. Die Gedanken der Fürstin, die vor revolutionären Unruhen von ihrem Gut bei Sankt Petersburg geflohen war, um in Odessa Erholung zu finden, schienen mitunter nicht weniger skandalös als ihre eigenen.
Oda konnte natürlich nicht wissen, ob die Fürstin ihr gegenüber genauso empfand. Sie war ja keine Adlige, wie Belle ihr nicht oft genug ins Gedächtnis rufen konnte, sondern lediglich eine Hotelerbin, wenngleich Oda das eine nicht gegen das andere hätte tauschen wollen. Sie war außerdem erst zwanzig – genau seit heute war sie zwanzig –, während die verschrobenen Weisheiten, die die Fürstin von sich gab, zweifellos einem weit höheren Lebensalter entstammten.
Wie alt Lidija Petrowna tatsächlich war, ließ sich unmöglich schätzen. Sie trug ihr Haar, das Ähnlichkeit mit einem Mopp in undefinierbarer Farbe hatte, mit einem um die Stirn geschlungenen Seidentuch in die Höhe gebunden, schminkte ihr Gesicht, als wollte sie im Stadttheater als Bajazzo auftreten, und bewegte ihre Leibesfülle langsam und selten. Letzteres war allerdings nicht ihrem Alter, sondern ihrem Stand geschuldet. »Wenn du einem Haushalt wie dem meinen auf Gut Flenowo in Pargolovo vorgestanden hast, vermeidest du Bewegung, wo du nur kannst«, hatte sie Oda erklärt. »Die Dienstboten könnten andernfalls auf den Gedanken kommen, man dürfe dir zumuten, etwas selbst zu tun.«
Oda betrachtete sie. Älter als ihr Vater, der noch immer zu den schönsten Männern von Odessa zählte, erschien sie mit ihrem zerknitterten Gesicht und den dick ummalten Augen auf jeden Fall. Andererseits wirkte sie deutlich jünger und vitaler als Odas zimperliche, krumm dahinschleichende Mutter, die dabei nur ein Jahr älter als der Vater war.
Mit dem Alter also war das so eine Sache. Wer wie aussah, wie dachte und fühlte, ließ sich so einfach nicht daran festmachen. Ihr Protest war berechtigt, fand Oda. Lidija Petrowna mochte im Vergleich mit ihr selbst steinalt sein, doch das bedeutete nicht, dass die Fürstin von Sehnsucht mehr verstand als sie.
Niemand verstand von Sehnsucht mehr als Oda Liebenthal.
Ich bin die Sehnsucht auf zwei Beinen, dachte sie. Auch wenn das niemand vermutet und Cesar Seibman behauptet, ich wäre kalt wie eine Hundeschnauze. Es weiß ja keiner, wie es hinter der kalten Schnauze im Hund vielleicht brodelt, und ich habe mich schon gesehnt, solange ich denken kann.
Nach Belle, von der ich schon glaubte, sie wäre ein Geschöpf ohne Makel, als ich sie nur aus Schwärmereien kannte.
Nach meinem Vater, der mir unerreichbar schien, selbst wenn er keinen Schritt weit von mir entfernt stand.
Zuletzt nach Karol und nach ihm so heftig wie nach niemandem und nichts zuvor.
Heute Nacht würde die Sehnsucht nach Karol sich erfüllen, und sobald Oda diesen Gedanken nur streifte, musste sie sich die Hand aufs Herz legen. Heute Nacht würde sie Karol so nahekommen, dass sie sich nicht mehr nach ihm zu sehnen brauchte. Und sie würde ihn bei sich behalten. Für immer. Er und sie würden eine Einheit sein, wie zusammengeschmiedet, so eng, dass keine Sehnsucht zwischen sie passte.
Gewiss aber würde sie nie vergessen, wie die Sehnsucht in ihr gewütet hatte, einerlei, wie viele Lebensjahre ihnen beiden miteinander geschenkt würden.
»In meinem Alter sehnt man sich durchaus auch«, wiederholte sie also, um ihrem Standpunkt Gewicht zu geben.
Die Fürstin legte die Zigarette samt Spitze auf dem Aschenbecher ab und griff nach einem Würfel grünlichen türkischen Honigs. Den ließ sie sich auch von den Liftboys mitbringen, denn der aus Seibmans Konditorei, der im Hotel serviert wurde, schmeckte ihrem Urteil zufolge nach Seife. »Das habe ich ja nicht bestritten«, sagte sie, ehe sie sich das klebrige Konfekt in den Mund schob. »Wir Alten sehnen uns nach einer Zeit, die es nicht mehr gibt, und ihr Jungen nach einer, die es niemals geben wird. Mais ma belle demoiselle, das wollten Sie ja nun so gar nicht von mir hören, habe ich recht?«
Warum Lidija Petrowna sie auf Russisch duzte, im Französischen aber zum förmlichen Sie wechselte, wusste Oda nicht, und sie hütete sich, zu fragen. Am Ende hatte es mit irgendeiner Eigenheit des Französischen zu tun, die ihr, die sich mit der Sprache der eleganten Welt schwertat, entgangen war, und sie stand als törichte Trine da. Für kalt und hundeschnäuzig mochte sie halten, wer wollte, doch sie hatte schier panische Angst davor, als ungebildet, dumm oder gar provinziell zu gelten.
»Nein, das wollte ich nicht von Ihnen hören«, bekannte sie grammatikalisch korrekt und wusste schon kaum noch, worum es eigentlich ging. Offiziell war sie in die Royal Suite hinaufgefahren, um fürsorglich nachzufragen, ob es dem vornehmsten Gast des Hotels für den bevorstehenden Ball an nichts fehle, ob eins der Zimmermädchen als Zofe geschickt werden solle oder etwas aufgebügelt werden müsse. Inoffiziell war sie hier, um Lidija Petrowna um einen Gefallen zu bitten, den außer ihr niemand für sie erledigen konnte.
Sie hatte Belle darum gebeten, hatte fest damit gerechnet, dass diese ihr eine so dringende Bitte nicht abschlagen würde. Das Gefühl, auf viel zu schwachen Beinen in den Himmel steigen zu müssen, vergaß man nicht, und die Verbindung, die aus den verschlungenen, schwitzigen Kinderhänden erwachsen war, hatte etwas ebenso Unzerstörbares wie Odas Entschluss, nie wieder Himmelblau zu tragen.
Natürlich hatte ihr Vater dieselbe Idee ein zweites Mal gehabt, hatte geplant, seine unansehnliche Tochter noch einmal in diese Farbe zu hüllen wie seinen zauberäugigen Liebling, aber diesmal hatte er die Rechnung ohne Oda gemacht. Nicht einmal für ihn, den sie vor Karols Ankunft in ihrem Leben am meisten geliebt hatte, würde sie sich einer solchen Blamage ein zweites Mal aussetzen. Schon gar nicht vor Karols Augen. Sobald die zwei haargenau gleichen Ballkleider aus himmelblauer Duchesse, die ihr Vater bestellt hatte, eingetroffen waren, hatte Oda sich ihres geschnappt und stillschweigend für Abhilfe gesorgt. Es reichte schon aus, dass sie den Ball zu ihrem Geburtstag teilen musste, weil die Eltern der armen Belle sich doch einen eigenen nicht leisten konnten und die arme Belle doch ohnehin auf so vieles zu verzichten hatte. Die arme Belle würde sich damit abfinden müssen, dass Oda an diesem Abend nicht in ihrem Schatten stand.
»Was ist das eigentlich mit dir und Belle?«, hatte Bodo, Belles Bruder, sie einmal gefragt. »Manchmal kommt es mir vor, als ob ihr aneinander hängt wie zwei Kletten, und dann wieder, als ob ihr euch am liebsten die Augen auskratzen würdet wie zwei Katzen.«
»Wir sind Wahlschwestern«, hatte Oda nur erwidert. Das sagte alles, auch wenn Blödsinn-Bodo, der als Halbwüchsiger noch mit seiner Modelleisenbahn spielte und den ohnehin niemand ernst nahm, sich verständnislos am Kopf kratzte. Man ließ keine Hand los, die einmal auf dem Weg in den Himmel oder ins Nirgendwo der einzige Halt gewesen war. Eben deshalb war Oda überzeugt gewesen, dass Belle sich ohne Wenn und Aber bereitfinden würde, ihr den winzigen Gefallen zu tun, an dem ihr Lebensglück hing.
Sie selbst hatte schon unzählige abstruse und nicht selten peinliche Dinge getan, weil Belle sie mit flehendem Augenaufschlag darum gebeten hatte. Sie hatte unzählige öde Gesellschaften besucht, weil sich dort irgendein rachitisch wirkender Jüngling herumtrieb, den sich Belle vorübergehend zum Helden ihrer Träume auserkoren hatte. Sie war an einem Regentag in offener Droschke von Pontius nach Pilatus gezockelt, um Belles Flirt mit einem pockennarbigen Polen als Alibi zu dienen, und hatte einmal einem eher windigen georgischen Journalisten Belles Abschiedsbrief auf den Bahnhof nachgetragen, weil diese ihr versicherte, der um gut zwanzig Jahre Ältere sei der Mann ihres Lebens.
Kaum hatte der Mann ihres Lebens die Stadt jedoch verlassen, tröstete Belle sich mit einem Offizierskameraden ihres Bruders, der in Odessa Verwandte besuchte und tanzte wie ein zumindest mittelprächtiger Gott. Oda hatte auch diesem wieder Nachrichten übermittelt, ihn durch Hintertüren eingeschleust und ihn am Ende, während Belle mit seinem Nachfolger im Café Fanconi Tee trank, mit Ausreden getröstet. Somit hatte sie allen Grund gehabt, sicher zu sein: Nachdem sie für die Wahlschwester bei allen erdenklichen Amouren in die Bresche gesprungen war, würde diese ja wohl das eine Mal springen, wo es für Oda um den einen und Einzigen ging.
Sie hatte sich getäuscht.
Statt mit fliegenden Fahnen zuzustimmen, hatte Belle ihre Händchen, die seit jener Besteigung der Treppe kaum gewachsen zu sein schienen, über dem blond gelockten Köpfchen zusammengeschlagen und ausgerufen: »Um Gottes willen, Oda! So lieb ich dich habe, aber das geht auf gar keinen Fall!«
»Was soll das heißen, es geht auf gar keinen Fall?«
»Ich bringe es nicht fertig, Liebes. Ich kann nicht Onkel Philipp und Tante Lene belügen, die immer so nett zu mir gewesen sind.«
»Und was ist mit mir?«, hatte Oda sie angefaucht. »Bin ich vielleicht nicht nett zu dir?«
»Doch, natürlich«, hatte Belle rasch beteuert, obwohl Nettigkeit nicht gerade zu Odas herausragendsten Tugenden zählte, wie sie selbst wusste. »Aber auch um deinetwillen bringe ich es nicht fertig. Es wird einen Skandal geben, Liebes, wer weiß, ob Onkel Philipp dir jemals verzeiht, vor allem nach dem, was mit deiner Tante Tessa passiert ist.«
»Ich habe keine Tante Tessa«, sagte Oda, denn die entlaufene Schwester ihres Vaters wurde grundsätzlich nicht erwähnt. »Und du nenn mich nicht Liebes. Das ist affig. Erst recht, wenn du mich verrätst.«
»Ich verrate dich doch nicht!«, hatte Belle mit spitzem Stimmchen ausgerufen, aber Oda war schon aufgestanden und hatte es dabei belassen. Mit Belle konnte man einfach nicht reden. Höchstens Händchen halten. Sie würde einen anderen Weg finden müssen, denn was sie sich in dieser Nacht zu eigen machen wollte, würde sie sich von niemandem nehmen lassen.
»Na, nun mal raus mit die Sprache, Kindchen«, sagte Lidija Petrowna plötzlich auf Deutsch, wobei das R brausend rollte und die Grammatik ein wenig holperte wie eine antiquierte Stadtbahn. Sie hatte deutsches Blut. Odas Vater behauptete, unter dem russischen Adel gebe es niemanden, der kein deutsches Blut hatte. »Erzähl mir von die Sehnsucht, du willst es doch so gerne, das sehe ich dir an. Eine junge Mann, ja? Eine schöne Herrchen, dem diese Sehnsucht gilt?«
Oda nickte. Herumreden würde nicht zum Ziel führen. Wenn sie die Fürstin für ihre Pläne einspannen wollte, musste sie ihr vertrauen. Sie schluckte trocken. »Karol Albus«, sagte sie.
Durch die Spirale beißenden Qualms, die sich von der Zigarette in die Höhe ringelte, blitzten Lidija Petrownas blutrot geschminkte Lippen. »Oh, là, là! Ich wusste es ja immer: Ma belle demoiselle hat einen exquisiten Geschmack.«
Vielleicht mochte Oda die Fürstin ja deshalb: Weil die ihr etwas zutraute und sie mein schönes Fräulein nannte. Kein anderer nannte sie schön. Nicht einmal Blödsinn-Bodo, der ihr einmal so gut wie einen Antrag gemacht hatte, oder Cesar Seibman, der verrückt nach ihr war.
»Genau wie ich, mein Täubchen. Genau wie ich.« Die Fürstin fuchtelte mit den Händen. »Und sage bloß, er wird kommen heute Abend?«
Oda nickte noch einmal. Karol war primo ballerino an Odessas prachtvollem, von Wiener Stararchitekten entworfenem Stadttheater und der Gott, dem die Stadt zu Füßen lag.
Ihn zu Odas Ball einzuladen, erhöhte Reiz und Wert der Veranstaltung – wie der eigens aus Frankreich importierte Jahrgangschampagner und der Beluga-Kaviar für die Mlynzi und Kanapees des Büfetts. Odas Vater scheute weder Kosten noch Mühen. Das bedeutete allerdings noch lange nicht, dass ein Balletttänzer ihm als Bewerber um die Hand seiner einzigen Tochter recht gewesen wäre. Philipp Liebenthal war ein Snob, was Oda nicht störte. Es galt lediglich, ihn davon zu überzeugen, dass Karol Albus sogar dem snobistischsten Anspruch gerecht wurde. Er war kein Schandfleck, den der Inhaber von Odessas Grandhotel hätte vertuschen müssen, sondern eine Medaille, die er sich an die Brust heften konnte.
Es gab etwas, das ihr Vater bis heute nicht begriffen hatte: Wenn jemand das Hotel, das er gegründet hatte, so sehr liebte wie er selbst, dann war es die Tochter, von der er so wenig hielt. Oda hätte vieles getan, um das Leben mit Karol zu führen, nach dem sie sich mit solcher Kraft sehnte. Aber sie hätte keinesfalls etwas getan, das die Zukunft des Hotels gefährdete. Ihr Plan bezog das Hotel mit ein, und so hatte sie es Karol auch erklärt: »Wenn ich das Hotel verliere, verliere ich mich selbst. Der Mann, der mich heiratet, muss wissen, dass er mich mit dem Grandhotel Odessa teilt.«
Karol hatte gelacht. »Die Frau, die mich heiratet, muss wissen, dass sie mich mit der Bühne teilt.«
Sein Lachen war so schön, dass es etwas in ihr zum Schwingen brachte. Ein kleines Pendel, von dem sie nicht gewusst hatte, dass sie es besaß. Oda wäre die Letzte gewesen, einen Mann zu heiraten, weil sie von seinem Lachen innerlich schwang. Aber bei Karol und ihr passte alles zusammen, und das Schwingen war wie eine Zugabe: Sie konnte ohne ihr Hotel nicht leben und er nicht ohne seinen Tanz. Sie würden einander die Freiheit lassen, die sie brauchten, und dennoch untrennbar sein.
»Ich wollte sie Karols wegen sprechen«, sagte sie zu Lidija Petrowna.
Die bot ihr das Silbertablett mit dem türkischen Honig an. »Das habe ich mir schon fast gedacht.«
»Karol und ich«, sagte Oda und lehnte das Konfekt mit einer Handbewegung ab, »wir lieben uns und wollen heiraten. Wenn er sich meinem Vater erklärt, wird mein Vater es mir verbieten. Schlimmstenfalls wird er mich sogar enterben, und das Grandhotel fällt an Anselm den Zweiten. Meinen Vetter. Den Sohn von Anselm dem Ersten.«
Der Sohn war vermutlich nicht viel mehr als ein unangenehmer Hanswurst. Der Vater hingegen war im Hotel und in seinem gesamten Dunstkreis derart berüchtigt, dass man unmöglich seit zehn Monaten hier wohnen konnte, ohne in die finstere Bewandtnis, die es mit ihm hatte, eingeweiht zu sein. Dementsprechend wiegte Lidija Petrowna den Kopf. »Das muss natürlich unter allen Umständen vermieden werden.«
»Deshalb haben wir beschlossen, zusammen zu fliehen«, erklärte Oda. »Mit dem Nachtzug hinüber nach Bessarabien, nach Ryschkanowka, wo Karol herstammt und einen Priester kennt, der nicht allzu genau auf die Papiere schauen wird, ehe er uns traut.«
»Einen Priester?«, fragte Lidija Petrowna. »Einen Katholiken?«
Oda nickte tapfer. »Wir haben keine Wahl. Wir werden mich als Katholikin ausgeben, die ihren Taufschein verloren hat. Ordentlich konvertieren kann ich dann später, wenn wir erst einmal Mann und Frau sind.«
»Ich verstehe.« Die Zähne der Fürstin mahlten. »Du bist eine mutige Mädchen, Oda Liebenthal. Setzt alles auf eine so gefährliche Karte wie die Liebe?«
»Es ist nicht, wie Sie glauben«, widersprach Oda. »Karol und ich haben alles bedacht. Wir werden uns trauen lassen und als verheiratetes Paar zurückkehren. Bis dahin wird mein Vater Zeit gehabt haben, sich zu beruhigen und die Sache mit Besonnenheit abzuwägen. Was ist schon geschehen? Ein Schwiegersohn, den er nicht selbst gewählt hat, ist weit weniger belastend fürs Geschäft als ein Familienzerwürfnis, und dass ich mit Karol an der Seite in der Lage bin, das Hotel zu führen, werde ich ihm beweisen. Letzten Endes will er ja selbst nicht, dass Anselm der Zweite das Odessa in seine schmutzigen Finger bekommt, und wird froh sein, wenn sich der ganze Staub ohne viel Aufsehen wieder legt.«
»Donner und Doria«, bekundete die Fürstin. »Ich glaube, darauf brauche ich einen armenischen Brandy. Trinkst du einen mit mir?«
Oda erhob sich, ging zum Servierwagen vor dem Kamin und füllte für die Fürstin ein Glas fingerbreit mit der goldbraunen Spirituose, die in einer Kristallkaraffe immer vorrätig sein musste. »Für mich nicht«, wehrte sie ab. Sie hätte recht gern etwas getrunken, um ihre flatternden Nerven zu beruhigen, doch es war besser, einen klaren Kopf zu bewahren. Stattdessen warf sie einen raschen Blick aus dem Fenster. Die Suite befand sich in der Kuppel auf einem der beiden Wohntürme des Hotels, und zu ihren Füßen erstreckte sich Odessa, die glückliche Stadt.
Diese Aussicht beruhigte besser als Alkohol.
Lidija Petrowna nahm das Glas entgegen. »Es klingt tatsächlich so, als hättet ihr alles bedacht. Das habt ihr natürlich in Wahrheit nicht. Verliebte junge Leute tun das nie. Aber um zu sein ehrlich, ich habe mein Leben lang dem Abenteuer gehuldigt, nicht dem Pfad der Vernunft. Also – wenn ich alte Schleiereule euch zwei Turteltäubchen kann behilflich sein, dann sag mir, was ist zu tun.«
Oda atmete auf. Die erste Hürde schien genommen. »Es ist nur eine Kleinigkeit, um die ich Sie bitte«, begann sie. »Ich hatte Karol versprochen, einen Treffpunkt für uns zu finden und etwas Reisekleidung sowie das nötigste Gepäck dorthin zu schaffen. Wir hatten vor, uns dort ungestört für die Reise zu rüsten, und den Treffpunkt wollte ich ihm durch die Patentochter meines Vaters übermitteln lassen. Sie sollte Karol einen Brief zum Faunenbrunnen bringen, doch sie will mir nicht helfen. Wenn ich niemanden sonst finde, weiß ich nicht, wie ich Karol benachrichtigen soll.«
»Belle von Arndt?« Lidija Petrowna machte aus ihrer Neugier keinen Hehl. »Belle von Arndt weigert sich, dir zu helfen, obwohl sie in deinem Elternhaus wie eine Tochter behandelt wird? Um zu sein ehrlich, ich hätte erwartet, die Fräulein kommt einmal, um mir ihre Aufwartung zu machen. Ich denke, ich darf sagen, ich bin hier wichtigste Gast, und Fräulein Patentochter hält nicht für nötig, sich mir bekannt zu machen?«
Tatsächlich, Belle und die Fürstin waren einander noch nicht begegnet. Im Sommer war Belle nicht wie üblich in Odessa gewesen, um die Saison am Strand zu genießen. Stattdessen war Oda dieses Mal nach Berlin gereist, wie sie es sonst im Winter tat, wenn Odessas buntes Treiben in Kälte erstarrte. Seit April, als die Fürstin angekommen war, war Belle jetzt zum ersten Mal hier.
In den vergangenen zwei Wochen hätte sie allerdings Zeit genug gehabt, Lidija Petrowna einen Besuch abzustatten. Zwar hatten sie einiges unternommen, waren zum Tee im Fanconi und bei Seibman gewesen, hatten verschiedene Bekannte besucht und als Höhepunkt Karol in Massenets neuer Oper Ariane bewundert, aber Gelegenheiten, bei der Fürstin vorzusprechen, hätte es dennoch in Hülle und Fülle gegeben. Belle war träge, lag oft bis zum Mittag im Bett und vertrödelte den Tag. Sie mochte von Adel sein, aber sie war genau wie ihr Bruder schlecht erzogen. Der Bruder riss fortwährend Witze, die nicht nur unziemlich, sondern vor allem dämlich waren, und die Schwester wusste nicht, was sich gehörte.
»Ich sorge dafür, dass sie Ihnen heute Abend vorgestellt wird«, versprach Oda.
»Nun mach dir mal darüber keine Gedanken, Täubchen«, sagte die Fürstin, ins Russische zurückfallend. »Ich werde nicht daran sterben, der Tochter von Gottfried und Sigrid von Arndt nicht begegnet zu sein.«
Diese Adligen kannten einander alle beim Namen, ob sie sich nun je begegnet waren oder nicht. Lidija Petrowna war ein wandelnder Adelskalender. »Du bringst mir jetzt diesen Brief«, fuhr sie fort. »Und dann beeilst du dich, um dich für die paar Augenblicke, die du auf deinem Geburtstagsball verbringen wirst, in Schale zu werfen. Und mir schickst du die kleine Sonya, damit sie mir meine Ajourspitzen aufbügelt, ja? In meiner neuen Rolle will ich schließlich etwas hermachen.«
Sonya war eins der Küchenmädchen, ein Kind von dreizehn oder vierzehn Jahren, das die Kaltmamsell Katjuša ohne ehelichen Segen aufzog. Oda, die für Katjuša eine Art nostalgischer Dankbarkeit empfand, versprach, deren Tochter sofort zu schicken.
»Ich warte also am Faunenbrunnen auf den Liebsten und übergebe ihm die geheime Botschaft? Ach!« Die Fürstin klatschte in die Hände. »Das weckt doch die Lebensgeister, endlich wieder einmal am Geschehen beteiligt zu sein. Ich spiele den Postillon d’Amour. Habe ich sonst noch etwas zu tun? Oder ist mein Part beendet, sobald Romeo mit dem Brief entfleucht ist?«
»Das ist so gut wie alles«, beeilte sich Oda zu versichern. »Nur … für den Fall, dass nach mir gefragt wird, wäre es natürlich von Nutzen, wenn Sie demjenigen erklären könnten, Sie hätten mit mir gesprochen …«
»Aha. Und was sprachen wir?«
»Nichts Besonderes. Sagen Sie einfach, ich wäre wohlauf und würde nur ein wenig umherspazieren, um mir über manches klar zu werden.«
»Umherspazieren, um sich über manches klar zu werden«, wiederholte die Fürstin und blickte unverwandt zu Oda auf. »Wird gemacht, ma belle demoiselle. Ich werde die Gelegenheit ergreifen und den Herrn Bräutigam wissen lassen, dass er ein Glückspilz vor dem Herrn ist. Aber auch einer, der besser auf der Hut sein sollte, denn mit unserer Oda vom Grandhotel ist nicht gut Kirschen essen, wenn man sie einmal gegen sich aufgebracht hat.«
2
Dass der Tourismus nach Odessa kommen würde – der betuchte, glamouröse, in Luxus schwelgende Tourismus, dem für Genuss und süßes Leben nichts zu teuer war –, hätte man bereits vor Jahrzehnten erahnen können. Wenn man klug war. Klüger als die anderen. Wenn man die Augen offen hielt und es wagte, einen Traum zu träumen.
Die Lage Odessas, in ihre Schwarzmeerbucht geschmiegt und auf Hügeln wie auf Terrassen erbaut, die den Gästen den Blick in eine blau glitzernde Ferne gewährten, war unwiderstehlich. Das kleine Paris, das Petersburg des Südens, die Vielvölkerstadt, in der sich Orient und Okzident die Hände reichten, lockte mit einer Mischung aus behaglicher Vertrautheit und fremdem, rätselvollem Zauber.
Mit dem Wetter verhielt es sich genauso: Europas Crème de la Crème schwitzte sich nicht gern nass, das galt als dégoutant. Die zartgesichtigen Damen wollten sich die Haut nicht verbrennen lassen und unternahmen ihre Exkursionen mit dem Baedeker höchstens widerwillig in sengender Schwüle. Aber sie planschten samt ihren Herren gern im seichten Meerwasser, luden zu Picknicks an schneeweißen Stränden ein und flanierten an lauen Abenden über erleuchtete, belebte Strandpromenaden. Odessa bot ihnen das Beste aus beiden Welten: Das Klima war mediterran, das Treiben südlich, die Sommer mild, hell und regenarm, doch die gefürchtete Hitze der Riviera oder der Côte d’Azur kam nicht auf.
Odessa war anders, war nicht nur eine Stadt, sondern ein Kaiserpanorama aus hundert Städten. Odessa war das Besondere, der Geheimtipp für die, die schon alles gesehen hatten und sich auf ausgetretenen Pfaden zu Tode langweilten.
In Odessa, wenn es auch noch so weit entfernt lag, war es leicht, sich zu Hause zu fühlen: Ein Türke ging zum Frühstück ins osmanische Kaffeehaus und ließ sich zu sündenschwarzem Mokka seine Menemen-Eier mit Knoblauch braten. Ein Brite nahm im englischen Club seinen Tee ein, ein Grieche konnte sich vor fliegenden Händlern mit Kataifi und Baklava kaum retten, ein Deutscher fand sich von Siedlungen der Schwarzmeerdeutschen vereinnahmt wie von eigenen Verwandten, und ein Pariser begann den Abend auf einem Ball im Palast des Prinzen Woronzow und tanzte sich anschließend in den Etablissements auf der Flaniermeile durch die Nacht.
Odessa war nämlich genau wie Paris eine Stadt, die nicht schlafen ging, sondern erst richtig erwachte, wenn auf ihrem Boulevard, der von Akazien gesäumten, schönsten Strandpromenade Europas, die Laternen angezündet wurden.
Der Italiener fand sich in den Werken der großen Architekten seines Landes von Boffo bis Bernardazzi wieder, und von den Russen, Juden, Polen und denen, die neuerdings darauf beharrten, Ukrainer zu sein, war erst gar keine Rede, denn denen gehörte die Stadt sowieso. Im Russischen Reich herrschten Besiedlungsgrenzen, aber nach Odessa kam jeder, dem der Sinn danach stand.
Odessa war jung. Erst 1794 von Katharina der Großen ins Leben gerufen, besaß die Stadt keine eigene Tradition und konnte somit die Traditionen aller Herren Länder zu sich einladen. Auch jene Siedler aus dem Westen und Süden Deutschlands, die man heute als Schwarzmeerdeutsche kannte, hatte die große Katharina eingeladen, weil sie sich von den als robust und strebsam geltenden Leuten Wachstum und Blüte versprach. Zu den ersten Siedlern, die 1803 ins Land gekommen waren, hatten die Familien von Odas Eltern gehört. Die ihres Vaters hatte sogar ihren Namen – Liebenthal – dem Namen der Kolonie angeglichen, die die Deutschen am Rand der jungen Stadt gegründet hatten, und ihr Urgroßvater hatte es dort mit einem Getreidehandel zu Wohlstand gebracht.
Jeder fand seine Nische hier. Und aus der Nische konnte er den Kopf hinausstrecken und den Duft der weiten Welt einatmen.
Oda hätte von all dem im Grunde nur wenig wissen können, denn außer den jährlichen Besuchen bei Belle in Berlin und ein paar Ausflügen in die Umgebung war sie nie gereist. Wer aber ein Grandhotel führte, in das die Welt zu Besuch kam, reiste, ohne sich vom Fleck zu rühren. Sie wusste, was man in Paris zur blauen Stunde trug, welche Cocktails man sich in den Bars von Manhattan mixen ließ, welchen Stars in der Mailänder Scala zugejubelt wurde und wer in den Häfen des britischen Weltreichs ein Schlachtschiff, eine Dreadnought, taufte.
Sie wusste vor allem, was das Grandhotel Odessa brauchte, um ganz vorn, unter den ersten Häusern des Kontinents mitzumischen. Neben zahllosen Dingen, die man kaufen konnte und kaufen musste, gehörte dazu vor allem Nonchalance, vollkommene Gelassenheit.
In einem Luxushotel wollte ein Gast sich verlieren wie in einem Wunschtraum, einem Schlaraffenland, einer Wolke sieben, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun hatte. Aufgabe eines Hoteliers und seines Personals war es, dafür zu sorgen, dass der Gast sich in diese Wolke fallen lassen konnte wie in sein frisch bezogenes Bett. Ein Luxushotel sollte ein Kosmos sein, der weitab vom Tagesgeschehen störungsfrei vor sich hin trieb und seine Bewohner so beschützend einhüllte, dass sie die Stöße des Alltags nicht länger spürten.
In einem Haus wie dem Odessa war jeder einzelne Tourist eine Prinzessin auf der Erbse.
Odas Vater schuf die Atmosphäre, die dies möglich machte, Tag für Tag. Er hatte seinen Finger am Puls des Hotellebensund reagierte auf kleinste Abweichungen mit Ausgleich.
Er hatte das Leben in den majestätisch aufragenden, weiß verputzten Wänden beschwingt und harmonisch gehalten, während im Hafen das Schlachtschiff Potemkin lag und die meuternden Matrosen sich auf der nur einen Steinwurf entfernten Treppe mit den Kosaken Schussgefechte lieferten. An dem Juniabend, als ein Generalstreik die gesamte Stadt lahmlegte, hatte er auf einer Soiree, die Graf Michail Tolstoi im großen Saal des Hotels für Gäste aus dem gesamten russischen Reich gab, Halbgefrorenes zum Dessert servieren lassen, ohne mit der Wimper zu zucken.
Später, in der Winternacht, in der das Blutbad eines Pogroms nicht nur die Moldawanka, sondern jedes jüdische Haus in Odessa erschütterte, hatte er seinen durchreisenden Gast Maximilian von Rothschild, der angeblich reicher als der deutsche Kaiser war, persönlich in das eleganteste Raucherzimmer – den Bernsteinsalon – gebeten, um ihm seine Auswahl kubanischer Zigarren zu präsentieren.
Die Geschichte war legendär: Philipp Liebenthal hatte das Personal angewiesen, sämtliche Fenster und Türen zu schließen und dafür zu sorgen, dass kein Laut von draußen ins Innere des Hotels drang. Dabei, so berichtete man, hätte ihm einen Atemzug lang die Stimme gezittert, als einziges Zugeständnis an die mit den Händen greifbare Angst. Seinem Gast gegenüber betrug er sich, als wären die Grenzen des Hotels auch die Grenzen der Welt. Zeugen zufolge hatten die beiden Herren stundenlang im sich verdichtenden Qualm ihrer Zigarren gesessen und über ihre Reisen nach Kuba geplaudert, das Odas Vater in Wahrheit nie gesehen hatte.
Und dann der Russisch-Japanische Krieg, die schweren Niederlagen des Reiches bei Mukden und Tsushina und am Ende die schändliche Kapitulation! Ein Hotelier war grundsätzlich neutral, ergriff für keine Seite Partei. Ein japanischer Gast war ihm ebenso willkommen wie einer aus Petersburg oder Nowgorod, und wenn sich bei politischen Gesprächen in einem der Salons die Gemüter allzu sehr erhitzten, hatte er schlichtend einzuschreiten. »Meine Herrschaften, Sie sind im Urlaub, nicht in der Kaserne«, pflegte Philipp Liebenthal zu sagen, und damit war es meist getan.
Manche natürlich blieben hartnäckig. »Sie als Russe …«, hatte ihn einmal ein Gast aus Moskau angesprochen, um ihn dazu zu bewegen, im Angesicht der heroischen Kämpfe Patriotismus an den Tag zu legen.
»Ich bin kein Russe«, hatte Odas Vater erwidert.
»Ach nein, Sie sind ja Deutscher«, hatte der Moskowiter pikiert angemerkt. »Unsere tapfer kämpfenden Männer zur See betrachten Sie daher wohl nicht als Ihre Brüder.«
»Ich bin ein Mann aus Odessa«, hatte Philipp Liebenthal mit jener Gelassenheit entgegnet, die ihm im privaten Leben völlig wesensfremd, im beruflichen jedoch wie eine zweite Haut war. »Und solange ich ein Hotel betreibe, bin ich Weltbürger und betrachte als meinen Bruder jeden, der mein Haus mit seinem Besuch ehrt. Sie heute ganz besonders, Nikolai Nikolajewitsch. Darf ich Sie um Ihre Meinung zu einem neuen Wodka bitten, von dem ich mir einige Flaschen aus Nemyriw habe schicken lassen? Mir scheint er recht gut zu sein, und ich überlege, ob ich nicht eine größere Menge davon ankaufen sollte, aber ihr Leute aus dem Herzen des Reiches versteht doch mehr davon als wir hier in unserem verschlafenen Süden.«
Für Oda war ihr Vater ein Genie. Sie kannte ihn, war sicher, außer Karol keinen Menschen so genau zu kennen, und hätte ihn als feinnervig und aufbrausend wie ein Vollblutpferd beschrieben, als Eigenbrötler, der am zufriedensten war, wenn die Mitglieder seiner Familie in seiner Gegenwart auf Zehenspitzen gingen. Sobald er jedoch die privaten Räume verließ und hinüber in den Hotelbereich trat, streifte er wie ein Schauspieler ein unsichtbares Kostüm über, eine Maske, die nie verrutschte. Vor den Gästen war er freundlich, jovial, nie um das eine Wort verlegen, das in der Situation das richtige war.
Die Stürme, die in seinem Innern toben mochten, blieben denen, die ihm am Empfang, auf den Treppen, in den Sälen und Salons begegneten, verborgen. Er erschien milde wie Odessas Wetter und trat als ein Mann auf, der nur eine Leidenschaft kannte: das Wohl der Menschen, die unter seinem Dach logierten.
Dafür bewunderte Oda ihn grenzenlos und tat, was sie nur konnte, um ihm nachzueifern. Vielleicht noch mehr bewunderte sie ihn dafür, dass er vorausgesehen hatte, was so vielen anderen entgangen war, als er nicht älter gewesen war als sie jetzt: dass der Tourismus nach Odessa kommen würde. Der mondäne, luxuriöse, in ganz großem Stil aufgezogene Tourismus, der einen Mann über Nacht zum Millionär machen konnte.
Odas Vater hatte sich für seinen Traum verlachen, enterben und so tief erniedrigen lassen, dass niemand jene Zeit auch nur erwähnen durfte. Er hatte jeden Rat, jede Warnung, jedes Verbot in den Wind geschlagen und das Land gekauft, auf dem sein Grandhotel erstehen sollte. Das beste Stück Land, das in Odessa damals zu bekommen war: hoch oben beim Platz mit dem Denkmal des Herzogs von Richelieu, dort, wo die große Treppe hinführte, die Himmelsleiter. Von den Balkonen an der Vorderseite bot sich den Gästen der Blick über das Meer und von denen nach hinten das schimmernde Gewirr der Dächer. Dabei lag das Grundstück jedoch ein wenig versetzt an der rechten Flanke des Platzes, sodass Raum blieb, eine Reihe von Gärten in Terrassen bis hinunter auf die berühmte Promenade anzulegen, einen jeden in einem anderen Stil.
Unten warteten Kutscher in der Livree des Hotels mit ihren Droschken darauf, die Gäste unter den Akazien hindurch an den Strand zu kutschieren, zu einem Ausflug durch die Anlagen des botanischen Gartens oder hinauf zur Deribasowskaya, Odessas Flaniermeile, die Königin der Straßen. Weiß und blau waren die Farben des Hotels, und Odas Vater achtete darauf, dass die Droschkenkutscher nur makellose Schimmel einspannten und die königsblauen Beschläge am Zaumzeug wienerten, bis sie glänzten.
Er achtete auf alles, auf jedes Detail, und das hatte er schon damals getan, als er mit gerade mal zwanzig ohne Unterstützung dastand und für seinen Traum als weltfremder Fantast verhöhnt wurde.
»Reiche Leute fahren nach Nizza, was sollen die hier bei uns?«
»Dein Vater verkauft Getreide, und das nicht schlecht. Bleib bei deinem Leisten, Schuster, lass die Kirche im Dorf.«
»Hochmut kommt vor dem Fall, schönes Herrchen. Die Flausen, die du und deine Schwester im Kopf habt, brechen euch noch eure hübschen Hälse.«
Odas Vater hatte nicht hingehört. Glasklar hatte er vor sich gesehen, wie ein Grandhotel für Odessa beschaffen sein musste, und davon hatte er sich nicht abbringen lassen, war in keinem Punkt einen Kompromiss eingegangen. Auch dass das Hotel, das er erschaffen würde, Grandhotel Odessa heißen musste, hatte für ihn von Anfang an festgestanden. Und er hatte recht behalten, hatte wie Galileo Galilei über die Köpfe aller Skeptiker hinweg gerufen: Und sie bewegt sich doch!
Im Schaltjahr 1888, an jenem 29. Februar, den es nur alle vier Jahre gibt, war das Hotel, das er sich in seinem Kopf zurechtgewoben hatte wie eine Spinne ihr Netz, Wirklichkeit geworden und hatte mit nicht mehr als drei halbherzigen Buchungen Eröffnung gefeiert.
Ihr Vater sprach nicht darüber, er weigerte sich, die Geschichten rund um die Entstehung des Hotels, auf die Oda brannte, mit ihr zu teilen. Er gab nicht mehr preis als das, was er in den Ansprachen zum Gründungsjubiläum sagte: »Man hatte mir den völligen Ruin in höchstens vier Wochen prophezeit, dabei war ich doch schon völlig ruiniert, als auf dem Grundstück des Odessa der erste Spatenstich getan wurde. Eine Woche später war ich ausgebucht. Und als der Februar das nächste Mal neunundzwanzig Tage hatte, war ich ein gemachter Mann.«
Das war er noch immer. Jetzt, wo in Odessa die große internationale Ausstellung für Industrie und Landwirtschaft bevorstand, war im Hotel bis in den Herbst hinein selbst die letzte Kammer ausgebucht.
Andere hatten versucht, es ihm nachzutun. Wie Pilze schossen das Bristol, das Moskau, das London und das Arcade aus dem Boden, eines prunkvoller als das andere, aber keines, das in Zeit, Ort und Ausführung derart ins Schwarze traf wie das Odessa. Die Inhaber des Moskau waren bereits nach Ablauf eines Jahres pleite und mussten verkaufen, das Passage mit seiner gläsernen Arkadekämpfte ums Überleben, und das Bristol gab es nicht mehr. Das London hielt sich als ernst zu nehmender Konkurrent, musste jedoch fortlaufend horrende Summen investieren, und weitere Neugründungen verschwanden, noch ehe sie sich richtig etabliert hatten. Das Odessa hingegen florierte scheinbar ohne Mühe, und was dieser reibungslose, geradezu träumerische tagtägliche Ablauf die Menschen, die es betrieben, tatsächlich kostete, bekam niemand mit.
So sollte es bleiben.
Daran gab es für Oda nichts zu rütteln.
Auch die Tatsache, dass sie Karol Albus, den Helden des Stadttheaters, liebte und heiraten würde, änderte daran nichts.
Bevor sie sich umkleidete und zu Belle ging, um wie vorgesehen mit ihr gemeinsam die Treppe in den Ballsaal hinunterzuschreiten, hätte Oda ihren Vater gern kurz noch gesprochen, um sich für all das zu bedanken. Für den Ball zu ihren Ehren, für ihre grandiose Abendtoilette, für den Reichtum und die Sorglosigkeit, in der sie aufgewachsen war. Vor allem jedoch für das Hotel, das sie eines Tages erben würde.
Sie hätte dem Vater jetzt, ehe das Drama, in das diese Nacht zweifellos münden würde, seinen Lauf nahm, gern all das gesagt, was ihr beim Gang durch das Haus durch den Kopf gegangen war: Dass sie ihn bewunderte. Dass sie sich seiner würdig erweisen wollte. Dass sie sich wünschte, er möge ihr einmal, wenn sie beide älter waren, erklären, wie froh er war, sie und nicht Belle zur Tochter zu haben.
Und überdies hätte sie ihm sagen wollen, dass sie Sonya nirgendwo auftreiben konnte und sich deshalb gezwungen sah, stattdessen Galina zu schicken, ein noch recht neues, besonders emsiges Zimmermädchen. Sie hätte das Trinkgeld der Fürstin gern Katjušas Tochter zugeschanzt, weil sie der Kaltmamsell in gewisser Weise etwas schuldig war. Außerdem hatte die Fürstin ausdrücklich nach Sonya verlangt, und was ein Gast des Odessa verlangte, das sollte er bekommen.
Da aber Sonya nicht zur Verfügung stand, ließ sich nichts machen. »Ich habe sie auf den Privoz-Markt nach Meerrettich geschickt«, hatte Katjuša beteuert und die Hände gefaltet wie zum Gebet. »Der Lieferant hat einen Fehler gemacht, und anderswo bekommt man jetzt nicht so viel, wie ich brauche.« Sie hatte auf die Deruny gedeutet, die Kartoffelplätzchen, die sie bereits abgebraten und für das Büfett zur Pyramide aufgetürmt hatte. Die Smetana-Sauce, die sie nach ihrem geheimen Rezept zubereitete, enthielt geriebenen Meerrettich und war bei den Gästen äußerst beliebt.
Die ganze Küche summte vor Geschäftigkeit. Mehr als ein Dutzend Menschen, fast ausschließlich Frauen und Mädchen, beugte sich emsig über Hackbretter, Rührschüsseln und dampfende Töpfe. Niemand schien abkömmlich, also hatte eben Sonya zum Markt gehen müssen. So leid es Oda für die Kleine und ihre Mutter tat – die lukrativere Aufgabe ging an Galina.
»Können Sie ihr nicht bitte noch ein Augenblickchen geben, Fräulein Oda?«, hatte Katjuša gebettelt. »Ich erwarte sie ja schon seit einer Weile zurück, aber der Weg zum Privoz ist nun einmal weit.«
»Ich kann deswegen keinen Gast warten lassen, das weißt du selbst«, hatte Oda erwidert, hatte Katjuša stehen lassen und war gegangen.
Ihr Gewissen zwickte sie deswegen, aber ihr Vater hätte ihr bestätigt, dass sie das Richtige getan hatte. Die Gäste gingen vor. Ihr Vater hätte sie bestärkt, und sie hätte ihm stumm, mit einem Händedruck, versichert, dass sie es für immer so halten würde, auch wenn sie ihn scheinbar heute Nacht verriet.
Nur war ihr Vater im ganzen Haus so wenig aufzutreiben wie Sonya, und Oda lief die Zeit davon. Ihr blieb nur, darauf zu hoffen, dass der Vater das, was ungesagt blieb, trotzdem wusste.
3
Belle von Arndt lag rücklings auf dem unglaublich weichen Bett im Schlafzimmer ihrer Suite, streckte ein langes, seidenbestrumpftes Bein in die Luft und betrachtete es mit wachsendem Wohlgefallen. Es hatte seine Vorteile, nicht vollkommen schlank oder sogar mager zu sein, auch wenn letzthin solche Frauen offenbar in Mode kamen. Oda beispielsweise war gebaut wie ein Jüngling, und Belle leugnete nicht, dass sie die neuen Tunikakleider mit der schmalen Silhouette, die der französische Modeschöpfer Poiret entwarf, beneidenswert gut tragen konnte. Geradezu majestätisch wirkte sie darin mit ihrem hohen, athletischen Wuchs.
Aber wenn die Zeit kam, die teuren Kleider abzulegen? Wenn sie nackt war?
Das Wort ›nackt‹durfte eine junge Dame von Belles Abkunft nicht einmal denken, und natürlich tat sie es gerade deshalb immerzu. Die jungen Männer taten nichts anderes. Um das zu wissen, musste man kein leichtes Mädchen sein, sondern nur Berlinerin und ein kleines bisschen schlau.
Wenn ein Mann eine Frau in einem eleganten Kleid sah, dachte er nicht: Ach du lieber Himmel, was für ein göttlich geschnittenes Kleid, und wie wunderbar die Farbe ihre Augen zur Geltung bringt! So dachten Frauen. Männer hingegen fragten sich, wie es wäre, diese Frau aus dem vornehmen Kleid herauszuschälen wie eine saftige Orange. Natürlich hätte jeder wohlerzogene junge Mann das geleugnet, und das gehörte sich ja auch so. Belle jedoch war mit einem Bruder aufgewachsen, für dessen Erziehung niemand Zeit gehabt hatte und der das Leugnen von Tatsachen für Zeitverschwendung hielt.
Die Königlich Preußische Hauptkadettenanstalt in Lichterfelde, die Bodo und seine Kumpane absolviert hatten, lehrte alles andere als verfeinerte Manieren. Die Horde war in der engen Lichterfelder Wohnung der Familie ein und aus gegangen, weil »der von Arndt die schönste Schwester in ganz Preußen« hatte, und während die Jungen an der Ehrenschmiede der preußischen Armee Militärwesen studierten, konnte Belle gar nicht anders, als sich zu einer Expertin für die männliche Gefühlswelt zu entwickeln. Zwar wurden Jungen weit langsamer erwachsen als Mädchen und lagen als Gymnasiasten noch mit Bodos Märklin-Eisenbahn auf dem Boden, aber irgendwann fiel auch bei ihnen der Groschen.
Bodo und seine Freunde begrüßten beispielsweise die neue Frauenmode, das sogenannte Reformkleid, nicht etwa, weil sie für die Frauen bequem war, sondern »weil nun kein Korsett mehr verbergen kann, was daruntersteckt.«
Und wozu hätte wohl Poiret, der Meister der Modeschöpfer, ein Kleid entwerfen sollen, bei dem das Korsett nicht verbarg, was daruntersteckte, wenn es gar nichts zu verbergen gab? Belle ließ ihre Fingerspitzen über das kleine Stück Haut ihres Schenkels gleiten, das der Strumpfhalter frei ließ. Ein Mann, der in eine Frau verliebt war und über dieses weiche, seidige Fleisch strich, wäre überzeugt, dass die Frau auch im täglichen Leben weich und schmiegsam wie Seide sein würde, dass sie nichts von ihm fordern und ihn nicht mit anderen vergleichen, sondern ihn nehmen würde, wie er war.
Belle mochte jung sein, sie mochte wirken wie eine, die sich lieber auf Bett und Diwan räkelte, als sich in den Strom des Lebens zu stürzen – und daran war ja nichts falsch: Sie räkelte sich tatsächlich gern auf Bett oder Diwan, und was Mädchen wie Oda in aller Herrgottsfrühe zu Turnübungen aus den Federn trieb, würde sie nie begreifen –, wenn es jedoch um Männer ging, machte ihr niemand etwas vor.
Vielleicht war ein Mädchen wie sie einfach dazu geboren, Männer zu durchschauen. Oder es lag an dem Leben, das sie führte und das ihr statt der Trägheit, die ihrem Wesen entsprach, Wachsamkeit aufzwang.
Sie ließ das Bein sinken, lehnte den Kopf zurück ins Daunenkissen und warf einen Blick zur Seite, wo über zwei Sessel gebreitet ihr himmelblaues Ballkleid lag. Ein Lichtschein spielte darauf und erweckte den Anschein, als hätte es ein Eigenleben, wäre eine Freundin, die nur darauf wartete, mit Belle loszuziehen und sich all die aufregenden Dinge ins Ohr flüstern zu lassen, die in dieser Nacht bevorstanden. Sie seufzte leise und schloss flüchtig die Augen. Sie liebte es, in Odessa zu sein, sie hatte es geliebt, solange sie denken konnte. Der Grund lag auf der Hand: Nirgendwo sonst in ihrem Leben wurde sie so sehr behütet, verwöhnt, gehätschelt und geliebt. Nirgendwo sonst bedeutete ein neuer Tag Erregung und Abenteuer, aber ohne Schrecken.
Dass sie nun auf einmal noch einen weiteren und noch viel wundervolleren Grund hatte, das Leben in Odessa zu lieben und nie wieder nach Berlin zurückzuwollen, vermochte sie selbst kaum zu glauben. Wieder schloss sie die Augen und sog den süßen Duft ein, den das Bukett aus zartrosa Rosen verbreitete. Längst hätte sie aufstehen und sich für den Ball ankleiden müssen, ehe Oda kam und ihr mit ihren Haaren half. Ganz kurz noch wollte sie jedoch die Vorfreude genießen, den Augenblick, in dem noch nichts geschehen und dafür alles möglich war.
Sie würde glücklich sein. Ein neues Leben beginnen. Dass andere Menschen dafür leiden mussten, widerstrebte ihr, denn Belle war ein Mensch, der allen Glück und niemandem Böses wünschte. Aber es lag ja auf der Hand, dass das Leid nicht lange dauern, sondern jeder Betroffene rasch einsehen würde, wie gut und richtig, ja unvermeidlich der Lauf der Dinge letztendlich gewesen war.
Die anderen würden auch noch ihr Glück finden. Dass Belle jetzt schon an der Reihe war, lag gewiss daran, dass irgendwer da oben in den Wolken eine gehörige Schwäche für sie hatte.
Es klopfte zweimal kurz und hart, dann wurde schon die Tür aufgeschoben. Das Zimmermädchen konnte es somit nicht sein, denn das hatte zu warten, bis Belle Herein! rief. Bei Onkel Philipp wäre es das Gleiche, Tante Lene kam nie zu ihr herauf, und ihre Mutter war sicher voll und ganz mit ihrem Äußeren beschäftigt. Somit blieben zwei Menschen übrig, um das zu wissen, brauchte Belle nicht die Augen zu öffnen. Entweder Oda oder Bodo. Es war Oda.
»Bist du noch nicht angezogen?«
»Ich dachte, du hilfst mir.« Belle streckte und räkelte sich, setzte sich auf und öffnete die Augen. Vor ihr stand Ihre Majestät, Königin Oda von Odessa, in einem Kleid, das Belle den Atem stocken ließ. Der Stoff war durchwirkt mit einem Muster aus Goldfäden, hatte etwas Metallisches, saß auf Odas Statur wie die Rüstung eines schlanken Ritters in einer dieser romantischen Legenden. Lancelot oder Tristan? Wäre Oda ein Jüngling gewesen, kein Mädchenherz hätte ihr widerstehen können.
Das Erstaunlichste an dem formidablen Stoff war jedoch seine Farbe. Die Seide war mitnichten himmelblau – sie schillerte in dem kraftvollen, klaren Türkis, wie man es manchmal auf dem Meer sah, im Sommer, wenn die Sonne Sprenkel darauf warf.
»Oh!«, entfuhr es Belle. »Ich hatte gedacht …«
»Was hattest du gedacht?«, fauchte Oda. »Dass ich mich in dieselbe blässliche Farbe hüllen lasse wie du, damit wir wie üblich als Goldmarie und Pechmarie daherkommen? Besten Dank. Mit einer Berlinerin mag ich vielleicht nicht mithalten können, aber das macht mich noch lange nicht zur Landpomeranze. Ich werde nicht so dumm sein und Karol auf Ideen bringen.«
»Ach, Oda.« Belle konnte nicht anders, als aufzuseufzen.
Sie liebte Oda. Wer das Gegenteil behauptete, war ein Lügner oder hatte von Liebe keinen Schimmer. Belle und Oda hatten einander Briefe geschrieben, seit sie in der Lage waren, einen Federhalter zu benutzen. Anfangs schrieben sie sich, weil Belles Mutter und Odas Vater sie drängten, doch schon bald wurde aus dem Zwang eine Gewohnheit:
»Liebste Oda Odessa, gestern waren wir alle im Tiergarten spazieren. Alle bis auf Vater natürlich, also Mutter, Onkel Georg, Bodo, ich und dieser neue Freund aus dem Rheinischen, den Bodo sich zugelegt hat …«
Es hatte etwas Beruhigendes, Vertrautes, am Ende eines Monats alles, was sich ereignet hatte, in einem Brief an Oda Revue passieren zu lassen. Es verlieh den banalsten Ereignissen Gehalt, wenn man sich dabei zu überlegen hatte: Was wird wohl Oda davon halten, was wird sie in ihrer Antwort dazu schreiben?
Oda war zuverlässig wie ein preußischer Feldwebel. Sie beantwortete jeden Brief, nicht weil sie aufs Schreiben versessen war, sondern weil es sich so gehörte. Belle war schlampiger, doch wenn etwas ihr Herz bewegte, schrieb sie ellenlange nächtliche Episteln. So stellten sie schließlich nicht ohne Verblüffung fest, dass sie fünfzehn Jahre lang ununterbrochen einen Briefwechsel geführt und einander womöglich mehr anvertraut hatten als jedem anderen Menschen.
War das etwa keine Liebe? Sich jemanden aus dem eigenen Leben nicht mehr wegdenken zu können, auch wenn man ihn nicht immer mochte? Und gegen die Einsamkeit, von der man niemandem erzählen durfte, hatte nichts so sehr geholfen wie die nächtliche Zweisamkeit mit einer Oda, die viele Meilen entfernt in Odessa saß.
Belle liebte Oda. Sie wollte sie niemals verlieren. In diesem Augenblick aber hätte sie sie liebend gern in die tiefste sibirische Tundra gewünscht. Es würde hart werden, ihr Zusammenhänge begreiflich zu machen, gegen die sich ihr starker Charakter mit aller Kraft zur Wehr setzen würde.