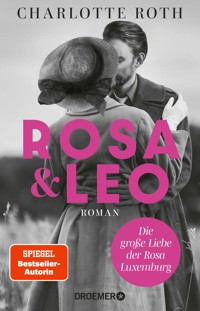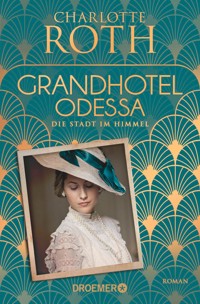9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Wintergarten-Saga
- Sprache: Deutsch
In finsteren Zeiten bringen drei Künstlerinnen Licht ins Dunkel. Anrührend und hochspannend: Der dritte historische Roman von Charlotte Roths Trilogie »Die Wintergarten-Frauen« erzählt von den Gefahren für die Freundinnen und das berühmte Varieté-Theater während der Nazi-Zeit. Berlin, 1933. Mit Hitlers Machtergreifung droht dem Wintergarten ein jähes Ende. Denn das berühmteste Cabaret der Stadt ist nicht nur die Bühne der Wunderweiber und der besten Artisten ihrer Zeit – es bietet auch denen Zuflucht, die die Nazis mit aller Macht bekämpfen. Intendantin Nina von Veltheim ist einmal mehr mit der gefährlichen Aufgabe konfrontiert, ihre Familie und ihre Freunde zu beschützen. Doch sie hat nicht damit gerechnet, dass Sonia Spielmann – neben der »Schlangenfrau« Jenny Alomis Ninas beste Freundin – einfach untertaucht. Die hochbegabte Künstlerin Sonia gestaltet sämtliche Programme des Varietés, unter ihren Händen werden Bilder regelrecht lebendig. Als Frau jüdischer Herkunft hat sie jedoch kaum eine Chance, alleine zu überleben. Außerdem können Nina und Jenny nicht begreifen, wie Sonia ihre kleine Tochter Eva einfach zurücklassen konnte. Auf der Suche nach ihrer Freundin setzen sich die Wunderweiber nicht nur tödlichen Gefahren aus, sondern entdecken auch ein Geheimnis, das ihrer aller Zukunft in Frage stellen wird. Schillernde Nächte und düstere Tage: die fesselnde historische Roman-Reihe aus dem Berlin der 20er- und 30er-Jahre Mit dem historischen Roman »Die Hoffnung lebt« schließt Bestseller-Autorin Charlotte Roth ihre Trilogie um die Wunderweiber und das Varieté Wintergarten ab. »Die Wintergarten-Frauen« lässt eine Zeit der Gegensätze dramatisch und opulent lebendig werden – vom Glamour der Goldenen 20er mit Champagner und durchtanzten Nächten bis zu den finsteren Abgründen des Nationalsozialismus. Am Ende aber bleibt: die Hoffnung! Die historischen Romane um drei Künstlerinnen und Freundinnen sind in folgender Reihenfolge erschienen: · Die Wintergarten-Frauen. Der Traum beginnt · Die Wintergarten-Frauen. Die Sehnsucht brennt · Die Wintergarten-Frauen. Die Hoffnung lebt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 609
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Charlotte Roth
Die Wintergarten-Frauen
Die Hoffnung lebtRoman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Berlin, 1933. Mit Hitlers Machtergreifung droht dem Wintergarten ein jähes Ende, denn Berlins berühmtestes Cabaret ist nicht nur die Bühne für die besten Artisten dieser Zeit, sondern auch der Zufluchtsort für heimatlose und gefährdete Künstler aller Art. Geschäftsführerin Nina ist wieder einmal mit der gefährlichen Aufgabe konfrontiert, ihre Familie, ihre Angestellte und ihre Freunde zu schützen bzw. ihnen das Leben zu retten. Doch womit sie nicht gerechnet hat, ist, dass Sonia, die hochbegabte Künstlerin, die sämtliche Programme optisch gestaltet und mit Jenny ihre beste Freundin ist, plötzlich verschwindet. Als Frau jüdischer Herkunft hat Sonia jedoch kaum eine Chance, alleine zu überleben – und Nina und Jenny verstehen nicht, wie sie ihre kleine Tochter Eva einfach zurücklassen konnte. Auf der Suche nach ihr setzen sich die Wunderweiber nicht nur tödlichen Gefahren aus, sondern entdecken auch ein Geheimnis, das ihrer aller Zukunft infrage stellen wird …
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Anmerkung
Widmung
Motto
Verehrtes Publikum, Damen, Herren, [...]
Auftakt
1. Kapitel
Erste Nummer,
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Zweite Nummer,
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
Dritte Nummer,
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
Glossar
Leseprobe »Die Liebe der Mascha Kaléko«
Zum besseren Verständnis zeithistorischer und lokaler Begriffe enthält dieser Roman am Ende ein Glossar.
Für Drax und Mantis
»Es ist eines der Geheimnisse der Mütter: Sie verzichten niemals darauf, ihre Kinder wiederzusehen, ihre totgeglaubten nicht und auch nicht ihre wirklich toten. (…) Eine Mutter erwartet die Wiederkehr ihres Kindes immer, ganz gleichgültig, ob es in ein fernes Land gewandert ist, in ein nahes oder in den Tod.«
aus: Die Kapuzinergruft von Joseph Roth, der aus dem galizischen Brody unweit der Stadt Lemberg stammt
Verehrtes Publikum, Damen, Herren, Menschen –
bitte spazieren Sie doch noch ein drittes Mal mitten hinein in mein Varieté!
Während draußen vor den Türen der Himmel sich mit düsteren Wolken bezieht, ist der künstliche Himmel des Wintergartens noch immer sternenklar und funkelt wie eh und je. Hier versprechen wir Ihnen auch jetzt noch Lügen, die so schön sind, dass Sie sie einfach glauben müssen, und Wahrheiten, die wir für Sie nach Belieben drehen und wenden.
Wir nehmen Ihre Träume ernst und verlachen Ihre Bedenken. Wir fragen Sie nicht nach dem, was Sie wollen, sondern zaubern Ihnen aus dem Hut, was Sie brauchen. Wir bekehren Schwarzseher und Teufel-an-die-Wand-Maler, denn was bei uns am Ende nicht gut wird, beginnt wieder von vorn. Legen Sie Ihre Klarsicht an der Garderobe ab, lassen Sie die Brille im Etui und folgen Sie uns ins Reich der Illusion.
Natürlich verrate ich Ihnen wie immer nicht, wen im Reigen meiner Darsteller es mit beiden Beinen auf der Erde gegeben hat und wer nur über die Stoppelfelder meiner Fantasie getanzt ist. Stattdessen hoffe ich, dass Sie sich von den einen wie den anderen bezirzen lassen und ein bisschen Spaß am Rätselraten haben.
Eine Ausnahme mache ich nur bei den zwei nachstehend Genannten, weil ich mir wünsche, dass mein Buch ihnen in ein paar Worten einen kleinen Stolperstein setzt. Gelebt haben also, wenn auch viel zu kurz und unwiederbringlich:
Fritz Löhner-Beda und Horst Schimmelpfennig.
Wenn Sie den beiden einen Platz in Ihrem Gedächtnis schenken, wäre ich Ihnen dankbar. Fritz Löhner-Beda war ein Autor, der zu Beginn der Dreißigerjahre mit seinen Schlagern zu den beliebtesten Textern überhaupt zählte. Er war ein lustiger Typ, der gern wissen wollte, was der liebe Hans mit dem Knie macht, der Rosa vorschlug, nach Lodz zu fahren, und sein Herz in Heidelberg verloren hatte. Die Musikverlage und Veranstalter rissen sich um ihn, und sein wohl bekanntestes Lied »Dein ist mein ganzes Herz«, das er für seine Frau schrieb, wird bis heute gespielt.
Er hat noch ein anderes geschrieben, das bis heute gespielt wird – auf Gedenkfeiern für die Opfer des Holocaust. Es ist das »Buchenwaldlied«,das er 1938 auf Befehl der Leitung im Konzentrationslager Buchenwald verfassen musste. Vier Jahre später wurde er aus Buchenwald nach Auschwitz verschleppt und dort im Alter von siebenundfünfzig Jahren ermordet.
Wer Horst Schimmelpfennig war, soll Ihnen mein Buch erzählen. Aus naheliegenden dramaturgischen Gründen habe ich an seinen Lebensdaten jedoch gerüttelt und Ereignisse von 1942 ins Jahr 1938 vorverlegt. Ich bitte dafür um Ihr Verständnis – Sie sind schließlich Menschen mit großem Herzen und der Bereitschaft, fünfe gerade sein zu lassen. Daran hege ich keinen Zweifel, denn ansonsten säßen Sie nicht hier. In meinem Varieté.
Dafür danke ich Ihnen. Mit Ihren Eintrittsgeldern retten Sie uns Gaukler durch karge, sturmgepeitschte Zeiten. Mit Ihrem Applaus sorgen Sie dafür, dass wir noch immer den Rücken durchdrücken und ein wenig eitel den Kopf oben tragen. Zumindest manchmal. Und wenn Ihnen zuweilen nach Buhrufen zumute ist, dann nehmen wir das von Ihnen mit gebührendem Bedauern hin. Sie haben es sich verdient.
Und damit Bühne frei.
Charlotte Roth, London 2024
Auftakt
Lwów, Lwiw, Lemberg, Lemberik – eine jener Städte mit vielen Namen, die es so nicht mehr gibt
September 1914
1
Die Mutter sah aus dem Fenster, hinaus auf den Krakauer Marktplatz. Vor zwei Wochen waren die Truppen hier entlangmarschiert, endlose Ströme von Reitern und Fußleuten, Offiziere in farbigen Uniformen und Soldaten in Grau.
»Das musst du zeichnen!«, hatte Nathan, Esters Cousin, gerufen. Sein Traum war es, zum Fotografen in der Armeniergasse zu gehen und ein Familienporträt anfertigen zu lassen. »Zur Erinnerung«, sagte er. »Falls ich mal blind werde wie der Vater, dann weiß ich noch, dass wir auf dem Bild zu sehen sind.«
Er wünschte sich Bilder von ihnen allen: von ihm selbst im gestreiften Sporttrikot von »Hasmonea Lemberg«,und Bilder von dem, was mit der Stadt geschah. Weil sie sich keinen Fotografen leisten konnten, sollte Ester dafür sorgen.
»Kann ich nicht«, hatte Ester gesagt. »Ich kann nur zeichnen, was ich mir lange aus der Nähe anschaue. Einer von den Reitern müsste anhalten und mich sein Gesicht zeichnen lassen, aber das wird er nicht tun.«
Zwei Wochen war es her, seit das, was die Zeitung Schlacht um Lemberg nannte, entschieden worden war. Die österreichischen wie die polnischen Beamten, die in den Amtsstuben vor sich hin gestritten hatten, waren vertrieben oder tot. Schon hingen über sämtlichen Schildern in Polnisch, Deutsch, Ruthenisch und Hebräisch neue in russischer Sprache. Aufrufe klebten an den Hauswänden und den Schaufenstern der Läden:
»Lemberger. Eure Stadt gehört mit sofortiger Wirkung zum Reich des russischen Zaren. In den nächsten Tagen findet ein Zensus statt, dem sämtliche Mitglieder eines Haushalts zu melden sind. Widersetzungen und Zuwiderhandlungen werden mit voller Strenge bestraft.«
»Zensus schreiben sie, und Judenzählung soll es heißen«, hatte Herr Ehrenpreis gesagt. »Wir räumen auf, sagen sie, doch in Wahrheit meinen sie: Die Juden kommen weg. Wie lange die schon hier sind, ist uns egal. Schafft uns die irgendwohin, wo kein Mensch lange überlebt. Nach Sibirien. In die Kälte. Aber so lange warten wir nicht ab.«
Ester hatte es ihrer Mutter erzählt: »Die Ehrenpreis gehen nach Westen. Sie sagen, die Russen schaffen die Juden nach Sibirien. Ich kann nur noch drei Mal zu ihnen gehen, dann sind sie nicht mehr hier.«
Für gewöhnlich ging Ester dienstags und donnerstags zu ihnen. »Zu deinen Leuten«, pflegte die Mutter zu sagen. Die Ehrenpreis gehörten zu den Reformjuden, die am Staryj-Rynok-Platz mit der Tempel-Synagoge wohnten, und hatten mit solchen wie ihnen, den orthodoxen Juden aus der Vorstadt Krakau, im Grunde nichts zu schaffen. Dass Ester hingehen und bei Leo Ehrenpreis zeichnen lernen durfte, hatte der Vater so bestimmt: »Das Maidele hat da ein Talent. Das soll ihm ja nicht zuschanden gehen.«
Heute würde sie zum letzten Mal hingehen. Sie hatte sich ihr grünes Kleid mit den Punkten angezogen, hatte die Tasche mit ihren Zeichensachen gepackt, während die Mutter am Fenster gestanden und auf den Platz hinausgeblickt hatte.
Jetzt drehte sie sich um. »Gehst du zu deinen Leuten?«, fragte sie.
Ester nickte. »Heute zum letzten Mal.«
Wie ihr Leben werden sollte, wenn sie nicht mehr zu den Ehrenpreis gehen und zeichnen konnte, wusste sie nicht.
»Ich komm mit«, sagte die Mutter, lief zur Garderobe und nahm sich ihr Tuch. Die Mutter war noch nie zu den Ehrenpreis mitgegangen, nur der Vater ganz am Anfang, um für Esters Stunden für ein Jahr im Voraus zu bezahlen. »Und Ziporah. Ziporah kommt auch mit.«
Ziporah war die Kleinste von ihnen. Das letztgeborene Kind des Hauses. Noch keine fünf Jahre alt.
Sie kam angelaufen, sobald sie ihren Namen hörte, begeistert von der Aussicht, an irgendeinem Abenteuer teilzunehmen – dem Gang zum Wochenmarkt oder zur Milchhandlung, dem Besuch bei einer von den Nachbarsfrauen. Ziporah war hübsch wie eine Puppe und so klein, dass Ester manchmal dachte, für all die Freude, die in ihr brodelte, könne in dem winzigen Körperchen unmöglich genug Platz sein. Was ihr auch zustieß, ob sie weinte, weil sie den Vater vermisste, oder Angst hatte, weil Geschützfeuer wie ein Gewitter durch die Straßen donnerte, immer war sie sofort bereit, das Schlimme zu vergessen und sich aufs Neue zu freuen, wenn sich nur der kleinste Anlass bot: ein Bonbon, das die Frau im Kartoffelladen ihr schenkte. Ein schillernder Käfer, den sie auf dem Treppenabsatz entdeckte. Ein Ausflug zu irgendwelchen Leuten, die sie gar nicht kannte.
Die Mutter ließ sich auf ein Knie nieder, packte ihre Jüngste fest bei den Schultern und bestand darauf, ihr die Strickjacke überzuziehen, sosehr sie sich auch wehrte.
»Ist doch viel zu warm dafür, Mame«, sagte Ester. »Und außerdem muss ich los.«
»Psst, psst«, machte die Mutter, »bin gleich fertig.« Sie kämmte der Kleinen mit den Fingern die braunen Locken aus der Stirn und rieb ihr mit dem Handrücken über die Wangen, um ein bisschen Schmutz zu entfernen.
Dann gingen sie los. Dieser Teil der Stadt, in dem es sonst wimmelte wie in einer Falle voller Mäuse, war wie ausgestorben. Zwar zockelte die Straßenbahn vorbei, doch beide Wagen, auf deren Plattformen sich für gewöhnlich die Leute dicht an dicht drängten, waren leer. Über dem Pflaster lag noch ein Flimmern vom Sommer, das den Staub vergoldete, und Ester wünschte sich, sie hätte einen Stift in dieser Farbe gehabt.
Aber solche Stifte gab es nicht. Schon gar nicht für die Tochter eines kleinen Handlungsreisenden, der zu den drei eigenen die Kinder seines Bruders durchfütterte und daher immer sparen musste.
Leo Ehrenpreis gab Ester ohnehin nur Bleistifte. »Du musst die Farbe, die du siehst, in deine Zeichnung bringen«, pflegte er zu sagen. »Sodass die Betrachter sie auch sehen, obwohl du gar keine Farbe benutzt.«
Damit Ester verstand, was er meinte, war er mit ihr in das Helios-Lichtspieltheater gegangen, das hinter der Goldene-Rosen-Synagoge neu eröffnet worden war und die Folgen von bewegten Bildern zeigte, die ›Films‹ genannt wurden. In einem dieser ›Films‹ trieb ein Boot voller Mädchen mit Blumen im Haar über einen See, und die Mädchen bewegten die Münder, als ob sie sangen. Während Ester zusah, wurde der See schillernd grün und begann, nach Fisch und modernden Pflanzen zu riechen, und das Lied, das die Mädchen sangen, handelte von der Liebe an einem Sommertag, die im Abendlicht schon vorüber war.
»Jetzt weißt du, was ich von dir will, nicht wahr?«, hatte Leo Ehrenpreis sie gefragt. »Ein Künstler muss das Unsichtbare sichtbar machen.«
Während sie mit der Mutter und Ziporah die leeren Straßen entlangging, versuchte Ester, sich allein auf das Flimmern des Staubs zu konzentrieren, auf die Frage, wie sie es in einer Zeichnung sichtbar machen könnte, obwohl sie keinen goldenen Stift besaß.
Ziporah hüpfte beim Gehen. Die kleinen Zöpfe an ihrem Hinterkopf hüpften mit, und das leise Schleifen ihrer Sohlen auf dem Pflaster war alles, was Ester hörte.
Die Stimme der Mutter unterbrach sie. »Das, was der Vater von deinen Leuten erzählt hat – das ist noch immer so, nicht wahr? Dass sie Geld haben und alles, was man sich wünschen kann, aber kein Kind, und dass sie darüber traurig sind?«
Ester nickte. »Für all unser Geld können wir uns nicht kaufen, was selbst der Ärmste hat: ein Kindchen«, hatte Rozia Ehrenpreis gesagt.
»Gut«, sagte die Mutter und ging schweigend weiter, hielt die hüpfende Ziporah an der Hand ganz fest. Es war ein weiter Weg, und Ester machte sich Sorgen, weil die Kleine viel zu warm eingepackt war. Hinter der Tempel-Synagoge wusste die Mutter den Weg nicht mehr, und Ester musste sie bis zum Haus der Ehrenpreis führen. Die Haustür war in einer Art Goldton gestrichen, und der Mutter würde gewiss auffallen, dass sich dahinter, am Pfosten, keine Mesusa befand. Auch kein Stück blankes Mauerwerk zum Gedenken an den Tempel in Jerusalem wie im Korridor ihrer eigenen Wohnung. Die Ehrenpreis waren nicht nur reformiert. Sie waren assimiliert. »Das bedeutet, dass wir an erster Stelle Lemberger sind und erst an zweiter Stelle Juden«, hatte Leo Ehrenpreis Ester erklärt.
Jetzt aber, wo die Juden fort sollten, zählte nicht mehr, ob jemand Jude an erster oder zweiter Stelle war, sondern nur noch, dass er es war.
Dvojre, das Hausmädchen, öffnete. »Ach«, sagte sie, als sie Ester erblickte. »Hast du dir jemanden mitgebracht?«
»Meine Mutter«, sagte Ester. »Und meine Schwester.« Sie wollte Ziporahs Namen nennen, hatte aber kaum das ›Zi-‹ ausgesprochen, als ihre Mutter ihr einen Finger auf den Mund legte.
»Ich bin mitgekommen, weil ich mit deiner Herrschaft sprechen muss«, sagte die Mutter.
Dvojre nickte. »Ich geb dem gnädigen Herrn Bescheid«, rief sie und lief die schmale Treppe hinauf in den ersten Stock, wo Leo Ehrenpreis sein Atelier hatte.
»Luzie«, sagte die Mutter leise und schirmte mit der Hand ihre Lippen. »Sie heißt Luzie. Merk es dir.«
»Aber …«, begann Ester. Dann schwieg sie. Wenn man von der Mutter etwas wissen wollte, tat man besser daran, zu warten, als zu fragen.
»Das ist ein Name, gegen den es nichts einzuwenden gibt«, erklärte die Mutter denn auch prompt. »Meine eigene Mutter hat Lucja geheißen. Aber er verrät nicht zu viel, klingt nicht nach Ostjuden, die im Westen jeder hasst und noch viel mehr hassen wird, je mehr der Krieg zu ihnen herüberspült.«
Ziporah, die jetzt Luzie hieß, hüpfte an ihrer Hand und sang dabei einen Abzählreim:
»Ziehet durch, ziehet durch,
durch die gold’ne Brücke.
Sie ist entzwei, sie ist entzwei,
wir woll’n sie wieder flicken.«
Das Gehüpfe und die monotonen Verse zerrten an Esters Nerven. Sie lobte sonst Ziporah für ihr Gedächtnis, mit dem sie sich all diese Reime einprägte, aber heute lag eine Spannung in der Luft, die sie nur schwer ertrug.
Herr Ehrenpreis kam die Treppe herunter. Er trug einen Kittel über einem braunen Anzug, obwohl er nur selten Materialien nutzte, die Flecken in die Kleidung machten.
»Frau Szpilman?«, fragte er auf seine vornehme, assimilierte Weise, sodass das »Szpil«wie »Spiel«klang. »Kommen Sie doch herein. Sie werden meinen Haushalt in Auflösung finden, die meisten Kisten sind schon gepackt. Aber deshalb brauchen Sie ja nicht auf der Straße zu stehen.«
Ziporah hörte auf zu hüpfen, blickte erwartungsvoll hoch und wollte den Fuß über die Schwelle setzen, doch die Mutter hielt sie zurück.
»Sie gehen nach Westen?«, fragte sie.
Leo Ehrenpreis nickte. »Mittwoch früh fährt der Zug. Kann ich zuvor noch etwas für Sie tun?«
Die Mutter schüttelte den Kopf. »Ich bin hier, um Ihnen etwas zu bringen. Eine Gabe. Eigentlich für Ihre Frau.«
»Für meine Frau?«
»Sie wünscht sich ein Kindchen, nicht wahr? Aber sie kann keines haben, sagt Ester. Wäre ein Mädchen ihr recht?« Sie ließ Ziporahs Hand los und schob sie Herrn Ehrenpreis entgegen. »Sie heißt Luzie. Ist vier Jahre alt, gelehrig und ganz gesund. Ich gebe sie Ihnen, damit Sie gut für sie sorgen und acht auf sie geben. Wenn Sie das tun, können Sie sie bei sich behalten. Für immer. Sie gehört Ihnen.«
Ester wollte protestieren, wollte Herrn Ehrenpreis zurufen, dass die Mutter nicht gemeint haben konnte, was sie gerade gesagt hatte, dass sie durcheinander war, weil sie sich Sorgen wegen der Russen machte, dass sie jetzt jedoch den Ehrenpreis eine gute Reise wünschen, sich verabschieden und zu dritt nach Hause gehen würden. Sie wollte Ziporah, die immer noch voll freudiger Neugier zu dem fremden Mann aufblickte, am Kragen ihrer kleinen, kornblumenblauen Strickjacke packen und aus dem Haus zerren, zurück zur Mutter und zu sich selbst.
Aber sie sagte das alles nicht. Sie tat auch sonst nichts, sondern stand stockstill, wie vor Schreck erstarrt.
»Gütiger Himmel«, sagte Leo Ehrenpreis. »Geht es Ihnen gut, erzählen Sie mir das in völligem Ernst?«
Die Mutter nickte.
»Wenn wir Ihnen Geld geben würden«, er legte den Kopf schräg, rieb sich die Augen und sah sie an. »Es würde nichts helfen, nicht wahr?«
»Es wäre ja nicht genug«, sagte die Mutter. »Ich habe zu meinen dreien noch die zwei von meinem Schwager, der nichts mehr sehen kann und dem die Frau gestorben ist. Sie sind alle alt genug, auf sich zu achten, vielleicht haben wir Glück und bringen uns durch, wohin sie uns auch verschleppen. Aber die Kleine – niemals.«
Sehr langsam wiegte Herr Ehrenpreis den Kopf, ehe er sich niederbeugte und Ziporah – Luzie – seine großen Hände auf die Schultern legte. »Wenn Sie es so wünschen«, sagte er.
»Ja, ich wünsche es«, sagte die Mutter. »Und Ester und ich werden jetzt gehen, ohne alles noch schwerer zu machen.«
»Wir müssen doch reden«, sagte Herr Ehrenpreis. Behutsam drehte er Ziporahs kleinen Körper herum und schob sie tiefer in die Wohnung. »Geh zur Lisbeth in die Küche, Luzie, lass dir ein Stück Mandelkuchen geben.«
Begeistert hüpfte Luzie davon, sang mit jedem Hüpfer, jedem Schwung ihrer kleinen Zöpfe ihren Abzählreim:
»Mit was denn? Mit was denn?
Mit Steinerlein, mit Beinerlein.
Der erste kommt, der zweite kommt,
der dritte muss gefangen sein.«
Herr Ehrenpreis sah wieder die Mutter an, doch die schüttelte den Kopf.
»Alles Gute für Ihre Familie«, sagte sie und gab Herrn Ehrenpreis eine kleine Mappe, in der sie sonst Familienpapiere aufbewahrte. »Hier. Darin ist alles, was Sie für sie brauchen.« Dann packte sie Ester so fest am Arm, dass es wehtat, fuhr herum und ging mit ihr die Straße hinunter, durch die sie gekommen waren. Ester sah das Gold des Staubs, der über der Straße flimmerte, und dachte an Luzies haselnussbraunes Haar und an die Farben von Stiften, die sie nicht besaß.
»Dreh dich nicht um«, sagte die Mutter und zog sie schneller voran. Ihre Stimme klang spröde, und ihre Augen sahen so trocken aus, als ob sie brannten. Aus einer Seitenstraße kam im müden Gleichschritt ein Trupp russischer Soldaten, die sich nicht um sie scherten. »Dreh dich nicht um und bleib nicht stehen«, sagte die Mutter.
»Aber wir haben ihr nicht Lebewohl gesagt«, brach es aus Ester heraus, und es klang, als wäre in den Worten kein Inhalt.
»Es ist besser so«, sagte die Mutter und zog sie weiter. »Sie soll guten Mutes sein, verstehst du?«
Ester konnte nur nicken.
»Jetzt komm.« Die Mutter fiel in Laufschritt. »Falls wir getrennt werden, jetzt oder irgendwann – nimm mein Lebwohl und meine guten Wünsche mit dir und sag keinem Menschen, dass dein Name Ester ist. Alles, nur nicht Ester.«
Erste Nummer,
in der Clowns auftreten, die aber nicht komisch sind
Berlin
30. Januar 1933
2
Nina
Nina und Jenny gingen einkaufen.
»Lass den schönen Anton sich heute mal alleine amüsieren«, hatte Jenny gesagt. »Wenn einem etwas bleischwer im Magen liegt, wenn Essen nicht hilft und es zum Trinken zu früh ist, gibt es nichts Besseres, als sich ins nächste Kaufhaus zu flüchten und nach Strich und Faden Geld zu verschleudern.«
Nina hatte sich nicht lange bitten lassen. Zwar hatte sie sich flüchtig gewundert, weil es für Jenny zum Trinken eigentlich nie zu früh war, und ihr war auch nichts eingefallen, was sie brauchen konnte, aber darum ging es bei so einem Einkaufsbummel ja auch nicht. Für Nina gab es nichts Besseres, als mit Jenny zusammen zu sein, wenn ihr etwas im Magen, auf der Seele oder wo auch immer lag. Und seit sie im vergangenen Jahr hatte fürchten müssen, sie wäre dazu verdammt, sich künftig ohne Jenny durchs Leben zu lavieren, galt das umso mehr.
Sie hatten einen ihrer seltenen freien Tage, es war so kalt, dass man sich auf der Straße nicht länger als fünf Minuten aufhalten mochte, aber wenn sie dafür eine doppelte oder sogar dreifache Tagesdosis Jenny bekam, sollte Nina ein Einkaufsbummel recht sein. Sie holte die Freundin in ihrer Wohnung in der Mariannenstraße ab, die beiden hakten sich unter und stiefelten los. Ninas Atemwolke vereinte sich mit den Schwaden von Jennys Zigarette, Jenny trug eine Mütze mit wippender Bommel, die Tante Sperling gestrickt haben musste, und die Welt sah auf einen Schlag nicht mehr so grau aus, wie sie es an diesem Montag im Januar war.
»Erzählst du mir, was dir im Magen liegt?«, fragte Nina, während sie die lange Oranienstraße hinunterstapften.
»Lieber nicht«, antwortete Jenny. »Ist zu unappetitlich. Versaut mir die Lust, Geld zum Fenster rauszuschmeißen.«
»Ganz unvernünftig wäre das nicht«, sagte Nina. »Immerhin stecken wir mitten in einer weltweiten Wirtschaftskrise.«
»Für so was habe ich meine Agentin«, erwiderte Jenny unbekümmert. »Und Wirtschaftskrisen müssen auf ewig Wirtschaftskrisen bleiben, wenn niemand mehr was kauft, oder nicht?«
»Deine Agentin will ja nur verhindern, dass dem Kaufrausch ein Kater folgt«, sagte Nina. Die Agentin war sie selbst. Um sicherzustellen, dass Jenny und die übrigen Mitglieder ihres Wunderweiber-Ensemblesselbst in haarigen Zeiten nicht ohne Engagement dastanden, verbog sie sich manchmal kaum weniger als Jenny bei ihrer Vorführung. Jenny konnte nicht mit Geld umgehen, es wurde in ihren Händen glitschiger als Seife. In all den Jahren ihrer Zusammenarbeit hatte Nina dazu höchstens mit den Schultern gezuckt. Jenny, die Schlangenfrau, und Sonia, die Schnellmalerin, waren ihre Stars, um derentwillen die Veranstalter ihr die Türen einrannten. Eine Zeit, die es an Haarigkeit mit der jetzigen aufnehmen konnte, hatten sie allerdings nie erlebt. Viele Theaterleiter bekamen ihre Säle nicht mehr voll, wer irgendwie konnte, sparte an den Gagen der Künstler, und obendrein wurden sie alle nicht jünger.
Nina konnte nicht verhehlen, dass es ihr lieb gewesen wäre, hätte Jenny über eine finanzielle Rücklage, eine Sicherheit für den Notfall verfügt, zumal sie nicht nur für sich selbst, sondern vor allem für ihr Sammelsurium von Familie zu sorgen hatte. Viktor, Jennys Sohn und für Nina der Ersatz für das Kind, das sie und Anton nicht hatten bekommen dürfen, war erst dreizehn und so klug, dass er eines Tages sicher studieren würde. Hinzu kamen Darius, der gute Geist ihres Lebens, und seine alternde Katze, die zu Jenny gehörten, solange Nina sie kannte. Eine Sicherheit gab es zwar im Leben ihrer Freundin: einen Mann, der sie über alles liebte und sich nichts mehr wünschte, als ihr und den Ihren ein schützendes Heim zu bieten. Jenny aber war ein wilder Vogel, der zuweilen schon die Zärtlichkeit einer Umarmung als Käfig empfand.
Da es sich bei dem Mann um Ninas Bruder Carlo handelte, hatte sie jedes Auf und Ab der stürmischen Beziehung miterlebt. Es blieb dabei, sosehr die beiden zweifellos aneinander hingen: Carlo war der Erbe des Familienguts in der Uckermark, und Jenny konnte nirgendwo leben als in Berlin. Sie würde auch weiterhin ein eigenes Einkommen brauchen.
Nicht jetzt daran denken, gebot sich Nina, sonst nützt die ganze Geldverschwendung nichts. Sie waren Gauklerinnen, Lebenskünstlerinnen, wurden dafür bezahlt, dass sie ihre Zuschauer für kurze Zeit ihren Alltag vergessen machten. Wenn sie dazu selbst nicht mehr in der Lage waren – mit welchen Kräften sollten sie andere verzaubern?
Die sich verdichtenden Menschenströme verrieten, dass sie ihr Ziel so gut wie erreicht hatten. Jenny liebte das Warenhaus Tietz in der Leipziger Straße mit seiner vier Stockwerke hohen verglasten Front, der ebenfalls verglasten Kuppel samt dem weithin sichtbaren Globus, den Sonderangeboten in der Wäscheabteilung und den vornehm ausstaffierten Damen, die zu reißenden Tieren wurden, sobald sie sich auf die Tische mit preisreduzierter Ware stürzten. »Hinterher gebe ich dir den gigantischsten Cocktail aus, den sie auf der Dachterrasse servieren«, versprach Jenny, während sie sich mit etlichen anderen Kauflustigen an den livrierten Portiers vorbei in das Gebäude zwängten. »In längstens einer Stunde bin ich sowieso pleite, dann bist du erlöst.«
Nina grinste. »Vergiss nicht, vor der Pleite Geld für meinen Gigantencocktail abzuzweigen.«
Jenny stürzte sich todesmutig ins Gewimmel, und Nina zockelte hinterher und begnügte sich damit, den Ansturm zu beobachten. Berlin war ihre Heimat, sie war mit kaum zwanzig in die Hauptstadt gekommen und hatte es keinen Tag lang bereut. Dennoch erinnerten sie Situationen wie diese von Zeit zu Zeit daran, dass sie im Gegensatz zu Jenny ein waschechtes Landei war.
Das Kaufhaus hatte sich verändert, seit sie zum letzten Mal hier gewesen war. Damals hatte sie voller Stolz und Vorfreude winzige Hemdchen, Hauben und Wickeltücher für ihr Kind ausgewählt, das nicht lebend zur Welt gekommen war.
Das Rudolf Kante ermordet hatte, flammte es in ihrem Kopf auf wie ein abrupt eingeschalteter Scheinwerfer.
Nina drängte den Gedanken beiseite. Was Kante getan hatte, würde sich vor keinem Gericht auf der Welt beweisen lassen, und jedes Nachsinnen über Racheakte war vergeudete Kraft. Ihr Kind kam nicht zurück. Nicht einmal, wenn sie Rudolf Kante tötete.
Sie zwang sich, zu ihren Beobachtungen zurückzukehren. Die Stimmung, die zwischen den vergoldeten Säulen, den mit Luxusgütern beladenen Ständern und Tischen herrschte, war ihr damals gelassener, freundlicher, weniger aggressiv vorgekommen als heute. Aber vielleicht bildete sie sich das auch nur ein, weil die ganze Welt ihr in jener Zeit freundlicher und weniger erfüllt von unterschwelliger Bedrohung erschienen war.
Gewisse Dinge bildete sie sich jedoch nicht ein, sondern sah sie vor ihren Augen: Früher war das Erstaunlichste bei Tietz die bunte Mischung von Kunden gewesen. Da gab es Arbeiterfrauen, die nicht nur sich selbst, sondern ihren sämtlichen Nachbarinnen Ausschussware sicherten, und daneben Unternehmergattinnen, die sich ein halbes Dutzend Schachteln mit Einkäufen von Dienstmädchen hinterhertragen ließen. Es gab den schüchternen, ein wenig abgerissenen Künstler, der zur Geburt seines Kindes sein Honorar für eine riesige Steiff-Giraffe ausgab, und den Bankier, der ein Geschenk zum Hochzeitstag suchte und drei Ladenmädchen Pelzkrawatten anprobieren ließ. Es gab Männer, die verzückter als ihre Söhne mit der elektrischen Eisenbahn spielten, und emsige Hausfrauen, die jedes Stück Stoff auf seine Waschbarkeit prüften.
Das alles hatte mehr oder weniger unbeschwert nebeneinander existiert. Man mochte die Nase rümpfen, aber man hackte einander kein Auge aus. Heute hingegen schienen sich selbst diejenigen mit gehässigen, neiderfüllten Blicken zu verfolgen, die demselben Stall entstammten. Die Arbeiterinnen und Kleinbürgerinnen waren nirgendwo mehr zu entdecken. Sie waren froh, wenn sie das Geld zusammenkratzen konnten, um Brot auf den Tisch zu stellen und in den eisigen Nächten den Ofen zu befeuern. Von vielen der Toten, die man im Morgengrauen fand, ließ sich nicht sagen, ob sie an der grassierenden Grippe gestorben oder einfach erfroren waren. Einen Kaufhausbesuch gab es für diese Menschen nicht einmal mehr in ihren Träumen.
Nina erlebte das Gleiche im Wintergarten, dem berühmten Varieté in der Friedrichstraße, in dem ihr Ensemble zu Hause war. Früher waren die Stehplätze im Entree Abend für Abend ausverkauft gewesen. Arbeiter, Handwerker, kleine Beamte und Ladeninhaber hatten sich dort samt ihren Frauen gedrängt, angetan mit ihren Sonntagskleidern und johlend vor Begeisterung. Inzwischen aber waren unzählige von ihnen arbeitslos, und von den paar Pfennigen, die die Sozialversicherung auszahlte, ließen sich ganz gewiss keine zwei Mark für Vergnügungen abzweigen.
Dabei brauchten die Menschen Vergnügungen mehr denn je. Sich ein paar Stunden in einer Glitzerwelt unter künstlichem Sternenhimmel verzaubern lassen, in der alles Bedeutung, aber nichts Gewicht hatte, nichts metallene Härte, aber alles Glanz. Nina sah den Einkaufenden zu, die ergatterte Schätze wie Flaggen in die Höhe hielten, und ihre Gedanken verloren sich.
Sie war recht sicher, zu wissen, was Jenny im Magen lag: die politische Entwicklung. Nach den Wahlen Anfang November hatte es keine regierungsfähige Mehrheit gegeben. Der als Notbehelf erneut aufgestellte Kanzler Papen hatte sich kaum vier Wochen lang halten können, und der Nachfolger, Schleicher, war vor zwei Tagen ebenfalls zurückgetreten. Wer immer als Nächster von Reichspräsident Hindenburg ernannt werden würde, würde sich auf dem Schleudersitz vermutlich auch nicht länger halten können, und die beständige Instabilität war nicht dazu angetan, die Lage zu verbessern.
Und dabei schrie das ganze Land geradezu nach einer Verbesserung der Lebensumstände und konnte unmöglich noch länger darauf warten.
Sechs Millionen Menschen waren in Deutschland ohne Arbeit. Was sie nötig hatten, war ein Hoffnungsschimmer, ein Rettungsseil, um sich daran festzuhalten. Im Herbst hatten Nina und ihre Freunde geglaubt, dieses rettende Seil sei zum Greifen nah. Neue Zahlen aus der Wirtschaft kündeten zaghaft von einer Erholung, und bei den Wahlen hatte Hitlers Nazi-Partei zwei Millionen Stimmen verloren. Die Republik schien sich von den Verletzungen aus ihrem härtesten Kampf zu erholen, wie sie sich nach der Inflation allen düsteren Prognosen zum Trotz wieder erholt hatte.
Jetzt aber schien diese noch viel zu zarte Hoffnung von Winterstürmen gebeutelt zu schwanken. Wenn es Neuwahlen gab, weil sich einfach kein Kandidat für das Kanzleramt mehr finden ließ – würde sich der Niedergang der Nazis fortsetzen und würde endlich wieder eine tragfähige Regierung gebildet werden, die das Land, in dem es überall brannte, in den Griff bekam?
Nina und ihre Freunde waren Künstlerinnen. Bohemiens. Scherten sich für gewöhnlich nicht viel um Politik. Aber sie waren auch Kinder, die einen Krieg erlebt und dabei den Boden unter den Füßen verloren hatten. Im Blut saß ihnen die Erinnerung an die verheerende Katastrophe, die Politik aus dem Leben von Menschen zu machen vermochte.
Bereits seit Längerem bekam Nina auf bedrohliche Weise zu spüren, dass sich einflussreiche Anhänger der Rechtsparteien an allen Schaltstellen des Kulturlebens eingenistet hatten. Die grellbunte, unzensierte Wildheit ihrer Darbietungen, die die Berliner in den Zwanzigerjahren bejubelt hatten, wurde zunehmend beschnitten, bereinigt und eingeschränkt. Für Künstler wie Darius, die nicht nur mit ihrem Programm, sondern auch mit ihrem Lebensstil aus dem Rahmen fielen, fand Nina kaum noch Engagements. Sonia, neben Jenny ihre engste Freundin, die als Schnellzeichnerin die Hauptstadt erobert hatte, lebte in ständiger Angst vor Nazi-Schlägern. Früher wäre sie bei einem Bummel wie diesem selbstverständlich dabei gewesen. Jetzt aber waren die drei Grazien meist lediglich zu zweit, denn Sonia wagte sich nur noch aus dem Haus, wenn es sich nicht umgehen ließ.
Nina wollte trotz allem nicht den Teufel an die Wand malen und sich vor allem nicht den schönen Tag verderben lassen. Wer auch immer zum nächsten Reichskanzler ernannt werden würde, würde sich genauso bewähren oder seinen Hut nehmen müssen wie die anderen vor ihm. Das war der Clou an der Demokratie, die schließlich Volksherrschaft bedeutete: Wer es sich mit dem Volk verdarb, den schickte das Volk in die Wüste.
In Jennys Gefolge schlenderte Nina von Abteilung zu Abteilung, bis die Freundin schließlich mit einer Vielzahl elegant bedruckter Tüten und Schachteln aus dem Menschenmoloch wieder auftauchte.
»Teufel noch mal.« Jenny war außer Atem. »Das war heute keine Jagd auf Schnäppchen, das war eine ausgewachsene Schlacht.«
Nina lachte, auch wenn sie spürte, dass die Stimmung nicht so unbeschwert war, wie Jennys Tonfall vorgab. »Was musstest du dir denn so dringend unter den Nagel reißen, dass es eine Schlacht wert war?«
»Im Ernst«, erwiderte Jenny. »Ich habe auf den Moment gewartet, in dem diese Vertreterinnen des Berliner Großbürgertums sich die Klunker vom Hals reißen und sich gegenseitig die Goldkronen ausschlagen.«
»Wegen ein paar verbilligter Miederhemdchen?«
Jenny schüttelte den Kopf und zog Nina zur Rolltreppe. »Machen wir, dass wir nach oben kommen. Ich bin reif für einen mindestens doppelten Manhattan.«
Auf den fahrenden Stufen in die Höhe zu gleiten, war für Nina, die selten in Kaufhäuser ging, noch immer ein Erlebnis. Durch die Glasfront sah sie hinaus auf das Treiben in der Einkaufsstraße, auf Limousinen, die wohlfrisierte Damen in Pelzmänteln entließen, und auf Bettler mit umgehängten Schildern. Alles schien wie immer in ihrem Berlin, ein ganz gewöhnlicher Montag im Winter, und doch war etwas anders.
Etwas war schon anders gewesen, als sie heute Morgen das Haus verlassen hatte, eine bange Erwartung lag in der Luft und ließ sich weder erklären noch beiseitewischen.
»Hier«, sagte Jenny, als sie das Dachgeschoss mit dem überkuppelten Restaurant erreicht hatten, und hielt Nina eine silberfarbene Tüte hin. »Für eure Selma. Sie war neulich ganz hin und weg von meinem roten Fetzen und fand ihn so hübsch zu meinem schwarzen Haar. Zu ihrem eigenen passt er dann ja wohl auch.«
Nina blickte in die Tüte und fand einen voluminösen Seidenschal in changierenden Rottönen. Es war ein prachtvolles Stück, das ein Vermögen gekostet haben musste. Viel zu elegant und auffallend für ein Kind von gerade zehn. »So etwas Teures?«, murmelte sie. »Ich bin mir nicht sicher, ob sie das zu schätzen weiß.«
»Dann wird es höchste Zeit, dass ihr es ihr beibringt«, erwiderte Jenny. »Die guten Dinge im Leben muss man beim Schopf packen und genießen, denn von den miesen bekommt man sowieso genug auf den Teller geladen.«
»Danke, Jenny«, sagte Nina seltsam zögerlich. Es kam ihr noch immer merkwürdig vor, für das Mädchen, das in ihrer Wohnung lebte, Geschenke entgegenzunehmen und darüber zu debattieren, was ihm beizubringen war und was nicht. Noch merkwürdiger war es, zu hören, wie ihre Freundin das Mädchen ›eure Selma‹ nannte.
Sie war nicht Ninas Selma. Sie war ein sehr gut aussehendes, sehr höfliches und umgängliches Mädchen, das sich alle Mühe gab, Nina nicht zur Last zu fallen, aber sie war nicht ihr Kind. Nur das von Anton. Und das war die Crux.
Aber in diesem Augenblick, in dem sie in das mattgoldene Licht des Dachrestaurants traten, in das verschwenderisch luxuriöse Ambiente eintauchten und sich vom wie absichtslosen Perlen des Klavierspiels umfangen ließen, wollte sie nicht darüber nachdenken.
Sie wollte über gar nichts nachdenken, was diese kleine idyllische Nische in der Zeit hätte stören können.
»Da vorn«, rief Jenny resolut und wies auf einen der begehrten Fenstertische für zwei Personen, der gerade frei geworden war und von einer der Kellnerinnen umgehend frisch eingedeckt wurde. »Den nehmen wir.«
Dass zwei ältere Damen, die weitaus länger gewartet hatten, ebenfalls auf den Tisch zustrebten, kümmerte sie nicht. Solche Dinge kümmerten Jenny Alomis grundsätzlich nicht. Sie hatte das größte Herz, das Nina je bei einem Menschen erlebt hatte, und hätte sich für ihre Freunde Beine und Arme ausgerissen, aber sie nahm sich, was sie haben wollte, ohne einen Gedanken darauf zu verschwenden.
Es war ein Überbleibsel aus jener Zeit nach dem Krieg, in der sie und ihr Sohn gar nichts gehabt hatten, nicht einmal ein Dach über dem Kopf, sondern von dem hatten überleben müssen, was Jenny auf welchen Wegen auch immer an sich brachte.
Wir sind alle wandelnde Überbleibsel aus jener Zeit, dachte Nina, auch wenn sie selbst im Vergleich dazu gelebt hatte wie die Made im Speck. Ihre Wunden hatten sie alle davongetragen.
Nina folgte Jenny, die bereits bei der Kellnerin ihre Getränke bestellte, an den Tisch und sah hinaus auf die Stadt, auf Gebäude und Menschen, die sich tief unter ihr bewegten. Alles schien wie von einer Eisschicht umgeben zu glitzern.
Ich wünsche mir, dass wir alle noch heil sind, wenn es im Frühling taut, dachte sie und wunderte sich über sich selbst.
3
Jenny
Nina starrte schon aus dem Fenster, seit sie Platz genommen hatten, und schien ebenso tief in Gedanken versunken wie Jenny. Statt der Kellnerin, bei der sie bestellt hatte, erschien ein schlanker, in einen Frack gewandeter Kellner mit ihren Getränken. Sorgfältig breitete er vor jeder von ihnen ein blütenförmiges Platzdeckchen aus und legte einen langstieligen Löffel daneben, falls Jenny oder Nina ihre Cocktails umrühren wollten. Zuletzt stellte er die Gläser vor sie hin – das hohe mit dem gezuckerten Rand vor Nina und den mit einer Maraschino-Kirsche garnierten Shortdrink-Kelch vor Jenny, die froh war, dass Nina ihre Bestellung nicht mitangehört hatte.
»Verzeihen Sie«, sagte der Kellner schüchtern. »Sind Sie nicht Jenny Alomis? Die Schlangenfrau?«
»Ich fürchte, Leugnen wäre sinnlos«, antwortete Jenny.
»Ich gehöre zu Ihren Bewunderern.« Der Mann suchte Jennys Blick und faltete allen Ernstes die Hände vor der Brust. »Ich habe Sie so sehr vermisst, und umso glücklicher bin ich, dass Sie wieder auftreten.«
Und ich erst, dachte Jenny. Vor allem wäre ich glücklich, wenn ich wüsste, dass es dabei bleibt.
»Dürfte ich Ihnen noch einen Augenblick länger zur Last fallen und um ein Autogramm bitten?« Aus seiner Brusttasche holte der Kellner einen winzigen Block. »Wenn der Oberkellner erfährt, was ich hier treibe, kann ich mich als gefeuert betrachten. Schließlich gibt es Unzählige, die sich um eine solche Stellung reißen. Aber bei Ihnen muss ich einfach …«
»Schon gut. Er erfährt es ja nicht.« Jenny nahm ihm den Block weg und kramte in ihrer Tasche nach einem Bleistift. Einen Füllfederhalter besaß sie nicht. Wozu auch? Sie war nicht die Frau, die an zierlichen Sekretären erbauliche Briefe abfasste, und hatte auch nicht vor, ihre Memoiren zu schreiben. »Wie heißen Sie?«, fragte sie den Kellner.
»Joseph Jonas.« Regelrecht verklärt sah er ihr zu, während sie, ohne den Blick zu senken, »Für den reizenden Herrn Jonas. Herzlichst Ihre Jenny Alomis, die Schlange vom Wintergarten«auf das kleine Stück Papier kritzelte.
Sie gab ihm den Block zurück.
»Haben Sie tausend Dank«, sagte er. »Ich werde mich nie davon trennen, werde verfügen, dass dieses kostbare Dokument mit mir in den Sarg gelegt wird.«
Jennys Schätzung nach konnte er nicht älter als dreißig sein und wirkte auch nicht, als litte er an einer Krankheit, die die Beschäftigung mit Särgen nahelegte. Aber man wusste ja nie, und er war offenbar einer, der vorsorgte.
»Nun lasse ich den Damen aber endgültig Ihren Frieden«, versprach er strahlend.
»Seien Sie so nett«, sagte Jenny. »Selbst bei acht Grad unter null will man seinen Cocktail ja nur ungern zum Grog werden lassen.«
»Natürlich nicht.« Unter Verbeugungen bewegte der Mann sich rückwärts und verschwand aus Jennys Blickfeld. »Auf Ihr Wohl, Fräulein von Veltheim«, sagte sie und hob ihr Glas. »Auch wenn Sie nicht den Eindruck erwecken, als wären Sie tatsächlich anwesend.«
»Oh. Entschuldige.« Nina griff nach ihrem Mojito, und eine Woge von Neid packte Jenny. »Ich weiß auch nicht, was mir heute für krauses Zeug im Kopf herumwabert.«
»Weshalb sollte es dir besser ergehen als mir?«, fragte Jenny, nippte an ihrem Drink und hätte um ein Haar ins Glas gespuckt, weil der Geschmack eine solche Enttäuschung war.
»Warum geht’s dir nicht gut, Jenny?«, fragte Nina. »Vielleicht wäre mir ja schon wohler, wenn ich wüsste, was mit dir los ist.«
Jenny zuckte mit den Schultern. »Es ist nichts.« Das war schon keine Lüge mehr, sondern ein ausgewachsenes Täuschungsmanöver. Warum rückte sie nicht mit der Sprache heraus? Sie hatte diese Einkaufsorgie nicht inszeniert, um Geld, das sie nicht hatte, für Kinkerlitzchen, die sie nicht brauchte, zu verplempern, sondern um mit Nina zu reden. Wenn sie es nicht tat, die Freundin nicht um Rat bat, wenn sie, wie es ihre gottverdammte Art war, das Problem verschob, bis es sich nicht mehr lösen ließ – was stellte sie sich für ihre Zukunft vor?
Der Gedanke schnürte ihr die Kehle zu, und automatisch griff sie nach ihrem Drink. Der ihr nicht helfen würde. Nicht einmal für die nächste halbe Stunde. Sie musste den Mund aufmachen. Wäre Nina nur Nina gewesen, die beste Freundin, die ein Straßenköter wie sie sich wünschen konnte, wäre es ihr leichter gefallen. Aber Nina war eben auch die Schwester von Carlo, dem Mann, den Jenny trotz aller Auflehnung dagegen nicht aufhören konnte zu lieben, und das machte die Sache heikel.
»Du läufst uns aber nicht wieder davon, oder?« Nina zog die Brauen über der Nasenwurzel zusammen. »Dass mit dir etwas nicht in Ordnung ist, sieht auch ein Blinder, Jenny, und ich möchte nicht noch einmal vor deiner Tür stehen und feststellen, dass der Vogel ausgeflogen ist. Ich werfe dir nicht vor, dass du dich vor einem Jahr so entschieden hast. Du hattest Angst, dein Kind zu verlieren, und ich bilde mir ein, von dem Thema etwas zu verstehen. Aber dass du mir nichts davon gesagt hast, das werfe ich dir vor. Und falls du auch nur in Erwägung ziehst, uns solch einen Schlag noch einmal zu versetzen, wäre ich dir ernsthaft böse.«
»Keine Sorge«, erwiderte Jenny prompt. »Ich bleibe hier, mich werdet ihr nicht noch mal los.«
Wenn sie eines zu wissen glaubte, dann das. In die Stadt zurückzukehren, die einst ihre Heimat gewesen war, hatte ihr in überscharfer Klarheit gezeigt, dass es diese Heimat nicht mehr gab. Dass es die junge Frau, die in dieser Stadt gelebt hatte, nicht mehr gab. Für die Frau, die aus ihr geworden war, existierte nur eine Stadt, in die sie gehörte, und die hieß Berlin. Das Berlin, das sie mit Nina, Sonia und all ihren Freunden teilte, das Berlin, in dem es den Wintergarten, ihre Stammkneipe Salamander und mehr Bars als Gemüseläden gab und immer geben würde. Das Berlin, das sie selbst sich geschaffen hatten und das sie wie ihren Augapfel hüten würden, was immer die Wichtigtuer in der Reichskanzlei sich auch einfallen ließen.
»Gut so«, sagte Nina. »Das wollte ich hören.« Sie ließ ihr Glas gegen das von Jenny klirren. »Du trinkst heute so langsam. Normalerweise hättest du spätestens jetzt dem dich anbetenden Herrn Jonas gewinkt und Nachschub bestellt.«
Bloß das nicht, dachte Jenny, griff nach ihrem Glas und nippte an dem klebrigen Zeug. »Ich weiß auch nicht«, sagte sie. »Ich glaube, das Schlachtgetümmel da unten ist mir auf den Magen geschlagen.«
Das war zumindest nicht gelogen. Nur hätte es für gewöhnlich dazu geführt, dass sie mehr trank, nicht weniger.
»Erzähl«, sagte Nina nur.
Jenny hatte das Thema kurz abhandeln wollen, doch es sprudelte nur so aus ihr heraus: »Eines von diesen Weibchen, die aussehen, als hätte ihr Bankiersgatte sie sich nur angeschafft, um sie wie einen Christbaum mit Klunkern zu behängen, hat einer anderen, die genauso dekoriert war, eine Pelerine aus der Hand gerissen und sie ihr anschließend links und rechts ins Gesicht geklatscht. ›Das ist deutsche Wertarbeit‹, hat sie gekeift. ›Das fasst eine wie Sie mit Ihren dreckigen Judenfingern in Zukunft nicht mehr an.‹«
»Ist das dein Ernst?« Ninas Augen weiteten sich. »Und vom Personal hat niemand eingegriffen? Aber Tietz, dem der ganze Laden hier gehört, ist doch selbst Jude.«
»Eingegriffen habe nur ich«, sagte Jenny. Und beileibe nicht so schnell, wie es sich gehört hätte, fügte sie in Gedanken hinzu. Sie war immer überzeugt gewesen, vor Pack wie dieser Frau keine Angst zu haben, hatte sich nie von solchen Leuten einschüchtern lassen. Als sie aber dort im Gedränge gestanden und die Frau gefragt hatte, was sie sich einbilde, war es ihr auf einmal vorgekommen, als wären sämtliche Blicke voll Feindseligkeit auf sie gerichtet, und sie hatte sich schwach und verwundbar gefühlt.
»Versteh mich nicht falsch«, fuhr sie fort, ehe Nina zu Wort kam. »Ich weiß, dass die Idioten nicht aussterben und dass man ihnen einen Gefallen tut, wenn man sie allzu ernst nimmt. Aber das hier – das war so geballt. So als stünden auf einmal die ganzen bislang harmlosen Weiber mit ihren Einkaufstaschen auf der Seite dieser ekelhaften Person. Ich konnte plötzlich Sonia und ihre dauernde Angst verstehen.«
»Ich auch«, sagte Nina. »Ich würde gern weiter auf sie einreden, dass sie sich all die Gefahren nur einbildet, aber nach dem, was du erlebt hast, bin ich nicht mehr so sicher.«
»Wir haben den verdammten Nazis und Konsorten viel zu lange erlaubt, ihren Hass und ihre Hetze zu verbreiten«, sagte Jenny. »Ich weiß, Sonia geht sowieso nicht in Warenhäuser, aber das Gleiche könnte ihr womöglich auch beim Kolonialwarenhändler an der Ecke passieren. Zum ersten Mal bin ich froh darüber, dass Friedhelm mit ihr überallhin trottet und wie ein Schießhund auf sie aufpasst.«
Friedhelm war der sonderbare kleine Mann, der mit Sonia zusammenlebte. Niemand wusste genau, woher er gekommen war und womit er sein Geld verdient hatte, ehe er Pandora, die tanzende Ente, dressierte, um mit ihr aufzutreten. Er hatte erklärt, er sei ein Dichter, ein Vertreter der brotlosen Kunst gewesen, aber niemand hatte je eine Zeile von ihm gelesen. Dass Friedhelm sich dennoch in die Herzen des Freundeskreises gestohlen hatte, lag daran, dass er Sonia sichtlich über alles liebte. Er begleitete sie auf Schritt und Schritt, schirmte sie vor pöbelnden Nazis ab und verdeckte judenfeindliche Wandschmierereien mit seinem schmächtigen Körper. Tatsächlich schien er sie durch die Straßen der Stadt zu führen wie eine Blinde durch einen Hindernisparcours, und endlich glaubte Jenny, seine Gründe zu verstehen.
»Friedhelm ist in Leipzig«, sagte Nina.
»In Leipzig? Ohne Sonia? Und das ausgerechnet jetzt, wo in ein paar Wochen ihr Kleining kommen soll?«
»Wegen des Kleinen ist er vor allem gefahren«, entgegnete Nina. »Er will unbedingt Geld für seine Familie verdienen, bewirbt sich an mehreren Theatern um ein Engagement, aber viel Hoffnung macht er sich nicht. Wer Pandora nicht gesehen hat, hat keine Vorstellung von ihrem Zauber, meint er. Und Pandora hat er nicht mitnehmen können. Pandora reist nicht gern.«
»Dann hast du nichts für ihn tun können?«, fragte Jenny.
Bedrückt schüttelte Nina den Kopf. »Aschinger lässt darüber nicht mit sich reden. Er will in unserer Nummer keinen Mann mehr, weder Darius noch Friedhelm. Und er verlangt ein paar jüngere Mädchen. Ich weiß, ich müsste ihm sagen, er soll sich zum Teufel scheren, und ich habe ihm das auch mehr als einmal gesagt. Aber unser Ensemble hat nicht mehr den früheren Marktwert, so schwer es mir fällt, das einzugestehen. Wenn wir den Wintergarten verlieren, wohin gehen wir dann? Du bist bald ein Jahr lang nicht aufgetreten. Dass du aus der Übung bist und dich erst wieder einfinden musst, weißt du selbst.«
Nicht nur das, dachte Jenny. Sie war aus der Übung, hatte elf Monate lang nicht trainiert, was bei einer Kontorsionistin einem beruflichen Selbstmord gleichkam. Obendrein kämpfte sie mit einer nie kurierten Rückenverletzung und wurde schlichtweg alt.
So wie sie alle.
Eine Artistin, die die dreißig überschritten hatte, gehörte in die Kategorie Schnee von gestern, daran ließ sich nicht rütteln. Aschinger, der Restauranterbe, der den Wintergarten aufgekauft hatte und aus nichts als Geldgier bestand, verlangte bereits nach einer neuen Generation Wunderweiber. Nach Frischfleisch, mit dem man die schwindenden Zuschauer zurück unter den Sternenhimmel des Varietés locken konnte. Rudi Kante, Aschingers teuflischer Spießgeselle, der im Admiralspalast eine Erfolgsrevue nach der anderen inszenierte, schickte seine Tänzerinnen angeblich nur noch in Trikots auf die Bühne, die ihnen zwei Nummern zu klein waren.
»Und Sonia tritt nirgendwo anders auf, das weißt du auch«, sagte Nina. »Sie braucht ein Einkommen. Das, was wir ihr für unsere Bühnenbilder zahlen, wird nicht genügen, wenn sie bald ebenso wie du für ein Kind zu sorgen hat. Also kann ich es mir nicht länger leisten, Aschinger zu verprellen. Friedhelm hat mich persönlich noch einmal angefleht, auf ihn keine Rücksicht zu nehmen.«
»Und wenn er in Leipzig etwas bekommt, pendelt er dann allwöchentlich hin und her?«, fragte Jenny. »Und in der Zwischenzeit bleibt Sonia mit dem Kind hier allein?«
»Mit dem Kind werden wir alle ihr helfen«, sagte Nina. »Darin haben wir schließlich Übung.«
Die hatten sie in der Tat. Sie alle hatten Jenny geholfen, Viktor die Familie, die er nicht hatte, zu ersetzen, ihn zu verwöhnen, mit Liebe zu überschütten und zu einem wundervollen Menschen zu erziehen. Wobei keiner von ihnen viel erzogen hatte und Viktor vermutlich auch von allein ein wundervoller Mensch geworden wäre, einfach weil er als solcher zur Welt gekommen war.
Der verzückte Kellner trat an ihren Tisch und erkundigte sich, ob sie noch etwas trinken wollten. Nur wirkte er jetzt überhaupt nicht mehr verzückt, sondern geistesabwesend, geradezu nervös. Im selben Atemzug fiel Jenny auf, dass der Pianist aufgehört hatte zu spielen. Stattdessen drangen Stimmen und das Schnarren eines schlechten Radioempfangs zu ihnen herüber. Offenbar versuchte das Personal hinter dem Tresen, irgendeine Sendung der Funk-Stunde zu hören.
Nina bestellte noch einen Mojito.
»Und für Sie?«, wandte er sich an Jenny. »Auch noch einmal das Gleiche, einen jungfräulichen Manhattan?«
»Jungfräulich?«, fragte Nina prompt.
»Mit Kirschsirup«, verkündete der Kellner. »Wird zwar im Allgemeinen nicht verlangt, ist für unseren Barmann aber kein Problem.«
Nina öffnete den Mund, aber Jenny war schneller: »Einen Manhattan«, sagte sie und sah den Kellner beschwörend an. »Ohne Kirschsaft.«
Seine Verwirrung war nicht zu übersehen, doch schließlich nickte er, murmelte: »Sehr wohl«, und verschwand. Jenny konnte nur hoffen, dass sie sich nicht würde übergeben müssen.
»Was war denn das?« Ninas Blick traf sie ohne Erbarmen. »Ich hätte gewettet, dass du jungfräuliche Cocktails nicht mal angerührt hast, als du noch Jungfrau warst.«
»Der gute Jonas muss da was verwechselt haben«, murmelte Jenny, statt die verdammte Katze aus dem Sack zu lassen.
Die Schnarrgeräusche aus dem Radio verstummten. Die Stimme eines Nachrichtensprechers ließ sich nun hingegen deutlich vernehmen, doch sie war zu weit entfernt, um etwas verstehen zu können. Um sich herum nahm Jenny eine eigentümliche Stille wahr, als verfiele der ganze Saal in angespanntes Lauschen.
Dann ertönte ein geradezu ekstatischer Aufschrei.
Gleich darauf sprang an einem Tisch vor der Bar ein grauhaariger Mann mit Fassbauch vom Stuhl und reckte die geballte Faust in die Luft.
»Ha!«, rief er. »Hab ich’s nicht gesagt? Jetzt wird aufgeräumt in dem Saustall. Jetzt wird mit eisernem Besen ausgekehrt.«
Andere sprangen ebenfalls von ihren Plätzen auf, liefen durcheinander und versuchten in Hörweite des Radios zu gelangen.
»Was ist denn da los?«, fragte Nina.
Jenny wusste es. Es kam ihr vor, als hätte sie es den ganzen Tag schon gewusst, als hätte sie keinen anderen Grund gehabt, bereits in der Frühe, nach dem Aufstehen, spuckend über der Kloschüssel zu hängen. Jetzt war ihr von Neuem speiübel, obwohl sie außer dem widerlichen Kirschsirupcocktail gar nichts getrunken hatte.
»Der neue Reichskanzler«, sagte sie zu Nina, die bereits wie gebannt aus dem Fenster blickte. Jenny tat es ihr gleich und sah die Scharen von Menschen, die von überallher wie Ameisen zusammenliefen, sich zu einem anschwellenden Strom verdichteten und die Fahrbahn hinaufzogen, allen Verkehr blockierten. Sie strebten der Wilhelmstraße entgegen, der Reichskanzlei. Was sie sangen oder grölten, war durch das dicke Glas nicht zu hören, aber dass sie es taten, erkannte man an ihrem Schritt.
Zackiger Gleichschritt so wie damals, als die jungen Männer durch die Straßen von Jennys Geburtsstadt Riga gestampft waren, irgendeiner Fahne entgegen, irgendeinem Ruf, für irgendein Vaterland zu sterben.
»Hitler«, sagte sie dumpf. »Hindenburg, der verdammte Tattergreis, muss Hitler ernannt haben.«
»Das ist nicht dein Ernst.«
»Ich wünschte, das wäre es nicht.«
»Jetzt geht’s dem Gesindel an den Kragen«, rief der Mann mit dem Fassbauch, wie um Jennys Vermutung zu bestätigen. »Hitler ist Reichskanzler! Endlich!«
»Aber er hat doch gar keine Mehrheit«, platzte Nina heraus. »Er hat Massen von Stimmen verloren, wir haben gedacht, der ganze Irrsinn ist demnächst vorbei.«
»Ist er vermutlich auch«, sagte Jenny, um vor allem sich selbst zu beruhigen. »Aber leider nicht heute. Heute fängt er erst einmal an.«
Ihre Getränke kamen nicht und würden auch nicht mehr kommen. Jonas war kein deutscher Name, jedenfalls nicht deutsch in dem Sinn, den das Wort für die Nazis hatte. Vermutlich hatte der junge Mann sich verdrückt, und Jenny konnte es ihm nicht verdenken.
Sie hatten beide nicht länger sitzen bleiben können. Eine ganze Weile lang standen sie schweigend vor der gläsernen Wand und blickten hinaus auf die Menschen, die alle wie vom selben krankhaften Wahn erfasst in eine Richtung marschierten.
»Wir müssen zu Sonia«, sagte Nina.
»Ja, das müssen wir«, sagte Jenny.
»Wenn sie das Radio laufen hat, wird sie in Panik geraten. Sie ist allein, Friedhelm ist in Leipzig. Und sie ist schwanger.«
»Ja«, sagte Jenny noch einmal, machte aber keine Anstalten, sich zu bewegen, sondern starrte weiter auf die Straße. Sie musste jetzt sprechen. Wenn sie es nicht tat, würde sie womöglich keine Gelegenheit mehr finden, ehe es zu spät war.
»Weißt du, was große Scheiße ist?«, fragte sie, ohne Nina anzusehen.
»Hitler«, sagte Nina, ebenfalls ohne den Blick von der Straße zu wenden.
»Der auch.«
Nina horchte auf und wandte sich ihr zu. »Was noch?«
Jenny starrte noch immer durch die Glasscheibe, doch das Menschengewimmel verschwamm ihr vor den Augen. »Dass Sonia nicht die einzige Schwangere ist«, sagte sie.
4
Rudi
Der Admiralspalast, in dessen Verwaltungstrakt Rudi in seinem Büro saß, hatte zwar noch keine sonderlich lange, aber dafür bereits eine bewegte Geschichte hinter sich. Begonnen hatte er sein Dasein 1910 als Eislaufhalle, hatte kurz darauf als luxuriöse Badeanstalt fungiert, später als Lichtspielhaus, das außerdem verschiedene Restaurants beherbergte, und schließlich als Varieté mit einem opulenten Zuschauerraum im Art-déco-Stil. Eine Zeit lang hatten sich Varietés in Berlin vor dem Ansturm des Publikums nicht retten können. Es war die Art von faulem Zauber, der Erwachsene zu staunenden Kindern machte, eine kunstvoll inszenierte Entführung in eine Welt der Illusionen, die vergessen ließ, dass vor der Tür das Gesetz von Fressen und Gefressenwerden herrschte, dass die Kälte der Wirklichkeit keine Gnade kannte, sondern alles, was gut und edel und wertvoll war, erfrieren ließ.
Rudi hatte dieser Lügenwelt nie etwas abgewinnen können, weil er kein Talent zum Selbstbetrug besaß. Das Theater, das er hatte inszenieren wollen, war real und beinhart, es bildete das Menschenleben ab, wie es war. Eine Zeit lang hatte er allen Ernstes geglaubt, mit dieser Art von Theater etwas bewirken zu können – einen Lernprozess, eine Wendung der Menschen zum Besseren und letzten Endes einen Beitrag zur Erneuerung der Welt. Dann war der Krieg gekommen und hatte nicht das Gute, Begabte, Schützenswerte bewahrt, sondern den Abschaum. Die Verkommenheit.
Als der Krieg – auch Rudis ganz persönlicher Krieg, mit dem sein Feind ihn aus dem Hinterhalt überrollt hatte – hinter ihm lag, war es ihm gleichgültig gewesen, was er am Theater inszenierte, solange es ihm nur eintrug, worum es ihm zuvor nie gegangen war: Ruhm und Luxus. Ein Gefühl von Macht, das die endlose Ohnmacht und Leere zumindest vorübergehend betäubte. Mit läppischen Revuen hatte er seine ersten Erfolge gefeiert, hatte die vernichtenden Kritiken ignoriert, solange sein Kontostand für sich sprach, und als ihm der Admiralspalast als ständige Spielstätte angeboten worden war, hatte er sich nicht lange bitten lassen.
Rudi hatte die Zeichen der Zeit erkannt, noch ehe die Wirtschaftskrise all die Träumer und Fantasten aus ihren Wolkenkuckucksheimen gerissen hatte. Wer nicht wusste, wovon er morgen leben sollte, der wollte heute noch Sex und Rausch, wenn er sich seine letzten Pfennige aus der Tasche ziehen ließ. Und Rudi lieferte beides: jede Menge billigen Sex auf der Bühne und für den Rausch einen billigen Schaumwein, den er als Admirals-Champagner anpries. Neben den Revuen nahm er Operetten ins Programm, deren Komponisten und Texter regelmäßig Schlager lieferten, und sorgte dafür, dass die Bühnenbilder reichlich Platz für Tanznummern leicht bekleideter Ballettmädchen ließen.
Das Ergebnis gab ihm recht, ganz egal mit welchen Schmähungen die selbst ernannten Intellektuellen der Presse über ihn herzogen. Andere Theater mussten schließen oder ihre Säle an die sich überall ausbreitenden Kinobetreiber vermieten. Der Admiralspalast hingegen stockte die Anzahl seiner Sitzplätze auf über zweitausend auf. Anschließend boten die Brüder Fritz und Alfred Rotter, denen neben diesem noch etliche weitere Theater in Berlin gehörten, Rudi eine Beförderung in die Etage der Intendanz an, die dieser dankend annahm.
Damit stand er auf einem Platz, an den andere Regisseure nicht einmal in ihren kühnsten Träumen zu denken wagten. Er hatte sich, wie man so sagte, aus dem Nichts etwas aufgebaut. Dass er darüber keine Befriedigung empfand, lag keineswegs daran, dass ihm das Aufgebaute nicht genügte. Sondern daran, dass es ihm um Aufbau nicht ging.
Rudolf Kante träumte nicht davon, etwas zu erschaffen, sondern davon, Erschaffenes zu zerstören.
Im Augenblick hatte er mit den Aufgaben, für die er von den Rotter-Brüdern bezahlt wurde, wenig zu tun und konnte sich dem Nachdenken über Zerstörung umso intensiver widmen. Alles lief wie am Schnürchen. Ball im Savoy, die Operette, die er im Dezember zur Premiere gebracht hatte, war jeden Abend ausverkauft bis auf den letzten Platz, und die Lieder, zu denen Fritz Löhner-Beda die schmissigen Texte geschrieben hatte, pfiffen die Spatzen von den Dächern. Gitta Alpár, die Hauptdarstellerin, vereinte rassige, fast schon zigeunerhafte Exotik mit einer zarten Blondheit, der niemand widerstehen konnte. Die Laufzeit des Stücks war gerade verlängert worden, und Löhner-Beda und sein Komponist Paul Abraham arbeiteten schon emsig am Folgeprojekt, auch wenn Rudi damit keine Eile hatte.
Er nutzte die Zeit, um sich gedanklich mit zwei anderen Vergnügungsstätten zu befassen, die in unmittelbarer Nähe des Admiralspalasts lagen.
Eine davon war das Deutsche Theater, in dem der verdammte Max Reinhardt noch immer seine hochtrabenden modernen Dramen aufführte und an Schauspielern alles versammelte, was über Rang und Namen verfügte. Gustav Fröhlich. Elisabeth Bergner. Und natürlich der unvermeidliche Anton Wendland.
Gegen Fröhlich war wenig zu sagen, wenn man davon absah, dass seine Fähigkeiten eher solide und bodenständig als hochfliegend waren und dass er kaum etwas anderes spielen konnte als den braven, verständnisvollen Ehemann. Hätte der Krieg nicht Deutschlands Schauspiellandschaft mit eisernen Zinken ausgekämmt und das Feinste und Beste unwiederbringlich herausgerissen, hätte Fröhlich sich mit einer weit niedrigeren Stufe auf der Leiter begnügen müssen, doch in der Not fraß der Teufel bekanntlich nicht nur Fliegen.
Es gab schlechtere Schauspieler als Fröhlich. Und was es an besseren gegeben hatte, lag vermodert und verscharrt in Belgien oder Frankreich und hatte nicht einmal einen Stein, auf dem sein Name verwitterte.
Elisabeth Bergner war ein anderes Kaliber. Ihre Schönheit ließ sich nicht leugnen, auch wenn diese Schönheit für Rudis Geschmack zu laut, zu wenig zart, zu dick aufgetragen war. Es ließ sich auch nicht leugnen, dass die Bergner spielen konnte. Sie war talentiert, diszipliniert und intelligent, und rein fachlich betrachtet gab es nichts, das Rudi gegen sie vorzubringen hatte.
Vielleicht hätte er sie sogar geschätzt, wäre sie nicht blond, sondern brünett gewesen und hätten Publikum und Presse sie nicht Lisl genannt.
Eine blonde Lisl aber durfte es nicht noch einmal geben, keine andere, die sich des Namens bemächtigte, dessen geflüsterter Klang ihn noch immer schweißnass aus dem Schlaf schrecken ließ.
Der Name gehörte nur einer. Seiner einen und einzigen Lisl, die nie wieder auf einer Bühne stehen, deren Bild nie wieder die Titelseite einer Zeitschrift zieren und die nie wieder in den Armen ihres Geliebten liegen und ihn die Hässlichkeit der Welt vergessen machen würde.
Rudi hasste sie alle. Gustav Fröhlich, Elisabeth Bergner und wie auch immer sie hießen. Er hasste sie dafür, dass sie lebten, während Reinhold und Liesa tot waren, dafür, dass sie die Triumphe feierten, die diesen beiden gebührt hätten, und dafür, dass ihre Namen in aller Munde waren, während die von Liesa Sentis und Reinhold Kante längst vergessen waren.
Mehr als jeden anderen hasste er jedoch Anton Wendland, den Star des Deutschen Theaters, der einmal sein Freund gewesen war und seine Träume geteilt hatte. Anton war der einzige Mensch gewesen, dem Rudi blind vertraut hatte: Er hatte ihm das Kostbarste anvertraut, was er besaß.
»Pass auf, dass du ihn mir heil wieder nach Hause bringst«, hatte er gesagt, und Anton hatte es ihm versprochen.
»Du kannst dich auf mich verlassen.«
»Das tue ich. Wenn ich nicht wüsste, dass du ihn beschützt, würde ich dafür sorgen, dass er mit mir zurückkehrt. Koste es, was es wolle.«
Anton hatte sich zu ihm niedergebeugt und ihn umarmt. »Ich achte auf ihn. Und du achtest mir auf mein Mädchen.«
Dann aber hatte Anton sein Versprechen gebrochen und Freundschaft und Vertrauen mit Füßen getreten. Scham kannte er keine. Als skrupelloser Schmarotzer saß er auf einem Platz, der ihm nicht zustand, und tat sich an dem gütlich, was er einem anderen geraubt hatte.
»Anton Wendland – ein Schauspieler, aus dem die Stimme unserer Zeit spricht«,hatte der Film-Kurier erst vor ein paar Wochen geradezu unterwürfig getitelt, obwohl sich der hochnäsige Anton mit ein, zwei Ausnahmen zu fein war, um überhaupt Filme zu drehen.
Für all das hasste ihn Rudi: Warum hatte seine Großmutter behauptet, unrecht Gut gedeihe nicht, wenn es dem Verräter, dem Feigling Anton Wendland, doch bestens gedieh? Er galt als unbestechlicher Vertreter des künstlerischen, vom schnöden Kommerz weit entfernten Theaters und hatte den kommerziellen Erfolg obendrein, die Frauen, die ihm zu Füßen lagen, und die Intendanten, die sich um ihn rissen.
Deshalb – um Anton Wendlands willen – war Rudi entschlossen gewesen, das Deutsche Theater zu zerstören. Nur hatte sich gezeigt, dass das gar nicht nötig war, denn das Deutsche Theater