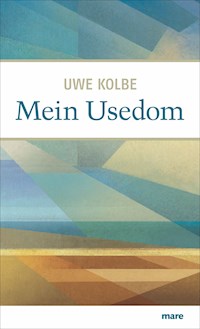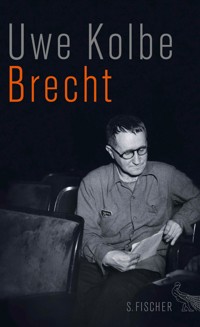9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Dies ist die Geschichte einer maßlosen und erschreckenden Verstrickung: Ein Vater, der in den Osten ging, um dem Land seiner Hoffnungen zu dienen. Ein Sohn, der als Komponist die Sounds seiner Generation einfängt und sich mit der Zensur arrangiert. Als der Sohn Karriere macht, steht der Vater vor der Tür. Fortan umkreisen sich die beiden, nur langsam ahnt man, welchen Kampf sie miteinander führen. Uwe Kolbes Roman vom Verrat am eigenen Leben ist auch eine Absage an die Gleichgültigkeit, ob im Alltag einer Diktatur oder anderswo.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 469
Ähnliche
Uwe Kolbe
Die Lüge
Roman
FISCHER E-Books
Inhalt
Die Eigentümlichkeit des Klanges nämlich,
welche wir mit dem Namen der Leerheit belegen,
entsteht, wenn die Obertöne verhältnismäßig zu stark gegen den Grundton sind.
Hermann von Helmholtz
dort drüben bracht ich meine jugend auf den grund
und gattete mich mit dem schatten meines vaters
Wolfgang Hilbig
1
Die Geschichte ist mehrfach erzählt worden. Als ich darauf kam, dass auch ich sie erzählen müsste, obwohl sie dem alten Muster gehorcht und ich kein Erzähler bin, war das kein besonders schöner Moment. Ich war Mitte zwanzig, und die Geschichte stand vor der Tür als ein mittelgroßer Mann. Er roch aus schmalem Mund nach Zigaretten, und ihm fehlte ein Schneidezahn. Er war doppelt so alt wie ich. Das fiel mir natürlich nicht gleich ein, als ich ihn erstaunt begrüßte und hereinbat. Aber ich konnte es leicht nachrechnen, weil ich sein Geburtsjahr wusste. Er war mein Vater.
Dass die Geschichte meine eigene ist, macht das Erzählen nicht einfacher. Immerhin muss ich nichts erfinden. Damals lebte ich als freier Komponist. Drei Jahre zuvor hatte ich die erste große Uraufführung eines eigenen Stücks erlebt. Obwohl E-Musik, machte es Furore und brachte meinen Namen in die Öffentlichkeit. Später gab mir Sebastian Kreisler, den ich schon als Schüler bewundert und früh kennengelernt hatte, die Ehre, mich zu seinem Meisterschüler an der Akademie der Künste zu ernennen. Von dem daran geknüpften Stipendium und ein paar Aufträgen lebte ich auskömmlich.
Mein Vater legte nicht einmal die Lederjacke ab. Er habe in der Stadt zu tun und in der Zeitung gelesen, ich hätte abends ein Konzert. Ob ich ihm eine Karte zurücklegen könnte. Ich lachte: »So voll wird es schon nicht werden.« Aber ich versprach es und nuschelte noch, was das für ein schöner Zufall wäre. Schon war er wieder weg. Der Zufall war nicht schön. Ich hatte im Leben wenig von meinem Vater gehört und gesehen. Es war nicht koscher, wenn er so hereinschneite und auf günstige Gelegenheit machte. Doch der Reihe nach oder, anders gesagt, einer der möglichen Reihen.
Mit vierzehn Jahren wollte ich Biochemiker werden. Das stand fest. Mich faszinierten Prozesse, die naturgemäß jeden Tag um uns herum stattfinden, auch in uns selbst, ohne dass wir sie beeinflussen können. Ich sage nur: Proteinbiosynthese. Ich sehe noch heute vor mir, wie einfach die Vorstellungen damals waren, wie überhaupt die populäre Form der Wissenschaft, mit der ich mich im Wesentlichen allein lesend befasste, zum klaren Schema neigte. In dem Fall stand mir der Reißverschluss des Genoms vor Augen, wie er sich öffnete für die Synthese komplementärer Einfachstränge, die nicht verdrillt waren wie das originale Erbgut und als offene Matrix für die Aminosäuren dienten, aus denen später Eiweiße gebaut wurden. Es schien mir ein sehr einleuchtender und harmonischer Vorgang zu sein. Jedenfalls habe ich ihn so in Erinnerung. Ich schlage während des Erzählens nicht nach. Dazu habe ich keine Zeit. Was in der Blattzelle vor sich geht bei der Photosynthese! Las ich darüber, wurde ich selbst ein aufgeladenes Mitochondrium, prall von Lebensenergie. Alles war erleuchtet. Das kam mir in der Schule zugute. Die Schulbücher der Naturwissenschaften sagten mir selten viel Neues, wenn sie im September frisch auf dem Tisch lagen, außer in jenem Bereich, der die schönen Vorstellungen umwandelte in schöne Mathematik. Deren Idiom war mir irgendwann abhandengekommen. Ich fühle noch heute den Abschied von der Mathematik wie einen Schmerz, der mich genau in der Zeit, aufs siebzehnte Lebensjahr, zu Anfang der elften Klasse der Erweiterten Oberschule traf. Vielleicht zum Ersatz begegnete ich zur selben Zeit dem Sound, meiner eigenen Auffassung von Musik.
Auf dem Weg zur Schule überquerte ich die Stolpische Straße. Es war dieselbe, die auf dem Richtungsschild der Straßenbahn der Linie 3 stand, wenn sie aus der Revaler Straße, vom Bahnhof Warschauer Straße wegfuhr. Hier vor der Bösebrücke war die andere Endhaltestelle. Oft stand ein schmutzigeierschalenfarbener Triebwagen mit einem ebenso betrüblichen Anhänger an der Betriebshaltestelle, wenn ich halb acht hier entlangging, schnell, die Haare im Wind. Ich verlangsamte den Schritt. Der Fahrer setzte das rumpelnde Ding wieder in Bewegung nach einer tonlosen Version des Abfahrtsignals, einem kurzen Aufleuchten der runden roten Lampen neben den Türen. Es sah aus, als nähme die Bahn den Weg in die Kleingartenanlage hinein. Sie fuhr aber in die Wendeschleife, die hinter ein paar Büschen und einem Transformatorenhäuschen verborgen lag. Das war der Moment. Ich blieb auf dem Plattenweg stehen, auf dem ich allmorgendlich die Schrebergartenkolonie Feuchte Senke durchqueren musste. Erst hörte ich das Schleifen unter dem Rumpeln der Straßenbahn. Dann trat ein feiner Ton dazu und verstummte wieder. Nach kurzem erneutem Schleifton ein Zweiklang, ungefähr eine Sexte. Der Grundton blieb stehen mit hörbarem Geräusch Metall auf Metall, erlosch kurz, kam wieder. Nun wurde aus dem Stahl Silber, nun schwang sich ein hoher Ton obenauf, stand in leichter Schwankung, krönte den schönen Dreiklang. Schleifen, fast Verstummen, Rumpeln des Anhängers, das letzte Viertel für den Triebwagen, Rollen der Räder, Glissando beider Schienenstränge in uneinheitlichem Intervall. Scharen von Obertönen. Der rumpelnde Wagen mit seinem anderen Gewicht gab das Echo, hinterdreinschlenkernde Koda. Schließlich nur noch das halblaute Aufjaulen der Elektromotoren, die anzogen. Jetzt hatte ich es eilig. Mit dem unwillkürlichen Lächeln, das mir die Mundwinkel hochzog, kam ich gut voran. Zwanzig Minuten später, im halbdunklen Treppenhaus der Schule, nahm ich drei der Granitstufen auf einmal. Die undeutliche Person am Geländer, die ich fast übersehen hatte, war Direktor Kahlberg. Er wendete mir sein sauertöpfisches Gesicht zu: »Zu spät, Einzweck. Kein’ Zweck mehr. Es ist schon fünf Minuten nach acht. Sie haben es wieder einmal geschafft.« Unwillkürlich blieb ich stehen. Natürlich hatte er mich mit dem Kalauer angeredet. Natürlich war ich zu spät. Ich wollte weiter. Kahlberg schaute an meinen Jeans herunter. Auf den Knien die Kunstlederflicken hatten es ihm angetan. Ich hatte sie höchstpersönlich draufgesetzt und war durchaus stolz darauf. Bis kurz darunter waren die Hosenbeine hochgekrempelt, und ich trug Sandalen. »Sie wissen, dass wir nichts gegen Jeans haben«, fing er doch wieder an. »Wenn sie gepflegt sind, sauber. Mit diesen hier will ich Sie nicht noch einmal in meiner Schule sehen. Haben Sie mich verstanden?« Mir stieg das Rot in die Wangen, aber ich brummte »Okay.« Ich stapfte ins Klassenzimmer hoch, nahm das Hallo der anderen Schüler entgegen, saß die verbleibenden vierzig Minuten ab, entschuldigte mich bei der Lehrerin, die die nächste Stunde halten sollte, mir sei schlecht, und verließ rasch die Schule.
Um elf stand ich mit meinem Felleisen in Oranienburg an der Fernstraße. Das Felleisen hatte ich vom Sperrmüll. Die Bezeichnung, meinte ich, passte dazu, weil seine Deckklappe aus braunweißem Kalbfell war. Es handelte sich um einen Tornister aus dem Ersten Weltkrieg. Das Ziel meiner Tramptour hatte ich spontan gewählt. Die Adresse hatte ich einem verschlissenen Briefcouvert entnommen. Ich hatte seit drei Jahren keinen Kontakt zu meinem Vater. Auf einem Blatt aus einem Schulblock stand groß mein Ziel: Seeburg. Nach einer halben Stunde hielt jemand, der bis Neuruppin wollte. Es ließ sich gut an. Am frühen Abend stieg ich aus einem Lkw mit offener Ladefläche, einem alten H6. Ich hätte seinem ruhigen Sechszylinder gern weiter gelauscht, gehüllt in den Geruch von Diesel, Öl, Leder und Zigarettenrauch in der Kabine. Der Fahrer setzte mich direkt unterhalb des Neubaugebiets Flegel ab. Mein Vater wohnte, wie vorher schon in Neustadt am See und davor auf dem Dorf, in einem Neubau. Ich klingelte an der Haustür bei dem einzigen Schild mit zwei Namen. Der Summer ging. Im Treppenhaus roch es nach Neubau. Im zweiten Stock rechts ging eine Tür auf. »He, guten Tag, komm herein, du bist Harry, stimmt’s?«, so begrüßte mich die Frau mit dem schmalen Gesicht und dem lose aufgesteckten Haar. Gleich rief sie »Hinrich, komm mal!« in die Wohnung hinein, und mein Vater stand vor mir, die unregelmäßigen, rauchgelben Zähne unterm Schnauzbart, der Blick aus grauen Augen über Krähenfüßen. Keine Nachfrage, wie ich so mitten in der Schulwoche hierherkäme und warum. Es gab Abendbrot. Die beiden Töchter der Frau, von denen ich aus dem alten Brief wusste, waren gleich aus dem Kinderzimmer gekommen, zwei Striche in der Landschaft. Sie nahmen mich in Augenschein und fanden den Hippiestiefbruder, wie ich mich selbst einführte, interessant. Man scherzte und kicherte. Ich berichtete lang und breit davon, wie ich per Anhalter bis nach Seeburg gelangt war. Der Ruch von Abenteuer hing an mir. Es gefiel meinem Vater, das konnte ich sehen. Er war so, wie ich ihn von der letzten Begegnung her in Erinnerung hatte. Die Bewegungen fahrig, immer einen Tick zu hektisch für einen Erwachsenen. Es war nicht angenehm, darin eine Ähnlichkeit zu erkennen. Die Töchter gingen bald ins Bett. Renate, seit kurzem, wie ich erfuhr, mit meinem Vater verheiratet, zog sich gegen zehn Uhr zurück, nicht ohne uns eine zweite Flasche Wein auf den Tisch zu stellen. Der Siebzehnjährige registrierte die Diskretion und fand sie angenehm. Wir wendeten uns tatsächlich einander zu, mein Vater und ich, und begannen ein Gespräch. Etwas wie ein Gespräch. Er stellte Fragen, und ich antwortete, redete, mäanderte im Reden herum, wie es meine Art war, wenn ich gefragt wurde. Dort, wo ich herkam, bei meinem Stiefvater und meiner Mutter, da war von meinen Angelegenheiten nicht viel die Rede. Da hielt ich sie in meinem Zimmer zurück, in meinen Papieren, bei denen ich zum Glück nicht gestört wurde. Weshalb hier auf dem Flegel in Seeburg eine Schleuse sich öffnete: Von der Schule ging es, von meiner Freundin, nach der er gleich genauer fragte, nach ihrem Herkommen, den Eltern. Ich konnte mit ihrem fußballernden Stiefvater aufwarten, mit dem mich eine starke Feindschaft verband, mit ihrer adretten Primaballerinamutter, deren erster Ehe mit einem bekannten Dirigenten Rebekka entstammte. Aufhorchen meines Vaters. Der Name des Dirigenten sagte ihm etwas. Nun legte ich los damit, dass ich selbst begonnen hatte, Musik zu schreiben, zu komponieren. Er war begeistert. Ich erzählte von meinen ersten Erfolgen, von der Bekanntschaft mit Kreisler. Das interessierte ihn erst recht. Aus mir sprudelte heraus, wie es dazu gekommen war, überhaupt alles. Nach meinem ersten öffentlichen Auftritt im Rahmen einer Vorstellung junger Komponisten im Zentralhaus hatte mich einer der Teilnehmer angesprochen, der hieß Leon. Er hatte mit einer Sängerin eigene Lieder aufgeführt. Was er mir bei dieser ersten Begegnung mitgab, ging so: »Hör bloß auf. Das nimmt ein schlimmes Ende. So hat es bei mir auch einmal angefangen.« Er war schon erwachsen. Und er meinte das natürlich als Kompliment. Es war ein richtiger Adelsschlag. Ich redete immer lauter auf meinen Vater ein: »Ich war dann zwei-, dreimal bei ihm zu Hause. Er wohnt nicht weit weg. Wir haben uns Sachen vorgespielt und auch Kompositionen und Entwürfe gegenseitig gezeigt und besprochen. Eines Tages sagte er, ein Freund wolle mich kennenlernen. Dem hätte er etwas von mir gezeigt. Als ich hinkam, saß Kreisler bei ihm. Der große, alte Mann.« Mein Vater wollte, dass ich dessen Reaktion auf mich genauer beschrieb, und wollte auch wissen, wie er meine Arbeiten fand. »Na ja, er ist Mitte fünfzig, nicht mehr so dick wie auf früheren Fotos. War, soweit ich weiß, mal Alkoholiker. Seine Zusammenarbeit mit Heiner Alt, seine Arbeiten für das Theater überhaupt, seine letzte Oper, die nach der Uraufführung abgesetzt worden ist. Das treibt uns um, meine Freunde und mich, auf dem Schulhof. Die Interessierten, meine engeren Freunde sind alle Fans. Er hat mir nur ein paar Fragen gestellt, wie lange ich schon komponierte, was meine Eltern dazu sagten, so etwas. Zu den Sachen selbst hat er nur gesagt, sie gefallen ihm und er will was für Leon, meinen Freund, und mich tun, dass wir einem breiteren Publikum bekannt würden. Über die Akademie.« Auf die abgesetzte Oper hin regte sich etwas bei meinem Vater, er wusste davon. Er hielte das auch für keine gute Entscheidung. Man hätte mit Kreisler »anders reden sollen«, fand er: »Diese Holzköpfe wissen nicht, wie man mit Künstlern umgehen muss. In der Sache haben sie recht.« Ich fuhr auf: »In welcher Sache? Die Oper ist ein Gleichnis auf den Kalten Krieg und die Erstarrung der Verhältnisse auf beiden Seiten. Das Science-Fiction-Milieu hält Kreisler selbst nur für eine Krücke. Darüber haben wir gesprochen. Aber er weiß, dass es insbesondere bei seinen jüngeren Fans ankommt. Ich finde, das sollte bei uns zu diskutieren sein und nicht einfach verboten.« »Verboten? Was heißt verboten?«, regte sich nun mein Vater auf. »Schließlich ist eins klar, nämlich wer die Macht im Lande hat. Es kann nicht einfach jeder, nur weil seine sogenannten Fans es gut finden, die Grundlagen des Staates angreifen.« Ich wurde lauter: »Die Macht also. Du meinst die Einheitspartei, dass die Einheitspartei die Macht hat. Das sagt mein bisschen Marxismus aber anders. Die Macht haben doch hier die Arbeiter, nicht wahr? Die Einheitspartei ist nur ein Organ, das die Interessen der Arbeiter vertritt. Wenn die Einheitspartei sich über die Klasse erhebt, liegt sie schief. Nicht nur das, sie missbraucht ihre Macht. Ihre Macht ist dann die einer Clique, und nichts sonst. Und darum geht es eben in dem Libretto von Kreisler.« »Was ihr so redet, du und deinesgleichen. Ihr wisst ja nichts. Du wärst unter den alten Verhältnissen nicht an der Oberschule, also am Gymnasium. Wenn wir nicht die Macht übernommen hätten, würden hier ringsum weiter die Junker herrschen.« Ich schaltete ab, während wir schärfer wurden, mitten im Streit. Das Wort »Klischee« sagte ich noch und dass wir das Jahr Soundso schrieben, nicht mehr die fünfziger Jahre. Dass zum Glück die Verhältnisse andere wären. Dass der Ismus stabil sei und dass man doch auf der Basis offen sein und die Zensur aufheben könnte. Er konterte: »Zensur wofür und gegen wen? Wir lassen doch alles zu, fast alles, wenn es nicht dem Gegner in die Hände spielt, wenn es nicht die alten Verhältnisse, die faschistischen, wiederherstellen will.« So redete er. Ich redete auch. Er redete wieder. Wir redeten durcheinander. Wir schrien uns an. Ich vergaß, noch während wir schnauzten, worum es ging. Wir hatten den Wein ausgetrunken und stellten die Gläser hart ab. Schließlich stöhnte er, dass wir doch beide vom selben Kaliber seien, dass er genau sehe, wen er da zurückgelassen habe: »Ich hätte um dich kämpfen müssen.« Was für ein Spruch, dachte ich. Er zeigte mir, wo ich schlafen könnte. Seine Frau hatte die Liege in einem kleinen Zimmer bezogen. Ich war gut durchgeglüht und schlief sofort ein. Am nächsten Morgen saßen wir schweigend über einem Frühstück, das er in seiner zittrigen, nervösen Art auftrug. Er schrieb noch einen Brief an die Schule auf der Schreibmaschine, in dem er um Verständnis für den jungen Mann bat. Seine Formulierung: den jungen Mann. Er adressierte das Blatt an liebe Genossen und unterzeichnete es in seiner geschwungenen Schrift mit Genosse H. Einzweck. Am Bahnhof kaufte er mir eine Fahrkarte, drückte mir einen Geldschein in die Hand, und wir umarmten uns.
Nach einer Nacht zu Hause holte ich am Nachmittag Rebekka von der Tippsenschule ab. Es war ein liebes Wort: Tippsenschule. Wir lachten. Sie wurde dort zur Stenotypistin und Phonotypistin ausgebildet. Ich sagte auch diese beiden Wörter sehr gerne, immer wieder. Nach Augenschein bei Schulschluss lernte sie dort mit tausend anderen Mädchen gemeinsam genau das, was draufstand. Die Berufsschule stand in einer verworrenen Gegend der Stadt. Achtzig, neunzig Jahre alt, war das Gebäude ein gewaltiger, historistischer Trumm. Ich meinte bei derart von Kohle, Staub, Wetter und Ruß nachgedunkelten Gebäuden immer, sie wären von den Weltkriegen angeschwärzt, von großen, durch die Stadt jagenden Bränden. Unweit rosteten genietete Stahlbrücken über halb gepflasterten, halb sandigen Straßen. Ein alter Wasserturm stand, teerschwarz wie von Dachpappe umwickelt, auf einer Aufschüttung. Schienenstränge wirkten wie aufgelassen. Ab und zu ratterten die stumpfgelbroten Züge darüber. Stadtbahnsteige zeugten mit ihrer Ausdehnung von früheren Ansprüchen. Jetzt wehte hier vierundzwanzig Stunden lang der eisige Ostwind, gab es Verspätungen, Warten beim Umsteigen, Warten beim Pendelverkehr, Warten von Menschen mit grauen Gesichtern. Wir fuhren rasch weg, vier Stationen mit der Stadtbahn Richtung Mitte, zu dem kahlen, aber belebteren Zentralplatz. Wir warfen die Sandalen fort und tanzten und spritzten herum im flachen Wasser des Brunnens, den alle nur die Nuttenbrosche nannten. Dann liefen wir lange durch die Stadt, in das Quartier hinauf, wo wir bei denen wohnten, von denen wir der Einfachheit halber sagten, sie seien unsere Eltern. Wir gingen Arm in Arm, knutschten einander durch die Welt, lachten. Bei Rebekkas Eltern gab es für mich kein Sein. Darum gingen wir wie immer zu mir, schliefen miteinander in meinem Zimmer, durch dessen Fenster das Zwielicht vom Hinterhof drang. Unser Bett war meine Doppelliege, Teil der sogenannten Aussteuer, mit der meine Mutter in ihre erste Ehe gegangen war, schwedisches Stahlrohrdesign mit braunen Polstern. Unser einziges Problem war, dass Rebekka immer zur selben Zeit pünktlich zu Hause sein musste. Außer gelegentlichen, lange vorher bei ihrer Mutter und ihrem Stiefvater anzumeldenden Ausnahmen hatte sie um neun Uhr abends anzutreten. Sie war sechzehn. Ich empörte mich jeden Tag, jeden Abend. So führte der Weg von mir zu ihr über die Brücke von Trauer, Ohnmacht und Wut. Es war eine Fußgängerbrücke, eine hellgrau angestrichene Stahlkonstruktion über der Schneise, in der unter uns die Stadtbahn, Schnellzüge und Güterzüge rollten. Da standen wir auch heute wieder. Sahen den Vollmond über den Brandmauern steil aufragender Hinterhäuser. Sahen kein Helles unter dem Mond. Schenkten uns den dahinwehenden Wolkenfetzen. Schauten beleuchteten Stadtbahnzügen zu, die einander entgegenfuhren und dicht aneinander vorbeiglitten, so dicht, dass der Spalt zwischen ihnen gefährlich aussah. Und das Zucken eines elektrischen Blitzes vom Stromabnehmer. Ich brachte Rebekka vor die Tür des Hauses in ihrer Straße. Ich heulte den Mond an. Ich ging unseren Weg allein zurück. Und heulte den Mond an.
Bald darauf kam eine Einladung mit der Post. In vier Wochen, zu Anfang der Sommerferien, könnte ich nach Schloss Ludwigsbaum kommen, um dort mit anderen jungen Komponisten an einem Seminar teilzunehmen. Leiten würden es Reiner Wolfsberg, der Schüler von Hanns Eisler, und Georg Jung, der Elektroniker. Als besonderer Gast war der alte Paul Dessau angekündigt. Das alles war erstaunlich. Es trug selbstverständlich den Stempel der Jugendverwaltung der Einheitspartei, trotzdem konnte ich es nicht ignorieren. Von diesen Seminaren hatte ich schon gehört, wollte ganz sicher daran teilnehmen. Es war die erste offizielle Anerkennung meiner Arbeiten nach dem Auftritt im Zentralhaus. Ich dachte mir, dass mein Vater da irgendwie die Finger im Spiel haben könnte. Das gab der Einladung einen Beigeschmack. Sie kam auch so kurzfristig. Das Schloss lag unweit von Seeburg, in seinem Einflussbereich. Doch tat ich es ab. Und wenn schon, dachte ich, wenn schon, es ist eine ganz offizielle Sache. Ist ja nicht einfach so sein Einheitsparteizeug, ist ja dieses bekannte Seminar, das sie mit guten Leuten zweijährlich dort abhalten. Gute Leute. Workshops. Arbeit mit ausübenden Musikern. Probezeit. Anleitung durch namhafte Meister. Ich schrieb gleich eine Postkarte, dass ich gern teilnehmen werde.
Mein Stiefvater gratulierte. Meine Eltern streckten das Geld für die Fahrkarte und Taschengeld für die Woche vor. Sie gaben mir so viel mit, wie mein Vater Alimente für mich zahlte. Die Woche verging wie im Flug. Singstimmen, Instrumente, Geräte zur Schallerzeugung und zu dessen Manipulation beherrschten das Schloss, seine Nebengebäude, den Park. Dort gab es auch eine große Bühne für das Abschlusskonzert. Und ein Publikum, das haute mich um. Die Sonne schien die ganze Zeit auf alles herab. Wir saßen in kleiner oder größerer Runde sooft es ging draußen, schleppten Tonbandgeräte auf die Terrassen oder saßen auf dem Rasen, in den Pausen sowieso, in denen die Gespräche nicht abrissen, im Grünen, und konzentrierten uns auf Tonreihen, auf Grenzen der Tonalität, auf formale Fragen, von denen ich noch nie gehört hatte. Namen und Beispiele ließen mir die Ohren und den Kopf schwirren: Saint-Saëns, Satie, Strawinsky, Messiaen. Manche Namen wurden geraunt, sozusagen gehandelt: Charles Ives, John Cage, Steve Reich. Ich hatte von serieller Musik bislang nur gehört, in Budapest. Wo ging diese Reise hin? Wirklich dahin, wo mein eigner diffuser Anfang, wo meine Sehnsucht nach dem Sound intuitiv schon lag, wo ich zu suchen begonnen hatte und eben fündig zu werden begann – so war mein intensives Gefühl. Ich nahm mir meins, den Sound des Ganzen, vergaß die Details, wunderte mich nur still, was mein Vater mit alldem zu tun hatte. Der gab hier ein Blättchen heraus, eine Seminarpostille. Das Ding hieß doch wirklich »Die rote Note«. Vielfach sah ich ihn übers Gelände hasten ohne ersichtlichen Grund. Einmal liefen wir direkt ineinander, und er klagte, er müsste allein bis in die Nacht hinein redigieren, sogar die Artikel selbst schreiben, wo er doch kein Fachmann sei. Jemand nahm mich beiseite und flüsterte mir, was er und andere davon hielten. Ich konnte das nicht gut abwehren, wollte es auch nicht. Ich betonte, wie früh sich meine Eltern hatten scheiden lassen. Ich nickte zu den Vermutungen. Er wäre ein überzeugter Genosse, im Kulturbereich unterwegs, Theater, Kabarett, Liedermacher, so etwas, sagte ich. Mehr wusste ich ja nicht. Er war im Auftrag hier, das konnte man sehen. Eine andere Erklärung gab es nicht. Die Einheitspartei, ihre Unterorganisation für alles, was dort unsere Jugend genannt wurde, womit aus dem Wort ein fremdes, ein Unwort geworden war, notorisch mit dem Mehrzahlpronomen davor, sie richtete das Seminar vornherum aus. Doch durch die Person meines leiblichen Vaters war offensichtlich auch die staatliche Überwachungsbehörde vor Ort. Ich legte es als Vermutung ad acta. Das alles war für mich nur mäßig interessant. Was die an uns sogenannten angehenden Komponisten fanden, was da zu observieren war, fragten wir uns untereinander. Mein Vater tat mir leid. Ich sah ihn Sinnloses tun, von dem ich nicht genau wusste, was es war. In diese losen Blätter, die vom Mittag an beim Essen auslagen, schaute jeder nur hinein, um zu prüfen, ob der eigene Name drinstand, und bestätigt zu finden, wie wenig die Texte und sogar die angeblichen Interviews mit den eigenen Absichten zu tun hatten. Einzig die Notationen stimmten. Das waren ja auch Fotokopien. Wo stand eigentlich das Gerät dafür? Ansonsten handelte es sich um eine Art Schülerzeitung, die größtenteils hergestellt wurde von einem erwachsenen Mann mit hagerem, ausgemergeltem Gesicht, ruhelosen Augen und gehetztem Gang. Ich hatte Mitleid.
Am Tag der Rückkehr strahlte mich meine Mutter an. Ein junger, gutaussehender, gutangezogener Mann wäre hier gewesen für mich. »Was wollte er denn?«, fragte ich. »Er war von der Stadt, von der Kultur. Er wird sich wieder melden. Sie wollen dich fördern«, antwortete sie begeistert. »Von was für einer Kultur? Vom Stadtbezirk?« »Nein, vom, wie heißt das?, vom Magistrat von Berlin.« »Interessant«, meinte ich und zog mich in mein Zimmer zurück. Wie kam das? Ging es jetzt richtig los mit der Förderung von allen Seiten? Schon zwei Tage später, Dienstag der Woche darauf, hatte er wieder bei meiner Mutter vor der Tür gestanden, irgendwann am Tag, und sie hatte ihm gesagt, wann ich meistens da wäre. Es irritierte mich. Zugleich war ich gespannt. Sie hatte nun eine Zeit mit ihm ausgemacht. Am Donnerstagnachmittag stand er dann in der Tür. Jemand, den ich »smart« nannte. Ein glatter Typ. Ja, vom Magistrat käme er, Abteilung Kultur. Ich bat ihn herein, wir saßen über Eck am Tisch in der Mitte meines großen Zimmers. Es war ein früherer Esstisch, der mit seiner Größe für alles taugte. Meistens stand er ausgezogen da. Dann bot er die doppelte Fläche. Die lag voller Zettel und Bücher. Jetzt hatte ich ihn abgeräumt. Das verschlissene, bucklige, ausgeblichene Furnier wirkte kahl und unschön. Der Typ auf dem alten Stuhl am alten Tisch, sein helles Hemd leuchtete unterm Sakko hervor. Ich saß gespannt da, auf gute Nachrichten aus. Sie hätten von mir gehört. Mein Name sei genannt worden. Aha. Sie hätten vom Zentralhaus Informationen bekommen über einige Talente. Aha. Ich komponierte also. Ja, hm, ja. Ob ich ihm etwas zeigte, damit er sich ein Bild machen könne. Hm, ja. Ich kramte die Klemmmappe mit Abschriften hervor, die ich in Ludwigsbaum dabeigehabt hatte. Die taugte wegen Änderungen und Anstreichungen nicht mehr so viel. Ich suchte eine Weile und fand ein paar einzelne Bögen. Er nahm sie in die Hand, klappte die größeren, gefalteten auf und zu, ohne eigentlich darauf zu schauen, aber stellte ununterbrochen Fragen. Ob ich noch andere junge Künstler kennen würde. Wie ich denn so meine Freizeit verbrächte. Mit wem. Wo. Ich antwortete zögerlich, schließlich einsilbig. Mir fiel nichts ein, das besonders wäre, das etwas zur Sache beitragen könnte. Außerdem wartete ich darauf, dass er in die Arbeiten schaute und etwas dazu sagte. Abteilung Kultur. Sie würden doch keinen Trottel schicken. Er merkte es immerhin. So schnell könne er nichts sagen. Ob er das mitnehmen dürfe. Er würde es gern einem Experten zeigen. Das sei er nicht. Er wäre der Mann für den ersten Kontakt. Er würde mir auch auf einen Zettel eine Quittung schreiben. Wäre nicht nötig, erwiderte ich, nur sicher wiederbringen. Es dauere nicht lange, meinte er, ein bis zwei Wochen. Er käme dann wieder vorbei. Hm, ja, gut, sagte ich, und weg war er mit ein paar kleinen Kompositionen, mit meinen Soundfragmenten.
Ich ging langsam ins Zimmer zurück. Darin stand das Licht, sommers wie winters dasselbe Licht, ob nun grün eingefärbt oder nicht, abends wie morgens dasselbe, mäßig hell oder mäßig dunkel, und das Nachtgrau jenseits von Schwarz gab seins dazu. Meine Stimmungen folgten dem. Sie waren laut von draußen her, wenn ich hereinstürmte, und wurden hier aus dem Flug heraus gedämpft. Der heiße Kopf kühlte ab von Fingern und Fußspitzen her. Was wird daraus werden?, fragte ich mich, ein bisschen begeistert, ein bisschen gebremst zugleich. Ob daraus was wird? Was wollen die von mir? Was kann der Magistrat, Abteilung Kultur? Sind sie diejenigen, die zu sein sie vorgeben? – Am nächsten Tag traf ich Alex und Thorsten, zwei Freunde. Wir bildeten ein Gelegenheitstrio mit Blues Harp, Gitarre und Klavier zu Sessions, bei denen wir Blues und Rock spielten, auch unsere Lieblingssongs der Beatles, der Doors, der Stones. Alles nach dem Gehör. Treffpunkt war bei Thorsten, in dessen schmalem Zimmer ein altes, allzeit gut gestimmtes Bechsteinklavier stand. Erst erzählte ich atemlos von Ludwigsbaum. In einem einzigen Schwall. Sie bremsten mich kaum, sie waren es ja gewohnt. Irgendwann kam ich auf den Magistrat, Abteilung Kultur. Alex bemerkte in seinem starken Einheimisch: »Det is die Firma, pass uff!« Ich erzählte von der seltsamen Rolle, die mein leiblicher Vater bei dem Jugendseminar dort gespielt hatte. Ich mochte den offiziellen Namen der Veranstaltung nicht aussprechen, betonte aber, wie wenig es real mit unseren Vorurteilen zu tun hätte einerseits, andererseits aber spielte eben doch »mein Alter«, der in Seeburg das Zentralhaus der Kultur leitete, dort eine Rolle. Bisher hatten beide Freunde nur gewusst, dass ich mit einem Stiefvater lebte. In unserer Klasse waren es fünf von fünfundzwanzig, die geschiedene Eltern hatten. Während ich erzählte, ging mir irgendwie die Luft aus. Ich ertastete auf dem Klavier ein paar Blue Notes, gab ihnen Akkorde, ging ein wenig über den Südstaatenbaumwollacker und machte schließlich einen Boogie draus. Meine Partner legten auch los. Bald war unsere Stimmung wie gewohnt. Im Nu wippte und zuckte und schwitzte alles. Schließlich freuten wir uns auf die Cola aus dem Kühlschrank, schmissen uns auf bequemere Sitzmöbel und redeten noch ein wenig über unsere musikalischen Helden, über Filme und was wir mit unseren Freundinnen in den Ferien unternehmen würden, zu sechst. Alex wusste, dass sie zwei surrealistische Stummfilme mit dem jungen Dalí im Studiokino zeigten. Er würde uns Bescheid sagen.
Auf dem Weg nach Hause dachte ich wieder an den Magistrat, Abteilung Kultur. Es ließ mich nicht los. Schließlich gab ich mich der Hoffnung hin, es bedeutete etwas, ließ mich davon anfeuern. Etwas bewegte sich. Ich ging durch die klingende Nacht, unter dem Wind hin, der die Bäume zauste, neben dem Hall der eignen Schritte her, nahm das Rumpeln und Schleifen der letzten Straßenbahn mit, zwei besoffene Stimmen am Stadtbahnhof, gicksend, freundlich. Es baute sich etwas auf. Mehr Lust als Unlust zwischen den Mietskasernen. Ich holte meine Blues Harp heraus und dehnte in einer Tordurchfahrt Töne. Ich spielte mich laut über den Bersarinplatz. Zu Hause schlief zum Glück schon alles. Ich setzte mich an den Tisch und skizzierte ein Stück, genauer einen Zirkel von Stücken, der mehrere Sphären zusammenführen würde zu einer Raummusik, zu Domen von Klang, jeder eine eigene Konfession, untereinander korrespondierend. Ich sah Räume und Farben und darin aufklingende Wörter, lateinische, griechische, hebräische, die ich mir ausdachte, wie ich überhaupt Sprachen mit nie dagewesenem Klang erfand, flirrende Muster, ganz Schmerz und ganz Liebe, Aufgehen in Welt. Was für eine hochtrabende Nacht das war. Ich nahm das Ganze mit in den Traum.
Im Aufwachen setzte es sich fort. Ich sah gigantische Soundcluster vor mir. Irgendwann brachte meine Mutter ein paar Scheiben belegte Brote und einen Pfefferminztee herein. Später rumorte sie draußen mit dem Staubsauger. Ich ging ans Fenster und inhalierte zum Ausgleich den Spatzentumult. Nun wischte sie hörbar, an die Scheuerleisten anstoßend, den Flur. Ich hielt mir die Ohren zu und schaute auf das Blatt vor mir. Sie stand in der Tür. »Es ist alles so klebrig hier«, sagte sie. »Man kann so nicht leben«, sagte sie. Ich redete sanft auf sie ein: »Zeig es mir. Wo klebt es hier? Komm, zeig es mir genau.« Ein Blick in die Stube erwies die übliche Akkuratesse von Sofa, Rauchtisch mit Drehaschenbecher auf dem Tischläufer, Fernsehgerät und den hellen Falten der bodenlangen Stores vor der Tür zum Balkon. Ganz abgesehen von der Tapete mit den silbrigen Streifen, die noch kein halbes Jahr alt war. Alles passte zur Beletage. Ich führte sie nach vorne in die Küche. Die sah aus wie geleckt. Das alte, makellose Linoleum glänzte. Auf dem Tisch am Fenster lag ein weißes Deckchen, darauf stand der kleine Porzellanleuchter von einer Wochenendreise nach Meißen. Links auf der hellen Arbeitsfläche der Küchenanbauwand stand die dicke Kaffeekanne mit dem Blumendekor, in der den Sommer über kalter Malzkaffee bereitgehalten wurde. Nach der Schule nahm ich gewohnheitsmäßig einen kräftigen Schluck daraus, setze die Tülle an und sog das Getränk mit seinem namenlosen Geschmack tief in mich hinein. »Sauber, siehst du? Alles sauber. Sehr sauber sogar. Du kannst das. Ich glaube, du bist perfekt. Du könntest noch einen Haushalt oder zwei zusätzlich versorgen. So gut bist du.« Ich umarmte sie und stapfte zurück in mein Zimmer. Kaum versuchte ich mich zu konzentrieren, stand sie wieder da. Sie rieb die Finger aneinander. Rings um die Nägel war schon alles blutig, weil sie mit den Daumennägeln ohne Unterlass die Spitzen der Finger traktierte. Ich führte sie wieder aus dem Zimmer, empfahl ihr, den Fernseher anzumachen und schloss die Tür hinter mir ab. Sie rumorte. Sie klopfte an meine Zimmertür. Ich schrie, sie sollte mich in Ruhe lassen. Minuten später schloss ich hastig die Tür auf, suchte sie, fand sie in der Küche auf dem Stuhl kauernd, nahm sie in den Arm, bat sie um Verzeihung. »Es wird alles gut, wir bekommen das hin«, sagte ich, ohne im Moment zu wissen, was genau und wie genau. »Wir müssen mit Vati reden, gleich, wenn er kommt, er muss das verstehen.«
Als mein Stiefvater von der Arbeit kam, saßen wir noch immer und redeten. Was zu reden war. Im Kreis. Es ging ja schon Tage so. Meine Mutter war krank. Ich sagte, es ist eine Depression. Ihr Mann sah das anders. Es würde vorübergehen, es. Das seien Stimmungen, die kämen und gingen. Ruhe, das brauchte sie, Ruhe. Ich hielt dagegen, empfahl, einen Arzt aufzusuchen. Wir vertagten das. Die warme Abendmahlzeit gab es immer schon um fünf, wenn er von der Arbeit in der Gaskokerei nach Hause kam. Wir aßen schweigend.
Wir räumten den Tisch ab in schweigender Dreierprozession Richtung Küche. Einer die Teller, das Essbesteck, das Töpfchen mit Resten der hellen Soße und einer zurückgebliebenen Kaper darin, sieben Meter Flur hin, mit leeren Händen zurück. Einer die große Schüssel mit Krümeln von Kartoffeln und Petersilie und die Schale mit Resten vom Schokoladenpudding und den Krug mit gelbem Rand von der Vanillesoße darin, sieben Meter hin, ohne etwas zurück. Meine Mutter folgte als Letzte mit den Kompottschalen und den drei Teelöffeln, sieben Meter hin, mit nichts in den Händen zurück. Die beiden setzten sich wie gewohnt, er in den Sessel, sie auf das Sofa. Anders als sonst wurde der Fernseher nicht eingeschaltet. Ich stand unschlüssig in der Tür. »Ich muss noch …« Nach ein paar Minuten müßigen Stehens und Aufundabgehens in meinem Zimmer kehrte ich zurück in die Wohnstube. Meine Mutter sprach davon, wie schmutzig alles sei und dass ihr das über den Kopf wachse. Er hielt dagegen, wie schön alles sei. Er sagte, er freue sich, dass er ein so schönes Zuhause habe. Sie sei eine Frau, auf die er sich verlassen könne, eine gute Hausfrau jetzt, wo sie gerade nicht arbeiten ging, weil sie das zusammen beschlossen hatten, weil sie auch so hinkämen mit dem Geld. Das gefalle ihm, wenn er nach Hause kommen und es einfach so genießen könnte. Sie unterhielten sich sonst über das Essen, das Fernsehprogramm, das Wetter, die Verwandten und die Ausflugsziele fürs Wochenende, die sich in gewisser Regelmäßigkeit abwechselten. Wir hatten kein Auto. Wir bewegten uns mit Straßenbahnen und Stadtbahnen durch die Stadt. Wir hatten schon jeden Pendelverkehr und jeden überfüllten Schienenersatzbus kennengelernt. Es gab bestimmte Routen für die Ausflüge. Es war überschaubar. Das meiste mochte ich, wenn ich auch die letzten zwei Jahre kaum noch dabei war. Zuletzt hatte ich das Paddelboot übernommen, das in Spindlersfeld im Bootshaus lag. Damit waren wir, solange ich noch vorn in der Spitze Platz fand mit meinen Beinen, auf Spree und Dahme unterwegs gewesen. Ich hatte mich aber nicht um das Boot gekümmert. Letzten Sommer war ich mal dort gewesen und zum Seddinsee gepaddelt, hatte gebadet, kaum der Rede wert. Diesen Sommer noch nicht einmal das. Keiner meiner Freunde hatte richtig Lust dazu. Mit Rebekka war ich auch eher anders unterwegs, weiter draußen, außerhalb der Stadt, im Wald, am Rande der Rieselfelder, auf den Mais- und Kornfeldern im Norden der Stadt, mit Freunden, mit Instrumenten, mit einem Picknick, zu Fuß. Oft aber ohne alles, nur wir zwei, tanzend auf der Oberfläche der Welt. Ich stand andächtig in der Stubentür. Wie diejenigen, die ich meine Eltern nannte, jetzt miteinander sprachen, hatte ich noch nie erlebt. Sie taten es weder gleichzeitig noch aneinander vorbei, sie schimpften nicht. Vor allem redete meine Mutter nicht endlos auf ihren Mann ein, wie es die Regel war, und er musste sich nicht erst kleinlaut, dann immer lauter gegen ihre Anwürfe zur Wehr setzen. Er sprach gut über sie, vor allem sprach er sie direkt an. Er sah ihr in das Gesicht dabei, was ihm sonst schwerfiel. Sie tauschten sich über die Umstände aus, unter denen sie lebten. Sie schauten sich in ihrem Leben um. Wenn auch, was sie sah, nicht dem entsprach, was er sah. Ich war mir der Kostbarkeit des Augenblicks bewusst. Der Mann meiner Mutter, mein Stiefvater, verstand noch nicht, dass seine Frau krank war, aber er drückte ohne Wenn und Aber seine Liebe aus. Und sie ihre Abhängigkeit von ihm. Und ihre Hilflosigkeit. Ich setzte mich auf den Stuhl, der vor dem Rauchtisch stand. Ich war zu jung, das lange schweigend auszuhalten. Als seine Rede schließlich wieder darauf hinauslief, dass alles schon gut würde, wenn sie nur ordentlich Pausen einlegte und sich ausruhte, sagte ich: »Aber wenn das nicht reicht? Wenn sie da nicht rauskommt, wenn sie es eben nicht kann? Wenn sie Hilfe braucht, um den Teufelskreis zu verlassen?« Er schnauzte mich an, was ich überhaupt mitzureden hätte, minderjährig, wie ich sei. »Das ist eine Sache zwischen deiner Mutter und mir, die dich nichts angeht. Kennst dich wohl im Leben aus?« Es war nach Mitternacht, aber ich blieb sitzen. Ich sah genau, wie er unsere Familie davor schützen wollte, seine Frau, sich selbst, nämlich vor allem davor, was die Leute sagen würden. Er sprach es nicht aus. Aber ich wusste, dass es ihm unangenehm, ja unheimlich war, dass seine Frau für verrückt gehalten werden könnte, dass sie in die Klapsmühle gebracht würde, dass es dann alle wüssten. Seine drei Cousinen besonders, die sich schon damals echauffiert hatten, als er eine Geschiedene mit Kind anbrachte. Sie hatten sich im Laufe der Jahre beruhigt, sich auf einen dauernd ironischen Tonfall gegenüber meiner Mutter zurückgezogen, den offenbar nur ich geringschätzig und oft auch gemein fand. Ich versuchte, ihm die Vorurteile auszureden, von denen er gar nichts gesagt hatte: »Es ist doch keine Schande. Wer ist nicht alles krank? Manche haben Krebs, manche haben einen Unfall. Viele müssen ins Krankenhaus. Es ist nicht gerade ein Schnupfen, aber doch auch kein Wahnsinn. Es ist eine Gemütskrankheit. Die Gefühle sind durcheinander. Das braucht eben, denke ich, doch einen Arzt und dass sie eine Weile weg ist, raus aus dem Alltag, aus dem allem hier.« »Was ist denn das alles hier?«, fragte er unwirsch. »Ich meine ihre Arbeit vorher. Die Arbeit in der Werkzeugmacherei, den Schiet.« Ich wollte nicht über sie in der dritten Person reden und sprach sie an: »Die Anstrengung dort, der Krach der Fräsen, die schlechte Luft. Kann sogar sein, dass es danach nicht so toll ist, nur den Haushalt zu haben. Kann es eine Unterforderung sein, dass du nun immerzu noch mehr machen willst, weil du wieder Hausfrau bist?« »Ja. Kann sein«, kam es zögerlich von ihr. »Das ist doch ganz normal, Haushalt, Hausfrau, das ist doch normal. Ist die Wohnung zu groß? Sind wir zu viele? Einmal am Tag warm essen, das geht doch«, stellte mein Stiefvater fest. Am Wochenende kochte oft er. Seit die Fünftagewoche eingeführt worden war und er sonnabends nicht mehr arbeiten musste, liebte ich besonders die kleinen Speisen, die er da zubereitete, mit einer gewissen ihm eigenen Pedanterie, aber guter Laune in der Küche, während ich am Tisch dabeisaß und auf Kartoffelpuffer oder Eierkuchen wartete. »Darum geht es doch nicht«, sagte ich. »Es geht ja nicht darum, wie es wirklich ist. Wenn du krank bist, siehst du die Welt anders. Die Wohnung ist schön, und ich denke auch, dass die Arbeit zu schaffen ist. Das sieht man ja gerade jetzt. Du hast alles so schön geputzt, es glänzt alles, fast zu sehr.« Wir Männer lachten, die Angesprochene zuckte nur kurz, wie im Schmerz, mit den Mundwinkeln. »Aber es geht schon zu lange. Es ist so wie eine Spirale, immer wieder von vorn, oder?« Meine Mutter bewegte langsam und halb ihren Kopf von oben nach unten. Mein Stiefvater schwieg. Wir saßen in der Sackgasse. Ich beschloss, einen Arzt zu finden.
Am Morgen schaute ich in das Telefonbuch, das in dem Schränkchen im Flur lag, obwohl wir kein Telefon besaßen. Darin fand ich einen Nervenarzt. Ich fragte meine Mutter, ob sie mit mir dorthin gehen würde. Sie widersprach nicht, sie nickte nur wieder halb und zog sich die Jacke über. Sie war ganz still. Wir gingen zunächst denselben Weg, den ich fast jeden Tag mit Rebekka nahm, von der Schönholzer Straße in die Ibsenstraße, wie über einen flachen Hügel, dessen Scheitelpunkt die Fußgängerbrücke bildete, darin eingegraben die Schneise des ehemaligen Nordrings. Links von uns der Stadtbahnhof Leninallee. Wir passierten das düstere Umspannwerk, dessen dunkle, burgartige Klinkerarchitektur mir seit Kindertagen unheimlich war. Manchmal seufzte meine Mutter, während sie tapfer ausschritt. Nach mehr als der halben Strecke, beim Friedensfahrtstadion hängte sie sich nicht mehr bei mir ein, ging selbständig. Wir nahmen das Treiben um den Stadtbahnhof Thälmannplatz nicht wahr, nicht die Straßenbahnen, nicht die Leute an den Ampeln, die Schlange an der Currywurstbude unter dem Hochbahnviadukt. Wir bogen in die Thälmannstraße ein und waren angekommen. In mir staute sich die Geschichte meiner Mutter, soweit ich sie bezeugen konnte, jene, die vor ihrer zweiten Hochzeit lag, die der Einsamkeit von Mutter und Kind. Die Anekdoten, die ich von ihr kannte, die sie gern wiederholte, von ihrem Leben davor, in denen ihr eigener Vater auftrat oder die böse Stiefmutter oder die Pflegeeltern in der Zeit der Evakuierung, wie sie es nannte, die kamen mir auch hoch, laut, deftig, böse. Und Erinnerungen an die Zeit mit meinem Vater, soweit sie nicht tabu waren in dem neuen Leben, trugen Farben auf sich. Nur unsere kurze zweisame Geschichte, die Zeit, in der ich als Sechsjähriger der Mann an ihrer Seite war, die blieb unter dem Schleier. Der Arzt gab ihr ein Rezept und eine Überweisung zur Vorstellung in einer psychiatrischen Klinik.
2
Ich schwang mich auf über Baumwipfel, flog über die Stadt und die Landschaft. Ich war aus der Björnsonstraße hinaus Richtung Bersarinplatz gestartet und hatte gleich abgehoben. In ausreichender Höhe, jenseits der Stadt, sah ich die flache Landschaft mit Feldern, Flüssen und Baumgruppen hingebreitet. Ich flog sicher und behände darüberhin. Sanfte Klangwellen erreichten mich, unter mir lag eine ganze Ebene davon. Ich flog sehr hoch. Ich justierte den Flug, war stabil über einem Wogen von Klängen und Farben. Nun versuchte ich ganz nahe, direkt darüberhin zu schweben, es gelang. Die Berührung, das sanfte Streifen der Linien, die vibrierten und Sounds erzeugten, war angenehm. Der Grund unergründlich. Dunkles, natürliches, weiches, moosiges Grün vielleicht. Ich spürte, wie meine Erektion darin eindrang, die Vibration aufnahm. Ich spürte, wie eine Hand mich erst sacht streifte, dann nach der Erektion griff und sie verstärkte. Unwillkürlich nahm ich die Hand und streichelte sie, die meine Erektion streichelte, die immer stärker wurde. Ich fühlte den Puls darin und wurde davon wach. Schon im Wachwerden nahm ich die Hand weg, die wirklich da war, die ihr gehörte. Meine andere Hand nahm ich aus ihrem Schoß, dass sie wieder mir gehörte, und mein Gesicht zog ich von ihrer dunklen steifen Brustwarze weg, und ich formte den Mund nicht mehr zum Saugen, hörte auf damit, ich wurde laut, ich schrie: »Was tust du? Was machst du? Was soll das werden?!« Doch halt, nein, ich wurde gar nicht laut. Ich schrie nicht. Ich machte es ganz sanft, zog mich aus ihrem Nachthemd heraus, unter das ich offenbar geraten war, und zog es wieder ganz über sie. Ich schüttelte den Kopf und sagte: »Komm, geh. Lass das. Ich bin nicht dein Mann. Mit dem kannst du das alles machen.« Sie schaute wie flehend, seufzte und ging. Am Tag darauf behielt man sie in dem katholischen Krankenhaus, das ihr empfohlen worden war. Es lag in einem Park und war umgeben von einer alten Ziegelmauer.
Vor dem zweiten Gespräch mit dem Magistrat, Abteilung Kultur, stand der Smarte wieder vor der Tür und fragte, ob ich am Freitag der Woche Zeit hätte. Er würde mich in dem Lokal Bornholmer Hütte treffen, gemeinsam mit dem Kollegen, der wie gesagt mehr Experte für Musik sei als er selbst. Dass er überhaupt kein Experte war, hatte ich schon begriffen. Es war die letzte Ferienwoche. Es passte mir, sagte ich. Ich blieb neugierig. Auch wenn sich durch die Art und Weise, wie er vor der Tür gestanden hatte und diesen Termin mit mir abmachte, und weil sie sich überhaupt in einer Kneipe mit mir treffen wollten, der Verdacht, es handelte sich um den Geheimdienst, neue Nahrung bekam. Die Spur von meinem Vater her war sowieso eindeutig genug, aber etwas in mir wollte es nicht wahrhaben. Zu sehr schmeichelte mir, dass der Magistrat, Abteilung Kultur, sich für meine Versuche, für meine Arbeit interessierte, für mich.
Von der Kneipe kannte ich nur das Fenster mit dem klobigen Modell eines alten Kriegsschiffs. Dessen Segel waren tabakrauchfarben und trugen rote Kreuze mit Serifen. Ich trat ein. Der Smarte kam mir entgegen. Der angekündigte, silberhaarige Kollege und er hatten sich im dämmrigen Licht des Fensters mit dem Schiffsmodell an einem großen, dunklen Tisch platziert. Wir bestellten drei Bier mit der Frage: »Warum nicht ein Bier?« Der ältere Mann sprach von seiner Hochachtung für meine Arbeit. Er sei erstaunt darüber und wollte gern wissen, wo ich mir denn bisher schon das Handwerkszeug dafür angeeignet hätte. Ich erzählte von meinem zurückgezogenen Leben, das es mir erlaubt hatte, diesen Sachen ungestört nachzugehen, mich dem Hören zu überlassen und einen Weg einzuschlagen, den meine Eltern zwar nicht verstünden, aber mich dabei in Ruhe ließen. So habe es sich ergeben. Dass ich von A bis Z Autodidakt sei. Dass ich mich selbst hervorbrächte. Meine Plattensammlung. Ausführliche Beschäftigung mit Renaissancemusik für Gitarre, die zu spielen ich mir selbst beigebracht hätte. Die Schallplatten aus dem Haus Ungarn hier in Berlin, Alte Musik, Bálint Bakfark, dann Bartók, Kodály. Ob der Silberhaarige den »Mikrokosmos« von Bartók kenne? Er bejahte mit einem Lächeln. Nun erzählte ich erst recht von der entscheidenden Reise, von der dritten Tour nach Ungarn im letzten Jahr. Ich schwärmte, redete, ich klappte das Visier hoch, machte die Schleusen auf in der Bornholmer Hütte vor meinen zwei zugewandten, aufmerksamen Zuhörern. Ich erzählte davon, wie ich mit meinen ersten Kompositionen Freunde gewonnen hätte. Nach denen fragte der Ältere sofort: »Sind es auch wie Sie Talente, auf die wir aufmerksam werden sollten? Was machen Sie so, wenn Sie zusammen sind? Musizieren?« »Ja, auch«, sagte ich. »Improvisieren und Blues und Rock spielen zum Spaß. Wir gehen auch zusammen zu Konzerten. Mit der E-Musik, das mache ich eher allein. Nur Jazzfans sind wir alle. Sie kennen ja sicher die Tanzbar Alte Meierei, wissen, dass da montags immer Jazz ist.« Das wäre gut. Das wäre interessant. Sie lächelten mich beide an. Ich war etwas wie freudig erregt. »Da kann man doch etwas machen«, sagte der Silberhaarige. »Das wird fein. Um weitere Einzelheiten zu besprechen, treffen wir uns bald. Dazu kommen Sie bitte das nächste Mal in unsere Räume im Roten Rathaus.« Das klang gut. Wir hoben die Neigen Bier. Wir schüttelten uns kräftig die Hände. Ich lief frohgemut die Thälmannstraße runter. Meine Wangen waren rot von dem Bier und vom Optimismus. Den Zweifel hielt ich klein, er wurde überstrahlt durch die Einladung in das Rote Rathaus. Der Experte hatte eigentlich nichts über meine Kompositionen gesagt, nichts Genaues. Aber mir Komplimente gemacht. Und Hinweise auf Musik verstanden. Mit geschwellter Brust schritt ich davon. Magistrat, Abteilung Kultur, Rotes Rathaus. Die nahmen das ernst, meine Kompositionen, mich.
Das erste Mal im Leben, dass ich bewusst mit meinem Stiefvater und einer seiner Handlungen, die mich betrafen, nicht nur einhundertprozentig einverstanden, sondern an seiner Seite glücklich war, stand unmittelbar bevor. Wir sollten umziehen. Die Gegend, in der er aufgewachsen war, wo er sein Leben im Wesentlichen in ein und derselben Wohnung und ich meines auch schon die längste Zeit verbracht hatte, war zum Sanierungsbezirk erklärt worden. Die Behörden wollten an ein paar Ecken retuschieren, was den Augenschein bestimmte, das Grau. Grau war der Grundton von unser aller, also auch meinem Leben, ob ich mich nun in meinem Zimmer zum Hof einrichtete oder die Straßen benutzte als ein mehr und mehr Aufhorchender, als ein sich langsam Aufrichtender, dieses unmissverständliche, raumfüllende, langanhaltende Grau im Tempo grave. Lebensgrau, könnte man sagen. Sagte man auch. Blätternder, Blasen schlagender Putz. Farbe trugen höchstens die Ziegel, wenn die lose Außenhaut der Gebäude abfiel, einem auf den Kopf oder in die Finger fiel als sandige Substanz, pochte man an eines der Häuser, aus Spaß, aus Langeweile, aus Unmut, um ein Geräusch zu erzeugen, um sich Gehör zu verschaffen. Meine Eltern sollten in eine sogenannte Umsetzerwohnung ziehen, auf Zeit um die nächste Ecke herum, solange eben das Haus saniert würde, in das sie danach wieder zurückkehren könnten. Zur Wahl stand auch, aus dem provisorischen Wohnen ein bleibendes zu machen. Sie wählten, nur einmal umzuziehen. Ich hatte meinen achtzehnten Geburtstag gerade hinter mir. An der Seite meines Stiefvaters marschierte ich zum Sonderbaustab, der für die Sanierung des Stadtteils zuständig war. Wir warteten, wie zu warten üblich war vor den Büros der staatlichen Wohnungswirtschaft. Ich saß kaum still neben dem Stiefvater, der seine hageren Einszweiundneunzig in aller Seelenruhe zusammengefaltet hatte. Ich hing mit jeder Faser an der Hoffnung auf diese einfache Abnabelung. Wir wurden aufgerufen. Er nannte seinen Namen und erklärte gegenüber der Dame vom Sonderbaustab: »Mein Sohn hier, der ist jetzt volljährig. Und wenn wir sowieso umziehen müssen wegen der Sanierung, dann dachten wir, könnte er doch gleich eine eigene Wohnung bekommen. Seine Freundin, mit der er zusammenziehen wird, ist übrigens schwanger.« Ich staunte. Wir hatten das nicht abgesprochen. Es war ein genialer Trick. Und siehe, das Wunder geschah. Die Dame zögerte nicht einmal. Die notorische Art in diesen notorischen Bürostuben war, einen zappeln zu lassen. Nicht hier, nicht in diesem Augenblick. Etwas war außer Kraft. Sie tauchte mit einem »Na, dann schauen wir mal, ob wir da etwas tun können!« zu einer Schublade hinab und mit Papieren wieder auf, die offenbar freie Wohnungen betrafen. Zwei davon legte sie mir vor, mit Grundriss und Adresse, mit allem Drum und Dran. Hinterhaus, vierte Etage, Zimmer, Küche, Innentoilette, in der Nähe gelegen. Ich griff zu. Eine Woche später unterschrieb ich den Mietvertrag. Mit Rebekka gemeinsam kaufte ich ein paar Packungen geleimte Wandfarbe. Drei Abende später lagen wir – es war ein Sonnabend, ihr Ausgang Freitag und Samstag bis zehn Uhr verlängert – in dem frisch geweißten Zimmer auf der frisch bezogenen Matratze auf dem Boden und flüsterten einander in die heißen Ohren: »Jetzt müssen wir nicht mehr aufpassen.«
Das zwölfte Schuljahr, mein letztes. Ich fand viele Ausreden und hatte oft ein Attest vom Arzt, der späte Pubertätszeichen zu wechselnden Krankheiten umdeutete. Gelegentlich waren es große, heiß ausstrahlende Pickel, die mit dem Scharfen Löffel ausgeschabt werden mussten. Das reichte schon einmal für zwei Tage Wegbleiben. Zahnarztbesuche inszenierte ich ähnlich, Nasennebenhöhlenentzündungen, fiebrige Angina. Es fehlte nicht an Gelegenheiten. Die Nachmittage und frühen Abende bis zur sturen neunten Stunde verbrachte ich mit Rebekka, mit unseren Freunden, die Wochenenden sowieso. Wir blieben viel Zeit im Bett, heizten, als der Herbst kam, mit Begeisterung den eigenen Kachelofen, kochten uns Nudeln oder Eintopf auf dem tatsächlich vorhandenen dreiflammigen Gasherd. Die Abende und Nächte allein saß ich über Konzepten, Ideen, Notierungen. Oft allerdings war ich vorher über die Brücke von Zorn und Trauer gegangen und brauchte Abstand zu ihr, um mich ruhig an die Arbeit setzen zu können. Aus Minuten, die Rebekka zu spät nach Hause kam, wurden immer wieder Tage Stubenarrest, rasch eine Woche. Wollten wir mehr Zeit für uns, mussten wir ankündigen, wofür wir sie brauchten. Wir gingen ins Kino, mal wirklich, mal nicht, ins Theater, ins Konzert, zum Jazz. Anfang Dezember wussten wir sicher, dass sie schwanger war. Sie sagte es ihren Eltern in einem Moment, wo sie gleich die Wohnung verlassen konnte. Deren Schockstarre wich zum Glück nur einer kurzen Phase der Beschimpfungen, dann ließen sie von ihr ab. Lockerungen des Regiments gab es nicht. Ich ging die Wand hoch von dem Haus, in das ich nur einmal eingetreten war, um beinahe von ihrem Sportlerstiefvater die Treppe heruntergeprügelt zu werden. Ich ging Haus um Haus in der Straße die Wände hoch, und in den anderen Straßen auch, die schwarzen Wände der abendschwarzen Häuser. Ich stapfte bebend vor Ohnmacht mitten auf der Fahrbahn auf den nassen, glitschigen Pflastersteinen vor mich hin, zog durch die Schluchten der Stadt als heulender Wolf, ließ mit böser Lust den eisigen Regen bis zu den Haarwurzeln durchrinnen. Zu Hause angekommen, schüttelte ich das Fell aus als der Hund, als der ich mich fühlte. Daraus folgten böse Kopfschmerzen, die am Morgen zum Glück nachgelassen hatten, aber mir als Argument gegen die halbe Stunde Schulweg ausreichten. Sowieso verschlief ich immerzu. Nach den Nächten über dem raschelnden, dem klingenden Papier. Und wenn ich in der Schule saß wie heute, wenn es nur irgend Anlass gab, ließ ich meinen Zorn los auf die Stalinisten, auf den Klassenlehrer, der Russisch und Deutsch unterrichtete, auf die stellvertretende Direktorin, die auch Russisch unterrichtete, auf den Direktor Kahlberg. Die russische Sprache, die aus Wörtern wie Internationalismus, Brüderlichkeit, Trasse der Freundschaft bestand, konnte mich sowieso und sonst wo. Im Rias Treffpunkt hatte ich vom Verbot der Gruppe Renft gehört. Mir gefielen deren einfache Melodien und Texte. Das, dachte ich, passte in den Deutschunterricht. Es wurde zunächst ein Verhör durch den Lehrer daraus. Er wüsste gern die Quellen der Information. Mein Interesse an verbotenen Liedermachern sei ihm auch zu Ohren gekommen. Solange steckten die Klassenkameraden erst einmal die Köpfe in den Sand. Dann wachten sie auf. Als Erstes der Dialektiker, der nicht auf Renft stand. Er finde meine Weise zu argumentieren fragwürdig, einerseits, andererseits habe er aber auch Verständnis für meine Position. Folgte mein Biochemiekumpel Lars, er sei Fan der Klaus Renft Combo, und basta. Dann redete die Oberzicke, die gegenüber dem Dialektiker hervorhob, eine eigene Meinung zu vertreten, aber doch sagen wollte, dass man es so wie der Einzweck einfach nicht sagen könnte. Hinten saß der Sohn eines Geheimdienstoffiziers. Der erklärte uns zu den Staatsfeinden, die wir schon immer gewesen wären, fand uns allesamt töricht und unsere Art und Weise, über solche Dinge zu sprechen, fahrlässig. Man sollte unbedingt mit dieser Diskussion aufhören. Dem stimmte der Klassenlehrer zu.