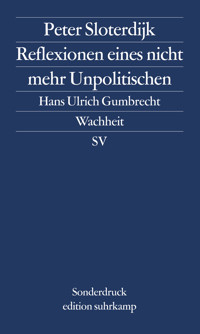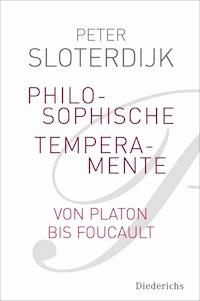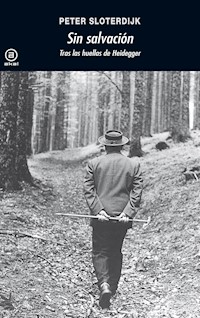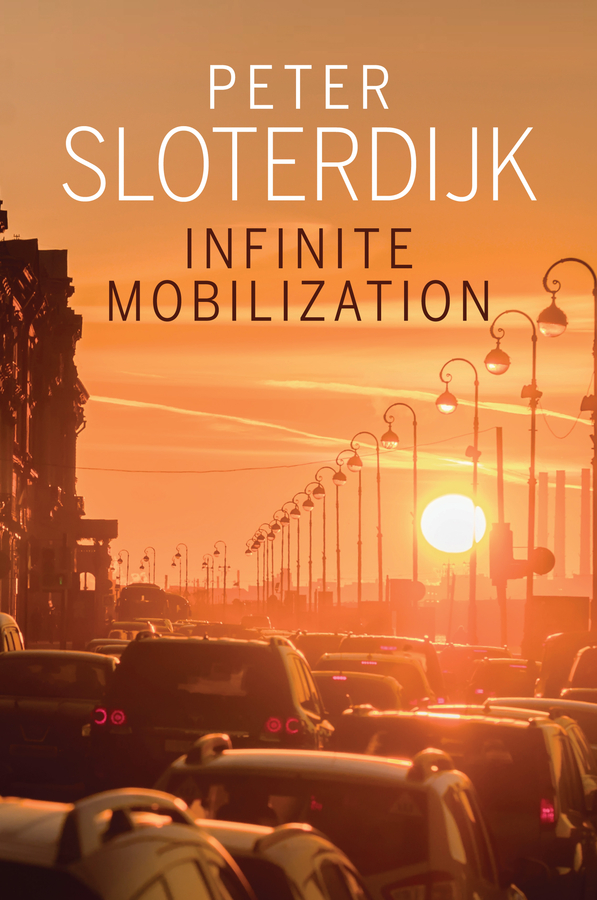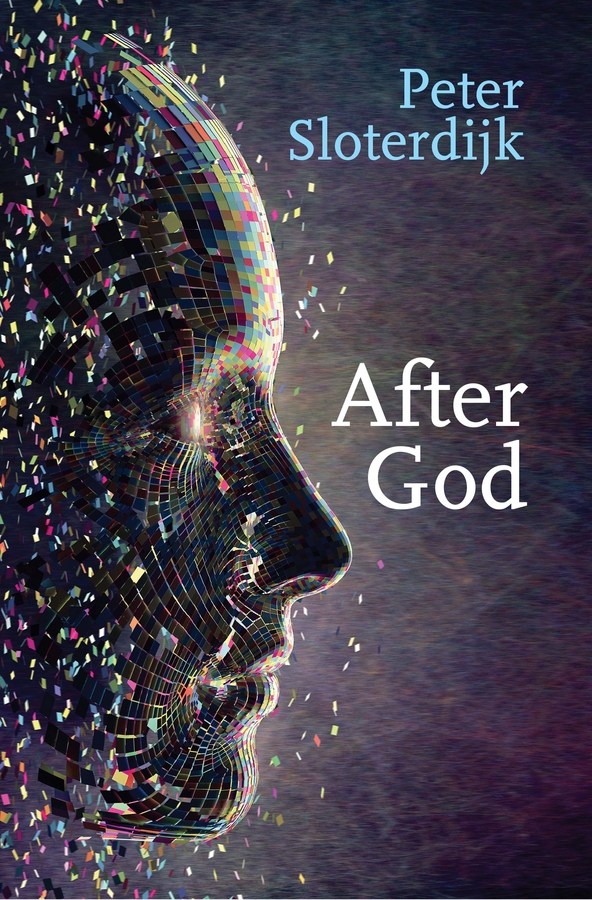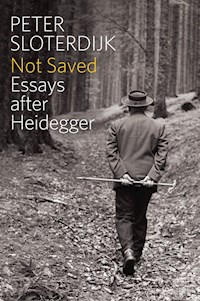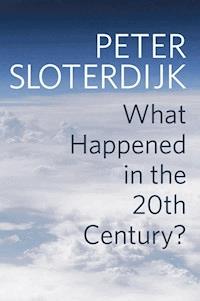11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
»Ich möchte in diesem Band meine konfliktträchtige These noch einmal erläutern, wonach in einer demokratischen Gesellschaft Steuern aus Zwangserhebungen in freiwillig erbrachte Bürgerspenden für das Gemeinwesen umgewandelt werden müßten – für eine Anfangszeit zu einem bescheidenen Prozentsatz, später progressiv in höheren Proportionen. Nur eine solche Transformation, behaupte ich, könnte die in Routinen mechanisierter Solidarität erstarrte Gesellschaft reanimieren und einen neuen Hauch von Gemeinwesenbewußtsein in die selbstbezüglich gewordenen Funktionssysteme tragen.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
»Ich möchte in diesem Band meine konfliktträchtige These noch einmal erläutern, wonach in einer demokratischen Gesellschaft Steuern aus Zwangserhebungen in freiwillig erbrachte Bürgerspenden für das Gemeinwesen umgewandelt werden müßten – für eine Anfangszeit zu einem bescheidenen Prozentsatz, später progressiv in höheren Proportionen. Nur eine solche Transformation, behaupte ich, könnte die in Routinen mechanisierter Solidarität erstarrte Gesellschaft reanimieren und einen neuen Hauch von Gemeinwesenbewußtsein in die selbstbezüglich gewordenen Funktionssysteme tragen.«
Peter Sloterdijk, geboren 1947, ist Professor für Ästhetik und Philosophie an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe und lehrt an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Zuletzt erschienen von ihm im Suhrkamp Verlag Du mußt dein Leben ändern. Über Anthropotechnik (st 4210), Scheintod im Denken. Über Philosophie und Wissenschaft als Übung (eu 28) und Zorn und Zeit. Politisch-psychologischer Versuch (st 3990).
Peter Sloterdijk
Die nehmende Hand unddie gebende Seite
Beiträge zu einer Debatte überdie demokratische Neubegründungvon Steuern
Suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2012
Originalausgabe
© Suhrkamp Verlag Berlin 2010
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Rechteinhabers reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag gestaltet nach einem Konzept von Willy Fleckhaus: Rolf Staudt
eISBN 978-3-518-79640-5
www.suhrkamp.de
Inhalt
Vorwort: Die nehmende Hand und die gebende Seite
1. Rückblick auf eine verzerrte Diskussion
2. Der nehmende Staat
3. Die neuen sozialen Fragen
4. Unterwegs zu einer Ethik des Gebens
Dokumentation
1. Die ganze Welt schien reif für die Sozialdemokratie.Von Heuschrecken und unverdientem Reichtum.Im Gespräch mit Dieter Schnaas
2. Kapitalismus ist ein janusköpfiger Prozeß.Im Gespräch mit Guido Kalberer
3. Wir lebten in einer Frivolitätsepoche.Im Gespräch mit Paul Jandl
4. Unruhe im Kristallpalast.Im Gespräch mit Frank A. Meyer
5. Verschwendung für alle.Im Gespräch mit Holger Fuß
6. Kapitalismus und Kleptokratie.Über die Tätigkeit der nehmenden Hand
7. Tragische Sozialdemokratie
8. Eingeweide des Zeitgeistes.Im Gespräch mit Matthias Matussek
9. Ansichten der Finanzkrise.Im Gespräch mit Sven Gächter
10. Von Zauberern und Philanthropen.Im Gespräch mit Eva Karcher
11. Worauf beruht der Steuerstaat?Im Gespräch mit Marc Beise
12. »Steuern sind das zentrale moralische Phänomenunserer Zivilisation«.Im Gespräch mit Stephan Maus
13. Dankesschreiben vom Finanzamt.Im Gespräch mit Holger Fuß
14. Letzte Ausfahrt Empörung.Über Bürgerausschaltung in Demokratien
Vorwort: Die nehmende Handund die gebende Seite
1. Rückblick auf eine verzerrte Diskussion
Das politische Feuilleton unserer Tage lebt davon, daß es in endlos variierten Formulierungen vier Gemeinplätze umwälzt. Erstens: Die Globalisierung unter neoliberaler Regie hat in letzten Jahrzehnten eine neue soziale Frage entstehen lassen, die sich durch das immer stärkere Aufklaffen der Schere zwischen Arm und Reich manifestiert – im globalen Maßstab wie auf nationaler Ebene; während die absolute Armut stellenweise zurückgeht, nimmt die die relative Armut in den wohlhabenden Gesellschaften zu. Zweitens: Die traditionelle Linke, die wesentlich Arbeiter- und Arbeitnehmerbewegung war, ist tot und kehrt doch aufgrund der neuen Gegebenheiten als Interessenorganisation der Prekären und Arbeitslosen wieder – wobei ihre potentielle und reelle Klientel das ärmere Fünftel der reichen Gesellschaften umfaßt – genug für eine Partei wie Die Linke, zu wenig für eine Sozialdemokratie herkömmlichen Stils. Drittens: Die modernen sozialen Systeme – sprich die wohlfahrtsstaatlich organisierten Nationalstaatsgesellschaften der Ersten Welt – haben die Fähigkeit entwickelt, ihre früher so genannten systemsprengenden »Widersprüche« in stimulierende Irritationen umzuwandeln und aus internen Konflikten Anlässe zu systemstabilisierendem »Lernen« zu machen – sehr zur Enttäuschung derer, die ihre Hoffnungen auf die »Revolution«, die »Katastrophe« oder das »Ereignis« setzten. Viertens: In einer Situation wie dieser liegt die Chance des sozialen Protests fast ausschließlich in der Auslösung von Skandalen – daher ist der gute Gebrauch des Skandals eines der Mittel, das utopische Potential der politischen Lebensform Demokratie am Leben zu halten.
Ich möchte mit der hier vorgelegten Dokumentation einiger meiner Äußerungen zur aktuellen Debatte über die neue soziale Frage den Vorschlag machen, diese Gemeinplätze und ihren inneren Zusammenhang anhand eines plötzlich zum Politikum gewordenen Themas zu überprüfen: Tatsächlich hatte ich – und nicht nur beiläufig, sondern mit ernstgemeinten Argumenten – vor einiger Zeit angeregt, eine allmähliche Umwandlung des bestehenden Steuersystems von einem bürokratisierten Ritual der Zwangsabgaben in eine Praxis freiwilliger Bürgerbeiträge zum Gedeihen des Gemeinwesens in Erwägung zu ziehen. Dieser Vorschlag mochte ungewöhnlich klingen, er ergab sich jedoch mit zwingender Konsequenz aus den anthropologischen und moralphilosophischen Überlegungen, denen ich mich seit einer Reihe von Jahren widme: Sie kondensieren sich in der Empfehlung, die überzogene Erotisierung unserer von Aneignungsaffekten dominierten Zivilisation durch eine stärkere Betonung der thymotischen, das heißt stolzhaften und gebenden Regungen auszugleichen.1 Sollte ein Hauch von Ironie an meinen Thesen zu bemerken gewesen sein, so wäre diese durch eine berufsbedingte Selbstdistanz zu erklären. Ein Autor kann normalerweise ziemlich gut einschätzen, wann er etwas von sich gibt, was aller Wahrscheinlichkeit nach in den Wind gesprochen ist. Zumindest schien es mir so: Ohne den Beweis durch die Tatsachen hätte es niemand, ich selbst zu allerletzt, für möglich gehalten, daß eine Wortmeldung zu dem hierzulande seit Jahrzehnten monoton diskutierten Komplex der unumgänglichen und doch unmöglichen »Steuerreform« überhaupt jemals noch Aufmerksamkeit erregen könnte.
Genau dies jedoch geschah im Anschluß an einen kompakten Essay, den ich am 10. Juni 2009 zu der (aus Anlaß der internationalen Finanzkrise nach dem Crash der Lehman-Bank im September 2008) von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung lancierten Serie über »Die Zukunft des Kapitalismus« vorgelegt hatte – die Reihe als ganze erschien vor etwa einem halben Jahr als Buch in der edition suhrkamp.2 Mit einer Verzögerung von wenigen Monaten wurde dieses Papier, das unter dem redaktionellen Titel »Die Revolution der gebenden Hand«3 erschienen war, von einem aufgebrachten Leser zum Anlaß genommen, zu behaupten, der Verfasser habe sich nun für immer aus dem Kreis der zurechnungsfähigen Zeitgenossen verabschiedet. Der Angriff auf meine Thesen erfolgte in einer Ausgabe der Zeit im September 2009 unter dem (wohl ebenfalls redaktionellen) Titel »Fataler Tiefsinn aus Karlsruhe«. Er stammte aus der Feder von Axel Honneth, einem Nachfahren der Frankfurter Schule – ich habe darauf halbwegs gelassen, aber nicht ganz ohne Zuspitzungen, mit einer Replik in der FAZ geantwortet, in der ich meine Idee noch einmal erläuterte, wonach nur eine Ethik des Gebens die Stagnation der zeitgenössischen politischen Kultur überwinden könnte.
Aus der nun kanalisierten Erregung über meine mit Hilfe der Feuilletonredaktion der Zeit effektvoll verzerrten Thesen entwickelten sich mehrere parallele Debatten, die in einigen Tages- und Wochenzeitungen über ein paar Monate am Leben gehalten wurden – teils unter dem Stichwort »Klassenkampf von oben« (was in meinen Augen eine ziemlich eigenwillige Abschweifung vom Thema »Steuerreform aus dem Geist des Gebens« bedeutete), teils in Form von Beiträgen zu einer Standortbestimmung einer aktuellen Linken (was ich noch immer für eine produktive Fragestellung halte, obschon mir, wie vielen Zeitgenossen, nicht entgangen ist, wie wenig die herkömmliche Links-Rechts-Unterscheidung zum Verständnis der heutigen sozialen Verwerfungen beiträgt). Ich hatte von der Bedeutung der Großzügigkeit für die Demokratie sprechen wollen, um den Weg zu einem empathisch umgestimmten Gemeinwesen anzudeuten – die Mehrheit der Kommentatoren jedoch wollte meine Thesen so lesen, als hätte ich unter dem Stichwort »Freiwilligkeit« eine Steuersenkung für die Reichen gefordert. Ich hatte von einer Intensivierung des Gemeinsinns durch die erweiterte Spendentätigkeit gehandelt, meine Kritiker hingegen wollten in diesen Überlegungen gefährliche Lockerungsübungen erkennen, die auf nicht weniger als die Zerstörung des Sozialstaats zielen. Damit die Komik zu ihrem Recht kommt, erwähne ich die von einem fröhlichen Blogger aufgebrachte Idee, ich hätte mich mit meinem Essay um die Mitgliedschaft bei den Freien Demokraten beworben. Wer Geschmack an der Groteske hatte, kam auf seine Kosten durch die von einem Honneth-Leser aufgestellte These, ich wolle zum »antifiskalischen Bürgerkrieg« aufrufen. Wer auf Delirien Lust hatte, fand auch dieses Bedürfnis befriedigt: Unter dem Datum vom 21. Januar 2010 las man in der Zeit eine Umdrehung meiner Thesen, die hohe Erwartungen ans Kabarett aus der Anstalt erfüllte: Ich hätte die Bettelei befürwortet, indem ich Überlegungen zur Reform der Fiskalität durch den Einbau freiwilliger Elemente in sie anstellte!4 Solche Kuriosa erwähnt man nur, wenn sie zur Sache selbst gehören: Wer in dem heutigen stark re-ideologisierten intellektuellen Feld der BRD den Versuch unternimmt, eine Programmatik für eine parteilich-überparteilich zukunftweisende Finanz- und Sozialpolitik im 21. Jahrhundert zu definieren, die mit dem Vorschlag verbunden ist, endlich auch die Wohlhabenden zu integrieren und die Gemeinwohlidee nicht mehr bloß durch erzwungene Umverteilung zu sichern, sondern in einer Ethik des Gebens auf breitester Basis zu begründen, muß sich auf Widerstand seitens der Verteidiger jahrhundertealter Klischees gefaßt machen.
Debatten enden hierzulande in der Regel damit, daß das Publikum seine von den Medien permanent umworbene Aufregungsbereitschaft nach kurzer Zeit anderen Themen zur Verfügung stellt. Am Ende siegt regelmäßig die Erschöpfung über das Lernen. Der demokratische Gebrauch der Aufregung bestünde im vorliegenden Fall darin, gewisse Thesen, die, zum Halbsatz verkürzt, provokativ und abwegig erscheinen, in den richtigen Kontext zu stellen und sie in weiterwirkende Anregungen umzuwandeln. Die hier zusammengestellten Dokumente sind als Beiträge des Autors zu einem Diskussionsexperiment zu lesen, das über die Entstellungen und Projektionen hinausführt, wie sie in vielen Artikeln des vergangenen Jahres zutage kamen. Ich möchte meine konfliktträchtige These noch einmal erläutern, wonach in einer demokratischen Gesellschaft Steuern aus Zwangserhebungen in freiwillig erbrachte Bürgerspenden für das Gemeinwesen umgewandelt werden müßten – für eine Anfangszeit zu einem bescheidenen Prozentsatz, später progressiv in höheren Proportionen. Nur eine solche Transformation, behaupte ich, könnte die in Routinen der Staatsverdrossenheit erstarrte Gesellschaft reanimieren und einen neuen Hauch von Gemeinwesenbewußtsein in die selbstbezüglich gewordenen Funktionssysteme tragen. Eine Wiederbelebung dieser Art käme einer Kehre gleich, die unserem entgeisterten politischen Betrieb eine moralisch anspruchsvolle Alternative zum visionslosen Weitermachen im Gewohnten aufzeigt.
Natürlich wäre es naiv, von einer Neubestimmung der Gemeinwesenfinanzierung all die Effekte zu erwarten, die sich die Wohlmeinenden von einem Konzept wie »soziale Gerechtigkeit« oder gar von der Utopie einer »post-kapitalistischen« Wirtschaftsweise versprechen. Gleichwohl bin ich der Überzeugung, eine tief ansetzende Neuausrichtung der Steuertätigkeit könnte einen wichtigen Schritt in die gute Richtung bewirken. Zu diesem Zweck ist es keineswegs nötig, erneut den »Geist der Utopie« zu beschwören oder hilflose Großbehauptungen wie un altro mondo è possibile zu wiederholen. Es sollte genügen, zu zeigen, daß eine andere Idee von Steuern möglich ist – und daß von einer entsprechenden alternativen Praxis weitreichende Impulse zur Revitalisierung des Gemeinwesens ausstrahlen. Über die Chancen für die rasche Akzeptanz meiner Überlegungen machte ich mir von vornherein wenig Illusionen. Auch ich weiß, was systemische Trägheiten sind. So gut wie jeder andere bin ich mit dem Phänomen vertraut, daß eingeschliffene Vorurteile um ihr Überleben kämpfen, und das steuerpolitische Vorurteil hat sieben Leben. Dennoch scheint es mir nötig, die Fragwürdigkeit, mehr noch, die Destruktivität des herrschenden Zwangssteuersystems zu verdeutlichen – von der babylonischen Irrationalität seiner Ausgestaltung in unserem Land ganz zu schweigen.
Ich lege dem Publikum insgesamt ein gutes Dutzend Dokumente aus jüngerer Zeit vor – den eben genannten FAZ-Aufsatz und eine Reihe von Interviews und Statements, mehrheitlich aus dem letzten und vorletzten Jahr, in denen ich auf Fragen von Journalisten zum aktuellen Thema und zum Umfeld der weltweiten Finanz- und Moralkrise der Gegenwart antworte. Mir schien es plausibel, einige Gespräche in die Sammlung einzuschließen, die einen weiteren thematischen Fokus aufweisen und auch von anderen Sorgen als von der besseren Begründung der Steuern handeln. Sie führen aufs Feld der allgemeineren Zeitdiagnostik und enthalten Verständigungen über globale Trends. Vor allem zeigen sie, wie das in meinen Büchern des letzten Jahrzehnts stets präsente Motiv einer Psychopolitik der Großzügigkeit von vornherein in den Horizont einer Ethik der Gabe eingebettet ist.
2. Der nehmende Staat
Auf den ersten Blick erscheint im Verhältnis zwischen den Staaten und ihren Gesellschaften nichts so normal wie die Tatsache, daß sich die öffentliche Hand am produktiven wie am konsumtiven »Leben« der Gesellschaft durch alle Arten von Steuererhebung und Abgabenerzwingung »beteiligt«. Der Steuerstaat ist eine Instanz, die praktisch bei allen Geschäften seiner Bürger als nehmende Partei im Spiel ist. Er bildet die Idealbesetzung für die Rolle des unsichtbaren Dritten bei jedem bilateralen Tausch. In Gemeinwesen des in Europa heute dominierenden Typs wird kaum irgendwo ein Tag bezahlter Arbeit geleistet, ohne daß der Fiskus auf seinem Vorrecht besteht, den Ertrag derselben mit einer Steuer zu belasten. Auch der Konsum wird punktgenau erfaßt. Es wird keine Zigarette geraucht, ohne daß der Finanzminister aus dem grauen Dunst seinen Vorteil herausliest, es wird kein Glas Wein getrunken, ohne daß der Fiskus mit angeheitert würde. Es wird von »Menschen unterwegs«, man sagt auch: von Mobilitätskonsumenten in eigenen Fahrzeugen, kein Kilometer zurückgelegt, ohne daß die staatliche Seite dabei das Ihre kräftig geltend macht. Man kann keine Suppe auswärts essen und keine Nacht in einem Hotel verbringen, ohne daß der Fiskus seine Hand auf die Rechnungen legt. In früheren Zeiten nahm der französische Fiskus die Zahl der Fenster an Häusern zum Vorwand, um den Ausblick mit einer Steuer zu belegen, er zählte die Kamine an einem Gebäude, um von ihrer Anzahl die Höhe der Abgabe für das menschliche Wärmebedürfnis abzuleiten. Die preußische Staatsweisheit ersann die Mahl- und Schlachtsteuern (die bis 1873 erhoben wurden), um überall den Fiskus mit zu Tisch zu bitten, wo Bürger Brot und Fleisch verzehrten.
An Begründungen für den Steuerzwang hat es nie gefehlt – von alters her führten die Schatzverwalter jedes nur denkbare Argument ins Feld – vom Willen der Götter bis zur Not des Vaterlandes. Unsere Gewöhnung an die Zumutung, an die immer durchschlagend bewiesenen staatseigenen Wahrheiten zu glauben, reicht bis in alte Schichten unseres Daseins als politische Wesen. Fiskalische Unterwerfungsübungen gehen bis auf frühe Staatsbildungen zurück, und die Resignation der Geber reicht tief, trotz gelegentlicher Rebellionen (»No taxation without representation!«). Auch die gegenwärtigen Zustände fügen sich in das Kontinuum der widerspenstigen Ergebung ins fiskalische Schicksal ein. Schwerlich läßt sich ein Tatbestand des zeitgenössischen Lebens benennen, der so hintergrundwirksam wäre wie die konfuse Überzeugung: daß es dem Staat eben irgendwie zukommt, bei allen Vorgängen unseres ökonomischen und vitalen »Stoffwechsels« auf seine Weise mit im Spiel zu sein – und im Spiel sein, das heißt hier: eine Prämie auf alles nehmen.
Hätte der Gedanke, die Gewährung von Bürgerrechten sei gegen die Erfüllung von Bürgerpflichten aufzurechnen, je einer Illustration bedurft, sie würde durch den Hinweis auf die aktuelle Steuerlast der einzelnen, der Haushalte, der Betriebe und der Körperschaften geliefert. Seit langem wird diese Bürde wie eine natürliche Gegebenheit hingenommen; nur libertäre Querulanten mucken hin und wieder gegen das fiskalische Fatum auf. Damit wir uns recht verstehen: Es steht außer Frage, daß der Staat, der autoritäre wie der freiheitliche, eine hinreichend gefüllte Schatztruhe braucht, um seinen Aufgaben nachkommen zu können. Er wird an so vielen Fronten zum Tätigwerden berufen: als Befehlshaber einer Streitmacht, als Bürge für die Sicherheit seiner Schutzbefohlenen im Inneren, als Organisator von Infrastrukturen, als oberster Präfekt des Schulwesens, als Schutzherr des Rechtssystems, als Wächter über die Orthographie sowie als Dienstherr zahlloser sonstiger Ordnungsfunktionen – nicht zuletzt als Garant seines Engagements für die Benachteiligten und Schwachen –, so daß kein Bürger sich der Einsicht entziehen kann, er müsse seine Taschen für den schwer beanspruchten großen Bruder öffnen. Zur Fülle der Aufgaben kommt hinzu, daß der Staat als Kommandeur eines stehenden Heeres eigener Bediensteter auf dem Posten sein muß. Mit gut viereinhalb Millionen Beschäftigten ist der Öffentliche Dienst hierzulande der lebende Beweis dafür, daß der Staat bei der Schaffung von Arbeitsplätzen im eigenen Hoheitsgebiet geradezu kreativ zu werden vermag. Man kann dem heutigen Staat alles mögliche vorwerfen, nur das eine nicht: daß er die Seinen vergäße.5
Kommen wir zur Sache! Niemand hat je im Ernst geleugnet, daß zu einer geordneten Staatlichkeit ein zuverlässiges Finanzwesen gehöre. Meine Anregungen tasten die gültigen Evidenzen nicht an. Was selbstverständlich ist, soll selbstverständlich bleiben. Wären Steuern, wie manche sagen, nur der natürliche Preis des Glücks, in einem effizienten Staat zu leben, so bräuchte man über ihre weitere Begründung kein Wort zu verlieren – obschon über ihre Höhe zu streiten bliebe.6 Jedoch: Es gibt es im verborgenen Kern des Selbstverständlichen einen Komplex von Annahmen, die sich bei näherem Zusehen als ein völlig inkohärentes und unplausibles Konstrukt erweisen.
Auf diese schwache Stelle zielt, was ich im Folgenden erläutern will. Wer dort genauere Sondierungen vornehmen möchte, stößt fürs erste auf die Mauer der Tatsächlichkeit: Der aktuelle Staat ist, wie jeder seiner Vorgänger, ein nehmender Staat, der immer eben gerade so viel nimmt, wie er faktisch nimmt. Sollte man ihn jemals mit der Frage konfrontieren, wie er sein nehmendes Benehmen rechtfertigt, so wird man feststellen: Er ist es gewohnt, in Tautologien zu kreisen. Er erhebt Steuern, weil es zum Staatsein gehört, Steuern zu erheben, und er braucht das Geld, weil es keinen Staat gibt, der das Geld nicht braucht. Auf diese abweisende Logik kann der Bürger allein mit Fatalismus antworten. Den vernimmt man in dem Bonmot, das Benjamin Franklin kurz vor seinem Tod einem Briefpartner anvertraute: »Völlig sicher sind auf dieser Welt nur zwei Dinge, man stirbt und man zahlt Steuern.«7
Wenn Einmütigkeit darüber besteht, daß sich der Staat rechtens als eine Instanz darstellt, die zu ihrem Funktionieren ausreichende Mittel braucht, kann eine tiefer eindringende steuerethische Debatte sich allein an der Frage entzünden, wie dieses Brauchen artikuliert wird und wie es sich vor den Bürgern erläutert. Kein geringerer als Thomas von Aquin hat die Praxis der Besteuerung im 13. Jahrhundert als »legalen Raub« bezeichnet – nach mehr als siebenhundert Jahren wartet man noch immer auf bessere Erklärungen für das Beiwort »legal«. Die Überprüfung hätte darauf zu achten, mit welchen Argumenten die nehmende Staatlichkeit sich vor der gebenden Gesellschaft rechtfertigt; wie sich der Wille zum Nehmen seitens des staatlichen Apparats in der Praxis äußert; und ob für die Bürger demokratischer Gemeinwesen angemessene Spielräume für eigene Stellungnahmen zu den fiskalischen Bedarfsdiktaten bestehen.
Um es kurz zu machen: Die Prüfung fällt ernüchternd aus. Der tautologische Steuerstaat erläutert sich nicht – heute so wenig wie zur Zeit der Feste feiernden und Kriege führenden Fürsten. Angesichts des Schweigens, das der moderne, vorgeblich demokratisch legitimierte (in Wahrheit noch immer in spätabsolutistischen Routinen und hoheitlichen Diktaten fundierte) Steuerstaat über seine Rechtfertigungen wahrt, könnte man in eine traurige Grübelei verfallen: Wäre es möglich, daß wir uns im Gefolge der Französischen Revolution und des seither dominierenden Evolutionsdenkens ein falsches progressives Weltbild vorgegaukelt haben? Könnte es sein, daß Begriffe wie Feudalismus, Absolutismus und Demokratie keine so tiefen Einschnitte beschreiben, wie man uns allgemein glauben macht, sondern nur Nuancen in der monotonen Geschichte der nehmenden Hand bezeichnen? Vielleicht sind sämtliche Wandlungen dessen, was man das »Wirtschaftsleben« nennt, nur flüchtige Moden bei der unerschütterlichen Schröpfung der jeweils Ausbeutbaren durch die diensthabenden Mächte? Im Stil des Melancholikers Leopardi möchte man fragen: Wozu all die Aufregung, die man Geschichte nennt, wenn alles zuletzt nur auf den Unterschied zwischen sklavenhaltenden und bürgerhaltenden Staaten hinausläuft?
Wie dem auch sei, es wäre vergeblich, vom aktuellen Fiskus eine rational befriedigende Auskunft über die seinem nehmenden Verhalten zugrundeliegenden Prinzipien zu erwarten. Auch der zahlungsbereiteste Bürger gewinnt heute nirgendwo einen überzeugenden Anhaltspunkt für seinen guten Willen. Der Glaube, der die Einsicht sucht, läuft hier ins Leere. Gewiß, es gibt im Grundgesetz unseres Landes eine kurze Aussage über die Gemeinwohlpflichtigkeit des Eigentums, und man liest von Artikel 104 an einige Sätze, die das Finanzwesen des zu gründenden Staates behandeln. Von diesen lapidaren Artikeln führt kein Weg zu der minoischen Steuerwirklichkeit der Gegenwart. Aus dem deutschen Steuerlabyrinth führt kein Ariadnefaden die Verirrten auf den Weg zum Ausgang. Eine viel bessere Orientierung gewinnt man, wenn man das ungeschriebene Grundgesetz heranzieht, dem unsere Staatsdiener und Steuerprofessoren realiter verpflichtet sind. In ihm heißt es in fast unlesbar kleiner Schrift: »Die Resignation des Bürgers ist die Grundlage solider öffentlicher Finanzen. Nur der hinreichend verwirrte Bürger verzichtet darauf, ein vermeintliches Recht auf Transparenz in Anspruch zu nehmen. Nichts schadet dem Finanzwesen eines Staates mehr als das unreife Begehren der Bürger, es verstehen zu wollen.« Erst in der Undurchsichtigkeit der Vorgänge kommt der von seinem Nehme-Recht durchdrungene Staat ganz zu sich. In seiner Unverständlichkeit gewinnt er seine wahre Identität. Er spricht darum am liebsten mit sich selbst und begründet sich ausschließlich aus seinem tatsächlichen Betrieb. Indem er sagt, was er braucht, nimmt er auch schon, soviel er will, und indem er zugreift, demonstriert er, was er zu brauchen sich zugebilligt hat. Sollte das aktuelle Aufkommen für sein anschwellendes Brauchen nicht genügen, holt sich der Staat schon heute das Seine aus der Zukunft, indem er sich bis über den Scheitel verschuldet und so das nächste Jahrhundert bürgerlicher Entmündigung vorbereitet.
Tatsächlich beruht der beunruhigendste Aspekt der gegenwärtigen Finanz- und Wirtschaftskrise, die galoppierende Staatsverschuldung, auf einer weltweit grassierenden radikalen Mißdeutung der Steuern: Etatisten und Fiskalisten aller Länder fassen de facto auch die erst in Zukunft zu leistenden Steuern als unumgehbare Schulden der Bürger beim jeweiligen nationalen Fiskus auf und behandeln sie daher so, als ließen sie sich wie positives Staatseigentum im voraus verpfänden. Ihnen allen entgeht der grobe Kategorienfehler, der jedem solchen Fiskalismus innewohnt: Statt die steuerlichen Leistungen der Bürger zugunsten ihres Gemeinwesens als freie Zuwendungen der Gesellschafter an die Staatskasse aufzufassen – was sie dem Stand der Sache nach tatsächlich sind und als welche sie endlich in aller Form begriffen werden sollten –, werden sie als gegebenenfalls vollstreckbare künftige Schulden vorgestellt, die jeder Bezieher von Einkommen und jeder Konsument von Waren und Diensten a priori auf sich lädt. Die gefährlichste Perversion der politischen Systeme unserer Tage, die entfesselte Staatsverschuldung, erwächst somit letztlich aus der chronischen Fehlauffassung von Steuern – einer Fehlauffassung, in der massive Relikte vordemokratischen Denkens überleben.
Bei den in sich kreisenden Selbstgesprächen des großen Nehmers kommt die gebende Seite nur insofern vor, als kein noch so starker Zugreifer es sich erlauben kann, von den Grenzen des Zumutbaren völlig zu abstrahieren. Im allgemeinen setzt die nehmende Seite die Steuerduldsamkeit der gebenden als eine eingespielte Prämisse im Habitus einer gegebenen Population einfach voraus. Daß solche Duldsamkeit keine Naturkonstante ist, sondern ein historisch gewachsenes Produkt aus Zwang, Gewöhnung, partieller Einsicht und überwiegender Resignation darstellt, kann durch historische Studien im Detail belegt werden. Den relativ jungen Hintergrund der heutigen Duldsamkeit für chronisch hohe Belastungen deute ich an einer Stelle meines FAZ-Essays mit dem Hinweis an, Queen Victoria habe sich bei der Einführung einer Einkommensteuer in Höhe von 3,33 Prozent in Großbritannien um 1850 sorgenvoll gefragt, ob man damit nicht zu weit gegangen sei. Bei der Nahme von Gütern, die in den Fiskus neuzeitlicher Staatswesen fließen können, sind prinzipiell vier verschiedene Modi der Aneignung und ebenso viele Optionen zur Begründung des Nehmens seitens der staatlichen Agenturen in Ansatz zu bringen. Sind diese explizit benannt, kann man sich ein Urteil darüber bilden, welche von ihnen für ein demokratisches Gemeinwesen akzeptabel sind.
An erster Stelle sind die »Plünderungen« in kriegerisch-beutemacherischer Tradition zu nennen. Sie bilden den ersten Modus der Staatsbereicherung, der sich seit den ersten Reichsbildungen in der frühen Antike über Jahrtausende hinweg bei den fürstlichen Kassenverwaltern großer Beliebtheit erfreute und auch für die Gründungsphasen frühmoderner Staatswesen charakteristisch blieb. Bekanntlich hatten die Bürger Roms sich über Jahrhunderte an Steuerbefreiungen gewöhnt, weil die erfolgreiche Plünderungspolitik an den Außengrenzen des expandierenden Reichs Abgaben im Inneren weithin überflüssig machte; erst unter Augustus mußten die nicht mehr ausreichenden Ausbeutungen der Peripherie durch interne Steuern ergänzt werden. Die Beliebtheit Napoleons bei den Franzosen war nicht zuletzt durch die Tatsache bedingt, daß er seine Feldzüge überwiegend durch Kontributionen der Besiegten finanzierte. Die Wirksamkeit des Plünderungsverfahrens zur Füllung von Staatskassen läßt sich bis ins 20. Jahrhundert verfolgen. Seine Popularität erreichte noch in einem »volksgemeinschaftlich« integrierten Sozialstaat wie dem NS-Regime Spitzenwerte. Götz Aly hat dies in seiner Untersuchung über Hitlers Volksstaat gezeigt: Für Überfälle auf das Vermögen wohlhabender Juden wie für die Enteignung der ärmeren jüdischen Mitbürger waren die große Mehrheit der Deutschen noch in den dreißiger und vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts leicht zu gewinnen; eine Prise Sozialismus, eine Prise Rassismus, schon setzte sich der Plünderungsfiskus auch auf der Höhe der Moderne unwiderstehlich in Bewegung.8 Offensichtlich ist das archaische Schema »Beute-Erwartung« in modernen Kampfkommunen ebenso wirksam wie in archaischen Kriegergesellschaften. Die Legitimierung erfolgt hier in der Regel unter Berufung auf die kulturelle oder rassische Überlegenheit der nehmenden Seite.
Daß Formen der Bereicherung dieses Typs für die Bedarfsregelung von demokratischen Gemeinwesen indiskutabel sind, bedarf keiner näheren Erläuterung. In Rechtsstaaten müssen externe Plünderungen durchwegs durch legitime interne Einkünfte ersetzt werden – diese können naturgemäß nur von der eigenen Steuerpopulation stammen. Infolgedessen stellt sich die heikle Frage, bis zu welcher Grenze interne Steuern dem allgemeinen Rechtsempfinden entsprechen und von welchem Niveau an sie als Fortsetzung der externen Plünderung mit administrativen Mitteln gelten müssen. Für sich genommen bedeuten die Progressivsteuern eine der bedeutsamsten moralischen Errungenschaften der Neuzeit.9 Friedrich der Große meinte, wer 100 Taler jährlich habe, solle davon zwei willig dem Fiskus überlassen; wer aber 1000 einnehme, könne davon 100 leicht entbehren. Dem preußischen König schwebte eine politisch-sittlich zu rechtfertigende Progression von bis zu zehn Prozent vor, um die Belastbarkeit der Stärkeren maßvoll auszuschöpfen – in der Praxis soll er sich zur Finanzierung seiner Feldzüge höhere Zugriffe gestattet haben. In der Ära des New Deal hielten amerikanische und britische Politiker Progressivsteuern von bis zu 90 % für vertretbar – was heute selbst von der Linken à la Lafontaine als sittenwidrig empfunden würde. Die aktuelle Sensibilität hält Spitzenwerte bis 50 % für nachvollziehbar – was für eine psychohistorisch bemerkenswerte, ja moralgeschichtlich vorbildlose Mentalitätsentwicklung spricht.10 Gewiß ist jedenfalls: Im Streit um die Grenze von Höchststeuersätzen lebt das von Thomas formulierte Paradoxon über den »legalen Raub« weiter. Der zweite Modus der Beschaffung und Begründung von Staatseinnahmen ergibt sich aus der autoritär-absolutistischen Tradition der »Auflagen« (impôts). Auf sie geht der größte Teil der aktuellen Steuerkultur zurück. Tatsächlich erwuchs das weitverzweigte Universum der bürokratischen Fiskalität von gestern und heute aus dem Gedanken der dem Staat zukommenden »Abgaben« auf alle Arten von Einkommen, Vermögen, Waren und Diensten. Bekanntlich hatte die Fiskalität des absolutistischen Staats das Bürgertum und die ärmeren Schichten der Bevölkerung gewohnheitsmäßig stark zur Kasse gebeten, indessen die Vermögen von Adel und Klerus über lange Zeit kaum angetastet wurden. Für die Moderne ist charakteristisch, daß die Wohlhabenden in puncto Steueraktivität an die Spitze rückten.11 Was die Legitimierung der Steuern und »Auflagen« im älteren fiskalischen Regime anging, fand man sie umstandslos in einem aufgeklärten Paternalismus: Der schützendvorsorgende Vater Staat brauchte keine Scheu an den Tag zu legen, wenn es galt, den Bürgern die Wohltaten der autoritär gewährten Ordnung in Rechnung zu stellen. Wenn alle Bürger Söhne sind, die dem vorausblickenden Vater Dank und Gehorsam schulden, ist kein weiteres Wort über Rechtfertigung oder Gegenleistung zu verlieren. Immerhin entstanden hier die Anfänge einer transaktionalen Deutung des fiskalischen Geschehens: Demnach wären Steuern, obschon zunächst ohne Debatte festgesetzt, der gerechte Preis des Lebens in geordneten Verhältnissen.
Um die Prozeduren der zeitgenössischen Fiskalität zu würdigen, ist daran zu erinnern, daß sie noch immer in direkter Kontinuität aus den absolutistischen Traditionen hervorgehen. Ein solches System bleibt darum für eine demokratische Gesellschaftsordnung inakzeptabel, da auch heute noch die materiellen Beziehungen zwischen Staat und Bürger fast ausschließlich einseitig von oben her gestaltet werden. Sollte es je zu einer demokratischen Metamorphose kommen, müßte der Fiskus seine Zugriffe auf Bürgervermögen den veränderten Verhältnissen in Theorie und Praxis anpassen. Erkennen würde man dies daran, daß die faktisch gebende Seite auch rechtens als gebende verstanden würde, und nicht bloß als schuldende. Folglich müßte die gebende Partei in allen Phasen des fiskalischen Prozesses, von der Vereinnahmung bis zur Verausgabung, auf angemessene Weise involviert werden – weit über die heutigen Üblichkeiten der »Haushaltspolitik« hinaus. Von einem solchen Schritt in die steuerpolitische Moderne kann heute nirgendwo die Rede sein. Auch wenn das Urteil hart klingt: Das fiskalische Mittelalter ist nicht zu Ende. Viel spricht dafür, daß das Fiskalsystem vor unseren Augen direkt aus dem Absolutismus ins postdemokratische Zeitalter übergehen wird, ohne dazwischen eine demokratische Phase gekannt zu haben.
Das dritte Verfahren zur Beschaffung und Begründung von Steuern im modernen Gemeinwesen stützt sich auf das Motiv der »Gegenenteignung«, das bis in jüngere Zeit für ein gut Teil der sozialistischen und linksradikalen Auffassungen von der Rolle des Fiskus in der kapitalistischen Gesellschaft prägend war. Der Vorstellung der »Gegenenteignung« liegt die bekannte Devise von der »Expropriation der Expropriateure« zugrunde, mit welcher die Linke des 19. Jahrhunderts bis weit ins bürgerliche Lager hinein Sympathien erwarb. Für sie galt jeder bürgerliche Reichtum als Resultat einer »Ausbeutung der Werktätigen«. Wenn wirklich, wie Proudhon unter dem Beifall des jungen Marx behauptet hatte, Eigentum Diebstahl ist, kann nur ein gut dosierter Gegendiebstahl das Mittel zur Behebung des Übels sein. Das politische Organon des Gegendiebstahls ist naturgemäß der Fiskus, sobald er in die Hand einer griffsicheren Sozialstaatspolitik gerät (vorausgesetzt, man votiert nicht mit den Bolschewisten geradewegs für Gesamtenteignung). Die Legitimierung kraftvoller Zugriffe auf Einkommen und Vermögen der Bürger erfolgt hier durch den Imperativ der Umverteilung. Diese soll nicht nur der inneren Befriedung moderner Gesellschaften dienen; sie will darüber hinaus als fiskalischer Ausdruck des Prinzips »soziale Gerechtigkeit« verstanden werden. Der Begriff »Gerechtigkeit« verleugnet seinen sozialmystischen Ursprung nicht: Da an der Erzeugung des Reichtums vorgeblich alle Gesellschaftsgenossen direkt und indirekt mitwirken, wäre nicht einzusehen, warum der »kollektiven Erzeugung« des Reichtums seine »private Aneignung« gegenübersteht. Aus dieser Sicht stellt die Gesellschaft im ganzen den einzigen wirklichen Unternehmer dar. Wo nur die Gesellschaft unternimmt, darf nur die Gesellschaft Gewinne verteilen.
Die argumentative und moralische Basis dieses Modells ist seit jeher brüchig, da sie von der mehr suggestiven als sachgerechten Hypothese der Ausbeutung der Werktätigen durch ihre Arbeitgeber abhängt. Weist man für die Gegenwart das vergilbte Dogma der Expropriation der Werktätigen durch die Arbeitgeberseite zurück,