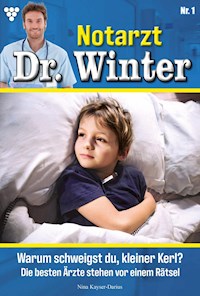3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sophienlust Bestseller
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Der Sophienlust Bestseller darf als ein Höhepunkt dieser Erfolgsserie angesehen werden. Denise von Schoenecker ist eine Heldinnenfigur, die in diesen schönen Romanen so richtig zum Leben erwacht. Das Kinderheim Sophienlust erfreut sich einer großen Beliebtheit und weist in den verschiedenen Ausgaben der Serie auf einen langen Erfolgsweg zurück. Denise von Schoenecker verwaltet das Erbe ihres Sohnes Nick, dem später einmal, mit Erreichen seiner Volljährigkeit, das Kinderheim Sophienlust gehören wird. »Wann gehen wir endlich einkaufen, Mutti?« »Aber das habe ich dir doch schon gesagt, Pedro. Sobald Onkel Sancho da ist.« Ines Rodrigez sprach ein fast akzentfreies Deutsch, obwohl sie Spanierin war. Allerdings wohnte sie schon seit zehn Jahren in Deutschland. »Er kommt! Onkel Sancho kommt!« Die zehnjährige Carmen sprang vom Fensterbrett und lief zur Tür. »Darf ich ihn hereinlassen, Mutti?« »Ja, geh schon«, erlaubte Ines lächelnd. Sie war froh, dass ihre beiden Kinder Sancho Cordoba so gern mochten. Denn Sancho sollte der neue Vater der Kinder werden. Er wollte sie, Ines, heiraten. Als Ines hörte, dass Sancho die Wohnung betrat, ging sie schnell in den Korridor. Da sah sie Carmen schon an Sanchos Hals hängen und ihn mit einem Kuss begrüßen. »Wir warten schon auf dich, Onkel Sancho«, meldete sich nun der vierjährige Pedro. Er wollte auf keinen Fall übersehen werden. Sancho begrüßte auch ihn mit zwei Küssen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 152
Ähnliche
Sophienlust Bestseller – 101 –
Die neue Schwester
Nina Kayser-Darius
»Wann gehen wir endlich einkaufen, Mutti?«
»Aber das habe ich dir doch schon gesagt, Pedro. Sobald Onkel Sancho da ist.« Ines Rodrigez sprach ein fast akzentfreies Deutsch, obwohl sie Spanierin war. Allerdings wohnte sie schon seit zehn Jahren in Deutschland.
»Er kommt! Onkel Sancho kommt!« Die zehnjährige Carmen sprang vom Fensterbrett und lief zur Tür. »Darf ich ihn hereinlassen, Mutti?«
»Ja, geh schon«, erlaubte Ines lächelnd. Sie war froh, dass ihre beiden Kinder Sancho Cordoba so gern mochten. Denn Sancho sollte der neue Vater der Kinder werden. Er wollte sie, Ines, heiraten.
Als Ines hörte, dass Sancho die Wohnung betrat, ging sie schnell in den Korridor. Da sah sie Carmen schon an Sanchos Hals hängen und ihn mit einem Kuss begrüßen.
»Wir warten schon auf dich, Onkel Sancho«, meldete sich nun der vierjährige Pedro. Er wollte auf keinen Fall übersehen werden.
Sancho begrüßte auch ihn mit zwei Küssen. Auf jede Wange einen. Erst dann wandte er sich an Ines. »Entschuldige«, bat er.
Ines sagte schnell: »Es ist völlig richtig, dass du die Kinder zuerst begrüßt. Ich bin ja so froh, dass ihr euch so gut versteht.«
»Ich auch.« Er küsste sie auf die Wange. Dabei dachte er an den Tag vor mehr als einem Jahr, an dem er Ines kennengelernt hatte. Damals war sie noch mit Juan verheiratet gewesen, und alles hatte so aussichtslos ausgesehen. Ines hatte ihm anvertraut, dass ihre Ehe eine einzige höllische Qual sei und dass sie sich scheiden lassen wolle. Doch er hatte ihr nicht geglaubt und sich von ihr zurückgezogen, obwohl er Ines schon damals geliebt hatte.
»Wir wollen einkaufen gehen«, unterbrach Carmen Sanchos Gedanken. »Kommst du mit?«
»Aber natürlich.« Sancho wusste, dass Ines nicht gern allein wegging. Noch immer fürchtete sie sich vor ihrem eifersüchtigen Mann, obwohl sie schon ein Jahr lang von ihm geschieden war. Doch Juan hatte ihr gedroht: »Ich bringe euch alle um, wenn du diesen Kerl heiratest!« Damit hatte er Sancho gemeint. Irgendwie hatte er erfahren, dass Sancho Ines heiraten wollte. Und genauso jähzornig, grob und unberechenbar, wie er als Ehemann gewesen war, gebärdete er sich auch jetzt noch. Bei jeder Begegnung drohte er Ines.
»Gestern hat er mich wieder angerufen«, berichtete Ines jetzt leise.
Sancho wusste sofort, wen sie meinte. »Was wollte er?«
»Gedroht hat er wieder. Er werde nicht dulden, dass ich dich heirate und die Kinder einen Stiefvater bekommen«, sagte Ines und dachte, dabei behandelt dieser Stiefvater die Kinder hundertmal besser als ihr leiblicher Vater, der sie ständig geschlagen hat. Und mich auch. Jeden Freitag ist er betrunken gewesen. »Es war die Hölle mit ihm«, wiederholte sie leise.
»Ich weiß.« Sancho streichelte ihre Hand.
Da sagte Ines etwas, was ihm zu denken gab: »Eher würde ich mich umbringen, als diesen gemeinen Grobian noch einmal heiraten.«
Sancho horchte auf. »Wieso? Hat er dir das vorgeschlagen?«
»Ja, gestern am Telefon«, sagte sie leise. »Aber ich habe sofort klipp und klar nein gesagt.«
»Und?«, fragte Sancho. Er konnte sich nicht vorstellen, dass der jähzornige Juan das so einfach hingenommen hatte.
»Er wurde sehr ausfallend. Er beschimpfte mich und drohte mir wieder.« Mit feuchten Augen schaute sie auf. »Kann er mich denn nicht endlich in Ruhe lassen? Ich ertrage das bald nicht mehr.«
Sancho schloss sie schnell in die Arme. »Beruhige dich, mein Liebes. Bitte, beruhige dich. Wir werden so schnell wie möglich heiraten und von hier wegziehen. Irgendwohin, wo er uns nicht finden kann.«
Dieses Versprechen ließ sie wieder ruhig werden. Und dann betraten Carmen und Pedro in ihren Regenmänteln das Wohnzimmer. »Wir sind fertig, Mutti.«
»Gut, dann können wir gehen.« Ines zog im Korridor ihren Mantel an und nahm einen Schirm. Alle verließen die Zweizimmerwohnung in Maibach, die eigentlich viel zu klein war. Aber sie sollte ja auch nur eine Übergangslösung sein.
»Wo willst du deine Lebensmittel einkaufen?«, fragte Sancho, als sie aus dem Haus traten.
»In dem großen Supermarkt. Gleich um die Ecke. Dort bekomme ich alles, was ich brauche. Soll ich schnell allein hineingehen? Willst du mit den Kindern hier auf mich warten?«
»Nein«, rief Pedro schnell. »Ich will mitgehen.«
Carmen schaute zu Sancho auf. »Komm, wir gehen auch mit hinein, Onkel Sancho.«
»Natürlich gehen wir mit. Wir können Mutti doch nicht allein lassen.« Sancho nahm die hübsche dunkelhaarige Carmen bei der Hand. Das lange glatte Haar und die hellgrauen Augen hatte sie von der Mutter. Sie wird einmal genauso schön werden wie Ines, dachte er und blinzelte Carmen zu.
Carmen zwinkerte zurück. »Ich mag dich, Onkel Sancho«, gestand sie ihm leise.
Er flüsterte ihr ins Ohr: »Ich dich auch, kleines Fräulein.«
Ines schaute lächelnd weg und tat so, als merke sie nichts. Dabei freute sie sich über diese kleinen Spielereien der beiden, weil es ihr zeigte, dass Sancho ihre Kinder liebte.
Froh griff Ines nach einem Drahtkorb. Doch Sancho nahm ihn ihr aus der Hand und stellte ihn zurück. »Wir nehmen einen Wagen. Das ist einfacher. Pedro darf hier oben sitzen, und ich fahre ihn. Du brauchst also nur auszuwählen.«
Auch Sancho sprach ein fehlerfreies und nur ganz leicht akzentuiertes Deutsch. Das war verständlich. Denn von den zweiunddreißig Jahren seines Lebens hatte er fast die Hälfte in Deutschland verbracht. Er hatte in München studiert und arbeitete seit
einigen Jahren in Stuttgart als Elektro-Ingenieur. Seit er die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hatte, fühlte er sich ganz als Deutscher.
Das Leben hier macht Spaß, dachte Sancho auch jetzt wieder. Wenn Ines erst meine Frau ist …
Doch diesen Gedanken konnte er nicht mehr zu Ende führen. Ein Tumult an der Kasse lenkte ihn ab. »Lasst doch diesen Verrückten nicht hier herein! Er hat eine Pistole!«, schrien die Leute durcheinander.
Sancho dachte an einen Überfall oder einen Ladendiebstahl, bis er Ines’ Gesicht sah. Alle Farbe war daraus gewichen. Zitternd stand sie in der Mitte des Ganges und starrte zum Ausgang, durch den eben ein Mann hereingestürzt war. Juan – mit verzerrtem Gesicht, die rechte Hand drohend erhoben. Er fluchte auf spanisch und kam Schritt für Schritt auf Ines zu.
Sekundenlang herrschte lähmendes Entsetzen im ganzen Laden. Sancho konnte sich vor Angst und Schrecken sekundenlang nicht rühren. Doch dann stürzte er sich entschlossen auf Juan. »Bist du verrückt? Du wirst sie noch umbringen!«
»Genau das will ich.« Mit einem Ruck schüttelte Juan Rodrigez Sancho ab und machte einen weiteren Schritt auf Ines zu.
Dieser war inzwischen eine junge Frau und deren Mann zu Hilfe geeilt. »Kommen Sie mit. Sie müssen hier weg, sonst passiert noch ein Unglück.« Die junge Frau nahm Ines bei der Hand und wollte sie mit sich fortziehen.
»Halt«, schrie Juan. »Bleib stehen – oder ich erschieße dich sofort!«
Ines hörte jedoch nicht auf ihn. In blinder Angst wollte sie davonstürzen. Da peitschten zwei Schüsse durch den Laden. Und dann noch einer.
Ines’ Todesschrei ging in dem Gebrüll der Menschen unter. Sie taumelte, suchte Halt an einem Obststand. Schließlich stürzte sie blutüberströmt zu Boden.
Nur zwei Meter von ihr entfernt lag der Mann, der ihr hatte helfen wollen. Auch die fremde junge Frau schien getroffen zu sein. Sie taumelte. Ihr Gesicht war schmerzverzerrt. Eine Hand presste sie an die Schulter, aus der Blut hervorquoll.
Ganz plötzlich wurde es still im Laden. Als Juan sah, was er getan hatte, lief er zu Ines und fiel neben ihr auf die Knie. »Ines! Ines, so sag doch etwas. Ich …, ich wollte das nicht …«
»Mörder«, schrie eine ältere Frau. »Massenmörder!« Und eine andere: »Holt die Polizei!«
Doch das war nicht nötig. Aus der Ferne hörte man schon das Martinshorn des Überfallkommandos.
Zitternd trat Sancho zu Ines. Auf dem Arm trug er Pedro. Irgendwie spürte er, dass Ines nicht mehr lebte aber er wollte es nicht wahrhaben. Carmen klammerte sich schluchzend an ihn. Dabei wandte sie keinen Blick von der leblosen Gestalt der Mutter.
»Bringen Sie doch die Kinder weg«, sagte der Geschäftsführer zu Sancho. Doch Sancho verstand ihn nicht. Er dachte nur immerzu, sie darf nicht tot sein, sie darf nicht sterben. Er spürte nicht, dass zwei Sanitäter ihn wegschoben. Er merkte auch nicht, dass eine Frau Carmen beiseite nahm. Nur Ines sah er. Ihr weißes lebloses Gesicht prägte sich ihm unauslöschlich ein.
Die Polizeibeamten verhafteten Juan Rodrigez, der sich widerstandslos abführen ließ.
Das Ehepaar, das Ines hatte helfen wollen, wurde ebenfalls mit dem Krankenwagen weggebracht.
»Sie sind ja auch verletzt«, sagte der Geschäftsführer des Supermarktes zu Sancho.
Verwundert betrachtete Sancho die dünne Blutspur, die aus seinem Ärmel sickerte. »Aber ich spüre nichts.« Er drehte sich suchend um. »Wo ist denn der Notarztwagen? Ich wollte doch ins Krankenhaus mitfahren.«
»Sie können ja nachfahren«, riet der Geschäftsführer ihm. »Kommen Sie jetzt erst einmal mit in mein Büro und verbinden Sie Ihre Wunde.«
Wie eine Marionette ließ sich Sancho wegfahren. Den weinenden Pedro trug er immer noch auf dem Arm. Und Carmen klammerte sich jetzt wieder an seine Hand. Unaufhörlich liefen ihr Tränen über die Wangen. Die ältere Frau, die sich um sie gekümmert hatte, wurde gerade als Zeugin verhört.
Vor der Tür des winzigen Büros des Geschäftsführers blieb Sancho stehen. »Ich muss doch ins Krankenhaus.«
»Trinken Sie erst einen Kaffee«, drängte der Geschäftsführer. Er sah, dass Sancho mit seinen Kräften am Ende war. »Danach fahre ich Sie zum Krankenhaus.«
Pedro begann lauter zu weinen. »Wo ist meine Mutti? Ich will zu meiner Mutti«, verlangte er.
Sancho presste den kleinen Lockenkopf an seine Wange. Dass er selbst auch weinte, merkte er gar nicht.
»Kommen Sie.« Der Geschäftsführer schob Sancho zu der Bürotür. Doch plötzlich blieben beide Männer stehen.
Auf dem Fußboden, neben dem Regal mit Bier und Wein, saß ein kleines Mädchen. Sechs Jahre mochte es etwa alt sein. Verschüchtert und hilflos sah es die Erwachsenen an. »Hast du meine Mutti gesehen?«, fragte es Sancho. Dass er ein Kind auf dem Arm trug, flößte dem Mädchen allem Anschein nach Vertrauen ein.
Sancho und der Geschäftsführer schauten sich an.
»Wie heißt du denn?«, fragte Sancho schließlich, nur um irgendetwas zu sagen und der Kleinen zu zeigen, dass er ihr helfen wollte. Sekundenlang vergaß er darüber sogar seinen eigenen Schmerz.
Die Kleine begann wieder zu weinen. Da nahm der Geschäftsführer sie auf den Arm und trug sie in sein Büro.
Dort begann das Mädchen zu reden. Leise nannte es seinen Namen. »Ich heiße Virginia Berger. Aber meine Mutti sagt Ginny zu mir. Wo ist sie?« Wieder schaute die Kleine Sancho an.
»Ich werde sie suchen«, versprach er und trank automatisch den Cognac, den der Geschäftsführer ihm hinhielt. Das half ihm ein wenig. »Du musst nicht mehr weinen«, sagte er zu Ginny. »Wir finden deine Mutti ganz bestimmt.«
»Aber …, aber …« Der Rest des Satzes ging in einem Tränenstrom unter. Doch dann entdeckte die sechsjährige Ginny Carmen, die ganz still neben Sancho stand und ebenfalls weinte. »Suchst du auch deine Mutti?«
Aufschluchzend presste Carmen die Hand vor den Mund. Ihr ganzer Körper zitterte.
Die beiden Männer schauten sich hilflos an. »Ich werde einmal hinausgehen und Ginnys Mutter suchen«, sagte der Geschäftsführer. Er verließ den kleinen Büroraum und schickte eine Verkäuferin herein, die sich nun um Carmen und Ginny kümmerte. Kunden waren ohnehin keine mehr da, denn die Polizei hatte den Supermarkt vorübergehend geschlossen.
Als die Verkäuferin die kleine Virginia sah, erschrak sie.
»Was haben Sie denn?«, fragte der Geschäftsführer, der bereits wieder zurückkam. Er hatte keine Frau finden können, die ein sechsjähriges Mädchen vermisste. Der Laden war leer.
So leise, dass die Kinder es nicht verstehen konnten, sagte die Verkäuferin: »Das kleine Mädchen gehört zu dem Ehepaar, das von den Schüssen ebenfalls getroffen wurde.«
»Mein Gott«, entfuhr es dem Geschäftsführer. Drei hilflose Kinder, deren Eltern Opfer dieses Wahnsinnigen geworden waren. Man sollte diesen Kerl lynchen, dachte er erzürnt.
Dann meldete sich der Polizeiwachtmeister, der Sancho ins Krankenhaus fahren sollte.
»Wissen Sie was, ich nehme alle drei Kinder mit«, sagte Sancho zu dem Geschäftsführer. »Hier können sie ja doch nicht bleiben. Und wenn Ginnys Eltern …«
»Was?«, fragte die Kleine sofort und schaute zu Sancho auf.
Der Polizist sagte rasch: »Wir fahren jetzt zu deiner Mutti.«
Da ergriff Ginny seine Hand und ging mit, ohne eine weitere Frage zu stellen.
»Ist Ginnys Mutti auch im Krankenhaus?«, fragte Carmen während der Fahrt leise.
Sancho nickte nur und streichelte Carmens Haar. Pedro war neben ihm eingeschlafen.
»Kann ich sonst noch etwas für Sie tun?«, fragte der Polizeiwachtmeister vor dem Krankenhaus.
»Nein. Es war schon sehr nett, dass Sie uns hierhergebracht haben. Vielen Dank.«
Er schaute dem Polizeiwagen nach. Dann betrat er mit den drei Kindern das Maibacher Krankenhaus.
Eine Schwester kümmerte sich sofort um ihn. Als sie erfuhr, wen er suchte, erschrak sie. Und zwar so sichtlich, dass sogar Carmen es merkte. »Was ist mit unserer Mutti? Sie wird doch wieder gesund?«
Die Schwester schaute hilflos von den Kindern zu Sancho. »Bitte, nehmen Sie einen Moment im Wartezimmer Platz. Ich sage dem Herrn Doktor sofort Bescheid.«
»Aber ich will zu meiner Mutti«, beharrte Carmen eigensinnig.
»Das kannst du jetzt nicht«, erklärte die Schwester geduldig. »Deine Mutti wird gerade operiert. Da darf niemand zu ihr.«
Sancho wusste, dass die Schwester log. Trotzdem hatte er die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Vielleicht ist Ines gar nicht tot, nur sehr schwer verletzt? Vielleicht liegt sie jetzt wirklich im Operationssaal?, dachte er. Er klammerte sich an diesen Gedanken wie an einen Strohhalm. Wenn ein Patient im Operationssaal lag, dann konnte er noch nicht tot sein, dann bestand noch eine Chance. Doch als er den Blick der Schwester sah, verließ ihn alle Hoffnung wieder. Sie gab ihm ein Zeichen, ihr auf den Korridor zu folgen.
»Wartet hier auf mich«, sagte Sancho zu Carmen und Pedro. »Ich komme gleich wieder.«
»Wohin gehst du?«
»Auf die Toilette.«
Die Schwester wartete auf dem Gang auf ihn. Sancho zitterte, als er zu ihr trat. Er ahnte, was sie ihm sagen wollte, doch er wehrte sich dagegen. Erst als die Schwester sagte: »Frau Rodrigez ist tot«, erwachte er aus seiner Trance. Er taumelte, lehnte sich gegen die Wand und kämpfte mit aller Gewalt gegen die aufsteigenden Tränen an.
Erst jetzt entdeckte die Schwester, dass er verletzt war. »Kommen Sie mit, ich verbinde Sie.«
Sancho reagierte jedoch nicht. Er stand da und spürte, dass seine kleine Welt zerbrochen war. Aus und vorbei war der Traum von einer glücklichen Zukunft, von einem Häuschen im Grünen und lachenden Kindern im Garten. Er presste die Hände vors Gesicht, bis ihm die Wangen schmerzten. Da spürte er eine sachte Berührung. Er hob den Kopf und schaute in zwei warme, gütige Augen. Doch sie gehörten nicht der Schwester, sondern einer jungen Ärztin.
»Kommen Sie, wir müssen Ihre Wunde verbinden.« Mit sanfter Gewalt nahm die Ärztin seinen Arm und führte ihn den Korridor entlang.
Schon nach drei Schritten blieb Sancho wieder stehen. »Die Kinder! Ich muss mich doch um die Kinder kümmern.«
Verwundert schaute Dr. Anja Frey ihn an. Was für Kinder?, fragten ihre Augen.
Die Schwester erklärte ihr leise und rasch die Situation. Auch Anja Frey hatte bereits von der Schießerei im Supermarkt gehört. Sie spürte instinktiv, dass der Mann vor ihr genauso hilflos war wie die zwei mutterlosen Kinder. »Schwester Hildegard wird sich inzwischen um die Kinder kümmern«, sagte sie zu Sancho. »Kommen Sie mit mir. Ihre Wunde muss behandelt werden.«
Ohne ein Wort des Widerspruchs folgte Sancho ihr.
In einem kleinen Verbandszimmer zog Frau Dr. Frey ihm vorsichtig Jacke und Hemd aus. »Ein Streifschuss«, stellte sie sachlich fest. »Das muss ziemlich wehgetan haben.«
Verwundert schaute Sancho auf. Er hatte nichts gespürt.
»Wahrscheinlich haben Sie gar nicht daran gedacht«, sagte die Ärztin mitfühlend. Sie war an solche Situationen gewöhnt und verstand es zu trösten und zu helfen. Nachdem sie die Wunde gereinigt und verbunden hatte, brachte sie Sancho in das Wartezimmer zurück. Sie staunte, als sie drei Kinder darin sitzen sah.
»Ginnys Mutter ist auch hier im Krankenhaus«, erläuterte Sancho. »Ich glaube, sie heißt Berger mit Nachnamen.«
Anja Frey musste sich beherrschen, als sie das hörte. Sie wusste, Constanze Berger, die Mutter des kleinen Mädchens, schwebte in Lebensgefahr. Ihr Mann war bereits gestorben. Noch nie hatte Anja Frey je einen Menschen gehasst. Doch jetzt lernte sie dieses Gefühl zum ersten Mal kennen. Zwei Tote und drei hilflose Kinder hatte dieser Wahnsinnige auf dem Gewissen. Sollte Constanze Berger auch noch sterben, dann würde er drei unschuldige Kinder zu Waisen gemacht haben. Was für ein Mensch war das? Verdiente er die Bezeichnung Mensch überhaupt noch?
Sanchos leise Frage riss Anja Frey aus ihren Gedanken. Aber sie verstand nicht sofort, was er meinte. »Was soll ich denn jetzt tun?«, hatte er gefragt.
Mühsam raffte sich Sancho zu einer Erklärung auf. »Ich möchte Pedro und Carmen gern behalten, aber ich weiß nicht, wo ich sie tagsüber lassen soll. Ich bin berufstätig. Und zwei Kinder in dem Alter kann man doch nicht den ganzen Tag unbeaufsichtigt lassen.«
»Nein, das geht nicht«, pflichtete Anja Frey ihm bei. »Wir müssen einen Platz für sie finden.«
»Nur vorübergehend«, sagte Sancho schnell. »Ich möchte die beiden nicht ganz verlieren. Sie sind ja das Einzige, das mir von Ines geblieben ist.«
»Natürlich«, erwiderte die Ärztin mitfühlend und führte Sancho wieder auf den Gang hinaus. »Wir müssen aber nicht nur eine Unterkunft für Carmen und Pedro finden, sondern auch für die kleine Virginia. Ihre Mutter schwebt in Lebensgefahr, und der Vater ist bereits gestorben.«
»O Gott!« Sancho schlug die Hände vors Gesicht. »Was hat dieser Gottlose angerichtet!«
Die Ärztin entschuldigte sich und ging davon. Als sie nach einer halben Stunde wieder das Wartezimmer betrat, war Pedro in Sanchos Armen eingeschlafen. Ginny saß neben Carmen und lehnte sich an sie.
»Ich habe etwas gefunden«, sagte Anja leise zu Sancho.
Sofort schlug Pedro die Augen auf. »Gehen wir jetzt nach Hause?«, fragte er schlaftrunken.
Anja nickte. »In euer neues Zuhause«, sagte sie sanft.
»Wir brauchen kein neues Zuhause«, erwiderte Carmen aggressiv. »Wir haben eine Wohnung.«
»Aber dort könnt ihr doch nicht allein bleiben«, meinte Anja Frey.
»Wir sind ja nicht allein. Onkel Sancho bleibt bei uns, bis Mutti wiederkommt. Sie …, sie kommt doch wieder?«
Die Ärztin nickte schnell. »Natürlich. Aber es kann ein Weilchen dauern. Und so lange könnt ihr nicht allein bleiben. Onkel Sancho muss doch den ganzen Tag arbeiten.«
Sie streckte Carmen ihre Hand entgegen. »Kommt, es wird euch gefallen in Sophienlust.«
»Sophienlust?«, fragte Carmen misstrauisch. »Was ist das?«