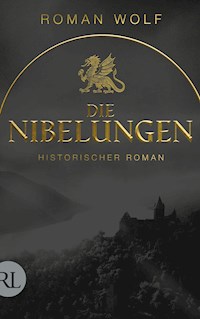
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Die Macht der Liebe und der Rache.
Siegfried von Xanten hat nur ein Ziel: Er möchte der mächtigste Krieger in seinen Landen sein. Deshalb kämpft er gegen einen Drachen und erbeutet dabei einen fluchbeladenen Goldschatz. Dann zieht er in den Suavawald, um sich bei einem sagenumwobenen Schmied ein Schwert anfertigen zu lassen. Doch zu seiner Überraschung ist der Schmied eine schöne Frau – die Königin Brunhild selbst. Die beiden verlieben sich. Brunhilds Seherin aber prophezeit, dass Siegfried die Königin einst verraten wird.
Als Siegfried wenig später dem Königreich Burgund gegen die Sachsen zu Hilfe eilt, verliebt sich die Königstochter Kriemhild in ihn – und das Schicksal, das ganze Völker ins Unglück reißen wird, nimmt seinen Lauf ...
Das größte Helden-Epos des Mittelalters – packend, atmosphärisch und völlig neu erzählt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 577
Ähnliche
Über das Buch
Die Macht der Liebe und der Rache.
Siegfried von Xanten hat nur ein Ziel: Er möchte der mächtigste Krieger in seinen Landen sein. Deshalb kämpft er gegen einen Drachen und erbeutet dabei einen fluchbeladenen Goldschatz. Dann zieht er in den Suavawald, um sich bei einem sagenumwobenen Schmied ein Schwert anfertigen zu lassen. Doch zu seiner Überraschung ist der Schmied eine schöne Frau – die Königin Brunhild selbst. Die beiden verlieben sich. Brunhilds Seherin aber prophezeit, dass Siegfried die Königin einst verraten wird. Als Siegfried wenig später dem Königreich Burgund gegen die Sachsen zu Hilfe eilt, verliebt sich die Königstochter Kriemhild in ihn – und das Schicksal, das ganze Völker ins Unglück reißen wird, nimmt seinen Lauf.
Das größte Helden-Epos des Mittelalters – packend, atmosphärisch und völlig neu erzählt
Über Roman Wolf
Roman Wolf lebt in der Nähe von Berlin. Schon während seines Studiums hat er sich ausführlich mit deutscher Mythologie und der Siegfried-Saga befasst. »Die Nibelungen« ist sein erster Roman.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Roman Wolf
Die Nibelungen
Historischer Roman
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
Teil I
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Teil II
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Epilog
Nachwort
Geographische Namen zur Zeit der Handlung und heute
Begriffe
Impressum
Prolog
Germania Magna, 430 A.D.
Ein bleicher Mond schien auf die weite, von unzähligen runden Zelten übersäte Ebene hinab und tauchte die Welt unter ihm in ein gespenstisches Licht. Auf einem Baum schrie eine Eule, eine Maus raschelte im vom Tau feuchten Gras.
Angespannt blickten die Männer auf das Lager, in dem nur wenige Feuer brannten. Bis auf einige Wachtposten schliefen alle. Das dichte Unterholz des ausgedehnten Hügels, auf dem die voll gerüsteten Krieger sich versteckt hielten, bot ihnen ausgezeichnete Deckung vor neugierigen Blicken, während sie selbst die Grasfläche unter ihnen ungehindert im Auge behalten konnten.
»Ihre Jurten füllen den ganzen Horizont. Wie sollen wir gegen sie bestehen?«, stieß Gernot leise hervor. Sein linkes Auge zuckte erregt, die Anspannung war in seinem fein geschnittenen Gesicht deutlich abzulesen. Unsicher blickte er auf das im Mondlicht blitzende Schwert in seiner Hand und hoffte, dass er damit viele der Hunnen da unten töten würde.
»Ich schätze, das sind ungefähr zehntausend Kämpfer da unten«, knurrte Hagen, während er sich unwillkürlich mit der Hand über eine weiße Narbe an der rechten Schläfe fuhr. Seine dunklen Augen unter den buschigen Brauen leuchteten vor Vorfreude auf die bevorstehende Schlacht. Dies waren die besten Momente im Leben eines Kriegers. Nichts genoss er so sehr wie das erhebende Gefühl, einen Feind zu töten, um damit Burgund, das ihm so viel bedeutete wie sonst nichts in seinem Leben, zum Sieg zu verhelfen.
»Und wir haben gerade einmal dreitausend«, stöhnte Gunther, während er sich nervös durch den sorgfältig gestutzten dichten Bart strich. Sein breites Gesicht zeigte diese Unsicherheit deutlich, ihm war nicht wohl bei dem Gedanken, einen zahlenmäßig so weit überlegenen Feind anzugreifen.
Unruhig lüftete Gunther seinen Helm und wischte sich einen Schweißtropfen von der Stirn. Doch dann sah er in das grimmige Gesicht Hagens, das im Mondschein matt glänzte. Der Anblick seines hochgewachsenen Halbbruders, dessen breite Schultern von dem derben Lederpanzer, den er über seinem Kettenhemd trug, noch besonders betont wurden, verlieh ihm Zuversicht.
Entschlossen packte er den mit Edelsteinen verzierten Griff seines blitzenden Schwertes, das genauso eindrucksvoll war wie die rote Tunika mit dem goldenen Saum über seinem schweren Brustpanzer. Der König der Burgunder legte Wert auf eine prächtige äußere Erscheinung, doch er war auch ein weithin gefürchteter Krieger, der sich auf den Schlachtfeldern zwischen Rhein und Elbe viel Ruhm erworben hatte.
»Warum ziehen sie eigentlich gegen uns? Sind wir nicht Verbündete Roms?«, fragte sein Bruder Gernot.
»Genauso wie die Hunnen da unten.« Hagen lachte verächtlich und band sich seinen schweren Helm mit den aufgesetzten Adlerschwingen fester. »Aetius schließt Verträge mit allen und jedem. So kann er sicher sein, dass er bei allen Streitigkeiten immer zumindest einen Gewinner auf seiner Seite hat.«
Gunther nickte bedächtig. Zwar hatten die früher so gefürchteten römischen Legionen schon längst den Nimbus der Unbesiegbarkeit verloren, mit dem sie jahrhundertelang alle Feinde in Angst und Schrecken versetzten, aber solange Rom noch Feldherren wie Aetius hatte, der es meisterhaft verstand, vorteilhafte Bündnisse mit den verschiedensten Stämmen zu schließen, war es immer noch das mächtigste Reich in diesem Teil der Welt.
»Gerade mit den Hunnen pflegt er gute Beziehungen«, pflichtete der König bei. »Immerhin war er lange als Geisel bei ihnen, dabei hat er wichtige Kontakte geknüpft.«
»Dieses Drecksgesindel braucht keinen Grund zum Kriegführen«, wandte Hagen sich an Gernot und spuckte abschätzig in Richtung ihres Lagers. »Töten und Plündern liegt ihnen im Blut.«
»Ganz so wie dir, Hagen.« Gunther grinste.
»Aber ich töte und plündere für Burgund«, erwiderte er unbewegt.
Gernot blickte mit einer Mischung aus Scheu und Ehrfurcht auf den berühmten Krieger, der wegen seiner Stärke im Kampf von seinen Freunden bewundert und seinen Feinden gefürchtet wurde. Vieles stieß ihn ab an seinem rauen Halbbruder, aber in der Schlacht war es immer gut, einen wie ihn an seiner Seite zu haben.
»Sie haben ihren Lagerplatz schlecht gewählt, hier sind sie leicht angreifbar«, brummte Hagen, während er sich bemühte, sein Pferd ruhig zu halten. Der Rappe spürte die Spannung der Männer in seiner Nähe und trippelte leicht.
»Sie wissen nicht, dass wir von ihrem Feldzug erfahren haben, darum fühlen sie sich sicher.« Gunther nickte zu seinen eigenen Worten.
»Es wird ihr Verderben sein.« Hagen spuckte aus.
Gunthers Augen zogen sich vor Anspannung zusammen. »Jetzt gilt es«, sagte er eindringlich. »Wir müssen vor allem schnell sein, damit wir sie überrumpeln, bevor sie überhaupt wissen, was geschieht. Wenn sie erst einmal auf ihren Pferden sitzen, sind sie unbezwingbar.«
Er hob die rechte Hand, die Männer in seiner Nähe gaben das Zeichen weiter, und plötzlich wurde der Hügel lebendig. Tausende von Kämpfern, die sich im Gebüsch verborgen hatten, begannen nun, gegen das Lager der Hunnen vorzurücken. Dabei bewegten sie sich langsam und behutsam. Keiner sprach ein Wort, denn sie wussten genau, wie wichtig es war, möglichst lange unbemerkt zu bleiben. An den Flanken des Stromes an Fußtruppen, der sich den Hügel hinabwälzte, führten die Reiter ihre Pferde vorsichtig am Zügel die Anhöhe hinunter. Hin und wieder schnaubte eines der Tiere, wenn es im Dunkeln gegen einen Ast stieß oder wenn sie ein Kaninchen aufscheuchten, das erschrocken davonlief. Es konnte nicht mehr lange dauern, bis sie entdeckt würden.
Dann kam der Moment, auf den sie alle gewartet und gleichzeitig auch gefürchtet hatten. Hunde begannen zu bellen, laute Rufe erschollen, Männer stürzten aus ihren Zelten. Die Feinde hatten sie bemerkt.
Gunther, der sich an der Spitze der Reiter befand, riss sein Schwert in die Höhe und deutete auf die Hunnen.
»Vorwärts, für Burgund!«, schrie er, und ein vielstimmiges Gebrüll seiner Krieger antwortete ihm.
Die Fußtruppen stürmten vor, so schnell sie konnten, während die Reiter links und rechts an ihnen vorbeipreschten. Die vordersten von ihnen waren noch hundert Schritte vom Lager entfernt, als es den ersten Hunnen gelang, sich auf ihre Pferde zu werfen. Aber sie hatten kaum Zeit, ihre Bogen anzulegen, da jagte Hagen mit seinen Männern schon heran, verbissen hieben die Burgunder mit ihren Schwertern und Speeren auf sie ein. Viele Hunnen trugen nur dünne Lederpanzer, die ihnen wenig Schutz gegen die schweren Schläge ihrer Gegner boten, während die meisten Burgunder eiserne Kettenhemden trugen, an denen die Hiebe der leichteren Säbel der Hunnen oft wirkungslos abprallten.
Mitten im dichtesten Kampfgetümmel wütete Hagen, der mit seiner breiten Klinge einen Feind nach dem anderen tötete. Plötzlich ritt ein Hunne heran, um ihn im Rücken anzugreifen, doch einer seiner Reiter warnte ihn rechtzeitig, und Hagen wirbelte im Sattel herum. Er wehrte den Speer seines Gegners mit dem Schild ab, dann spaltete er den Helm des Hunnen mit einem mächtigen Schlag. Blut spritzte auf seinen Arm, aus dem Augenwinkel erkannte er eine heransausende Klinge, rasch wandte er sich zur Seite, so dass sie ihn nicht richtig traf, sondern wirkungslos an seiner Rüstung abglitt. Wütend schlug er auf den Mann ein, der ihn fast überrumpelt hätte. Es gelang dem Steppenkrieger, einige Hiebe abzuwehren, dann wandte er sein Pferd zur Flucht. Doch er kam nicht weit, denn er traf auf einen weiteren Burgunder, der ihn mit seinem Speer durchbohrte.
Inzwischen hatten es einige der Hunnen geschafft, mit ihren Pferden aus dem dichtesten Kampfgetümmel zu entkommen. Sie formierten sich zu kleinen Gruppen von fünf oder sechs Reitern und jagten kreuz und quer über das Schlachtfeld, während sie ständig Pfeile auf ihre Gegner abschossen. Doch viele Geschosse verfehlten ihr Ziel, die Hunnen waren zwar unübertroffene Bogenschützen, aber im Dunkel der Nacht war es schwierig, ihre Feinde genau auszumachen.
Trotzdem gelang es ihnen, so viele der Burgunder zu töten, dass deren Ansturm ins Stocken kam. Doch Gunther ließ sich davon nicht beirren. Sie konnten die Schlacht nur gewinnen, wenn sie weiterhin entschlossen vorrückten. Gelänge es den Hunnen, sich zu formieren, wären sie durch ihre Überzahl im Vorteil.
Hoch richtete er sich im Sattel auf, zeigte mit seinem blutrot gefärbten Schwert auf einen Trupp feindlicher Reiter und warf sich mit seinen Männern auf sie. Die Hunnen wichen zurück, drehten sich dabei aber immer wieder im Sattel um und sandten ihnen ihre Pfeile entgegen. Doch dann trafen sie auf eine Gruppe burgundischer Fußtruppen, die ihnen ihre langen Speere entgegenstreckten. Schon war Gunther mit seinen Kriegern heran, und in dem darauffolgenden Gefecht wurden sie bis auf den letzten Mann niedergemacht.
Auch Gernot gelang es mit seinen Kämpfern, eine Gruppe von Feinden zu umzingeln und zu töten. Im Gegensatz zu Gunther und Hagen ritt er nicht an der Spitze seiner Krieger, sondern hielt sich in der zweiten Reihe. Der jüngere Bruder Gunthers, der die berühmten klassischen Helden Herkules und Achilles bewunderte, von denen ihm ein Römer erzählt hatte, war kein großer Kämpfer, obwohl er es sich so sehr wünschte. Zwar mangelte es ihm nicht an Körperkraft, doch Schwert, Schild und Speer würde er niemals so geschickt handhaben können wie Gunther oder gar Hagen.
In der Dunkelheit hatte er den Überblick über das Kampfgeschehen verloren, umso deutlicher vernahm er dagegen die Geräusche der Schlacht. Die gellenden oder klagenden Schmerzensschreie sterbender und verwundeter Männer drangen an sein Ohr, er hörte das Klirren von Metall auf Metall, den dumpfen Aufprall eiserner Schwerter auf hölzerne Schilde, das Schnauben von Pferden und das Getrappel ihrer Hufe. Gegen seinen Willen freute er sich darüber, gut geschützt inmitten seiner Männer zu sein, gleichzeitig schämte er sich dafür. Hier und jetzt, auf dem Schlachtfeld, war der Ort, ein Held zu werden, dessen Taten weithin gerühmt wurden. Doch er hatte versagt, wieder einmal.
Dann geschah etwas Erstaunliches. Die Hunnen verloren den Glauben an ihre eigene Unbesiegbarkeit. Das hier war nicht wie die Schlachten, die sie sonst schlugen; in denen sie den Feind mit einem Hagel von Pfeilen eindeckten und so aus der Ferne jeden Widerstand erstickten. Jetzt kämpften sie Mann gegen Mann, nur eine Schwertlänge von ihrem Gegner entfernt, und darin waren ihnen die germanischen Krieger überlegen.
Wenn sie sich umblickten, sahen sie überall die verstümmelten Leichen ihrer Kameraden auf dem Boden liegen, während diese kraftstrotzenden Burgunder sie mit wutverzerrten Gesichtern immer wieder angriffen. Mehr und mehr von ihnen stürzten tot oder verwundet zu Boden, wo sie von Pferden zertrampelt wurden oder die Kehlen durchgeschnitten bekamen. Voller Panik wandten die Hunnen sich zur Flucht und versuchten zu entkommen. Doch die Burgunder setzten nach und töteten noch viele von ihnen, bevor sie die Verfolgung endlich aufgaben.
Teil I
1
Behaglich räkelte sich Siegfried im warmen Wasser und schüttelte die blonden, leicht gelockten Haare. Unglaublich, wie entspannend solch ein heißes Bad war. Dann griff er nach dem Spiegel, der auf dem Beckenrand lag, und betrachtete sich zufrieden. Anders als die Spiegel, die er kannte, war dieser hier aus Glas und gab ein einigermaßen getreues Abbild wieder, wenn man hineinblickte.
Ebenso wie viele Römer war er glatt rasiert. Mit dem kantigen Kinn, der geraden, leicht hervorspringenden Nase und den kräftigen Backenknochen bot er einen beeindruckenden Anblick. Der offene Blick und seine selbstbewusste Art, sich zu bewegen, verrieten, dass er ein Mann war, der selten Anlass hatte, etwas zu fürchten.
Staunend betrachteten seine blassblauen Augen den prunkvoll ausgestatteten Raum. Er lag in einem rechteckigen Becken mit grünem Grund. Über ihm befand sich ein reich mit Stuck verziertes Dach aus Zement, getragen von vier griechischen Säulen, der Boden war aus blank poliertem Marmor. Kostbare Malereien schmückten die mit roten Tüchern bedeckten Wände, während ein Dutzend Kerzen für eine angenehme Beleuchtung sorgte.
Sein Gastgeber, der reiche Händler Rapold, war schon gegangen, aber Siegfried hatte darauf bestanden, noch ein wenig im Bad zu bleiben, um seine angenehme Wärme zu genießen. Immerhin hatte er mit seinen Knechten Dietbald und Göbel vier Tage lang im Sattel gesessen. Es war nicht einfach gewesen, die kleine Herde Pferde von Xanten bis hierher zu treiben. Schon kurz nach ihrem Aufbruch gerieten sie in ein schweres Gewitter, mehr als einmal waren ihnen einige der Tiere entwischt, so dass sie mühsam wieder eingefangen werden mussten. Doch als sie erst einmal die gepflasterten Straßen erreichten, die die Römer gebaut hatten, wurde die Reise leichter. Nur das Wetter besserte sich nicht, es regnete fast ununterbrochen, und als sie endlich in Bonna ankamen, waren sie total durchnässt.
Beim Einzug in die bis vor kurzer Zeit noch römische Stadt waren die Xantener tief beeindruckt. Die breiten Straßen wurden von prachtvollen Villen gesäumt, es gab sorgfältig angelegte Gärten mit Brunnen darin, und an vielen Ecken befanden sich kunstvoll gearbeitete Statuen von römischen Göttern. Allerdings war unübersehbar, dass die Franken sich weniger um die Instandhaltung der Stadt kümmerten als die Römer vor ihnen. An vielen Gebäuden bröckelte der Putz ab, die Straßen waren an manchen Stellen beschädigt, und die steinernen Figuren, die früher Wasser für die Brunnen gespendet hatten, taten dies nun nicht mehr.
Siegfried tauchte seinen Kopf unter und genoss die wohlige Wärme dieses Bads. Erstaunlich, dass ein Volk, das in der Lage war, solche Wunderwerke zu bauen, sich nicht mehr gegen seine Feinde durchsetzen konnte. Aber vielleicht war das ja gerade der Grund. Möglicherweise waren die Römer inzwischen zu bequem geworden, und deshalb konnten die raueren Germanen sie nun ein ums andere Mal besiegen.
Man hatte versucht, den Verfall der römischen Macht aufzuhalten, indem man das Imperium zweiteilte, in ein östliches und ein westliches Reich. Doch das hatte nicht viel genützt. Statt einem gab es nun zwei schwache Imperien, die verzweifelt versuchten, ihr Territorium zu behaupten, indem sie Bündnisse mit anderen Völkern schlossen, auf die sie hochmütig herabblickten und die sie abschätzig Barbaren nannten.
Eine Sklavin kam herein und brachte Siegfried frische Kleidung. Bevor sie wieder gehen konnte, stieg er aus dem Bad. Befriedigt sah er, wie sich ihre Augen leicht weiteten, während das Wasser von seinem muskelbepackten Körper abperlte. Mit einer Handbewegung forderte er sie auf, ihm ein Tuch zu reichen, dann trocknete er sich die Haare ab, die ihm bis weit über die Schultern auf den kräftigen Rücken fielen, über den sich eine lange Narbe zog.
Siegfried lächelte die dunkelhäutige Frau an, von der er vermutete, dass sie aus Ägypten oder Mauretanien kam.
»Gefällt dir das Leben in einer römischen Villa?«, fragte er, doch sie huschte schnell davon. Wahrscheinlich verstand sie kein Fränkisch, und ihre Herren sprachen nur Latein mit ihr.
Schnell zog er sich eine leinene Hose an – ein Kleidungsstück, das inzwischen selbst einige Römer trugen – und warf sich eine braune Tunika über. Dann ging er ins Speisezimmer, in dem Rapold mit seiner Familie bereits auf ihn wartete.
Der klein gewachsene Hausherr erhob sich lächelnd, als Siegfried den Raum betrat.
»Wir freuen uns sehr, dass du den Luxus des römischen Lebens zu schätzen weißt«, begrüßte ihn Rapold.
»Ich muss zugeben, ihr habt einige Annehmlichkeiten hier, die ich in Xanten vermissen werde«, erwiderte Siegfried, während er sich an die reich gedeckte Tafel setzte. Auch der Speiseraum wirkte sehr edel, es gab weich gepolsterte Stühle, und der glatte Boden glänzte im Licht der untergehenden Sonne, die durch die großen Fenster hereinfiel.
»Dann nutze die Zeit, um den Aufenthalt hier zu genießen. Ich habe immer gern Geschäfte mit deinem Vater gemacht, ich freue mich, dass es nun mit dem Sohn so weitergeht«, sagte der Kaufmann.
»Mein Vater hat mir viel Gutes über dich berichtet, und ich finde seine Worte bestätigt«, entgegnete der Xantener ebenso höflich.
Rapolds vierzehnjähriger Sohn Marbrecht blickte mit leuchtenden Augen auf Siegfried.
»Wir sind wahrhaft stolz darauf, einen so großen Helden wie dich in unserem Hause zu Gast zu haben«, versicherte er aufgeregt. »Ich weiß alles darüber, wie du auf dem Schlachtfeld die Friesen, Sueben oder Alemannen das Fürchten gelehrt hast.«
»Wodan hat es gut mit mir gemeint«, schmunzelte der Xantener.
»So hängst du dem alten Glauben an?«, meldete sich Ruda, Marbrechts Schwester, und sah Siegfried erwartungsvoll an.
Er betrachtete das schlanke Mädchen nachdenklich, das etwa so alt war wie ihr Bruder. Sie hatte das Haar auf römische Art hochgesteckt.
»Ja, das tue ich«, erwiderte er.
Dann grinste er leicht. »Aber in erster Linie vertraue ich auf mein Schwert. Wenn ich es gut führe, wird Wodan immer an meiner Seite sein.«
»Ruda ist vor Kurzem Christin geworden«, erklärte Rapold mit einem Gesichtsausdruck, als wolle er sagen, junge Mädchen hätten eben oft noch Flausen im Kopf.
»Du solltest das nicht erlauben, so etwas sät Zwietracht in einer Familie«, zischte Marbrecht mit einem giftigen Seitenblick auf seine Schwester.
Rapold seufzte. »Vielleicht bin ich wirklich nicht streng genug mit meinen Kindern.«
Ruda sah ihn liebevoll an. »Ich finde es gut, dass mein Vater uns erlaubt, so zu leben, wie wir wollen. Es sollte mehr verständnisvolle Menschen wie ihn geben, dann hätten wir weniger Streit auf der Welt.«
Rapold erwiderte den warmherzigen Blick. »Es ist wahr, ich erlaube es ihr, auch wenn ich es nicht billigen kann.«
Dann schaute er lächelnd zu Rudas Schwester Rinelda, einer hübschen Sechzehnjährigen, die ihr brünettes Haar, das sie normalerweise in langen Zöpfen um ihren Kopf wickelte, nun offen trug.
»Wenigstens hat meine andere Tochter den Glauben ihres Vaters nicht aufgegeben.«
»Und den ihrer Mutter«, ergänzte Rapolds Ehefrau Halgard, eine kräftig gebaute Frau Mitte dreißig, deren selbstbewusster Haltung man anmerkte, wie stolz sie auf ihr prächtiges Haus war.
Zwei Sklaven brachten das Essen herein. Der gedünstete Fisch, die verschiedenen Sorten Gemüse und die frischen Brotfladen dufteten verheißungsvoll.
»Man sagt, dass es den Menschen in Xanten gut geht«, sagte Halgard, die keinerlei Lust verspürte, die Grillen ihrer jüngsten Tochter zu diskutieren.
»Das ist wahr, wir haben fleißige Bauern und tüchtige Handwerker«, erwiderte Siegfried, während er sich einige Weintrauben nahm.
»Der gute Ruf der Xantener Tücher reicht bis hierher. Glaubst du, daraus könnte man ein schönes Festtagskleid für Rinelda nähen?«, erkundigte sich Rapold.
»Sie kommt jetzt nämlich ins heiratsfähige Alter. Da ist es wichtig, dass sie immer angemessen gekleidet ist«, erklärte Halgard mit einem bedeutungsvollen Blick auf Siegfried.
Er zuckte unwillkürlich zusammen. Schon wieder traf er auf Eltern, die ihn mit ihrer Tochter verheiraten wollten. Auch daran konnte man erkennen, wie stark das Ansehen Xantens in letzter Zeit gestiegen war, was nicht zuletzt mit seinem Ruhm zu tun hatte.
»Es wird sich bestimmt bald ein geeigneter Bräutigam finden. Deine Tochter ist schön und zurückhaltend«, entgegnete er. »So wie man sich eine gute Ehefrau wünscht«, fügte er hinzu, wobei es ihm nicht ganz gelang, einen spöttischen Unterton zu unterdrücken.
Rinelda hatte, seit er hereingekommen war, noch kein Wort gesagt, ihm aber immer wieder verstohlene Blicke zugeworfen, die so offensichtlich waren, dass er sie bemerken musste.
»Obwohl viele Ehefrauen so sind, müssen ja nicht unbedingt alle so sein«, stellte Ruda bestimmt fest und knackte eine Nuss.
Halgard seufzte hörbar. »Ruda hat schon immer ihren eigenen Kopf gehabt. Ob sich das jemals ändern wird?«
Der Xantener tauchte seine Hände in eine Schale Wasser, um sie zu säubern. »Ich bin vielleicht zu jung, um mir ein Urteil erlauben zu können, aber im Allgemeinen habe ich es gern, wenn jemand sagt, was er denkt, egal, ob Mann oder Frau.«
»Vortrefflich, Siegfried, du zeichnest dich nicht nur auf dem Schlachtfeld aus!«, rief Ruda begeistert.
Rinelda hatte inzwischen eine Fibel an der linken Schulter ihres ärmellosen Gewandes gelöst, so dass der Träger leicht nach unten rutschte, was Halgard sofort bemerkte.
»Schau dir Rinelda doch einmal genau an, Siegfried. Glaubst du, dass sie einen Ehemann glücklich machen könnte?«
»Davon bin ich überzeugt.« Er lächelte. »Vorausgesetzt, der Mann ist bereit zu heiraten.«
Rapold verstand. Siegfried hatte also noch nicht vor, sich zu vermählen. Aber das beunruhigte ihn nicht, es gab genügend Bewerber, die begierig darauf waren, seine schöne Rinelda zu heiraten.
Auch Marbrecht war froh, dass sie nicht mehr über seine Schwester sprachen. Er wartete schon lange auf eine Gelegenheit, um über etwas anderes zu reden.
»Hast du schon von dem Drachen gehört, der bei uns sein Unwesen treibt?«, wandte er sich gespannt an Siegfried.
Der Xantener sah ihn belustigt an. »Ich habe schon einige Geschichten über Drachen gehört, aber bis jetzt habe ich noch nie einen gesehen.«
Marbrecht gefiel es nicht, dass Siegfried ihn anscheinend nicht ernst nahm.
»Ich rede nicht von irgendwelchen Geschichten, sondern von einem echten Lindwurm«, versicherte er beleidigt.
Ruda sah ihn beunruhigt an. »Ach, erspar unserem Gast doch diese Ammenmärchen«, sagte sie hastig.
Siegfried spürte ihre plötzliche Anspannung, er wurde aufmerksam. »Was weißt du denn über diesen Drachen?«, wandte er sich an Marbrecht.
»Nicht weit von hier gibt es eine Klippe, die wir Drachenfels nennen. Dort haust er in einer Höhle, er hat schon viele große Krieger getötet.«
»Vielleicht sollte ich ihn einmal besuchen. Ich wollte schon immer mal einen richtigen Drachen kennenlernen«, schmunzelte er.
»Ihn zu bezwingen ist eine Heldentat, die dir würdig wäre, Siegfried«, mischte sich Halgard ein.
***
Kurze Zeit später brach Siegfried auf. Der Regen hatte endlich aufgehört; die Sonne schien von einem strahlend blauen Himmel. Lautes Vogelgezwitscher erfüllte die Luft. Einige Bewohner der Stadt genossen das schöne Wetter bei einem Spaziergang durch die Straßen, auch wenn sie auf ihrem Weg ständig großen Pfützen ausweichen mussten.
Marbrecht hatte ihm den Weg zur Höhle, in der das Untier leben sollte, genau beschrieben, er konnte ihn nicht verfehlen. Kraftvoll schwang er sich auf Grane, seinen großen Schimmel. Der Sattel knirschte vernehmlich, als er losritt. Wenn er wieder zu Haus war, würde er ihn einfetten. Freundlich winkte er seinen Gastgebern zum Abschied.
Der Xantener war gespannt, was ihn erwartete. Er gab nicht viel auf die Geschichten über Drachen. Doch sowohl Marbrecht als auch seine Mutter waren anscheinend fest davon überzeugt, dass es ihn gab. Und Ruda schien sogar besorgt um ihn zu sein.
Unwillkürlich berührte er den Knauf seines Schwertes, das er eben noch in Rapolds Villa an einem Wetzstein geschärft hatte. Egal, welche Gefahr nun auf ihn lauerte, er würde schon damit fertigwerden. Seine gewaltige Kraft gab ihm die Gewissheit, jeden Gegner überwinden zu können. Bei fast allen Kampfspielen, an denen er teilnahm, hatte er gesiegt, und auch auf dem Schlachtfeld konnte ihn niemand bezwingen. Wenn es diesen Lindwurm tatsächlich geben sollte, würde er ihn töten – und damit in den Gesängen der Völker unsterblich werden.
Es dauerte nicht lange, die Höhle zu finden, die Marbrecht ihm beschrieben hatte. Enttäuscht stellte er fest, dass nichts auf einen Drachen hindeutete. Der Eingang zur Grotte befand sich auf einer kleinen Lichtung, auf der viel nasses Laub und einige abgebrochene Äste herumlagen. Das Gewitter, in das er auf seinem Weg zu Rapold geraten war, hatte offensichtlich auch hier gewütet.
Vorsichtig trat Siegfried in die Höhle. Er verharrte einen Moment, bis sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Irgendwo vor sich hörte er ein leises Rascheln. Blitzschnell wirbelte er herum und riss sein Schwert aus der Scheide, doch es war nur ein Vogel, der in der feuchten Erde herumwühlte.
Behutsam schlich er tiefer in die Grotte hinein. Wenn hier tatsächlich etwas auf ihn lauerte, würde er bereit sein. Aufmerksam sah er sich um und lauschte auf verdächtige Geräusche. Doch alles blieb ruhig. Langsam ließ seine Anspannung nach, nichts deutete auf eine Gefahr hin.
Plötzlich bemerkte er, wie in einer Ecke vor ihm kurz etwas aufblitzte. Wahrscheinlich war ein Lichtstrahl von außen hereingedrungen und von etwas zurückgeworfen worden. Langsam bewegte er sich auf die Stelle zu. Was war das gewesen? Abgesehen von diesem kurzen Augenblick war es im hinteren Bereich der Höhle stockdunkel, deshalb konnte er nichts erkennen.
Dann stolperte er über einen Gegenstand, neugierig bückte er sich und hob ihn auf. Es war ein großes Trinkgefäß, das allem Anschein nach ganz aus Gold war. Während sich seine Augen immer besser auf die Dunkelheit einstellten, erkannte er verblüfft, dass der ganze Boden vor ihm mit Kostbarkeiten aller Art bedeckt war. Goldene, mit Perlen besetzte Halsketten, Armbänder aus schwerem Silber, verziert mit funkelnden Edelsteinen, oder reich geschmückte Truhen, aus denen riesige Mengen an goldenen Münzen hervorquollen, boten sich seinen staunenden Blicken dar.
Siegfried atmete schwer, noch niemals hatte er auch nur annähernd so viele Reichtümer an einem Ort gesehen. Wie waren all diese Dinge hierher gelangt, wer hatte sie angehäuft und – vor allem, warum lagen sie hier einfach so herum? Gab es denn niemanden, dem dieser gewaltige Hort gehörte?
Der Xantener fand keine Antwort auf diese Fragen. Dann lachte er laut los. Glücklich breitete er die Arme aus und lachte aus vollem Hals. Ja, Wodan meinte es wirklich gut mit ihm; er hatte einen riesigen Schatz gefunden, mit dem er sich alles kaufen konnte, was er wollte. Und er brauchte sich dafür noch nicht einmal in Gefahr zu begeben, weit und breit war kein Drache zu sehen. Wieder lachte er schallend, als er daran dachte, wie er stolz mit dem Schatz in den Hof seiner überglücklichen Eltern in Xanten einziehen würde.
Plötzlich hörte er ein anderes Geräusch, in dem sein Lachen unterging. Es war ein wahrhaft markerschütterndes Brüllen, das die Wände der Höhle erzittern ließ. Siegfried erbebte vor Schrecken, als das ohrenbetäubende Gebrüll noch einmal ertönte. Dann sah er, wie sich inmitten des Schatzes ein gewaltiges echsenartiges Tier erhob. Der Xantener hatte es zunächst im Dunkeln nicht bemerkt, aber nun erkannte er, dass er doch kämpfen musste, wenn er den Hort mit sich nehmen wollte. Es war unglaublich, ein Drache hauste in dieser Höhle, und seine Aufgabe war es, den Schatz zu bewachen.
Das Untier war groß wie ein Haus, aus kalten Augen starrte es auf Siegfried herab. Erneut öffnete es das Maul und brüllte furchterregend. Zwischen den riesigen Zähnen schob sich die lange Zunge lauernd hervor. Siegfried überlegte hektisch, wie er den Lindwurm töten konnte. Er war zu groß, als dass er mit dem Schwert auf Schlagweite herankommen konnte. Das Ungeheuer würde ihn einfach zertrampeln oder ihn mit dem Maul schnappen, wenn er es versuchen sollte.
Verzweifelt machte er sich bittere Vorwürfe, weil er seine Lanze nicht mitgenommen hatte. Doch er hatte es nicht für nötig gehalten, den langen Spieß mit sich zu tragen, zumal er nicht an den Drachen geglaubt hatte.
Das Untier kam langsam auf ihn zu. Als es nur noch wenige Ellen vor ihm war, öffnete es erneut sein Maul. Siegfried bereitete sich schon darauf vor, einem sengenden Feuerstrahl auszuweichen, doch das blieb ihm erspart. Stattdessen traf ihn der Gestank des heißen Atems; würgend rang er nach Luft, während er behände der Schnauze auswich. Wieder schnappte der Lindwurm nach ihm, erneut gelang es Siegfried auszuweichen, aber es war diesmal knapper gewesen, er konnte den Luftzug des an ihm vorbeisausenden Mauls deutlich spüren. Früher oder später würde es ihn erwischen, denn das Untier begann, ihn in die Enge zu treiben. Er hatte kaum noch Raum, sich zu bewegen.
Der Drache beobachtete ihn aufmerksam, sein Opfer konnte ihm nun nicht mehr entkommen. Dann schnellte sein Kopf vor. Siegfried duckte sich flink und stieß dem Lindwurm im Fallen sein Schwert in den Unterkiefer. Getroffen brüllte die Bestie auf, ein armdicker Schwall von heißem, klebrigem Blut ergoss sich über den Xantener, der ihm den Atem nahm. Er versuchte seine Klinge in die Kehle des Drachen zu rammen, doch der Lindwurm senkte seinen Kopf und schwang ihn hin und her. Mit schreckgeweiteten Augen sah Siegfried den gewaltigen Schädel auf sich zukommen, im letzten Moment konnte er sich mit einem Sprung hinter einen großen Felsbrocken retten. Er prallte heftig auf den harten Höhlenboden. Stöhnend rieb er sich die schmerzende Schulter, doch sein Kettenhemd hatte ihn vor Schlimmerem geschützt.
Angespannt beobachtete Siegfried den Drachen. Das Ungeheuer sah sich ratlos um, es wusste nicht, wo sein Gegner war. Dann kam es langsam auf den Felsen zu, hinter dem er sich verbarg; hatte es ihn entdeckt? Aber der Lindwurm bewegte sich achtlos an ihm vorbei, offenbar hatte er eine andere Stelle im Blick, die er untersuchen wollte. Schnell sprang Siegfried hinter dem Felsbrocken hervor und stieß dem Drachen sein Schwert in die Seite.
Das Untier fauchte wütend und wirbelte herum. Die Wunde an seiner Seite blutete stark, doch es schien ihm nichts auszumachen. Siegfried verzweifelte fast, wie sollte er dieses Ungeheuer töten? Seine Angriffe waren wie Nadelstiche, die zwar schmerzhaft waren, aber keinen Schaden anrichteten.
Jetzt hatte der Lindwurm ihn entdeckt. Aber als sein Maul zustieß, sprang Siegfried zur Seite. Dann traf ihn der Drache mit seinem mächtigen Schwanz und warf ihn um. Siegfried war für einen Augenblick benommen; ihm war, als hätte ihn ein Stier umgerannt.
Als er im Kopf wieder klar war, sah er einen gewaltigen Fuß von oben auf sich zukommen. Gedankenschnell rollte er zur Seite, wodurch der Fuß eine Handbreit neben seinem Kopf aufkam. Der Boden erzitterte unter dem Aufprall, und die Höhle erbebte von seinem Widerhall. Siegfried holte weit aus, als ob er einen Baum fällen wolle, und hackte auf das Bein ein. Erneut brüllte das Untier auf, es öffnete sich eine klaffende Wunde, aber das schien das riesige Tier nicht im Geringsten zu beeinträchtigen. Wild schnappte es nach ihm, doch er konnte erneut ausweichen.
Siegfried überlegte fieberhaft. Seine einzige Chance, den Lindwurm zu besiegen, war, den Kopf zu treffen, nur dort konnte er ihm eine tödliche Wunde beibringen. Die Unterseite des Drachen war zwar auch verwundbar, aber die würde er nicht erreichen können. Es blieb also nur der Kopf.
Entschlossen kletterte er auf den Felsbrocken, hinter dem er sich versteckt hatte. Er breitete die Arme aus und schrie den Lindwurm an.
»Hier bin ich! Komm her, du hässliches Ungeheuer, wenn du dich traust!«, rief er ihm zu.
Natürlich konnte das Tier seine Worte nicht verstehen, aber es verstand die Herausforderung. Fauchend starrte es ihn an, dann bewegte es sich auf den Felsen zu. Doch kurz bevor es ihn erreichte, verharrte es unentschlossen. Misstrauisch blickte der Lindwurm auf seinen Gegner. Fragte er sich vielleicht, warum Siegfried nicht mehr vor ihm floh?
Der Xantener ergriff einen faustgroßen Stein und schleuderte ihn gegen den Schädel des Drachen. Das Ungeheuer grollte, aber es bewegte sich nicht. Siegfried warf noch einen Stein auf den Drachen, erneut fauchte er wütend, doch er verharrte weiterhin unentschlossen. Er warf einen weiteren Felsbrocken, der genau die empfindliche Spitze der Schnauze traf. Der Lindwurm knurrte zornig, dann stürmte er vor.
Der Xantener blickte ihm mit klopfendem Herzen entgegen, der Drache wirkte wahrhaft furchterregend. Rasend schnell schoss sein Maul auf ihn zu, doch kurz bevor es ihn erreichte, sprang er ab und landete auf der Schnauze, die unter ihm ins Leere stieß. Der überraschte Lindwurm schüttelte heftig seinen Kopf hin und her, um Siegfried abzuwerfen, aber der hielt sich mit der freien Hand an einem der dicken Augenbrauenwülste des Ungeheuers fest, während seine Rechte auf einen geeigneten Moment wartete, um mit dem Schwert zuzustoßen.
Siegfried biss vor Anstrengung die Zähne zusammen. Er brauchte all seine Kraft, um sich festzuklammern. Das Wutgebrüll des Drachen wurde immer lauter, während seine stampfenden Füße den Boden aufrissen. Dann hörte er plötzlich auf, seinen Kopf zu schütteln, und der Xantener sah entsetzt, wie der Felsen, von dem er abgesprungen war, mit ungeheurer Geschwindigkeit auf ihn zukam. Das Ungeheuer versuchte, ihn zwischen seinem Kopf und dem Felsbrocken zu zerquetschen!
Mit der Gewandtheit einer Katze schwang er sich auf den Schädel des Drachen, im nächsten Augenblick krachte das gewaltige Maul gegen den Felsen.
Brüllend vor Schmerz war der Lindwurm einen Moment verwirrt. Auf diese Gelegenheit hatte Siegfried gewartet. Mit aller Kraft stieß er dem Tier sein Schwert in den Schädel. Aber der Knochen war härter, als er gedacht hatte, und zu seinem Entsetzen brach die Klinge. Er hielt nur noch einen Stumpf in der Hand, während die Spitze klirrend auf den steinernen Boden fiel.
Verzweifelt blickte Siegfried ihr nach. Was konnte er jetzt noch ausrichten? Dann sah er direkt unter sich das linke Auge des Drachen. Entschlossen rammte er den Stumpf seines Schwertes hinein – und mit pochendem Herzen fühlte er, wie sich der klebrige Inhalt des Auges warm über seine Hand ergoss.
Das Untier brüllte ohrenbetäubend, rasend vor Schmerz stampfte es ziellos in der Höhle umher. Siegfried stieß noch einmal zu, und seine Hand färbte sich rot von dem Blut des Ungeheuers. Er tauchte seinen Arm tief in die Augenhöhle hinein, bis er auf einen weichen Widerstand stieß, das Gehirn des Drachen. Er bohrte seine Finger in die butterartige Masse und riss einen Teil heraus. Noch einmal brüllte der Lindwurm auf, dann brach er ächzend zusammen.
Zusammengekrümmt lag das Tier auf dem Boden. An der Stelle, wo vorher das Auge gewesen war, klaffte ein dunkles Loch, aus dem ein Strom von Blut hervorquoll, in dem Teile der grauen Hirnmasse schwammen. Siegfried wartete einen Moment, bis er sicher war, dass der Drache nicht mehr in der Lage war aufzustehen, dann sprang er auf den Boden.
Das Ungeheuer beobachtete ihn kraftlos mit seinem verbliebenen Auge, als der Xantener die zerbrochene Klinge nahm und sie entschlossen in die Kehle des Tieres stieß. Ein Schwall warmen Blutes spritzte ihm entgegen und ergoss sich über ihn.
Schwer atmend wischte Siegfried sich das Gesicht ab, während die Blutlache vor dem Kopf des Lindwurms immer größer wurde. Langsam blickte er sich in der Höhle um, dann schaute er wieder auf den Drachen. Er konnte es nicht glauben, an einem einzigen Tag hatte er sich zum größten Helden weit und breit gemacht und war unermesslich reich geworden. Niemals hatte er so einen großen Hort gesehen wie diesen, der nun ihm gehörte. Stolz reckte er die Arme in den Himmel, während er Wodan für die Gunst dankte, die er ihm erwiesen hatte.
Doch schnell fasste Siegfried sich wieder. Jetzt kam es darauf an, den Schatz nach Xanten zu schaffen. Er hatte nicht die leiseste Ahnung, wie er hierhergekommen war, oder wem diese Reichtümer gehörten, doch er wusste, dass er den Hort so schnell wie möglich in Sicherheit bringen musste, zumal er nun unbewaffnet war.
Auf dem Weg zur Höhle hatte er ein Dorf gesehen, in dem ein ungewöhnlich großes Fuhrwerk stand, das kam ihm nun wie gerufen. Entschlossen stopfte er sich ein paar Handvoll goldener Münzen in den ledernen Beutel an seinem Gürtel, dann sprang er auf Grane. Der Schimmel spürte Siegfrieds überschäumende Freude, wieherte vor Vergnügen und galoppierte los.
Die Siedlung bestand aus fünf Häusern, von denen vier ziemlich schäbig wirkten. Die Bretter der Wände waren löchrig, und die Grasdächer mussten an einigen Stellen ausgebessert werden. Doch das fünfte war ein großes Langhaus, das offensichtlich von seinen Bewohnern gut instand gehalten wurde. Erleichtert stellte Siegfried fest, dass das Gespann noch vor dem Bau stand.
Der Besitzer, ein grobknochiger Mann mit dem Namen Gerwald, wollte zunächst nicht verkaufen, denn er war stolz auf seinen gewaltigen Wagen, um den ihn seine Nachbarn beneideten. Auch Siegfried zeigte sich beeindruckt. Das Gefährt wirkte zwar ziemlich alt, da das Holz an einigen Stellen schon rissig war, doch Achsen und andere bewegliche Teile wurden offenbar regelmäßig eingefettet, so dass es sich in einem ausgezeichneten Zustand befand.
Der Xantener konnte es sich nicht leisten, lange um den Preis zu handeln. Was wäre, wenn in der Zwischenzeit jemand den Schatz fand und ihn mit sich nahm? Also bot er Gerwald so viel Gold, dass dieser gar nicht anders konnte, als ihm sofort den Wagen, vier Pferde und eine große Plane zu überlassen. Glücklicherweise besaß er auch noch ein Schwert, das seinem verstorbenen Bruder gehört hatte. Es war zwar nicht zu vergleichen mit Siegfrieds alter Klinge, doch es war besser als gar keins, darum kaufte er die Waffe ebenfalls.
Eilig band Siegfried Grane an die hintere Wand des Fuhrwerks und schwang sich auf den Bock. Doch als er die Leinen anzog, rührten sich die Pferde nicht, auch leichte Berührungen mit der Peitsche brachten die Tiere nicht dazu, sich in Bewegung zu setzen.
Der Xantener seufzte. Anscheinend fiel es ihm leichter, einen Drachen zu töten, als ein Fuhrwerk zu steuern. Zwar hatte er schon einmal einen Zweispänner gefahren, aber das war lange her, nun musste er mit einem Vierspänner zurechtkommen. Außerdem kannten ihn die Tiere nicht, offensichtlich waren sie nicht gewillt, ihn als ihren neuen Herrn anzuerkennen.
Als er mit der Peitsche etwas fester zuschlug, trotteten sie zwar los, allerdings nicht in die Richtung, in die er steuern wollte. Erschrocken zog er die Leinen an, als er merkte, dass sie auf einen großen Misthügel zuhielten. Dann sah er erleichtert, wie Gerwald den Tieren ruhig entgegentrat. Die Pferde stoppten ab, dann sahen sie ihn erwartungsvoll an.
»Keine Sorge, ich kümmere mich darum!«, rief er Siegfried schmunzelnd zu.
Er führte eines der vorderen Tiere am Halfter aus dem Dorf heraus, flüsterte ihm etwas ins Ohr und gab ihm einen leichten Klaps auf den Rücken. Gehorsam trabten die Pferde los. Befreit winkte Siegfried Gerwald zu, während das Fuhrwerk rumpelnd vom Hof fuhr.
Doch sie kamen nur langsam voran; als sie die Höhle endlich erreichten, war es bereits dunkel. Ungeduldig sprang der Xantener vom Bock und eilte hinein. Erleichtert stellte er fest, dass der gesamte Schatz noch da war.
Rasch machte er sich daran, ihn aufzuladen, dann deckte er den Hort sorgfältig mit der Plane ab und fuhr los. Ein fast voller Mond leuchtete vom Himmel, so dass es einfach war, dem Weg zu folgen.
Auf seinem Weg zur heimatlichen Burg machte er einen Umweg über Bonna, um Rapolds Familie von dem Kampf mit dem Drachen zu berichten. Das Wichtigste war allerdings, dass er dort seine Knechte abholte und dass Dietbald es gewohnt war, ein Fuhrwerk zu lenken.
Als Siegfried an der Eingangstür zum Innenhof der Villa klopfte, ließ ihn ein älterer Sklave ein. Sofort eilte Rapold mit seiner Familie aus dem Haus, um ihn willkommen zu heißen.
»Wir sind froh, dich unverletzt zu sehen«, begrüßte ihn der Hausherr.
»Was ist mit dem Drachen, hast du ihn getötet?«, platzte Marbrecht heraus.
Siegfried tätschelte ihm lächelnd den Kopf. »Nur nicht so ungeduldig, ihr werdet schon noch alles erfahren.« Er deutete auf seinen Wagen, der an der Straße stand.
»Habt ihr noch Platz für den auf dem Hof?«
»Platz genug schon, aber es könnte schwierig werden, ihn durch das Tor zu bekommen«, meinte Rapold.
Die Xantener Knechte, die in den Quartieren der Sklaven untergebracht waren, kamen ebenfalls in das Atrium.
Siegfried nickte ihnen zu. »Dietbald schafft das schon, macht euch da keine Sorgen«, erwiderte er und winkte den stämmigen Mann heran, der sofort auf den Bock stieg und die Leinen in die Hand nahm.
Tatsächlich schaffte er es, das Fuhrwerk ohne größere Mühe in den Hof zu lenken.
Nachdenklich betrachtete Rapold den Wagen. Den hatte der Xantener noch nicht, als er zum Drachenfels aufgebrochen war. Was mochte da wohl drauf sein? Aber Siegfried machte keinerlei Anstalten über das Gespann zu reden, er würde wohl seine Gründe dafür haben.
Dietbald stieg wieder vom Fuhrwerk. »Brauchst du mich noch, Herr?«, fragte er.
»Nein, das ist alles.« Siegfried nickte seinem Knecht anerkennend zu.
»Gute Arbeit, Dietbald.«
»Danke, Herr«, antwortete er und ging zu einer Säule an einer Ecke des Hofs. Siegfried zog überrascht eine Augenbraue hoch, als er erkannte, dass dort die dunkelhäutige Sklavin wartete, die er im Bad kennengelernt hatte. Die beiden fassten sich an den Händen und verließen das Atrium. Göbel trottete ihnen mit hängendem Kopf hinterher. Anscheinend hatte Dietbald die Zeit seiner Abwesenheit gut genutzt, während Göbel leer ausgegangen war.
Während zwei Sklaven eine kleine Mahlzeit zubereiteten, wurde Siegfried weiterhin mit Fragen über den Drachen bestürmt.
»Eins nach dem andern. Zuerst zu den Geschenken, die ich für euch mitgebracht habe«, wehrte er ab.
Er öffnete einen Beutel an seinem Gürtel, holte einige spitze Gegenstände von der Größe eines Fingers hervor und breitete sie auf einem Tisch aus.
Halgard betrachtete die weißlichen Dinger, die an einigen Stellen rote Spritzer aufwiesen, misstrauisch.
»Was hast du uns denn da mitgebracht?«, fragte sie ratlos.
»Wonach sieht es denn aus?«, fragte er zurück.
Plötzlich schrie Marbrecht erregt auf. »Das sind Zähne des Drachen, du hast ihn tatsächlich getötet«, rief er begeistert.
Siegfried legte ihm lachend die Hand auf die Schulter. »Da hast du recht. Und weil du mir von dem Lindwurm erzählt hast, darfst du dir jetzt den schönsten aussuchen.«
Freudestrahlend blickte der Junge auf den Tisch. Seine Augen jagten aufgeregt zwischen den Zähnen hin und her, er konnte sich nicht entscheiden. Schließlich wählte er den größten und nahm ihn begierig auf.
»Eine gute Wahl«, befand Siegfried. »Jetzt seid ihr dran«, wandte er sich an die anderen. »Nehmt euch einen, aber beeilt euch. Wer zu lange zögert, muss das nehmen, was übrig bleibt.«
Schnell griffen sie zu, doch am Ende blieb ein gelblicher Zahn mit einem großen Blutfleck zurück.
Überrascht blickte Siegfried auf Ruda, die keinen genommen hatte.
»Was ist mit dir? Willst du keinen Zahn?«, fragte er.
»Nein, daraus mache ich mir nichts.«
Der Xantener sah sie bedauernd an. »Das tut mir leid, dann habe ich ja gar kein Geschenk für dich.«
»Also … Vielleicht könntest du mir ja etwas anderes geben«, erwiderte sie leise.
Verwundert runzelte er die Stirn. »Wenn es mir möglich ist …«
Sie errötete, trat ganz nah an ihn heran und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Er spürte, wie ihre warmen Lippen seine Ohrmuschel berührten.
Dann schmunzelte er.
»Habt ihr eine Schere?«, erkundigte er sich.
Mit einem fragenden Ausdruck im Gesicht gab Halgard ihm eine, die noch auf dem Boden lag, weil ein Sklave mit ihr Unkraut beseitigt hatte.
Siegfried ergriff sie, schnitt sich eine Locke aus dem Haar und reichte sie Ruda. Mit einem schüchternen Lächeln nahm sie das Haarbüschel entgegen, dann verstaute sie es hastig in einem Beutel an ihrem Gürtel.
Halgard und Rinelda warfen sich einen missbilligenden Blick zu.
»Dafür musst du aber einen Ehrenplatz finden«, schmunzelte Rapold.
»Das werde ich«, erwiderte sie bestimmt.
Nach dem Essen, das wieder sehr schmackhaft war, besuchte Siegfried noch einmal das römische Bad, das er bei seinem ersten Aufenthalt in Rapolds Villa so lieb gewonnen hatte, und machte sich dann zufrieden auf den Weg nach Xanten. Die Zähne, die er verteilt hatte, würden dafür sorgen, dass sich die Kunde von seinem Sieg über den Drachen rasch verbreitete.
2
Unwillkürlich flog ein Lächeln über Siegfrieds Gesicht, als er die heimatliche Burg erblickte. Sie hatten für den Weg mehr Zeit gebraucht, als er gedacht hatte. Zwar führten sie jetzt nicht mehr die Pferde mit sich, die er Rapold verkauft hatte, aber dafür hatten sie den mit dem Schatz schwer beladenen Wagen dabei.
Das vormals römische Gebäude lag auf einer felsigen Anhöhe. Die massiven Mauern boten immer noch einen beeindruckenden Anblick, auch wenn einige Ziegel schon herausgebrochen waren. Römische Handwerker kamen selten in diese Gegend, und sie waren die Einzigen, die wussten, wie man steinerne Bauten errichtete. Wie zu seiner Begrüßung erhob sich ein Schwarm Tauben von der Burgmauer in die Luft. Erleichtert ritt er den schlammigen Weg zum Tor hinauf, es war eine lange Reise gewesen, und er freute sich, wieder zu Hause zu sein.
Doch Dietbald konnte ihm nicht folgen, die Pferde waren nicht in der Lage, den steilen Anstieg hinaufzukommen. Heftig schnaubend bemühten sie sich, das schwere Fuhrwerk vorwärts zu ziehen, aber die lehmverschmierten Räder fraßen sich schmatzend in den tiefen Boden, der Wagen steckte fest. Siegfried und Göbel sprangen von ihren Pferden, um von hinten zu schieben. Ächzend stemmten sie sich gegen das aufgewühlte Erdreich und versuchten, das Gefährt aus dem Morast zu befreien. Doch es bewegte sich immer noch nicht. Zu allem Überfluss sanken die Räder auf der linken Seite nun noch tiefer ein, so dass der Wagen sich zur Seite neigte. Er drohte umzukippen.
Aber dann öffnete sich knarrend das Tor, und ein halbes Dutzend Männer stürmte heraus, um ihnen zu helfen. Mit vereinten Kräften schafften sie es, das Fuhrwerk wieder freizubekommen. Während Siegfried den Männern dankte, musste er an die gepflasterten Straßen in Bonna denken. Dort wäre so etwas nicht passiert.
Bei seinem Einzug in die Burg fielen ihm Dinge auf, die er vorher nicht bemerkt hatte. Die strohgedeckten Hütten der Knechte und Mägde waren so verwahrlost, dass es bei schlechtem Wetter hineinregnete, der Boden war verdreckt vom Kot der frei herumlaufenden Hühner und Gänse, und die überall herumliegenden Abfälle verbreiteten einen fauligen Geruch.
Doch das bedrückte ihn nicht lang, gelöst winkte er den Menschen zu, die sich im Hof versammelt hatten und immer wieder »Siegfried, der Drachentöter!« riefen. Die Nachricht von seiner Heldentat hatte sich also schon bis hierhin herumgesprochen. Stolz blickte er zu seinen Eltern Siegelind und Siegmund, die vor dem Tor der Halle standen und ihm zulächelten.
Siegelind, die ebenso wie ihr Sohn ungewöhnlich groß war, sah argwöhnisch auf den schweren Planwagen, den Dietbald mit einiger Mühe in den engen Pferdestall lenkte. Dann sprach Siegfried mit einem Bewaffneten, der sich daraufhin vor den Eingang stellte. Was hatte das zu bedeuten?
Er eilte zur Halle und küsste seine Eltern auf die Wangen.
»Dein Ruf als Drachentöter eilt dir weit voraus«, begrüßte Siegmund ihn lachend und strich sich sein dunkles, mit Spuren von Grau durchsetztes langes Haar aus dem Gesicht.
»Nichts reist schneller als eine gute Geschichte«, erwiderte sein Sohn fröhlich.
Kurz darauf saßen sie am reich gedeckten Esstisch. Um Siegfrieds Rückkehr zu feiern, gab es neben dem üblichen Gemüseeintopf auch einen saftigen Schweinebraten.
Natürlich musste er seinen Kampf mit dem Drachen in allen Einzelheiten erzählen, und er berichtete, wie freundlich ihn Rapolds Familie aufgenommen hatte. Als sein Vater zufällig aus dem schmalen Fenster blickte, sah er, wie der Wachtposten vor dem Stall seinen Speer an einem Wetzstein schärfte.
»Was ist eigentlich auf dem Wagen?«, wollte er wissen.
Siegfried ließ einen Moment verstreichen, dann schaute er seinen Vater verschmitzt an. »Ach ja, ich vergaß zu erwähnen, dass der Drache etwas bei sich hatte.«
Er stand auf und wischte sich seine Hände an einem Tuch ab.
»Kommt mit«, sagte er knapp, dann verließ er den Raum.
Verwirrt folgten seine Eltern ihm zu den Stallungen, wo sie der Geruch von frischen Pferdeäpfeln empfing.
Wortlos ging Siegfried zum Wagen und schlug die Plane zurück. Seine Eltern benötigten einen Moment, um zu begreifen, was sie da sahen.
Fassungslos blickten sie auf die Reichtümer, die sich ihren erstaunten Augen darboten. Einen Moment lang sagte niemand etwas. Siegmund rang nach Atem, während seine Frau sich an ihrem Sohn festhalten musste, um nicht zu Boden zu stürzen.
»Der Drache war der Hüter dieses Horts, er gehört nun mir – uns«, erklärte Siegfried lächelnd.
Seine Eltern starrten immer noch wie gebannt auf das viele Gold.
»Und wo sollen wir ihn aufbewahren?«, fragte Siegelind mit belegter Stimme.
»Haben wir nicht eine Schatzkammer, in der wir unsere wenigen Kostbarkeiten hüten? Nun können wir dafür sorgen, dass sie ihren Namen auch verdient«, antwortete ihr Sohn leichthin.
Siegelind sah besorgt nach dem Wachtposten, aber der pisste gerade in eine dunkle Ecke.
»Mir ist nicht wohl dabei. Du hast den Hort geraubt, nun ist er verflucht«, raunte sie.
Erstaunt blickte Siegfried sie an. War sie etwa nicht froh darüber, dass sie nun einen riesigen Schatz besaßen?
»Was ist mit dir, Mutter? Ich habe einen furchtbaren Drachen getötet, damit habe ich mir den Hort verdient«, erwiderte Siegfried entschlossen.
»Behalte ihn nicht«, drängte Siegmund. »Schaff ihn wieder in die Höhle und weihe ihn Wodan, dann werden die Götter ihn zurücknehmen.«
Siegfried sah sie ungläubig an. »Was ist nur los mit euch? Ich bringe einen gewaltigen Schatz nach Haus, und anstatt sich mit mir zu freuen, tut ihr so, als hätte ich einen schlimmen Fehler gemacht.« Er blickte ihnen fest in die Augen. »Die Nornen haben mich an ihren Schicksalsfäden in die Höhle geführt, damit ich den Hort gewinne.«
Plötzlich tat es einen gewaltigen Donnerschlag. Von einem Augenblick auf den anderen zogen große dunkle Wolken auf, und eine von ihnen legte sich so vor die Sonne, dass es für einen Moment düster war wie die Nacht.
Mit einem dumpfen Gefühl der Beklemmung betrachtete Siegfried den Himmel. Doch er fasste sich schnell wieder.
»Wir müssen die Fenster in der Halle abdichten, damit es nicht reinregnet«, rief er und hastete über den Hof.
Seine Eltern sahen ihm besorgt nach, dann folgten sie langsam.
Auf dem Weg zur Halle kam ihnen eine alte Frau entgegen, deren langes graues Haar ihr aufgelöst ins Gesicht hing.
Mit wirrem Blick fasste sie Siegmund am Handgelenk.
»Siehst du, was da draußen vor sich geht, Herr?«, fragte sie eindringlich und streckte den anderen Arm mit einer weit ausladenden Geste zum Himmel. »Ich frage euch, zieht ein normales Gewitter so schnell auf? Die Luft riecht verbrannt, die Mäuse kommen aus ihren Löchern, die Vögel verharren furchtsam auf ihren Ästen …«
Plötzlich begannen die Hunde, laut zu bellen, Pferde wieherten aufgeregt in ihren Ställen, Hühner flatterten nervös von einer Ecke in die andere.
»Seht ihr es?«, rief die Frau mit heiserer Stimme und drückte Siegmunds Arm so fest, dass ihre Nägel sich wie Adlerklauen in seine Haut bohrten.
Siegfried war inzwischen wieder umgekehrt und eilte zurück auf den Hof. Mit einem kräftigen Ruck riss er die Frau von seinem Vater los.
»Tyra, was fällt dir ein, deinen Herrn so zu bedrängen?«, fuhr er sie an.
Ganz langsam, wie entrückt drehte sie sich zu ihm um und richtete ihre durchdringenden dunklen Augen auf ihn. Dann wurde ihr Blick wieder klarer, und sie ließ Siegmunds Arm los.
»Verzeih, Herr, ich habe nur gesagt, was ich sehe«, murmelte sie und schlich in gebückter Haltung zur Hütte der Knechte und Mägde.
Siegfried und seine Eltern atmeten auf. Es wirkte immer beängstigend, wenn eine weise Frau sich so gebärdete, doch anscheinend hatte sie sich nun wieder beruhigt.
Aber unvermittelt wandte sie sich noch einmal zu ihnen um. Ihre Haltung straffte sich, und in ihren Augen loderte ein unheimliches Feuer.
»Ich sehe Unglück und Tod. Ein Fluch ist in diese Mauern eingezogen, einer von euch wird im nächsten Sommer nicht mehr am Leben sein – das sagt euch Tyra!«, verkündete sie mit ihrer heiseren Stimme, die im Heulen des Sturmes kaum zu verstehen war. Dann ging sie langsam zu ihrer Hütte, während der Wind ihr den Regen ins Gesicht peitschte.
Die drei Burgherren sahen sich beklommen an.
Siegfried fasste sich als Erster wieder.
»Wir haben genug Zeit verloren – schnell zur Halle!«, rief er, und sie stürzten hinein.
Es war höchste Zeit, die Fenster abzudichten. Einige Pfützen hatten sich schon auf dem Boden gebildet, und der heftige Wind trieb immer mehr Wasser hinein. Schnell schnappten sie sich Tücher, um damit die kleinen dreieckigen Öffnungen zuzustopfen. Wieder musste er an Bonna denken. Einige der Häuser dort hatten große Fenster mit Scheiben aus Glas, durch die der Regen nicht hineindrang.
Als sie alle Luken abgedichtet und das Wasser vom Boden aufgewischt hatten, setzten sie sich erleichtert an einen Tisch. Schweigend lauschten sie dem Heulen des Windes und dem Prasseln des Regens, der gegen die Wände schlug.
Siegfried wischte sich die nassen Hände an einem prächtigen Wolfsfell ab, das an der Wand hing.
»Das ist ja nicht zu glauben, im ganzen Land rühmt man mich als mächtigen Drachentöter, doch in meinem eigenen Haus will man mir einreden, ich sei verflucht«, spottete er.
Niemand antwortete ihm, seine Eltern blickten betroffen zu Boden.
Siegfried seufzte. »Wir kennen Tyra doch, sie hat jede Woche böse Vorahnungen und sieht schlimme Dinge. Meistens ist nichts davon wahr.«
»Aber manchmal hat sie auch recht«, widersprach Siegelind bedrückt.
»Einmal von hundert«, winkte ihr Sohn verächtlich ab.
Lächelnd fasste er sie an den Hüften und hob sie in die Höhe.
»Mutter, du weißt doch, was ich von Flüchen und anderem Hexenwerk halte«, grinste er sie an. »Sie haben nur Macht, wenn man sie fürchtet.«
Vorsichtig ließ er sie wieder hinunter. Gegen ihren Willen musste Siegelind sein Lächeln erwidern. Irgendwie schaffte er es doch immer, sie zu überzeugen.
Auch Siegmund lächelte. Es stimmte schon, Tyras Weissagungen kamen in regelmäßigen Abständen. Wenn er all ihren unheilvollen Prophezeiungen glauben würde, könnte er sich morgens gar nicht mehr aus dem Bett trauen.
Gelöst verzehrten sie die Reste ihres Essens. Dabei erzählte Siegfried seinen Eltern die Geschichte von einem Fluch auf eine uralte Burg, in der angeblich eine weise Frau ermordet worden war. Immer wieder öffnete sich auf geheimnisvolle Weise das Tor der Halle und knallte laut zu. Auch fielen häufig Gegenstände zu Boden, außerdem ging in der Nacht manchmal der alte Burgherr im Nachtkittel über den Hof, obwohl er augenscheinlich in tiefen Schlaf versunken war. Erst viele Jahre nachdem diese seltsamen Erscheinungen erstmals auftraten, stellte sich heraus, dass die angeblich tote Seherin in Wahrheit höchst lebendig war und ihre Kinder dazu angehalten hatte, Unruhe zu stiften. Sie hatte sich nämlich tödlich beleidigt gefühlt, als man sie wegen einer ihrer Weissagungen verspottete, und war im Zorn von der Burgmauer gesprungen. Bei der Landung hatte sie sich den Kopf angeschlagen, wodurch sie ohnmächtig wurde.
Die Menschen glaubten, sie sei tot, aber aus Angst vor ihrem Geist, der noch in der Nähe sein musste, überprüfte es niemand. In der Nacht kam sie wieder zu sich und ging davon. Als die Burgbewohner sie am nächsten Morgen nicht mehr sahen, waren sie überzeugt, dass die Seherin sie von nun als Wiedergängerin heimsuchen werde, und lebten seitdem in ständiger Furcht vor ihr. Aus Rache nutzte die weise Frau nun die Schläue ihrer Kinder, um die Kunde zu verbreiten, die Burg sei verflucht. Überdies litt der Schlossherr zu ihrem Glück unter einer seltenen Krankheit, die ihn dazu zwang, im Schlaf durch die Burg zu wandeln, wodurch die Geschichte von ihrem Fluch weiter an Glaubwürdigkeit gewann.
Seine Eltern lachten Tränen über diese Geschichte und die witzige Art, in der er sie erzählte, und bald konnte Tyras düstere Wahrsagung sie nicht mehr beunruhigen. Es stimmte schon, Seherinnen nahmen sich selbst viel zu wichtig und machten Prophezeiungen oft nur, damit man ihnen Beachtung schenkte.
Siegfried nahm einen Schluck von dem würzigen Met, den sein Vater ihnen eingeschenkt hatte.
Als er sein Trinkgefäß wieder absetzte, schaute er seine Eltern gelöst an. »Um euch noch den letzten Rest an Sorge zu nehmen, versichere ich euch, dass ich den Hort nicht mehr lange behalten werde.«
Sie blickten ihn erwartungsvoll an. Glaubte er doch an den Fluch, den Tyra verkündet hatte?
»Jedenfalls nicht den ganzen«, schränkte er ein.
Dann sah er sie bedeutungsvoll an.
»Die Welt ist in Bewegung geraten. Im Osten bedrängen die Hunnen ihre Nachbarn so stark, dass viele von ihnen aus Furcht Richtung Westen ziehen. Im Norden kommt es zu schweren Stürmen und Überflutungen, darum verlassen die Stämme dort ebenfalls ihre Heimat. Immer wieder erscheinen nun fremde Völker an unseren Grenzen, um zu plündern oder Land zu erobern. Es ist noch nicht lange her, als wir die Sueben abwehren mussten, und kurz nach ihnen kamen die Friesen.«
Siegmund nickte mit ernster Miene, es waren kriegerische Zeiten, auch Xanten war nicht verschont geblieben. Einige Dörfer waren verwüstet worden, und sie hatten viele Männer verloren.
»Unsere Stärke bin ich«, fuhr Siegfried fort. »Die Krieger vertrauen auf meine Kraft, sie glauben, mit mir an der Spitze können sie alle Feinde besiegen. Doch ich bin nur ein Mann, meine Macht ist nicht grenzenlos.« Siegfried blickte ihnen fest in die Augen. In seinem Blick loderte ein Feuer, das sie ansteckte.
»Darum will ich mich unbesiegbar machen«, rief er aus. »Und der Schatz wird mir dazu verhelfen. Ich werde seinen Reichtum verwenden, um mir die besten Waffen zu beschaffen, die je ein Held besaß. Ein mächtiges Schwert, das auch die stärksten Panzerungen durchschlägt, und, wichtiger noch, eine Rüstung, der kein Feind etwas anhaben kann.«
Sein Vater blickte mit leuchtenden Augen auf ihn und fühlte sich mit einem Mal zwanzig Jahre jünger. Ja, von solchen Dingen träumte jeder Krieger, sie waren der Schlüssel zu Ruhm und Ehre.
»Niemand kann mich in offenem Kampf bezwingen«, sprach Siegfried weiter. »Aber jemand, der sich in meinem Rücken heranschleicht, könnte mich töten. Doch mit einer meisterlich gefertigten Rüstung bin ich unangreifbar. Dann kann kein Feind mehr Xanten gefährlich werden.«
Siegelind kam mit ausgebreiteten Armen auf ihn zu und drückte ihn an sich.
Als sie sich wieder von ihm löste, standen ihr Tränen in den Augen.
»Dann hol dir diese Waffen. Jedes Mal, wenn du ausreitest, mache ich mir Sorgen um dich. Wie leicht kann ein aus dem Hinterhalt abgeschossener Pfeil dich treffen, oder ein starker Krieger sucht seinen Ruhm zu mehren und fordert dich heraus.« Ihr Blick fiel auf die Truhe, in der sie die weiße Tunika verwahrte, die sie bei ihrer Hochzeit getragen hatte. »Und wenn du alle Feinde bezwungen hast, wirst du endlich auch Zeit haben, an deine Vermählung zu denken«, lächelte sie.
Siegfried war in zu guter Stimmung, um ihr zu widersprechen, also erwiderte er nur das Lächeln.
Sein Vater strich sich nachdenklich über seinen dünnen Bart. »Weit im Osten, im Suavawald, gibt es einen Schmied, von dem man sagt, er versteht sein Handwerk wie kein Zweiter. Nirgendwo wirst du bessere Waffen finden als bei ihm.«
»Dann auf in den Suavawald! Morgen mache ich mich auf den Weg«, lachte Siegfried.
3
Träge blinzelte Siegfried in den wolkenverhangenen Himmel, während er sich fröstelnd fester in den Mantel hüllte. Bald würde es wieder schneien, und die dicke Schneeschicht würde noch tiefer werden. Seit zehn Tagen ritt er nun schon ostwärts. Es war eine beschwerliche Reise. In den ausgedehnten Wäldern gab es kaum Wege, darum musste er sich oft zwischen umgestürzten Bäumen und scharfkantigen Felsen hindurchkämpfen, um voranzukommen. Für Grane war das besonders anstrengend, seine Fesseln wiesen viele blutige Kratzer auf.
Wieder einmal kamen sie zu einer Senke, in der der Schnee fast kniehoch lag. Siegfried saß ab, um den ausgelaugten Hengst am Zügel hinter sich herzuziehen. Mensch und Tier waren erschöpft und stießen ihren Atem als dichte Wolken aus.
Mehr als einmal hatte er sich verirrt, denn die hohen Bäume standen so dicht, dass er die Sonne oft nur schwer ausmachen konnte, und anders als die in seiner Heimat verloren sie im Winter nicht ihre Blätter. Vielleicht hätte er sich doch auf ortskundige Führer verlassen sollen, aber das war ihm zu riskant gewesen. Wie leicht konnte jemand wegen der schweren Satteltasche, die er auf dem Rücken seines Schimmels mit sich trug, auf dumme Gedanken kommen.
Plötzlich hörte er die lauten Schreie von zwei Kindern, die im Schnee miteinander rangen. Die beiden etwa sechsjährigen Jungen waren gleich stark, keiner wollte nachgeben, und so kämpften sie verbissen gegeneinander, während sie sich Beleidigungen ins Ohr schrien. Beruhigend strich er Grane über die Nüstern. Spielende Kinder bedeuteten, dass es hier eine Ansiedlung gab, und das bedeutete Gefahr. Die Sachsen waren ein kriegerisches Volk, das nicht zögerte, Angehörige anderer Stämme, die sich auf ihrem Gebiet befanden, ohne Warnung anzugreifen, erst recht, wenn sie so viel Gold dabeihatten wie er.
Wachsam suchte er mit den Augen die Umgebung ab. Dann sah er den Schein eines Feuers, von dem dünner Rauch aufstieg. Er band Grane an einen Ast und näherte sich vorsichtig, bis er zum Rand einer Lichtung kam. Besorgt hörte er das Knirschen seiner Stiefel im Schnee und hoffte, dass ihn niemand bemerkte. Er zählte ein Langhaus und fünf kleinere Häuser, also musste er mit bis zu zwanzig waffenfähigen Männern rechnen.





























