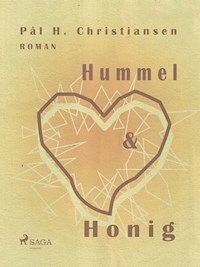Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Eines der erheiterndsten Bücher über das Romanschreiben und die Suche nach den Richtigen Worten.Hobo Highbrow könnte kurz vorm Literaturnobelpreis stehen, wenn er nur endlich mit seinem neuesten Roman beginnen würde. Statt dessen scheint ihn die Freundin zu betrügen, Unbekannte stehlen seinen Schreibtisch, und er verliert den Job. Ein Glück, dass ihm da wenigstens ein Wörterbuch, die Kneipe "Vier Hühner" und die Popgruppe a-ha Halt geben.Im bürgerlichen Leben arbeitet Hobo beim norwegischen Boulevardblatt VG. Mit seiner Freundin Helle verbindet ihn die pedantische Liebe zur norwegischen Sprache, selbst am Strand spielen die beiden Scrabble. Er trifft sich regelmäßig in seiner Kneipe auf ein Bier mit seinen Kumpels und verbreitet dort seine Erkenntnisse über die Welt.AUTORENPORTRÄTPål H. Christiansen wurde 1958 in Oslo geboren. "Die Ordnung der Worte" ist sein fünfter Roman und sein erster, der in Deutschland erscheint. 2001 erhielt er den Tiden-Preis für sein Buch "Hummel und Honig". Christiansen lebt in Oslo."Erfrischender Großstadtspirit - Skandinavien - das Mekka moderner Literaten, die das Leben nehmen wie es kommt und auf köstliche Art und Weise über die alltäglichen Merkwürdigkeiten des menschlichen Daseins und Handelns zu erzählen wissen." - U., Amazon.de-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pål H. Christiansen
Die Ordnung der Worte
Roman
aus dem Norwegischen vonChristine von Bülow
Lindhardt & Ringhof
»Ich bin nichts.Ich werde nie etwas sein.Abgesehen davon, trage ich in mir alle Träume der Welt.«
ÁLVARO DE CAMPOS
Für die Morgentoilette brauchen Frauen einfach etwas länger. Manche Männer machen deshalb einen Mordszirkus. Sie ereifern sich und lassen ihrer Ungeduld freien Lauf durch Schmähungen und tätliche Angriffe auf alles, was ihnen in die Quere kommt. Aber hilft es denn, vor Ungeduld gegen die Badezimmertür zu treten oder damit zu drohen, schon mal alleine loszugehen, in der Hoffnung, damit die Wartezeit zu verkürzen? Macht das die Sache nicht bloß immer schlimmer, die Wartezeit schwerer erträglich? Statt sich einfach hinzusetzen und locker zu bleiben, bis die Zeit reif ist. Neben der Fähigkeit, korrektes Norwegisch zu schreiben, ist das eins der wichtigsten Dinge, die das Leben mich gelehrt hat.
Ich saß bei Helle in der Küche und horchte auf das laufende Wasser im Badezimmer. Ging ich nicht recht in der Annahme, dass sie gerade dabei war, sich die Haare einzuseifen? Dass sie das lebensspendende Shampoo mit kräftigen Fingern in die Kopfhaut einmassierte? Darauf würden das Spülen und die Pflegekur folgen, und dann wäre der Rest des Körpers an der Reihe.
Die Uhr an der Wand stand auf halb neun. Helle hatte gerade eine aktive Phase und wollte anfangen, die Küche zu renovieren. Der Kühlschrank stand mitten im Zimmer, zusammen mit dem Gewürzregal, der Pinnwand und einer Reproduktion von Gauguin, die eine Frau mit einem Kind auf dem Arm darstellte. Soweit ich verstanden hatte, wollte Helle die Wände grün streichen, während sie für die Küchenschränke den Rotton gewählt hatte, der ihrer Meinung nach der ursprünglichen Farbe entsprach.
Eine Sache hat mich das Leben in Bezug auf Frauen gelehrt, dachte ich. Sie lullen sich ein in dem Glauben, dass das Leben nach einer Renovierung ein besseres Leben wird, ein Leben voll unendlicher Möglichkeiten. Die Wahrheit ist jedoch, dass nur harte Arbeit zu den Pforten des Himmels führt.
Ich ging ins Wohnzimmer und stellte mich vor das Bücherregal. Die Balkontür stand weit offen, und die Geräusche der Stadt drangen von der Straße herauf: Geschrei von Kindern auf dem Weg zur Schule, die Straßenbahn, die vorbeifuhr, der Lärm von einem Müllwagen, der sich von Haus zu Haus bewegte.
Über Helle ließ sich enorm viel Gutes sagen, aber was die Systematik in ihrem Bücherregal betraf, war sie ein hoffnungsloser Fall. Vor mir stand zum Beispiel ein Buch wie Erogene Zonen im Mittelalter von einem gewissen Howard Humpelfinger. Ich zögere nicht zu behaupten, dass der Verlag der Menschheit einen großen Dienst erwiesen hätte, wenn die gesamte Auflage eingestampft worden wäre. Das Buch war ein Machwerk, derart strotzend vor Druckfehlern, dass es schier unlesbar war. Helle hatte darauf bestanden, es neben dem Wörterbuch des Riksmål einzuordnen, das sich jener Sprachform unseres Landes widmet, die aus unserer dänisch-norwegischen literarischen Tradition hervorgegangen ist, – so als wäre das eine ganz natürliche Sache, so wie Butter aufs Brot zu schmieren.
Das Riksmål Wörterbuch der Norwegischen Akademie für Sprache und Literatur ist ein phantastisches Hilfsmittel. Hier findet man Antworten auf alles, was man sich nur fragt, mit einer solchen Präzision und einem Sprachgefühl, dass einem fast schwindelig wird. Wohl war die Ausgabe, die ich nun aus Helles Bücherregal zog, von 1982, aber wenn es um sprachliche Fragen geht, schadet es meiner Meinung nach nicht, einige Jahre in der Zeit zurückzugehen. Die Rechtschreibung von 1917 hat beispielsweise sympathische Züge, und auch über die von 1907 lässt sich viel Gutes sagen. Noch weiter zurück traue ich mich dann aber doch nicht.
Ich saß lange auf dem Sofa und vertiefte mich in verschiedene Worterklärungen, während Helle duschte und duschte, als ob es kein Morgen gäbe. Ein Typus Wörter, für den ich schon immer etwas übrig hatte, sind solche, die einfallsreich und präzis ein Phänomen beschreiben, ein Lebewesen oder einen Gegenstand, wie zum Beispiel ISEGRIM. Der ISEGRIM ist ein eiskalter Jäger und ein grimmiges Tier, nämlich der Wolf. Ich sah ihn förmlich vor mir, wie er durch die kalten schwedischen Grenzwälder schlich, hungrig und alleine auf der Jagd nach einem Schaf, das er fressen könnte.
Die Dusche wurde abgestellt und es war einen Augenblick lang still. Was passierte nun? Salbte sie sich mit der mystischen Creme, an der ich immer schnupperte, wenn ich in ihrem Bad war? Oder war jetzt Zähneputzen dran? Ich stand auf und ging einige Schritte in Richtung Badezimmer.
Die Tür sprang auf. Helle kam heraus mit einem Handtuch um die Hüften und nassen Haaren. Sie sah unverschämt fraulich und gutgelaunt aus und durchquerte das Wohnzimmer, anscheinend ohne zu bemerken, dass ich da mit dem Riksmål Wörterbuch in der Hand und einem schläfrigen Ausdruck im Gesicht herumstand. Am Abend zuvor waren wir spät ins Bett gegangen nach einer Partie Scrabble, die interessante Diskussionen über das korrekte Buchstabieren von Wörtern wie MENSENDIECKEN, PSORIASIS und ASSESSOR mit sich gebracht hatte. Wenn es um Sprache ging, war Helle einer der wenigen Menschen auf dieser Welt, auf die ich mich verließ und an denen ich mich richtig reiben konnte.
Nachdem ich das Spiel gewonnen hatte, und zwar mit Hilfe des Wortes RAHMENANTENNE, hatten wir, jeder für sich, den Abend mit einem Lumumba beschlossen, waren wie arglose Kinder ins Bett gegangen und hatten uns unseren Träumen überlassen.
»Es gibt TATSÄCHLICH so etwas wie eine RAHMENANTENNE«, sagte ich.
Helle blieb vor der Balkontür stehen und drehte sich um.
»Steht hier drin«, sagte ich.
»Steht wo drin?« fragte Helle.
»Eine RAHMENANTENNE ist eine Radioantenne aus Draht, der um einen Rahmen gespannt wird«, erklärte ich.
»Okay«, sagte Helle.
Sie ließ das Handtuch fallen. Im selben Augenblick ergriff eine schwache Bö die Gardinen, so dass sie wie eine Fahne ins Zimmer wehten. Und mit dem Wind kam ein Wirbel starker Gefühle über mich: Da stand Helle nackt und lachte. Ich starrte auf ihre Brüste. Sie wippten ein bisschen auf und nieder, so als wollten sie unerforschte Weiten entdecken. Ich ging zu ihr hin und umarmte sie, ich scherte mich nicht darum, dass ich mein weißes Hemd nass machte. Das war die Frau, die ich liebte.
Helles Wohnung lag im dritten Stock, und während sie sich anzog, ging ich hinaus auf den Balkon, um die Aussicht zu genießen. Unten auf der Straße stand der Müllwagen, ein orange gekleideter Mann rollte eine Mülltonne heran, hob sie hoch und entleerte sie. An irgendjemanden erinnert der Kerl mich, dachte ich und beugte mich vor, aber jetzt war er schon wieder verschwunden. Müllmann ist ein schlecht angesehener Beruf, aber ein guter Ausgleichssport, und früh fertig ist man auch. Ein hervorragender Job für einen Dichter, fand ich.
Es war der 1. September, und eine Hitzewelle hatte Ostnorwegen überrollt. Das passte mir eigentlich schlecht, denn ich wartete schon eine ganze Weile auf den Herbst. Neulich hatte ich die Arbeit an einem weiteren Manuskript aufgenommen, in das ich große Hoffnungen setzte. Wenn ich das ins Trockene brächte, würde ich vor meinem Durchbruch als Schriftsteller stehen. Nun ging es darum, den Text auf das notwendige Niveau zu heben, um bei der Kritikerzunft der landesweiten Presse mehr als ein mattes Blinzeln zu bewirken. Ich freute mich auf diese Arbeit, die im Laufe des Herbstes erledigt werden sollte, wenn es dunkler und kälter wurde und das Bedürfnis, nach draußen zu gehen, sich auf das absolut Notwendige beschränkte.
Der Herbst war ganz entschieden meine Zeit. Eine Zeit zum Nachdenken. Eine Zeit, um die grundlegenden Weichenstellungen im Dasein zu überdenken. Weiterzubauen, wo ich aufgehört hatte, als der Frühling mit seinem ganzen Vogelgezwitscher und Sonnenschein mich aus der Bahn geworfen hatte. Wann hatte ich denn meine besten Sachen geschrieben, wenn nicht im Herbst? Im sparsamen Schein meiner alten Arbeitslampe, in eine Rauchjacke aus Samt gehüllt, die ich immer zum Schreiben anzog, verlieh ich den Wörtern Flügel, während der Regen draußen in der Stadt auf den dunklen Asphalt fiel.
Die Straßenbahn fuhr gerade von der Haltestelle ab, als wir aus dem Haus traten. Das gab mir die Gelegenheit, Helle zur Arbeit zu begleiten und den Weg zu Fuß fortzusetzen, durch den Schlosspark und weiter zur Zeitung. Helle hatte das geblümte Sommerkleid an, das mir so gut gefiel, und sie hatte das Haar hochgesteckt, um etwas mehr wie eine Lehrerin auszusehen.
»Was für Wissen wirst du heute auf den Markt schmeißen?« fragte ich freundlich und nahm ihre Hand in meine.
»Jambus und Trochäus«, sagte Helle.
»Interessant«, platzte ich heraus, glücklich darüber, dass die Jugend immer noch eine Einführung in die klassischen Versmaße erhielt.
»Naja, kommt auf die Augen an, mit denen man das sieht«, sagte Helle.
»Wie steht’s mit Anapäst?« fragte ich.
»Kriegen wir später«, antwortete Helle.
»Allein auf den Jambus kann man ein ganzes Leben verwenden«, sagte ich.
Helle zupfte meinen Hemdkragen zurecht, als wir zum Schultor kamen. Dann küsste sie mich und ging über den Schulhof. Helle war eine beliebte Lehrerin, viele Schüler grüßten sie. Ein paar Jungs balgten sich aus Spaß darum, ihr die Tür aufhalten zu dürfen. Schließlich purzelten alle übereinander, so dass Helle die Tür selber öffnen musste.
Nach der Scrabble-Partie am Abend vorher fühlte ich mich sprachlich derart gestählt, dass ich mich im Redaktionsbüro der Zeitung sofort an meinen Schreibtisch setzte. Vier, fünf Texte lagen bereit, und ich machte mich an einen Artikel über Oslos Kneipenszene, verfasst von einem erfahrenen Journalisten, der gerne damit prahlte, nie falsch zu schreiben.
Alle machen mal einen Fehler. Ja, es ist unnatürlich, nie den kleinsten Fehler zu machen, nie in der Eile einen Buchstaben zu vergessen oder eine Konjunktion oder Buchstaben zu vertauschen, so dass aus einem Wort wie BRANCHE BARNSHE wird oder GANG zu GNAG. Das sind ganz gewöhnliche Fehler im hektischen Journalistenalltag, für die man sich wirklich nicht übermäßig schämen muss. »Man wächst nur durch Peinlichkeiten«, sagte Holm immer auf unseren Seminaren. Aber wenn man aus seinen Fehlern nichts lernt, war man natürlich so dumm als wie zuvor.
Aber wie sorgfältig ich den Artikel auch las, ich fand keine weiteren Fehler, als dass AM ABEND zu AMABEND zusammengewachsen war, und das war ja kein sprachlicher Fehler im engeren Sinne, sondern konnte beispielsweise an einer ungehorsamen Tastatur gelegen haben oder schlimmstenfalls daran, dass der Mann für eine Zehntelsekunde gestört worden war.
Die nächste Sache war ein Artikel über a-ha, die ihre Talente wieder gemeinsam einsetzen wollten, um die Band erneut aufleben zu lassen, nachdem die einzelnen Mitglieder einige Jahre lang ihre jeweils eigenen Projekte verfolgt hatten: Morten Harket als Solokünstler, Magne Furuholmen mit bildender Kunst und Filmmusik und Pål Waaktaar mit seiner Familienband Savoy.
Ich muss sagen, das war eine gute Neuigkeit, sowohl für mich als auch für den Rest der Welt. Wie oft hatte ich nicht a-has anspruchsvolle und melancholische Popmusik zum Schreiben gehört? Wie oft hatte ich mich von Morten, Magne und Pål dazu inspirieren lassen, nach den Sternen zu greifen? a-ha war eine meiner Lieblingsbands und eine positive Kraft im kulturellen Leben Norwegens und auf internationaler Ebene. Dass sie sich jetzt nach Unstimmigkeiten, Reibereien und sinkenden Plattenverkäufen wieder zusammenraufen wollten, war eine Freudenbotschaft, die ihre Druckerschwärze wert war.
Der Artikel führte nicht näher aus, wer sich in den vergangenen Jahren worüber unstimmig gewesen war und wer sich an wem gerieben hatte. Aber es war kein großes Geheimnis, dass Morten Harket und Pål Waaktaar eine Zeitlang ein angespanntes Verhältnis zueinander gehabt hatten. Sie waren zwei starke Persönlichkeiten, die harsch aufeinanderprallen konnten. Dass sie jetzt wieder besser miteinander zurechtkamen, war einfach erfreulich. Dass eine neue Platte in Aussicht stand, war mehr als das.
Der Journalist hatte den Namen der Band abwechselnd mit und ohne Bindestrich geschrieben. Ich räumte damit auf, schickte den Artikel zurück an die Redaktion und beschloss, mir bei nächstbester Gelegenheit wieder einmal meine a-ha-Platten anzuhören.
Mittags ging ich in die Kantine, um mir etwas zu Essen zu holen. Redakteur Holm saß an einem Fensterplatz und besprach sich mit einigen Kollegen aus der Journalredaktion. Das überraschte mich, denn normalerweise wäre er bei einem Wetter wie diesem längst zum Golfplatz gerauscht.
Ich musste ein paar Runden um das Buffet drehen, um mich zu entscheiden. Vieles sah verlockend aus, aber ich war nicht der Typ, der sich von knackigen Salatblättern verführen ließ, ich versorgte mich lieber mit einem halben belegten Käsebrötchen und einer Tasse Kaffee und ging wieder.
Holm und die zwei anderen sahen zu mir herüber, als ich die Kantine verließ. Ich bekam das Gefühl, dass sie über mich geredet hatten, und ich erwog einen Augenblick lang, umzudrehen und mich zu ihnen zu setzen, um mit ihnen über den Fall Hubbing zu reden. Dann schlug ich mir das allerdings sofort wieder aus dem Kopf und ging zurück in mein Büro an den Schreibtisch. Dort nahm ich meinen Mittagsimbiss alleine ein und versuchte dabei, mich an den Titel eines Gedichts von Olaf Bull zu erinnern. Die erste Strophe lautete:
Hochsommer neigt sich zum Herbst
die Baumkronen beugen sich in Fülle
Oh, die dunkle Zeit erhebt die Stimme
bevor die Zweige sich vergolden
Mir war so, als müsste das Gedicht aus dem Zyklus Die Sterne von 1924 stammen, aber sicher war ich nicht. Es hätte auch aus Neue Gedichte sein können, der 1913 erschienenen Sammlung, die auch »Im Schnee« enthielt. Letztendlich rief ich Helle auf ihrem Handy an, um das Rätsel zu lösen, aber sie nahm nicht ab. Ich hinterließ ihr eine Nachricht auf der Mailbox und hoffte, dass sie so bald wie möglich zurückrufen würde.
Ich blieb sitzen, aß zu Ende und dachte dabei an meinen Roman. Die Einleitung hatte schon Form angenommen und ging so: Der Held kommt von einer langen Reise durch die Wüste zurück und stellt fest, dass etwas nicht stimmt. Alle Vögel sind verschwunden. In seinem Garten ist es völlig still, nicht einmal der kleinste Spatz zwitschert eingerostet vor sich hin. Der Mann klettert auf einen Baum, um das Geheimnis zu lüften. Aber es ist kein einziger Vogel zu sehen, in seinem Garten nicht und bei den Nachbarn auch nicht. Er bleibt den ganzen Tag lang in dem Baum sitzen und klettert erst spätabends wieder herunter, fest entschlossen, sein Leben der Aufgabe zu widmen, die Vögel zurückzulocken.
Die nächste Sache auf meinem Schreibtisch war der Leitartikel. Holm hatte ihn geschrieben und sich wie erwartet den Fall Hubbing vorgenommen. Er beschäftigte sich mit der Rechtssicherheit und der Rolle der Medien. Dass er den Leitartikel schon so früh am Tag fertig hatte, wies darauf hin, dass er auf dem Weg ins Grüne war. Darauf deuteten auch einige Tippfehler wie RECHSSTAAT, GESLELSCHAFT und mindestens eine verschollene Präposition hin. Wenn er nach dem Hole-in-one strebte, war er weit übers Ziel hinausgeschossen, um es wie ein Golfer auszudrücken. Über den Inhalt sann ich lieber nicht nach. Dann hätte ich den Rest des Tages darüber grübeln können.
Helle rief nach dem Mittagessen an.
»›Sommers Schiffbruche‹«, sagte sie, »steht in Neue Gedichte.«
»Mist«, sagte ich, »ich war mir sicher, dass es aus Die Sterne ist.«
»Verwechselst du es vielleicht mit ›Im Herbst‹?« fragte Helle.
»Kann sein«, sagte ich, »aber die erste Strophe wusste ich immerhin.«
»Trauriges Gedicht«, sagte Helle.
Die Hitze schlug mir entgegen, als ich das Redaktionsgebäude verließ und Richtung Karl Johans Gate ging. Die Pflichtarbeit des Tages war erledigt, und ich konnte mich mit besserem Gewissen meinen Gedanken hingeben, die um meine eigenen Schreibereien kreisten. Meine früheren literarischen Bestrebungen waren nur die erste Phase eines aufblühenden Lebenswerks gewesen. Der Roman Der Brief (1984) handelte dementsprechend von einer Person, die ausbrechen musste, um ihren eigenen Raum zu schaffen: In diesem Raum würde das Allergrößte passieren! In der Kurzprosasammlung Harry war nicht ganz bei Sinnen von 1985 hatte ich zum ersten und letzten Mal die Möglichkeiten der kleinen Form ausgelotet, und in der Gedichtsammlung Auf Abwegen von 1990 machte ich Gebrauch vom Sonett.
Eine Weile hatte Funkstille geherrscht. So war es gewesen. Ehrlich gesagt, hatte ich seit mehr als zehn Jahren kein Buch veröffentlicht. Ich hatte geschrieben und geschrieben, aber es hatte zu nichts geführt. Ein Umschwung im Zeitgeist hatte mich aus den warmen Besuchersesseln der Verlagslektoren hinausgefegt, zuerst auf den Flur, wo ich mit der Mütze in der Hand gestanden und auf eine neue Chance gewartet hatte, während die frischen Kräfte der neuen Zeit in der Warteschlange vor mich gerutscht waren. Später kam ich nicht einmal mehr in den Flur, ich streifte in einem literarischen Winter umher, der Jahr und Tag andauerte.
War ich verbittert? Nein. War ich enttäuscht über das fehlende kulturelle Niveau in diesem Land? Ja. Was wusste denn der durchschnittliche Norweger darüber, wie viel Anstrengungen und Entbehrungen es kostet, einen Traum ernst zu nehmen? Was wussten die schon vom Weg zum Erfolg?
a-ha wussten alles darüber. Sie hatten es am eigenen Leibe erfahren, in London hatten sie gehungert wie eine moderne Ausgabe von Hamsun, wie Ratten zwischen Müll und Dreck. Sie hatten in der Hoffnung gelebt, in der Überzeugung, dass sie etwas in sich trugen, das zu groß für das kleine Norwegen war. Etwas, das die Brust sprengen und weit über die sozialdemokratische norwegische Selbstzufriedenheit hinausfliegen sollte. Die Probleme türmten sich vor ihnen auf, mag sein, aber sie würden sie lösen! Manche tun so, als ob das alles nur Glück gewesen wäre. Denen will ich nur sagen, dass das überhaupt nichts mit Glück zu tun hatte. Das hatte mit Talent zu tun, und damit, wie es in den Köpfen von Morten Harket, Magne Furuholmen und Pål Waaktaar aussah.
Ich bog auf die Karl Johans Gate ein und ging weiter auf das Schloss zu. Die Leute genossen das gute Wetter mit Bier und Sonnenbrillen in den Straßencafés. An der Buchhandlung Tanum hielt ich an und betrachtete die Auslagen im Schaufenster. Die neuen Kriminalromane fläzten sich neben Kochbüchern von Promi-Köchen und anderen, die angeblich Ahnung von der Essenszubereitung hatten. Die seriöse Belletristik war nirgends zu sehen, stattdessen hatte das Riksmål Wörterbuch anlässlich des Schulbeginns eine kleine Ecke zugeteilt bekommen. Ich setzte meinen Weg mit einem Kopfschütteln fort.
Ich hatte nie daran gezweifelt, dass ich mehr zu bieten hatte, als all diese Durchschnittstalente, die versuchten, Bücher zu schreiben, und deren Machwerke tatsächlich auch noch veröffentlicht wurden. Die wussten, wie man über nichts schreibt, denn hierzulande erwartet man von einem Schriftsteller, dass er ein oder zwei Bücher im Jahr herausbringt, dachte ich. Und herausgebracht werden diese Bücher, und staatlich gefördert, und damit werden sie zur Butter auf dem Brot dieser Sippe geistfreier Möchtegern-Dichter.
Aber nun wollte ich mich im Namen der Gerechtigkeit nicht größer machen, als ich im Moment war! Mir war völlig klar, dass meine bisherige Produktion ein einziges Gesellenstück darstellte im Vergleich zu dem, was noch kommen sollte. Aber der Keim zu etwas Großem lag da! Der Literaturpreis des Nordischen Rates war augenscheinlich in Reichweite, um es mal so auszudrücken. Und während ich so spazierte, wuchs die Schreiblust in mir. Ich war wie ein Brotteig, der aufging und der bald aus der Form quellen würde, hinaus aus dem Backofen um die Welt zu erobern!
Was hatte Rainer Maria Rilke gesagt?
»Geduld ist alles, nicht rechnen und nicht zählen sondern reifen wie der Baum, der seine Säfte nicht drängt und getrost in den Stürmen des Frühlings steht. So als würde dahinter kein Sommer kommen! Er kommt doch! Aber nur zu den Geduldigen, die da sind, als würde die Ewigkeit vor ihnen liegen,« sorglos, still und unendlich.
Ich muss sagen, dass es mitunter ziemlich nervte mit der Geduld. Außerdem war eher der Herbst meine Jahreszeit.
Ich überquerte die Universitetsgate, danach die Karl Johans Gate und näherte mich Ibsen und Bjørnson, die dort jeder auf seinem Sockel vor dem Nationaltheater standen. Es war vielleicht verlockend, ein bisschen vor sich herzuschmunzeln über die zwei, aber das waren wahrhaftig Leute, die sich höher hinauf geschwungen hatten als neunundneunzig Prozent derer, die sich heute Schriftsteller nannten, dachte ich. Ich hielt an und studierte ihre Gesichter: Bjørnsons etwas pompösen Ausdruck und Ibsens ernsthaften. Zwei Giganten auf ihrem jeweiligen Hügelchen, zwei, die, jeder auf seine Art, diesem Land ihren Stempel aufgedrückt hatten, dachte ich.
Aber was war mit Wergeland? Was war denn aus ihm geworden?
Ich sah mich um und entdeckte ihn einsam und verlassen auf der anderen Straßenseite. Da hatten sie ihn also hingestellt! Zugegeben in einer im Verhältnis etwa zum Parlamentsgebäude hervorgehobenen Position, aber doch alleine.
Wergeland wirkte äußerst zufrieden, als ich zu ihm ging, um ihn näher zu betrachten. Verglichen mit den zwei anderen Kerlen hatte Wergeland etwas Quicklebendiges und Zupackendes, dachte ich.
Jetzt sah ich die Straßenbahn auf der Stortingsgate kommen. Ich ging über die Straße und lief zur Haltestelle. Der Bus nach Tårnås kam aus der entgegengesetzten Richtung, als ich um die Ecke bog.
Als ich aus der Straßenbahn ausstieg, war ich wild entschlossen, meine Wohnung anzusteuern und sofort mit dem Schreiben anzufangen. Auf dem Weg warf ich einen Blick durch das Fenster des »Vier Hühner«. Drinnen saßen keine Bekannten, nur ein paar unermüdliche Tresengäste, die mit einem großen Bier vor sich hin dösten.
Ich hatte neulich einen Text Korrektur gelesen, in dem es darum ging, wie wichtig es sei, sich bei Hitze ausreichend Flüssigkeit zuzuführen. Sonst konnte der fein abgestimmte Mechanismus des menschlichen Körpers ganz schnell abkacken. Dort wurde eine Einnahme von zehn bis fünfzehn Litern täglich angedeutet; das fasste ich mal cum grano salis auf. Trotzdem hielt ich an und fühlte, wie mein Hemd am Rücken klebte. Mein Flüssigkeitshaushalt war offensichtlich aus dem Gleichgewicht. Mein Kopf war schwer, während vor allem die Arme bemerkenswert leicht waren. Ich fürchtete, die Inspiration könnte mir entgleiten, wenn ich nicht sofort etwas dagegen unternahm.
Hirsch stand wie immer hinter dem Tresen und wusch Gläser, wobei er den großen Sommerhit von Hubert & Die Hauskater vor sich hinsummte: »Tritt mich in den Arsch«.
»Sag jetzt nichts«, sagte er, »du willst ein großes Bier.«
»Ohne Schaum«, sagte ich.
»Willst du nicht vielleicht doch mal das neue Bier aus Monrovia probieren?« fragte Hirsch.
»Von wo?« fragte ich zurück.
»Die machen gutes Bier da«, sagte Hirsch.
Ich hatte keine Ahnung, was Hirsch dafür bekam, den Müll aus Liberia zu promoten. Aber ich hatte Ahnung davon, dass ich ein gewöhnliches großes Bier wollte, ohne Schaum und ohne Brotkrümel. Zum Glück gab er den Versuch auf und fing an zu zapfen, während ich dasaß und überwachte, ob auch alles mit rechten Dingen zuging.
»Viel zu viel Schaum«, sagte ich.
»Wart’s doch ab«, sagte Hirsch.
»Ich bezahl nicht für den Schaum«, sagte ich.
Hirsch entfernte den Schaum und zapfte noch etwas nach. Dann schob er das Glas über den Tresen. Ich nahm einen Schluck und genoss es, wie der Gerstensaft sich daranmachte, alle Gleichgewichte im Körper wieder herzustellen.
»Ist dir aufgefallen, dass Higgins in letzter Zeit schlecht riecht?« fragte Hirsch.
»Nein«, sagte ich.
»Er hat gestern mal reingeschaut, und ich musste ihn einfach bitten, wieder zu verschwinden«, sagte Hirsch, »geh nach Hause, duschen, hab ich gesagt.«
»Hmm«, sagte ich.
»Ich hab hier einen Laden laufen«, sagte Hirsch.
»Higgins ist Künstler«, sagte ich.
»Der Spruch ist echt zu alt«, sagte Hirsch.
Ja, war er das? Konnte man von Künstlern verlangen, dass sie sich genauso oft wuschen wie andere Leute? Ich war überzeugt, dass das nicht zutraf, war aber offen dafür, dass die Meinungen auseinander gehen konnten. Wir lebten in einem freien Land. Aber es gab natürlich Grenzen. Wenn er eines Tages wirklich seine Umgebung belästigte, musste dies ausgesprochen werden. Die Frage war bloß, ob der Tag schon gekommen war.
»Was meinst du mit riechen?« fragte ich.
»Ich meine es genau so, wie ich es sage«, sagte Hirsch.
»Meinst du eigentlich stinken?« fragte ich.
»Ich meine riechen«, sagte Hirsch.
Helle kam zur Tür rein, eine Tüte von »Farbenland« in der Hand. Das ließ böse Vorahnungen in mir aufkeimen. Wenn sie gedacht hatte, mich mit zu sich nach Hause zu schleifen, um die Küche zu streichen, hatte sie falsch gedacht. Für mich gab es wichtigere Dinge zu tun, und das musste ich ihr auf eine nette und freundliche Weise klarmachen.
»Hab ich mir doch gedacht, dass ich dich hier finde«, sagte sie.
»Ach ja?« sagte ich, »ihr zwei beiden denkt ja eine Menge schräges Zeug, was? Hirsch denkt auch so Sachen über mich. Er behauptet, er hätte gewusst, dass ich ein großes Bier wollte.«
»Reiner Glückstreffer«, sagte Hirsch.
»In Wirklichkeit will ich direkt nach Hause und SCHREIBEN«, sagte ich, »ich habe da einen Roman, der geschrieben werden muss, und wenn ich ihn nicht schreibe, was glaubst du, wer ihn dann schreibt?«
»Ich will nach Huk«, sagte Helle.
»Nach Huk?« sagte ich, etwas freundlicher gestimmt. Ich beugte mich vor und küsste sie auf die Stirn. Ich legte einen Arm um sie und zog sie an mich heran. Sie roch frisch und gut, nur ein schwacher Hauch von grüner Seife und alten Pausenbroten kündete davon, dass sie direkt von der Arbeit kam.
»Wir können am Strand grillen«, sagte Helle.
Ich warf einen Blick in die Tüte. Darin lagen Farbe, Schleifpapier, Spachtel und Spiritus, und ganz unten einige Malwerkzeuge zwielichtiger Herkunft.
»Ich hab erstmal anderthalb Liter gekauft«, sagte sie.
»Schlau«, sagte ich und wühlte in der Tüte herum.
»Die wollten mir zehn Liter aufschwatzen, aber ich hab nein gesagt«, sagte Helle.
»Braves Mädchen«, sagte ich.
Jetzt hatte ich die Werkzeuge gefunden und nahm sie für eine nähere Begutachtung heraus. Es handelte sich um einige jämmerliche Exemplare mit Plastikgriff und struppigen Borsten. Das waren ehrlich gesagt die unbrauchbarsten Malerwerkzeuge, die ich je gesehen hatte.
»Was ist das?« fragte ich.
»Pinsel«, sagte Helle.
»Ein paar Scheißpinsel, wenn das so ist«, sagte ich, »weißt du denn nicht, dass solche Billigpinsel schlimmer haaren als räudige Straßenköter?«
»Wird schon gehen«, sagte Helle.
»Nein, das wird es nämlich nicht«, sagte ich, »davon verstehst du offensichtlich höchst wenig. Hirsch kann sicher bestätigen, was ich sage.«
Aber Hirsch hatte sich verdrückt und sich irgendwo ganz hinten in der Küche versteckt, von ihm war also keine Hilfe zu erwarten.
»Zwei Dinge sind wichtig im Leben«, sagte ich, »zum einen, reichlich Wasser zu trinken. Zum anderen, beim Streichen ordentliche Pinsel zu benutzen.«
Jemand war in der Wohnung gewesen. Ich merkte es am Geruch. Eine unbestimmte Mischung aus Schweiß, Mundspray und irgendetwas noch Schlimmerem. Hatte die Verrottung meines eigenen Körpers jetzt ernsthaft eingesetzt? Darauf wartete ich schon seit meinem vierzigsten Geburtstag.
Die Unordnung war ansonsten schlimmer als gewöhnlich: Überall standen Stapel aus Bücherkisten, die Bettwäsche lag in einem Knäuel auf dem Boden. Es sah aus, als ziehe jemand gleichzeitig ein und aus. Und das Sofa, wo war das hin?
Ich suchte überall, ohne Erfolg, stolperte dabei aber reichlich über die Bücherkisten. Einige hundert Exemplare von Der Brief waren an der Wand entlang nebeneinander aufgestellt, vor dem Bett lehnte Harry war nicht ganz bei Sinnen, während Auf Abwegen