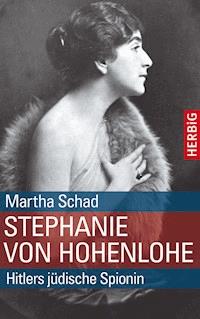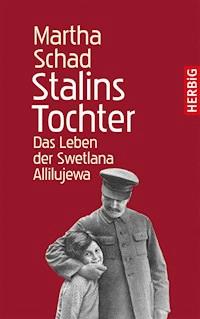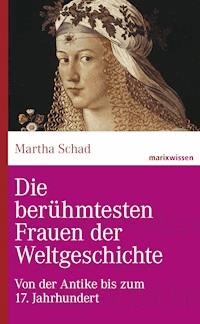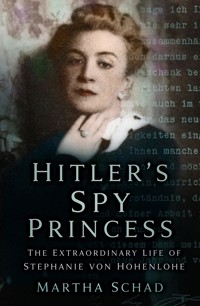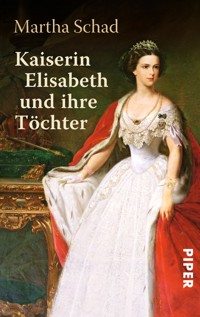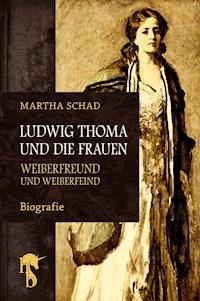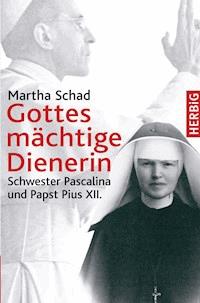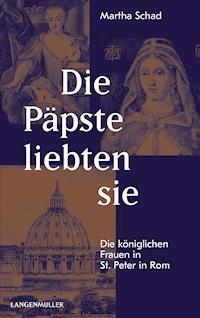
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Langen-Müller
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Der Vatikan gilt als eine der letzten Männerdomänen. Dennoch befinden sich unter den Begräbnisstätten in der Basilika von St. Peter in Rom vier Gräber von Frauen. Welche historischen Umstände führten dazu, dass Mathilde von Canossa, Charlotte Lusignan-Savoyen, Christine von Schweden und Maria Clementina Stuart dort begraben und in Stein verewigt wurden? Diesen Fragen geht Martha Schad, eine der profiliertesten Sachbuchautorinnen Deutschlands, nach. In ihrem Buch zeigt sie Jahrhunderte der Religionsgeschichte aus einem ganz neuen Blickwinkel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Besuchen Sie uns im Internet unter
www.langen-mueller-verlag.de
© für die Originalausgabe und das eBook: LangenMüller in der F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: STUDIO LZ, Stuttgart
Umschlagmotive: picture alliance (vorne oben, hinten rechts); shutterstock (vorne unten); ©Leto Severis, Ladies of Medieval Cyprus and Caterina Cornaro (hinten links)
eBook-Produktion: Verlagsservice Dietmar Schmitz GmbH, Heimstetten
ISBN 978-3-7844-3456-8
Inhalt
Die königlichen Frauen in St. Peter
Charlotte von Zypern
Mathilde Markgräfin von Canossa und Tuszien
Christine Königin von Schweden
Maria Clementina Stuart
Anmerkungen
Ausgewählte Literatur
Bildteil
Die königlichen Frauen in St. Peter
Die Basilika St. Peter – die größte und erhabenste Basilika der Christenheit – wurde über dem Grab des heiligen Petrus, dem der Überlieferung nach ersten Bischof Roms, errichtet. Am 18. April 1506 legte Papst Julius II. den ersten Grundstein für den Neubau der heutigen Basilika, die schließlich 1626 geweiht werden konnte.
500 Jahre später, am 17. April 2006, nannte Papst Benedikt XVI. den Petersdom »ein Meisterwerk der Kunst und des Glaubens« und »das Herz der katholischen Kirche«. Er dankte seinen zwanzig Amtsvorgängern, die über eine Zeitspanne von über 120 Jahren die Errichtung von St. Peter geleitet hatten. Und er erinnerte dabei an die großen Architekten und Künstler, wie Bramante, Bernini, Maderno, Michelangelo, Raffael und Sangallo, die ihn errichtet und ausgeschmückt haben.
Der Petersdom ist nicht nur die größte, sondern auch die wichtigste und meistbesuchte Kirche der Christenheit. Zwischen fünftausend und zwanzigtausend Besucher strömen täglich durch die Eingangstüren der Basilika.
St. Peter ist die Grabeskirche des Apostelfürsten und seit Langem als Grablege den Päpsten vorbehalten. Die Grabstätten finden sich vor allem in der Unterkirche, in den Grotten – auch Heilige Grotten genannt. In der Kirche im linken Schiff des Langhauses, direkt beim Durchgang zur Sakristei, führt eine große Tafel 148 Namen von in St. Peter begrabenen Päpsten auf. Erstaunlicherweise gibt es aber auch die Grablegen von vier Frauen in St. Peter. Drei davon werden zudem mit prächtigen Grabdenkmälern in der Basilika geehrt. Es sind königliche Frauen, die weder als Selige noch als Heilige verehrt werden. Die Grablegungen bestimmten die jeweiligen Päpste, die Finanzierung erfolgt durch die Camera Apostolica.
Charlotte von Lusignan-Savoyen (1444–1487), Königin von Zypern, Prinzessin von Antiochien, Titularkönigin von Jerusalem und Armenien, war die erste Frau, die in St. Peter beerdigt wurde. Sie verlor den Kampf um ihr rechtmäßiges Erbe an ihren Halbbruder, lebte fast ständig im Exil, wurde gedemütigt und verarmte völlig. Doch hörte sie nie auf, um ihr Recht zu kämpfen. Sie erfuhr die große Zuneigung und Hilfe von den Päpsten Pius II., Sixtus IV. und schließlich Innozenz VIII., der sie mit einem königlichen Begräbnis in St. Peter würdigte.
Einen wichtigen Blick ins Hochmittelalter zeigt der Lebensweg einer der mächtigsten Frauen ihrer Zeit, der Markgräfin Mathilde von Tuszien (1046–1115). Sie war von tiefer Frömmigkeit erfüllt, eine erfolgreiche Politikerin, eine unbeugsame kriegerische Frau, die große Verbündete von Papst Gregor VII. Und für immer verbunden mit dem Geschehen um Canossa und der Schenkung ihres Familienbesitzes an die katholische Kirche. Erst 500 Jahre nach ihrem Tod holte der gewaltige Barberini-Papst Urban VIII. ihre Gebeine nach St. Peter in das Zentrum der katholischen Christenheit.
Das Ende des 30-jährigen Krieges, die Abdankung und die Konversion sowie ihr rastloses Leben in Rom ließen die schwedische Königin Christine (1626–1689) zu einer europäischen Exzentrikerin in der Zeit der Renaissance werden. Zu Christines Lebzeiten waren es vier Päpste, deren Ziel es war, die durch die Reformation verlorene Vormachtstellung des Katholizismus zurückzugewinnen. In Rom war sie als lebendige Trophäe der Gegenreformation sehr willkommen. Es zeigte sich für Papst Alexander VII. allerdings früh, dass sie sich zu einer schwierigen und unkonventionellen Adoptivtochter der katholischen Kirche entwickelte, die mit fast unerträglichem Hochmut auch vor einem Mord nicht zurückschreckte. Christine war ganz besonders von einem starken dynastischen Bewusstsein geprägt.
Die vierte in St. Peter ruhende Königin ist Maria Clementina Stuart von England (1702–1735), eine katholische polnische Prinzessin, Gemahlin von James III., der aus England verjagt wurde. Sie war eine Königin, die nie ihr Land gesehen hat, und von Anfang an gegen Intrigen zu kämpfen hatte. Sie wurde nicht glücklich in dieser politisch geprägten Verbindung. Ihr Leben im Exil in Rom endete bereits mit 32 Jahren.
Mit diesen vier königlichen Frauen endeten jeweils die Zweige ihrer Dynastien. Die Kinder von Charlotte von Zypern und Mathilde von Tuszien starben sehr früh, Christine von Schweden hatte keine Nachkommen. Maria Clementina Stuart hatte zwar zwei Söhne, die jedoch ohne legitime Nachkommen blieben. Erwähnenswert ist sicher die Tatsache, dass nicht nur Maria Clementina, sondern auch ihr Ehemann und ihre Söhne in St. Peter ruhen.
Die spannenden Lebenswege dieser Frauen führen in verschiedene Epochen der letzten 1000 Jahre europäischer Geschichte. Die erste Grablegung war 1487, die letzte 1735. Die Schicksale zeigen die politischen Umbrüche der Zeit auf: Sie erzählen von Macht und Intrigen, Frömmigkeit und Aufbegehren, von Freundschaft und Verrat, von Armut und Verschwendung sowie von weltlichen und kirchlichen Herrschaftsansprüchen.
Charlotte von Zypern(1444–1487)
Charlotte von Lusignan-Savoyen, Königin von Zypern, Prinzessin von Antiochien, Titularkönigin von Jerusalem und Armenien, wurde als erste Frau im Jahr 1487 in St. Peter zur letzten Ruhe gebettet. Sie hatte den Kampf um ihr Königreich Zypern zwar verloren, doch die respektvolle Zuneigung von drei Päpsten – Pius II., Sixtus IV. und Innozenz VIII. – gewonnen. Sie fand schließlich Aufnahme in Rom und durfte dort auch ihr Leben beschließen.[1]
Charlotte, Mitglied der Adelsfamilie von Lusignan, wurde Königin von Zypern, jener Insel, die schon in der antiken Mythologie als Insel der Aphrodite, der Göttin der Liebe, einen sagenumwobenen Ruf hatte. Aphrodite soll vor Zyperns Küsten dem Meer entstiegen und in den schattigen Tempelhainen von Paphos und Amathus hochverehrt worden sein.[2]
In der wechselvollen Geschichte Zyperns war die Insel 1192 an das französische Haus Lusignan gefallen, das sich nach der Burg Lusignan benannte. Sie war bereits im 12. Jahrhundert so beeindruckend, dass die Legende ging, ihr Erbauer müsse über magische Kräfte verfügt haben, wie etwa die Fee Melusine[3], der die Burg als Geschenk für ihren Ehemann Raymondin zugeschrieben wird. Dieser soll aus dem Hause Lusignan, das Melusine auch in seinem Wappen trägt, gestammt haben.
Realität und Romantik des Königreiches waren zunächst nichts anderes als ein unvorhergesehenes Nebenergebnis des dritten Kreuzzuges unter dem englischen König Richard I. Löwenherz. Mit ihm beginnt die Geschichte des Kreuzfahrerkönigreichs Zypern. Die Kreuzzüge wurden mit dem Ziel unternommen, die heiligen Stätten Palästinas vom bedrückenden Joch der Anhänger Mohammeds zu befreien.[4]
Richard I. war 1191 auf dem Weg von Sizilien nach Syrien ungewollt auf Zypern gelandet, nachdem wegen eines Seesturms zuvor das Schiff, auf dem sich seine Braut Berengaria von Navarra befand, an Zyperns Gestaden gestrandet war. Weil Isaak Komnenos, der letzte byzantinische Potentat Zyperns, der sich Kaiser von Zypern nannte, den Schiffbrüchigen die gebührende Hilfe verwehrt hatte und zudem König Richard befahl, die Insel zu verlassen, eroberte dieser daraufhin große Teile der Insel und belagerte Isaak auf seiner Burg Kantara. Dabei kam Richard die mangelnde Loyalität von Teilen der zypriotischen Bevölkerung zugute, die in den sieben Jahren unter der Herrschaft Isaaks zu leiden hatte. Isaak Komnenos kapitulierte schließlich, unter der Bedingung, dass Richard ihn nicht in Eisen legen dürfe. Dieser zog daraufhin in die Burg ein – und legte ihn und seine Tochter in Silberketten.
In dieser Zeit traf Guido von Lusignan (1150–1194) mit edlem Gefolge bei Richard in Zypern ein, der seine Gegenwart nutzte, um mit großem Prunk am Sonntag, dem 12. Mai 1191, in der zyprischen Hafenstadt Limassol seine Hochzeit mit der schönen Berengaria von Navarra zu feiern und sie sogleich zur Königin von England zu krönen.
König Richard I. nutzte Zypern nun als reiche Nachschubbasis für seinen Kreuzzug, erbeutete Isaaks Staatsschatz und belegte Zypern mit hohen Sondersteuern. Am 5. Juni 1191 segelte er nach Palästina weiter. Doch bevor der englische Monarch Zypern verließ, verkaufte er die Insel für 100 000 Golddinare an den Templerorden, eine mächtige, der römischen Kirche zugehörige Organisation. Da sie allein auf die finanzielle Ausbeutung bedacht waren, vermochten die Templer der beständigen Unruhe auf der Insel nicht Herr zu werden, und die Zyprioten revoltierten gegen ihre harte Behandlung. Dazu kam die drückende Verschuldung gegenüber dem König, sodass die Templer die unrentabel gewordene Insel wieder loswerden wollten. Am Ostertag des Jahres 1192 kam es zu einer blutigen Revolte, woraufhin die Templer die Insel an Richard zurückgaben, obwohl sie so ihre Anzahlung von 40 000 Golddinaren einbüßten. Doch der König hatte kein Interesse mehr an Zypern, und so gab er es 1192 dem französischen Kreuzritter Guy de Lusignan, Titularkönig von Jerusalem[5], als Lehen.
Die Lusignan-Dynastie trug ab 1291 auch die Krone von Jerusalem und ab 1393 zudem jene von Kleinarmenien[6] – beides Titel mit Anspruch, doch ohne Verfügungsgewalt über die Länder. Der große Zypern-Kenner Franz Georg Maier nennt die Lusignan-Zeit »eine eigentümliche Mischung von französischem Rittertum und orientalischem Lebensstil, gotischer Kunst und byzantinischem Kulturerbe.«[7] Die Dynastie der Lusignans hob sich in mancher Hinsicht vorteilhaft von der byzantinischen Verwaltung ab und sicherte Zypern bis ins 15. Jahrhundert vor weiteren islamischen Eingriffen. Bis heute ist das herrlich gelegene Bergschloss von St. Hilarion, das die Lusignans, seinen byzantinischen Namen »Didymoi« romanisierend »Dieu d’Amour« nannten, ein Symbol der fränkischen Herrschaft in Zypern. Ein mächtiges Tor führte in die innere Burg mit einer Kapelle und einem imposanten Refektorium, das den Lusignans als Bankettsaal diente. Im Südteil der Burg hat man heute vom einstigen »gotischen Fenster der Königin« aus einen wunderbaren Blick auf das Dorf Karmi.
Charlottes Elternhaus
Von 1432 bis zu seinem Tod im Jahr 1458 regierte König Johann II. in Zypern. Er war in zweiter Ehe verheiratet mit Helena Paläologa von Byzanz, Tochter des Despoten von Morea, Theodor II., einem Sohn des byzantinischen Kaisers Manuel Paläologa. Obwohl Helena streng orthodox aufgewachsen war, hatte man sie überzeugt, aus politischen Gründen den katholischen König von Zypern zu heiraten. Die als sehr stolz geltende Helena hatte das Glück, von großen Lehrern unterrichtet worden zu sein, wie Georgius Gemistos Plethon (1355–1452) und Basilius Bessarion (1403–1472), einem byzantinischen Theologen und Humanisten, der Kardinal und Patriarch von Konstantinopel war.
Die Braut Helena war mit großem Gefolge in Xeros an der Nordküste von Zypern angekommen. In ihrer Begleitung befand sich auch ihre Amme, die sie aufgezogen hatte, sowie deren Sohn Thomas, ihr »Milchbruder«. Er und Helena waren wie Geschwister aufgewachsen, woraus sich ein enges Verhältnis entwickelt hatte. Nikosia, die prachtvolle Residenz- und Hauptstadt des Königreichs mit Sitz des römisch-katholischen Bischofs, erregte Helenas Erstaunen. 250 Kirchen und prachtvolle Adelshäuser prägten das Stadtbild im Mittelalter. Im großen Palast der Lusignans war die Hofhaltung überaus glänzend, von halb orientalischem, halb französischem Charakter.[8] Die Hofsprache war Französisch. Turniere, Jagd, Spiele und Festgelage waren an der Tagesordnung.
Am 3. Februar 1442 fand die Trauungszeremonie von König Johann II. und Prinzessin Helena in der Kathedrale St. Sophia in Nikosia statt. Die Kathedrale, die zwischen 1209 und 1326 errichtet worden war, gilt als Meisterwerk des gotischen Kirchenbaus, vergleichbar den großen Kathedralen Frankreichs. Sie war bis 1489 die Krönungskirche der Könige Zyperns. Die Westfassade mit Vorhalle und ihrem dreifach gegliederten Portal gilt als künstlerischer Höhepunkt der französischen Gotik. Auf dem Balkon zwischen den Türmen empfingen die Lusignans an Feiertagen die Huldigungen ihrer auf dem Kirchplatz versammelten Untertanen. Als Zypern von den Osmanen besetzt wurde, wandelten diese die Kathedrale in eine Moschee um; die unvollendet gebliebenen Westtürme wurden als Minarette vollendet – heute wird sie Selimiye-Moschee genannt.[9]
König Johann II. gilt als unbedeutender zyprischer König, verweichlicht und charakterlos, allein materiellen Genüssen zugetan. Er förderte das Parteiwesen, das zum Untergang des Reiches beitrug. Mit diesem Mann wurde nun die intelligente, allerdings oft auch skrupellose byzantinische Prinzessin vermählt, die als Heiratsgut nichts als den Stolz auf ihre kaiserliche Abstammung mitbrachte.
Helena regierte mit starker Hand und förderte die orthodoxe Kirche. Die Staatsämter wurden mit Griechen durchsetzt, und obwohl das Land verarmt war, stiftete sie Klöster. Allgemein wurde von ihr das »griechisch-byzantinische Element als neuer stabilisierender Faktor bevorzugt und in seinem Selbstbewusstsein gestärkt.«[10] Nun kam auch wieder die griechische und zyprische Sprache zu ihrem Recht, die, nachdem die Lusignans die Insel erworben hatten, zugunsten der französischen Sprache vernachlässigt worden war.
Als am 29. Mai 1453 Konstantinopel von den Osmanen erobert wurde, suchten viele reiche Familien aus Konstantinopel und viele Mönche auf Zypern Zuflucht. Eine schwierige Situation für Helena, aber: »Die Königin war diesen Flüchtlingen sehr wohlgesonnen und ließ für sie die St. Georgskirche, die ›Mangana‹, als Kloster herrichten. Sie stattete es mit beträchtlichen Einkünften aus, damit ihr Name bei den Gebeten stets erwähnt werde.«[11]
König Johann II. und Königin Helena hatten zwei Töchter, die im Kindesalter verstorbene Kleopatra und die am 28. Juni 1444 in Nikosia geborene Charlotte. Sie war in der byzantinischen Tradition aufgewachsen, sprach fließend griechisch, was ihre Mutter sie gelehrt hatte. Sie war zwar auch in Französisch, Italienisch und Latein unterrichtet worden, Dokumente in Französisch oder in Latein mussten für sie aber ins Griechische übersetzt werden.
Marietta, König Johanns Geliebte, und ihr gemeinsamer Sohn Jakob
Es war demütigend für Königin Helena, dass sich ihr Gemahl am Hofe ständig mit jungen Frauen umgab. Eine von ihnen, die schöne und geistreiche Marietta aus Patras († 1503), war schon vor ihrer Hochzeit seine Geliebte gewesen. Und als sie 1440 einen Sohn zur Welt brachte, war ihr der König völlig verfallen. Der Sohn wurde auf den Namen Jakob getauft. Später erhielt er den Beinamen »Le Batard«.
Das war bitter für Helena, die folglich Marietta und den kleinen Jungen von ganzem Herzen hasste. Als sie eines Tages den König und Marietta sehr vertraulich miteinander umgehen sah, verlor sie völlig die Kontrolle, zog Marietta an den Haaren, beschimpfte sie und biss ihrer Rivalin die Nase ab. Mariettas schönes Gesicht war nun zerstört, und sie wurde von da an »Kopsomita«, die Nasenlose, genannt. Sie verließ nach dieser Tragödie die Stadt und zog sich auf ein Landgut in Kythrea zurück, das ihr der König überlassen hatte, wo sie sich um die Erziehung ihrer weiteren gemeinsamen Kinder, zwei Knaben und ein Mädchen, kümmerte.
Es zeigte sich sehr schnell, dass der illegitime Sohn Jakob der Liebling des Königs war. Deshalb setzte die Königin alles daran, ihren Mann davon abzubringen, Jakob als seinen Nachfolger zu bestimmen, zu Ungunsten der Thronfolge von Tochter Charlotte. Um die Königin zu beruhigen, ließ der König seinem 16-jährigen Sohn durch Papst Eugen IV. das Erzbistum von Nikosia übertragen – allerdings unter dem Protest der Kurie – und ihm die niederen Weihen spenden. Der Chronist Georgis Bustrom bezeichnete Jakob nur als den »Apostel«, so wie man Papst und Bischöfe damals nannte.[12] Jakob wuchs zu einem großen, kräftigen Lusignan heran, mit fein geschnittenem Gesicht, er galt als klug und ehrgeizig. Seine blendende Erscheinung unterstrich er durch das Tragen des schwarzen Priesterkleides. Doch Jakob entwickelte sehr bald Ambitionen und Charaktereigenschaften, die mit seiner apostolischen Stellung schwer zu vereinbaren waren.[13]
Charlottes Vermählung mit Johann Herzog von Coimbra
Königin Helena hatte beschlossen, ihre Tochter Charlotte, die Erbin des Throns, mit einem Mann ihrer Wahl zu verheiraten. Herzog Philipp von Burgund schlug seinen Verwandten, Johann Herzog von Coimbra (1431–1457), Enkel von Johann I. von Portugal, vor, der sich an seinem Hof befand und mit Glücksgütern nicht gerade gesegnet war. So fand im Mai 1456 die Vermählung der 12-jährigen Charlotte mit dem portugiesischen Prinzen statt.[14] Er erhielt den Titel eines Fürsten von Antiochien und bekam Mitspracherecht in der Regierung.
Der Herzog war Helena als faul und unentschlossen geschildert worden, doch er erwies sich als äußerst klug und war zudem ein fanatischer Katholik – was Helena nicht ertragen konnte. Sie machte dem jungen Ehepaar das Leben so schwer, dass es den Palast verließ, zuerst in die Residenz von Auguste de la Baume zog und später in das Haus von Peter Lusignan, einem Cousin des Königs.
Johann von Coimbra starb bereits am 7. Oktober 1457. Der Palast hatte bekannt geben lassen, der Prinz sei vom Pferd gestürzt. In Windeseile verbreitete sich jedoch das Gerücht, Königin Helena und ihr »Milchbruder« Thomas hätten ihn vergiftet. Dieser hatte es immerhin zum Kämmerer gebracht, war entsprechend arrogant und unbeliebt, weil er wusste, dass die Königin immer hinter ihm stehen würde.
Charlotte konnte nicht glauben, dass ihr Mann umgebracht worden sei. Sie bat ihren 17-jährigen Halbbruder Jakob, sie bei der Aufklärung der Todesursache zu unterstützen. Jakob erklärte der Schwester seinen Plan: Er wollte den Kämmerer »niedermachen lassen«. Mit zwei gedungenen Mördern begab er sich nach Nikosia, wo sie Thomas in dem Palast, den ihm König Johann II. geschenkt hatte, erstachen. Der König war angesichts der Tat seines geliebten Bastards so verwirrt, dass er den Hohen Rat entscheiden ließ, was nun mit Jakob geschehen solle. Die Noblen wagten es allerdings nicht, sich gegen den König zu stellen. So wurde beschlossen, Jakob solle in das Erzbistum zurückkehren, als Strafe wurden ihm allerdings seine Bezüge als Erzbischof gestrichen.
Nach dieser Demütigung war Jakob so verärgert, dass er heimlich Nikosia verließ, nach Salines (Larnaka)[15] reiste und von dort auf der Karavelle eines Patrons nach Famagusta und weiter nach Rhodos segelte. Als Königssohn wurde er überall gut aufgenommen. Zu seiner Freude traf er dort auch den Augustinerpater Wilhelm Gonem, den früheren Beichtvater Johanns II., der vor dem Hass Königin Helenas geflohen war.
Eigentlich hatte Jakob erwartet, dass ihn seine Schwester nach Zypern zurückrufen lassen würde, doch nichts geschah. So kehrte er Ende 1457 oder Anfang 1458 nach Nikosia zurück. Er drang nachts in den Palast des Vizegrafen Jakob Gurri ein und erstach ihn. Danach brach Jakob mit seinem Gefolge in den erzbischöflichen Palast ein und verschanzte sich dort. Er forderte seine Einkünfte wieder zurück, anderenfalls, so drohte er, wolle er mit den Waffen in der Hand sterben. Für die Adelspartei war Jakob der Todfeind. Und auch der König zeigte sich, um der Königin zu gefallen, über das Geschehene äußerst entrüstet. Doch Jakob versicherte ihn seines Gehorsams und erhielt sein Erzbistum zurück.
Der Tod des Königspaares Helena und Johann II.
Königin Helena starb am 11. April 1458. Papst Pius II. nannte sie »eine Feindin der katholischen Kirche, eine engstirnige und dennoch mächtige Frau, die den König sowohl in politischen als auch religiösen Angelegenheiten dominiert hatte.«[16] Es war der Wunsch der Königin, in der St. Georgskirche beigesetzt zu werden. Doch der König ließ ihren Leichnam in das Dominikanerkloster überführen, das als das reichste im Mittleren Osten galt.
Der König überlebte seine Frau nur um drei Monate. Er starb am 26. Juli 1458. Dem toten König wurde sein Ring vom Finger gezogen und Prinzessin Charlotte überreicht. Wie seine Gemahlin wurde Johann II. in das Dominikanerkloster überführt und dort erdbestattet.[17] Daraufhin begaben sich Jakob und die übrigen Ritter in den Palast, riefen Charlotte zur rechtmäßigen Königin von Zypern, Armenien und Jerusalem aus und schworen, für sie zu leben und zu sterben.
Charlottes Krönung zur Königin von Zypern
Unter größter Prachtentfaltung wurde Charlotte am 15. August 1458 in Nikosia zur Königin von Zypern und Armenien gekrönt, in der St.-Sophia-Kirche, dem damals größten gotischen Sakralbau Zyperns. Seit dem Tod ihres Vaters waren 40 Tage der Hoftrauer vorüber, die nach zyprischem Brauch von dem Tod des Königs bis zur Krönung des neuen Regenten beachtet werden mussten. »Und am Sonntag Morgen führten sie die Königin in die Sophienkathedrale[18], alle Ritter und das ganze Volk, und sie wurde unter großem Jubel gekrönt.«[19] Die feierliche Predigt endete mit: »Möge Gott Ihnen Wohlstand verleihen!«[20] Die Krönung wurde vollzogen von Nicholas, Bischof von Limassol, dem Bischof von Evreux und dem Abt der prachtvoll gelegenen früheren Prämonstratenser-Abtei Bellapais (de la Paix), die heute noch in gotischer Schönheit erstrahlt.
Das Volk empfing die Königin nach der Krönung mit unbeschreiblichem Jubel. Doch ein Vorfall trübte die Begeisterung: Als Charlotte mit ihrem Gefolge in den Schlosshof ritt, scheute ihr Pferd, die Krone fiel ihr vom Haupt und rollte die Straße hinunter – was jeder für ein schlechtes Omen hielt. Königin Charlotte wurde von Rittern und Adligen zu ihrem Wohnsitz begleitet. Sie residierte im Palast von Auguste de La Baume, da die Mameluken bei ihrer Invasion im Jahr 1426 den Palast der Lusignans in Nikosia zerstört hatten. Seit damals war Zypern dem Sultan von Ägypten tributpflichtig.[21]
Obwohl Charlotte ihrem Bruder wohlgesonnen war, gab es Hetztiraden gegen ihn. Er war sich sicher gewesen, das Recht zu haben, die Krönung seiner Schwester vorzunehmen. Doch dem war nicht so, die Königin und die Hohe Kammer ließen ihm ausrichten, dass er am Krönungstag in seinem Bischofssitz bleiben müsse. Allerdings solle er seinem Vikar Silvaner befehlen, alles für die Krönung vorzubereiten. Jakob respektierte zwar den Wunsch der Königin, aber diese Zurücksetzung traf ihn schwer.[22] Und er fasste den Plan, nach Ägypten zu fliehen.
Jakobs Aufstand gegen Charlotte
Die ständigen Demütigungen setzten Jakob schwer zu. Und so beschloss er, den Vizegrafen und die Ritter, die zum engen Kreis der Königin gehörten, umzubringen. Er scharte die Verwegensten um sich und war schon auf dem Weg zur Königin, als er erfuhr, dass sein Plan verraten worden war. Jetzt schlug der Hof zurück: Die Bestallung zum Erzbischof sollte ihm entzogen und er selbst, tot oder lebendig, ergriffen werden. Doch davon hatte Jakob erfahren und sich mit 300 seiner Leute um den Hof herum verschanzt. Auch den griechischen Bischof Nikolaus von Nikosia hatte er zu Hilfe geholt.
Nun schritt wieder die Königin ein. Sie ließ Jakob zu sich bitten, allerdings unter der Androhung, ihn im Falle des Nichterscheinens als Hochverräter zu behandeln. Wieder kam es zu einem Verrat. Ein Bediensteter Jakobs verriet, dass dieser die Absicht habe, Sturm läuten zu lassen, um dann mit seinem Gefolge am Hof zu erscheinen. Jakob kam mit seinen Getreuen, die Königin und die Kammer verhandelten mit ihm. Was er jedoch nicht ahnen konnte, war die Tatsache, dass zur gleichen Zeit eine königliche Truppe in den erzbischöflichen Palast einbrach, ihn völlig verwüstete und alles, was nicht niet- und nagelfest war, mitnahm; lediglich die Pferde ließen sie stehen.
Nun konnten auch seine Getreuen Jakob nicht mehr davon abhalten, in die 2700 Jahre alte Stadt Nikosia[23] zu fliehen. Seine Vorbereitungen wurden verraten, und schließlich verließ er mit Pater Gonem, seinem Oheim Markos, George Bustron, Rizzo di Marino und Nikolo Morabito den erzbischöflichen Palast. Sie flohen ins armenische Quartier, gelangten über die Mauer ins Freie und konnten sich in Salines nach Ägypten einschiffen. Dort bat Jakob den Mameluken-Sultan Inal um Asyl.
Es dauerte eine Weile, bis Charlotte erfuhr, und zwar von Kaufleuten, die aus Kairo kamen, dass ihr Halbbruder von dort aus mit allen Mitteln versuchte, den Divan zu einer Expedition gegen Zypern zu überreden.
Charlottes Vermählung mit Louis von Savoyen
Noch zu Lebzeiten ihrer Eltern wurde diesen angezeigt, dass der Hof von Turin eine Heirat ihrer Tochter Charlotte mit Louis von Savoyen, Graf von Genf (1436–1482), begrüßen würde. Ein Angebot, das dem König und der jungen Witwe gefiel, während die Königin ihre ganze Beredsamkeit entfaltete, um ihre Tochter von einer Heirat mit ihrem leiblichen Vetter – Anna von Lusignan war seine Mutter – abzuhalten. Dennoch erfolgte kurz nach dem Tod der Königin die Verlobung des jungen Paares.
Die Prokurativtrauung von Charlotte und Louis von Savoyen fand am 19. Juni 1458 in Chambéry statt. Der Bräutigam plante, im Januar 1459 zu seiner Angetrauten zu reisen, doch erst im Hochsommer 1459 machte er sich über Venedig auf den Weg nach Zypern. Auffallend war, dass Louis dabei angeblich schlechter ausstaffiert war als der Sohn oder die Tochter des simpelsten savoyischen Barons, wenn dieser seine Kinder in ein fremdes Land schickte.
Bei der Überfahrt passierte Louis von Savoyen ein Missgeschick, das ihn für immer die Sympathie von Papst Pius II. kostete. Dieser hatte damals in Mantua die christlichen Fürsten versammelt, um einen Türkenfeldzug vorzubereiten. Der Bräutigam hätte das Boot, das ihn den Po hinabtrug, in Mantua anhalten lassen müssen, um sich dem Papst vorzustellen und vor allem seinen Segen für sich und Charlotte zu erbitten.
Bei den Heiratsverhandlungen war Louis von Savoyen zugesichert worden, dass er als Prinzgemahl auch den Titel König von Zypern führen und später beim Ableben seiner Gemahlin der legale Erbe des Throns sein würde. Bei seiner Ankunft in Zypern stellte sich schnell heraus, dass ihn das Volk unsympathisch fand. Der Prinz war sehr blass und schwächlich, hatte einen melancholischen Gesichtsausdruck und schien wenig intelligent zu sein. Er galt bald als kranker Mann, der zudem den Waffen völlig abgeneigt war. Von ihm konnte die Königin keinerlei Hilfe beim Kampf um das Königreich Zypern erwarten. Es sollte sich zeigen, dass er ihr mehr schadete als zur Seite stehen konnte. Er half seiner Frau nicht, gegen den mächtigen Rivalen Jakob aufzustehen.
Die Vermählung fand am 7. Oktober 1459 mit großer Pracht in der St.-Sophia-Kirche in Nikosia statt. Louis von Savoyen wurde anschließend zum König von Zypern, Armenien und Jerusalem ausgerufen und gekrönt. Aus Savoyen waren Geschenke für Charlotte von ihrem Schwiegervater gekommen. Als dieser 1465 starb, forderte sein Sohn und Nachfolger Amadeus IV., der Bruder von Louis, die Geldsummen zurück, die sein Vater immer wieder nach Zypern gesandt hatte, und auch die zur Hochzeit geschenkten Juwelen. Doch Louis antwortete ihm, dass der Wert des Schmuckes nur sehr gering sei.
Unmittelbar nach der Krönung wurde eine Gesandtschaft nach Kairo geschickt, um Sultan Al-Aschraf-Inal die Huldigung des neuen Königspaares zusammen mit dem schuldigen Tribut überbringen zu lassen, was dieser wohlwollend aufnahm. Da dort damals die Pest wütete, starben auch viele Gesandte, unter denen auch Freunde Jakobs waren. Charlotte ließ daraufhin den aus einem griechisch-zyprischen Adelsgeschlecht stammenden Ritter Pierre Podochator mit savoyischen Rittern und reichlichen Geschenken nach Kairo entsenden.
Jakobs Kampf um das Königreich Zypern
Der Sultan war Podochator durchaus gewogen, was Jakob gar nicht gefiel. Und er begann daran zu zweifeln, sein geplantes Vorhaben jemals ausführen zu können. Außerdem hatte sein Freund Gonem erfahren, dass der Sultan bereits zwei Ehrenkleider für Louis und Charlotte bestimmt habe und dass der Gesandte demnächst nach Zypern zurückreisen werde. Nun setzte Gonem alles daran, die Emire auf die Seite Jakobs zu ziehen. Jakob verließ Zypern 1460 auf einem ägyptischen Schiff und mit einer großen Armee. Einer seiner engen Verbündeten, der Sizilianer Rizzo di Marino, half ihm bei diesem Unternehmen.
In Kairo wurde Jakob von den Mameluken mit dem Ruf begrüßt: »Lang lebe König Jakob!« Sultan Mohammed schrieb an Al-Aschraf-Inal, er solle nicht dulden, dass Zypern in die Gewalt eines fränkischen Fürsten übergehe. Der Vorschlag lautete, Jakob als tributpflichtigen König einzusetzen. Zu Jakobs Gunsten erhoben sich sämtliche Emire. Sie setzten ihn auf ein Kamel, und unter Trommelschlag und Pfeifenklang wurde er als neuer König von Zypern durch die Straßen von Kairo geführt. Dann wurde eine Art Krönung inszeniert.
Dass sich ein lateinischer Erzbischof nach einem fehlgeschlagenen Staatsstreich gegen seine Halbschwester an den Hof des Mameluken-Sultans begab, um sich von ihm als Souverän gegen die legitime Thronerbin zum »König von Cypern, Jerusalem und Armenien« erheben zu lassen, erschien als etwas Unerhörtes. Zum Entsetzen von Papst und Abendland empfing ein katholischer Erzbischof die Königswürde des Kreuzfahrerreiches aus der Hand des muslimischen Feindes.
Jakob hatte es geschafft, sich geschickt als Anhänger der Sultane und als Freund der zyprischen Machthaber auszugeben. Am 18. September ereignete sich das nächste befremdliche Schauspiel: Ein Prätendent der Krone Zyperns kehrte mit einem ägyptischen Geschwader auf die Insel zurück, umgeben von mamelukischen Soldaten. Jakob ging mit einer aus achtzig Galeeren bestehenden Flotte in der Nähe von Famagusta bei den Ruinen des alten Salamis – der einstigen Großstadt, von Homer als »Stadt der schönsten Bauwerke gepriesen« – vor Anker und zog mit seinen sarazenischen Soldaten in Nikosia ein.
Die Hauptstadt lief sofort zu Jakob über, und so kam er als Sieger nach Nikosia zurück. Das Volk liebte ihn, vor allem auch deshalb, weil Louis von Savoyen so unbeliebt war. Jakob eroberte die ganze Insel, außer das sehr reiche Famagusta, das seit 1373 in den Händen der Genueser war.
Der Sultan hatte ein Schreiben an Louis von Savoyen geschickt, worin er diesem befahl, Zypern, das ihm tributpflichtig sei, seinem rechtmäßigen Herrscher Jakob zu überlassen. Zudem erlaube er ihm, seine Frau Charlotte mit sich zu führen und Zypern zu verlassen.
Wie reagierten die Königin und der Hof auf Jakobs Erscheinen? Louis geriet in große Panik und überredete seine Frau, 1460 den Hof zu verlassen und in die als Hafen und Festung bekannte Stadt Cerines[24] zu flüchten. Das wohlerhaltene Schloss, ein mächtiger Bau mit starken Wällen und von einem tiefen, in den Felsen eingeschnittenen Graben umgeben, steht an der Ostseite des Ortes auf einer etwas vorspringenden Landspitze. Auch der lateinische Klerus, der versuchte, die Kirchenschätze zu retten, wollte nach Cerines, dem Punkt auf der Insel, der sicheren Schutz und eine Verbindung zum Abendland gewährte. Die Mitglieder der Regierung hielten sich ebenfalls dort auf. Drei Jahre lang belagerte Jakob die Burg.
Königin Charlotte flieht nach Rhodos