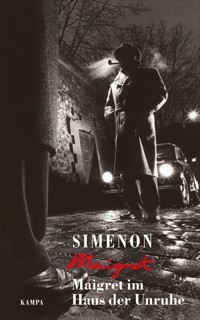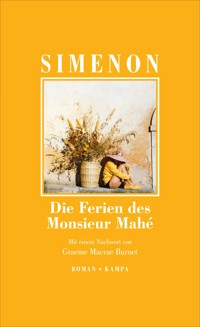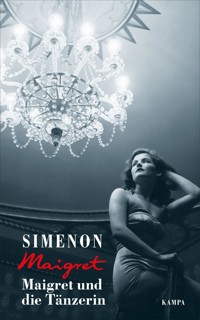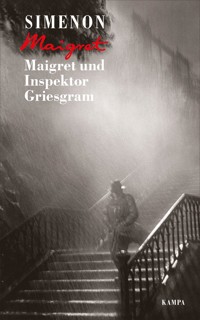Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Georges Simenon
- Sprache: Deutsch
Der angesehene Hutmacher Léon Labbé und der kleine Schneider Kachoudas. Viel haben die beiden nicht gemein, auch wenn sie in der Rue du Minage, einer Geschäftsstraße in der Hafenstadt La Rochelle, dicht beieinander leben und arbeiten. Nur durch einen Zufall findet der Schneider heraus, dass es der Hutmacher ist, der seit Wochen die Stadt in Angst und Schrecken versetzt: In fünf verregneten Nächten hat er, scheinbar wahllos, fünf Frauen ermordet. Die ausgesetzte Belohnung würde dem Schneider einige Sorgen nehmen, aber er weiß, dass man ihm, dem Einwanderer, nicht glauben wird. Und während sein Schweigen ihn zum Komplizen macht, schlägt der Mörder erneut zu.Der Stoff um die komplizierte Beziehung zwischen einem Mörder und seinem Nachbarn ließ Simenon nicht los, er behandelte ihn zunächst in zwei Erzählungen und erst dann in Romanform. Die Erzählung »Der kleine Schneider und der Hutmacher«, die Simenon 1947, ein Jahr vor dem Roman, geschrieben hat, findet sich im Anhang dieser Ausgabe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Band 66
Georges Simenon
Die Phantome des Hutmachers
Roman
Aus dem Französischen von Juliette Aubert und Mirko Bonné
Kampa
Die Phantome des Hutmachers
1
Es war der 3. Dezember, und immer noch regnete es. Riesig, tiefschwarz, mit einer Art dickem Bauch, hob die Ziffer 3 sich vom grellen Weiß des Kalenders ab, der rechts der Kasse an der dunklen Eichenholztrennwand zwischen Laden und Schaufenster hing. Genau zwanzig Tage waren vergangen – am 13. November nämlich war es passiert, auch da so eine fettleibige 3 auf dem Kalender –, seit bei der Saint-Sauveur-Kirche, nur ein paar Schritte vom Kanal entfernt, die erste alte Frau ermordet worden war.
Ja, es regnete seit dem 13. November. Ohne Unterbrechung regnete es seit zwanzig Tagen, konnte man sagen.
Ein lang anhaltender, platternder Regen war es meistens, und wenn man durch die Stadt rannte, dicht an den Häusern entlang, hörte man in den Dachrinnen das Wasser. Man nahm die Straßen mit Arkadengängen, um wenigstens kurz geschützt zu sein, man zog andere Schuhe an, sobald man zu Hause war. In sämtlichen Hausfluren trockneten nahe dem Ofen Regenmäntel und Hüte, und wer über keine Wechselkleidung verfügte, lebte in einer beständigen klammen Feuchtigkeit.
Schon weit vor vier wurde es dunkel, und in manchen Fenstern war von früh bis spät das Licht an.
Es war vier, als wie jeden Nachmittag Monsieur Labbé aus dem Hinterzimmer seines Geschäfts getreten war, wo hölzerne Köpfe in allen Größen in den Regalen standen. Er war die Wendeltreppe hinaufgestiegen, die ganz hinten in der Hutmacherei nach oben führte. Auf dem Treppenabsatz hatte er kurz innegehalten, einen Schlüssel aus der Tasche gezogen und die Tür des Schlafzimmers aufgeschlossen, um sogleich Licht darin anzumachen.
Ehe er den Schalter umgedreht hatte, war er da bis zum Fenster gegangen, an dem die dicken, verstaubten Spitzenvorhänge immer zugezogen waren? Wahrscheinlich, denn bevor er Licht machte, ließ er für gewöhnlich das Rollo herunter. In diesem Moment hatte er drüben, nur ein paar Meter weiter, Kachoudas, den Schneider, in dessen Atelier sehen können. Es war so nah, zwischen ihnen der Straßengraben so schmal, dass es einem vorkam, als wohnte man im selben Haus.
Kachoudas’ Atelier lag im ersten Stock über seinem Laden und hatte keine Vorhänge. Die kleinsten Details des Zimmers zeichneten sich ab wie auf einem Kupferstich – die Blumen der Tapete, der Fliegendreck auf dem Spiegel, das flache und fettige Kreidestück, das an einer Schnur hing, die an einer Wand befestigten Schnittmuster aus braunem Papier, und Kachoudas, der auf seinem Tisch saß, im Schneidersitz, in Reichweite eine schirmlose Glühbirne, die er mithilfe eines Stücks Draht zu sich heranzog. Die Tür im Hintergrund, die in die Küche führte, stand immer etwas offen, wenn auch meistens nicht so weit, dass man das Innere des Zimmers hätte sehen können. Die Anwesenheit von Madame Kachoudas erriet man trotzdem, denn ab und zu bewegten sich die Lippen ihres Ehemannes. Während der Arbeit redeten sie miteinander, von Zimmer zu Zimmer.
Geredet hatte Monsieur Labbé auch. Valentin, sein Gehilfe, der sich im Laden aufhielt, hatte über seinem Kopf Schritte und Stimmengemurmel gehört. Daraufhin hatte er den Hutmacher wieder nach unten kommen sehen, erst die elegant beschuhten Füße, die Hose, das Jackett, schließlich das ein bisschen schlaffe, stets ernste, nie aber übertrieben strenge Gesicht, das Gesicht eines Mannes, der sich selbst genügt, der nicht das Bedürfnis empfindet, sein Innenleben nach außen zu kehren.
Bevor er an diesem Tag aus dem Haus ging, hatte Monsieur Labbé noch zwei Hüte über Dampf in Form gezogen, darunter den grauen Hut des Bürgermeisters, und in dieser Zeit war auf der Straße der Regen zu hören gewesen, das Wasser, wie es das Fallrohr hinunterbrauste, und im Laden das sachte Gezischel des Gasofens.
Immer war es dort zu warm. Kaum dass Valentin, der Gehilfe, morgens kam, stieg ihm das Blut in den Kopf, und nachmittags, da wurde ihm der Kopf schwer; mitunter sah er dann seine wie vor Fieber blitzenden Augen in den zwischen den Regalen befestigten Spiegeln.
Monsieur Labbé redete nicht mehr als an den anderen Tagen. Er konnte Stunden mit seinem Angestellten verbringen, ohne etwas zu sagen.
Sonst hörte man rings um sie her nur das Geräusch des Uhrpendels und jede Viertelstunde ein Klicken. Zu vollen und halben Stunden wurde der Mechanismus zwar ausgelöst, blieb jedoch nach einer vergeblichen Anstrengung abrupt stehen – die Uhr hatte vermutlich noch immer ein Schlagwerk, das aber kaputtgegangen war.
Wenn der kleine Schneider auch nicht in das Zimmer im ersten Stock sehen konnte – am Tag wegen der Vorhänge, am Abend wegen des Rollos –, so brauchte er sich doch nur vorzubeugen, um einen Blick in das Hutgeschäft zu werfen.
Natürlich lugte er herüber. Monsieur Labbé gab sich zwar keine Mühe, es nachzuprüfen, trotzdem wusste er es. Darum änderte er auch nichts an seinem Zeitplan. Seine Bewegungen blieben bedächtig, akribisch. Er hatte sehr schöne, etwas speckige Hände, die ganz erstaunlich weiß waren.
Fünf Minuten vor fünf war er aus dem Zimmer hinter dem Laden gekommen, das man »die Werkstatt« nannte, wo er erst die Lampe ausgemacht und daraufhin eine seiner ritualisierten Phrasen von sich gegeben hatte:
»Werde mal nachsehen, ob Madame Labbé nicht etwas braucht.«
Von Neuem war er die Wendeltreppe hinaufgestiegen. Valentin hatte seine Schritte über sich gehört, ein gedämpftes Stimmengemurmel, dann wieder die Füße gesehen, die Beine, den ganzen Körper.
Hinten hatte Monsieur Labbé die Tür zur Küche aufgemacht und zu Louise gesagt:
»Werde früh nach Haus kommen. Valentin schließt den Laden ab.«
Dieselben Worte sagte er jeden Tag, und das Hausmädchen antwortete:
»Ist gut, Monsieur.«
Während er seinen dicken schwarzen Mantel überzog, sagte er noch einmal, jetzt zu Valentin, auch wenn der es sehr wohl gehört hatte:
»Sie schließen den Laden ab.«
»Ja, Monsieur. Guten Abend, Monsieur.«
»Guten Abend, Valentin.«
Er nahm das Geld aus der Kassenschublade und wartete noch etwas ab, indem er die Fenster gegenüber nicht aus den Augen ließ. Kein Zweifel, Kachoudas war erst vor Kurzem von seinem Tisch geklettert, in dem Moment nämlich, als er Labbés Schatten über das Rollo im ersten Stock hatte huschen sehen.
Was sagte er zu seiner Frau? Denn er sagte etwas zu ihr. Er brauchte eine Ausrede. Sie fragte ihn nichts. Nie hätte sie sich erlaubt, ihm gegenüber eine Bemerkung zu machen. Schon seit Jahren, ungefähr seit er sich selbstständig gemacht hatte, ging er nachmittags gegen fünf im Café des Colonnes ein oder zwei Gläser Weißwein trinken. Auch Monsieur Labbé ging dorthin, und noch andere, die sich nicht mit Weißwein und auch nicht mit nur zwei Gläsern zufriedengaben. Für die meisten ging dort der Tag zu Ende. Kachoudas dagegen aß, sobald er heimgekommen war, rasch einen Happen inmitten seiner Rasselbande und kletterte daraufhin von Neuem auf seinen Tisch, auf dem er oft bis elf oder Mitternacht saß und arbeitete.
»Ich werd ein bissel an die frische Luft gehen.«
Er hatte große Angst, Monsieur Labbé zu verpassen. Der hatte das begriffen. So war es zwar nicht schon seit der ersten ermordeten alten Frau, aber seit der dritten, also seit die Stadt ernstlich durchzudrehen begann.
Die Rue du Minage war zu dieser Stunde fast immer menschenleer, zumal wenn es so in Strömen regnete. Ja sie war sogar noch leerer, seit es jede Menge Leute vermieden, nach Einbruch der Dunkelheit noch aus dem Haus zu gehen. Die Geschäftsleute, die als Erste unter der Panik zu leiden gehabt hatten, waren auch die Ersten gewesen, die Patrouillen organisierten. War es diesen jedoch gelungen, Madame Geoffroy-Lamberts Tod zu verhindern oder den von Madame Léonide Proux, der Hebamme aus Fétilly?
Der kleine Schneider hatte Angst, Monsieur Labbé aber bereitete es ein boshaftes Vergnügen, auf ihn zu warten, auch wenn nichts danach aussah – war das nicht ein teuflisches Vergnügen?
Er öffnete schließlich die Eingangstür und ließ dadurch deren Glöckchen ertönen. Er schlüpfte unter dem riesigen Zylinderhut aus rotem Blech hindurch, der ihm als Ladenschild diente, schlug den Mantelkragen hoch, versenkte die Hände in die Taschen. An Kachoudas’ Tür gab es ebenfalls eine Glocke, und schon nach wenigen Schritten auf dem Trottoir war sich Monsieur Labbé sicher, sie zu hören.
Es war eine Straße mit Arkadengängen, so wie die meisten alten Straßen von La Rochelle. Es regnete also nicht auf die Trottoirs. Sie waren wie kalte, feuchte Tunnel, wo es nur ab und an Licht gab, mit Toreinfahrten, die in die Dunkelheit führten.
Auf dem Weg zur Place d’Armes richtete Kachoudas sein Schritttempo nach dem des Hutmachers, hatte aber trotz allem eine solche Angst vor einem Hinterhalt, dass er lieber mitten auf der Straße und durch den Regen lief.
Bis zur Ecke begegneten sie niemandem. Dann kamen die Schaufenster der Parfümerie, der Apotheke, des Hemdengeschäfts und schließlich die breiten Glasfenster des Cafés. Jeantet, der junge Journalist, mit seinen langen Haaren, seinem hageren Gesicht, seinen glühenden Augen war auf seinem Posten, am ersten Tisch, dicht beim Fenster, gerade dabei, vor einer Tasse Kaffee seinen Artikel zu schreiben.
Monsieur Labbé lächelte nicht, schien ihn überhaupt nicht zu sehen. Er hörte die Schritte des kleinen Schneiders, wie sie näher kamen. Er drehte den Türknauf, betrat die wohlige Wärme, ging ohne Zögern hinüber zu den mittleren Tischen nah am Ofen zwischen den Säulen und blieb stehen hinter den Kartenspielern, während der Kellner, Gabriel, ihm den Mantel und den Hut abnahm.
»Wie geht es dir, Léon?«
»Nicht übel.«
Sie kannten einander schon zu lange – zumeist seit der Schule –, um noch Lust zu haben, miteinander zu reden. Diejenigen, die Karten in der Hand hielten, machten ein kleines Zeichen oder berührten mechanisch die Hand des Neuankömmlings. Gabriel fragte aus reiner Gewohnheit:
»Wie immer?«
Und mit einem behaglichen Seufzer nahm der Hutmacher hinter einem der Bridge-Spieler Platz, Doktor Chantreau, den er Paul nannte. Mit nur einem Blick hatte er gesehen, wie die Partie stand. Sie dauerte schon seit Jahren und Jahren, hätte man meinen können, weil sie jeden Tag zur gleichen Stunde am gleichen Tisch mit den gleichen Getränken vor den gleichen Spielern mit den gleichen Pfeifen und den gleichen Zigarren fortgesetzt wurde.
Die Zentralheizung war wohl nicht kräftig genug, da Oscar, der Wirt, den großen, schönen, leuchtend schwarzen Ofen behalten hatte, dem Monsieur Labbé die Beine entgegenstreckte, um seine Schuhe und Hosenumschläge zu trocknen. Der kleine Schneider war mittlerweile hereingekommen, war ebenso zu den mittleren Tischen gegangen, wenn auch nicht mit der gleichen Sicherheit, hatte respektvoll gegrüßt, ohne dass ihm jemand geantwortet hätte, und auf einem Stuhl Platz genommen.
Er gehörte nicht dazu. Weder war er auf denselben Schulen noch in denselben Kasernen gewesen. Zu der Zeit, als die Kartenspieler einander bereits geduzt hatten, lebte er noch Gott weiß wo im Nahen Osten, wo Leute von seiner Sorte wie Vieh umhertransportiert wurden, von Armenien nach Smyrna, von Smyrna nach Syrien, nach Griechenland oder sonstwo.
Vor ein paar Jahren hatte er anfangs noch ein Stück abseits Platz genommen, um seinen Weißwein zu trinken, und folgte dem Spiel, das ihm wahrscheinlich völlig fremd war, derart aufmerksam, dass seine Stirn sich in Falten legte. Unmerklich war er von da an näher gekommen, indem er zunächst den Stuhl heranschob, dann einfach den Sitzplatz und schließlich den Tisch wechselte, um sich direkt hinter den Spielern wiederzufinden.
Keiner redete von den alten Frauen, so wenig wie von dem Grauen, das in der Stadt herrschte. Man diskutierte womöglich an anderen Tischen darüber, nicht aber an diesem. Laude, der Senator, nahm die Pfeife vom Mund, um zu fragen, indem er sich kaum merklich zu dem Hutmacher wandte:
»Deine Frau?«
»Immer dasselbe.«
Eine Angewohnheit, die die Leute schon seit fünfzehn Jahren hatten. Gabriel hatte ihm seinen Grenadine-Picon gebracht, dunkel mahagonibraun war er, und er trank einen Schluck davon, langsam, während er einen Blick auf den jungen Jeantet warf, der dabei war, seinen Artikel für den Echo des Charentes zusammenzuschmieren. Eine Pendeluhr mit in Kupfer eingefasstem Zifferblatt hing zwischen dem eigentlichen Café und dem hinteren Teil, in dem in einer Reihe die Billardtische standen. Sie zeigte Viertel nach fünf, als Julien Lambert, ein Versicherungsmensch, der wie üblich verlor, den Hutmacher fragte:
»Machst du für mich weiter?«
»Heut Abend nicht.«
Was nichts Außergewöhnliches war. Sie waren sechs oder sieben, die mal die Karten in der Hand hielten, mal hinter den Spielern saßen. Einzig Kachoudas wurde nie gefragt, ob er mitspielen wolle, und wahrscheinlich war er auch gar nicht erpicht darauf.
Er war klein, schwächlich. Er roch schlecht, und er wusste das – er wusste es so gut, dass er es vermied, den anderen zu nahe zu kommen. Es war ein Geruch, der bloß ihm anhaftete und seinen Angehörigen und den man den Kachoudasgeruch hätte nennen können, eine Mischung aus dem Knoblauch in ihrer Küche und dem Wollfett der Stoffe. Hier sagte man nichts, höflich tat man, als bemerke man es nicht, in der Schule aber protestierten die nicht so diskreten Mädchen, wenn sie neben die Kachoudaskinder gesetzt wurden.
»Du stinkst! Deine Schwester stinkt! Ihr stinkt alle!«
Er rauchte eine der wenigen Zigaretten des Tages, denn während der Arbeit konnte er nicht rauchen, ohne Gefahr zu laufen, dabei Kleidung von Kunden zu versengen. Er drehte sich seine Zigaretten selbst, und immer war da ein Ende ganz dunkel von Spucke.
Es war der 3. Dezember. Es war Viertel nach fünf. Es regnete. Die Straßen waren schwarz. Es war warm im Café, und Monsieur Labbé, der Hutmacher aus der Rue du Minage, verfolgte, wie der Doktor spielte, der eben fünf Treff angesagt hatte, was der Versicherungsfritze unklugerweise gerade kontrierte.
Morgen früh würde man aus der Zeitung erfahren, was Jeantet soeben über die ermordeten alten Frauen schrieb, denn mit vollem Einsatz führte der eine Untersuchung und hatte sogar eine Art Kampfansage an die Polizei losgelassen. Sein Chef, Jérôme Caillé, der Druckereibesitzer, der bei dem Blatt das Sagen hatte, spielte seelenruhig Bridge, ohne sich um den jungen Hitzkopf zu kümmern, dessen Artikel er überfliegen würde, sobald er nach Haus kam.
Chantreau war dabei, die Trümpfe zu ziehen, und riskierte den entscheidenden Impass, als Monsieur Labbé sich nicht mal umzudrehen brauchte, um zu sehen, wie Kachoudas halb aufstand, ohne dabei völlig den Kontakt zu seinem Stuhl zu verlieren, sich ihm entgegenbückte und den Arm ausstreckte, wie um etwas aufzuheben, das in den Sägespänen auf dem Fußboden lag.
Aber es war die Hose des Hutmachers, auf die er es abgesehen hatte. Sein Schneiderauge hatte am Aufschlag einen kleinen weißen Fleck bemerkt. Bestimmt hatte er gemeint, da sei ein Faden. Böse Absichten hatte er sicher keine. Hätte er aber welche gehabt, die Tragweite seiner Geste hätte er nicht abzuschätzen vermocht.
Auch nicht Monsieur Labbé, der ihn machen ließ, leicht überrascht, jedoch nicht im Geringsten beunruhigt.
»’tschuldigen Sie.«
Kachoudas griff nach dem weißen Etwas, das kein Faden, sondern ein winziger Schnipsel Papier war, kaum einen halben Zentimeter groß, leichtes und raues Papier, wie Zeitungspapier.
Niemand in dem Café schenkte dem, was da vor sich ging, die mindeste Beachtung. Kachoudas hielt den Rand des Schnipselchens zwischen Daumen und Zeigefinger. Reiner Zufall, dass er im Vornüberbeugen, den Kopf gesenkt, mit der Unterseite des Hinterns gerade noch auf dem Stuhl, einen Blick darauf geworfen hatte. Nein, ein x-beliebiger Zeitungsfitzel war das nicht. Mit einer Schere sorgfältig ausgeschnitten worden war er. Genauer gesagt hatte jemand am Ende eines Wortes zwei Buchstaben ausgeschnitten, ein n und ein t.
Monsieur Labbé blickte hinunter, woraufhin sich der kleine Schneider, von Panik ergriffen, schlagartig nicht mehr rührte, schließlich aber den Kopf hob, den Oberkörper aufrichtete und es vermied, dem Hutmacher in die Augen zu sehen, als er ihm stammelnd den klitzekleinen Gegenstand hinhielt:
»Verzeih’n Sie bitte.«
Anstatt den Papierschnipsel wegzuwerfen, gab er ihn zurück – was ein Fehler war, gestand er damit doch ein, dessen Bedeutung begriffen zu haben. Weil er schüchtern und quasi von Natur aus demütig war, beging er noch einen zweiten Fehler, indem er einen Satz begann, den zu beenden er nicht den Mut hatte:
»Ich hatte angenomm…«
In einem Nebel aus Lichtern sah er nichts anderes als Stühle, Rücken, Tuch, Sägespäne auf dem Fußboden, die schwarzen Füße des Ofens, und er hörte eine tiefe und ruhige Stimme, die sagte:
»Danke, Kachoudas.«
Denn sie unterhielten sich. Jeden Morgen um acht traten der Hutmacher und der Schneider vor ihre Häuser, um die Holzplatten wegzunehmen, die ihnen an ihren Geschäften als Fensterläden dienten. Die Metzgerei neben Kachoudas hatte schon lange geöffnet. Samstags versperrten die Bäuerinnen der Gegend, die Gemüse oder Geflügel verkauften, mit ihren Körben die Straße, an den übrigen Tagen aber trennten die beiden Männer nur die Pflastersteine und sagte Kouchadas schon aus Gewohnheit:
»Guten Morgen, Monsieur Labbé.«
Je nach Himmel fügte er hinzu:
»Schönes Wetter heute.«
Oder aber:
»Immer Regen.«
Und der Hutmacher erwiderte gutmütig:
»Guten Morgen, Kachoudas.«
Das war alles. Sie waren zwei Ladenbesitzer mit einander gegenüberliegenden Geschäften. Soeben aber hatte Monsieur Labbé Silbe für Silbe betonend gesagt:
»Danke, Kachoudas.«
Und zwar mit ungefähr der gleichen Stimme. Womöglich war es sogar genau die gleiche Stimme, und das trotz der fürchterlichen Entdeckung, die der kleine Schneider da gerade gemacht hatte. Kachoudas hätte sein Glas am liebsten in einem Zug geleert. Das Glas klackerte gegen seine Zähne. Er versuchte, sehr schnell zu denken, richtig zu denken, doch je mehr er sich anstrengte, umso mehr gerieten seine Gedanken durcheinander.
Vor allem aber durfte er den Kopf nicht nach rechts drehen. Das hatte er gleich im ersten Moment beschlossen.
An dem mittleren Tisch, dem des Senators, des Druckers, des Arztes, des Hutmachers, saßen Männer um die sechzig bis fünfundsechzig, die im Grunde die wichtigsten waren, an den anderen Tischen dagegen saßen andere Spieler, ja, und hauptsächlich rechts die Belote-Spieler, die die Generation der Männer zwischen vierzig und fünfzig repräsentierten. Und dort an diesem Tisch konnte man so gut wie immer zwischen fünf und sechs Uhr Sonderkommissar Pigeac sehen, ihn, den man betraut hatte, die Sache mit den alten Frauen zu untersuchen.
Kachoudas musste um jeden Preis vermeiden, in seine Richtung zu blicken. Er durfte sich aber ebenso wenig zu dem jungen Reporter umdrehen, der immer noch schrieb. War Jeantet nicht zweifellos einmal mehr damit beschäftigt, auf eine der Botschaften des Mörders zu antworten?
Binnen zwanzig Tagen war dies zu einer festen Gewohnheit geworden, fast einer Tradition. Nach jedem Mord erhielt die Zeitung einen Brief, für den Buchstaben, häufig ganze Wörter ausgeschnitten worden waren aus älteren Ausgaben des Echo des Charentes – wo dieser daraufhin abgedruckt wurde, gefolgt von einem Kommentar des jungen Jeantet. Am nächsten oder übernächsten Tag antwortete dann wiederum der Mörder, immer mithilfe von ausgeschnittenen und auf ein weißes Blatt geklebten Papierschnipseln.
Und gerade am Tag zuvor hatte die Botschaft einen Satz beinhaltet, der den kleinen Schneider auf der Stelle erstarren ließ:
Sie täuschen sich, junger Mann. Ich bin kein Feigling. Nicht weil ich feige wäre, halte ich mich an alte Frauen, sondern weil ich dazu gezwungen bin. Sollte ich morgen ebenso gezwungen sein, einen Mann anzugreifen, und sei er noch so groß und kräftig, so werde ich das tun.
Manche Briefe waren eine halbe Spalte lang und bestanden aus Hunderten von geduldig ausgeschnittenen Buchstaben, weshalb Jeantet geschrieben hatte:
Der Mörder geht nicht nur geduldig und akribisch vor, seine Lebensweise lässt ihm zudem viel Freizeit.
Der Journalist, er war neunzehn, geduldig auch er, hatte ein Experiment gemacht. Er hatte ausgerechnet, wie viel Zeit man benötigte, um mithilfe von aus alten Zeitungen ausgeschnittenen Buchstaben einen dreißig Zeilen langen Brief zu verfassen. Kachoudas erinnerte sich nicht mehr an das genaue Ergebnis, doch war es ungeheuer.
Sollte ich morgen ebenso gezwungen sein, einen Mann anzugreifen … Der eine rauchte in kleinen Zügen seine Pfeife und sah zu, wie Karten gespielt wurde, der andere hatte einen schmuddeligen Zigarettenstummel an der Lippe kleben und traute sich nirgends hinzugucken. Ab und zu warf Monsieur Labbé einen Blick auf die Uhr, und schon um fünf Uhr fünfundzwanzig bestellte er seinen zweiten Picon. Es war halb sechs, als er aufstand – was genügte, damit Gabriel mit seinem Mantel und seinem Hut gelaufen kam.
Musterte er Kachoudas wirklich mit ironischem Wohlwollen? Eine Rauchschwade über den Köpfen der Spieler wurde länger und länger. Der Ofen sorgte für Hitzewallungen. Man hätte meinen können, Monsieur Labbé würde warten, würde genau erraten, was der kleine Schneider dachte.
»Wenn ich ihn allein gehen lasse, kann er sich irgendwo in einer dunklen Ecke in der Rue du Minage auf die Lauer legen …«
Und wenn Kachoudas auf der Stelle reden würde, egal mit wem, mit dem Kommissar oder sogar dem Journalisten? Wenn er alles erzählte, mit ausgestrecktem Zeigerfinger: »Er ist es!«
Der Papierschnipsel war verschwunden. Vergeblich suchte Kachoudas ihn mit Blicken. Ihm fiel wieder ein, dass der Hutmacher ihn zwischen den Fingern zerknüllt, in eine gräuliche Pille verwandelt hatte. Und selbst wenn die beiden ausgeschnittenen Buchstaben auf den Boden gefallen wären – wie beweisen, dass er sie aufgelesen hatte auf der Hose von Monsieur Labbé?
Nicht mal das würde ausreichen. Das stand dermaßen außer Frage, dass Monsieur Labbé nicht mit der Wimper gezuckt, nicht die geringste Angst gehabt, einfach nur gesagt hatte:
»Danke, Kachoudas.«
Auf dem Spiel standen zwanzigtausend Franc, ein Vermögen für einen kleinen Schneider, dem kaum etwas anvertraut wurde außer Ausbesserungen oder Anzügen zum Wenden und dessen älteste Tochter als Verkäuferin bei Prisunic arbeitete.
Um sich die zwanzigtausend Franc zu verdienen, konnte man nicht mir nichts, dir nichts eine Anschuldigung in die Welt setzen. Man hätte den Mörder nicht vorwarnen sollen.
Jetzt wusste es Monsieur Labbé. Und Monsieur Labbé, der seit dem 13. November – das heißt binnen zwanzig Tagen – fünf alte Frauen umgebracht hatte, würde sich seiner leicht entledigen können.
Hatte Kachoudas Zeit, all das zu bedenken? Der Hutmacher berührte die Fingerspitzen von jedem seiner Freunde. Man sagte zu ihm:
»Guten Abend, Léon.«
Denn er hieß ja Léon. Er klopfte dem Doktor, der beim Kartengeben war und keine Hand frei hatte, auf die Schulter, worauf der Doktor grummelte:
»Gute Besserung für Mathilde.«
Man hätte schwören können, dass er absichtlich langsam machte, um Kachoudas Zeit für eine Entscheidung zu geben. Sein Gesicht war dasselbe wie vorhin, als Valentin ihn die Wendeltreppe hatte herunterkommen sehen. Früher war er mal dick gewesen, vielleicht sogar fett, hatte aber mächtig abgenommen, was man an seinen weichen Linien, an seinen schlaffen Zügen merkte. Nach wie vor wog er bestimmt doppelt so viel wie Kachoudas.
»Bis morgen.«
Der Zeiger hatte gerade das halbe Zifferblatt durchschritten, da fiel die Tür ins Schloss und griff sich Kachoudas vom Nachbarstuhl seinen Mantel. Um ein Haar wäre er ohne zu zahlen gegangen, so sehr hatte er Angst, Monsieur Labbé könnte um die Ecke in die Rue du Minage gebogen sein, ehe er selber draußen war. Dann nämlich wären alle Fallen möglich. Allerdings nach Haus musste er ja schließlich.
Monsieur Labbé ging mit seinen gleichmäßigen Schritten, weder langsam noch schnell, und zum ersten Mal fiel dem kleinen Schneider auf, dass er extrem leichtfüßig war, wie die meisten Dicken oder früher mal Dicken, und dass er beim Gehen keine Geräusche machte.
Er bog nach rechts in die Rue du Minage. Kachoudas folgte ihm in ungefähr zwanzig Metern Abstand, indem er achtgab, in der Mitte der Straße zu bleiben. Im Notfall bliebe ihm immer noch Zeit zu schreien. Zwei, drei Geschäfte, deren Beleuchtung man durch den Regen sah, hatten noch geöffnet; in fast sämtlichen Wohnungen war in den oberen Etagen Licht an.
Monsieur Labbé ging auf dem linken Trottoir, dem der Hutmacherei, aber anstatt dort anzuhalten, setzte er seinen Weg fort und wandte, als er ein bisschen weitergegangen war, den Kopf, vielleicht um sicherzugehen, dass sein Nachbar ihm weiterhin folgte – was im Übrigen überflüssig war, da man ja Kachoudas’ Schritte auf dem Pflaster hörte.
Der kleine Schneider hätte zu sich nach Haus gehen können. Der Weg war frei. Sein Laden war noch geöffnet, und er hätte sogar Zeit gehabt, rasch den Riegel vorzuschieben. Durch das Fenster im ersten Stock sah er das Stück Kreide, das neben der Glühbirne über dem Tisch baumelte. Die Kleinen waren aus der Schule zurück. Esther, die Älteste, die von Prisunic, würde um kurz nach sechs nach Haus kommen, und zwar im Laufschritt, weil auch sie Angst vor dem Mörder hatte und keine ihrer Kolleginnen im Viertel wohnte.
Er ging weiter. Er bog nach links, wie Monsieur Labbé, sodass sie sich einen Moment lang beide in einer etwas helleren Straße befanden. Es war beruhigend, Leute in den Geschäften und hin und wieder ein Auto vorbeikommen zu sehen, das klatschend durch die Wasserpfützen fuhr.
Es gab keine Arkaden mehr, und so regnete es jetzt ungehindert auf Monsieur Labbés Schultern. Die Straße wurde wieder dunkel. Mal verschwand der Hutmacher, und mal tauchte er im Lichtkreis einer Laterne wieder auf, während Kachoudas genau in der Straßenmitte blieb, starr vor Schrecken die Luft anhielt und trotzdem außerstande war umzudrehen.
Wie viele Freiwilligenpatrouillen gab es zu dieser Stunde in der Stadt? Wohl vier oder fünf, ja sogar junge Leute mit Taschenlampen, die das Ganze lustig fanden. Es war die berüchtigte Zeit. Drei der alten Frauen waren zwischen halb sechs und sieben Uhr abends ermordet worden.
Nacheinander erreichten sie das ruhige Museumsviertel mit dessen einstöckigen Häuschen, wo man hier und da hinter Fensterscheiben Familien versammelt sah, Kinder, die ihre Hausaufgaben machten, Frauen, die schon den Tisch fürs Abendessen deckten.
Unvermittelt verschwand Monsieur Labbé im Dunkeln, worauf Kachoudas, als würde er etwas Wesentliches vermissen, nach einigen Schritten innehielt: Aufgrund der auf der Straße herrschenden Finsternis war es ihm unmöglich, seinen Nachbarn auszumachen. Stand er vielleicht in irgendeiner Nische? Oder bewegte er sich womöglich doch? War er nicht in der Lage, völlig geräuschlos von hier nach da zu gelangen? Nichts deutete darauf hin, dass er sich dem kleinen Schneider näherte, und doch blieb der erstarrt stehen, wie von Eiseskälte durchdrungen.
Nicht weit von ihm hörte er Klaviertöne. Ein schwacher Lichtschein sickerte durch die Jalousien eines Hauses. Ein kleines Mädchen oder ein kleiner Junge bekam in einem hell erleuchteten Zimmer Musikunterricht und spielte unermüdlich dieselben Tonleitern.
Kein menschliches Wesen bog in die Straße, weder an dem einen noch am anderen Ende, und Monsieur Labbé hielt sich weiterhin irgendwo verborgen, geräuschlos, unsichtbar, während sich Kachoudas den Häusern nicht zu nähern wagte.
Das Klavier verstummte, und es herrschte vollkommene Stille. Dann der dumpfe Laut des Deckels, der zurück auf die weißen und schwarzen Tasten klappte. Licht hinter einer Tür, gedämpfte Stimmen, durchdringender, sobald zwanzig Meter weg von dem kleinen Schneider die Tür aufging, indessen die Regentropfen sich in Funken verwandelten.
»Wollen Sie da wirklich raus, Mademoiselle Mollard? Es wäre doch viel sicherer, Sie warten, bis mein Mann aus dem Büro kommt. Er muss in fünf Minuten hier sein.«
»Für die fünfzig Schritte bis zu mir! Gehen Sie schnell wieder rein! Erkälten Sie sich nicht. Bis nächsten Freitag.«
Es war ein Freitag. War es nicht so, dass das kleine Mädchen (oder der kleine Junge) jeden Freitag zwischen fünf und sechs Uhr Klavierunterricht bekam?
»Ich lasse meine Tür auf, bis Sie zu Hause sind.«
»Das kommt gar nicht infrage! Damit das ganze Haus auskühlt! Wo ich Ihnen doch sage, dass ich keine Angst habe.«
Anhand ihrer Stimme stellte Kachoudas sie sich klein vor und dürr, ein bissel runtergekommen, ein bissel gekünstelt. Er hörte sie die Stufen hinabgehen, das Trottoir betreten. Die Tür, für einen Moment noch offen, ging schließlich zu. Er hörte sich schon schreien. Er wollte schreien. Aber es war schon zu spät. Außerdem wäre er körperlich dazu gar nicht in der Lage gewesen.
Es machte kein lauteres Geräusch als, zum Beispiel, in einem Hochwald ein auffliegender Fasan. Wahrscheinlich Geraschel der Kleidung. Jeder in der Stadt wusste, wie es passierte, unwillkürlich fuhr sich Kachoudas mit der Hand an die Gurgel, stellte sich die Cellosaite vor, die den Hals einschnürte, und mühte sich dann, seine Erstarrung abzuschütteln.
Er war sich sicher, dass es vorbei war, dass er sich schleunigst davonmachen, sofort eine Polizeiwache aufsuchen musste. Es gab eine in der Rue Saint-Yon, gleich hinter dem Markt.
Er glaubte, vor sich hin gebrabbelt zu haben, dabei hatte er lautlos bloß die Lippen bewegt. Er ging. Es war ein Triumph. Noch schaffte er es nicht, zu rennen. Aber war es nicht sogar besser, hier nicht zu rennen, in den Straßen, wo der andere genauso rennen, ihn einholen, ihn fertigmachen konnte, so wie er gerade das alte Fräulein fertiggemacht hatte?
Ein Schaufenster. Es war, wie aus Ironie, das eines Waffenhändlers. Der Hutmacher bediente sich ja zu keiner Zeit einer Waffe. Kachoudas kam sich nicht mehr so allein vor. Er konnte wieder Luft holen. Er hätte sich gerne umgedreht. Noch zwanzig Meter, zehn Meter, und schon würde er es sehen, das rote Licht der Polizeiwache.
Er war durch die Pfützen gepatscht, weshalb seine Füße nass und seine Gesichtszüge verhärtet waren von der Kälte. Er ging wieder wie ein normaler Mensch, ging vorbei an der Rue du Minage, seiner Straße.
Er war beinahe am Ziel. Er hörte kein Geräusch von Schritten, aber er wusste trotzdem, dass jemand hinter ihm ging, ihn einholte, immer noch traute er sich nicht, zu rennen, auch nicht, stehen zu bleiben, als eine größere und breitere Silhouette als die seine links von ihm Gestalt annahm, Schritte sich den seinen anpassten, eine Stimme seltsam ruhig sagte:
»Sie würden einen Fehler begehen, Kachoudas.«
Er blickte nicht auf zu seinem Nebenmann. Er erwiderte nichts. Er kehrte nicht sofort um.
Er war allein. Er sah die rote Laterne, einen Polizisten, der aus der Wache kam und auf sein Fahrrad stieg.
Er drehte sich um. Ohne sich weiter mit ihm abzugeben, hatte Monsieur Labbé kehrtgemacht und begab sich, Hände in den Taschen, Mantelkragen hochgeschlagen, zur Rue du Minage, zur Straße, in der sie beide wohnten.
2
Als er ankam vor seinen Fensterläden, die Valentin zugemacht hatte, blieb er stehen und knöpfte sich den Mantel auf, um den Schlüsselbund aus der Hosentasche zu holen. Er machte stets die gleichen Bewegungen, wenn er abends nach Haus kam. Jemand war an der Ecke zur Rue du Minage stehen geblieben. Es war Kachoudas, der darauf wartete, dass die Tür des Hutmachers sich wieder schloss, ehe er seinerseits nach Haus ging.
Monsieur Labbé hob den Blick und bemerkte in der Werkstatt im ersten Stock die Frau des Schneiders. Ein wenig beunruhigt, hatte sie soeben einen Blick aus dem Fenster geworfen.
Er drehte den Schlüssel im Schloss, trat in die warme Dunkelheit, schloss die Tür wieder, ehe er den Lichtschalter drehte und die Querstange vorlegte; dann blieb er stehen, das Gesicht gegen einen Spalt im Fensterladen gepresst.
Endlich kam der kleine Schneider, vorsichtshalber immer noch in der Straßenmitte, auf Höhe seines Hauses an. Er ging komisch, irgendwie ruckartig … Zum ersten Mal fiel Monsieur Labbé auf, dass er ein Bein nach außen hin nachzog. Auch Kachoudas blickte nach oben, doch war seine Frau gerade zurück in die Küche gegangen. Er platzte in sein Geschäft, aus dem er aber noch mal zurück auf die Straße musste, um die Läden vorzulegen, denn er hatte keinen Gehilfen, der das an seiner Stelle machte. Alle seine Bewegungen waren nervös, abgehackt. Zur Treppe gewandt – der gleichen Wendeltreppe wie in der Hutmacherei –, hatte er wohl gerufen:
»Ich bin’s!«
Er beeilte sich, verriegelte die Tür. Das Licht im Erdgeschoss ging aus und kurz darauf in der Werkstatt an, wo der kleine Schneider gar nicht schnell genug aus dem Fenster sehen konnte.
Monsieur Labbé zog sich zurück von seinem Beobachtungsposten, legte den Rest von dem Geld, das er mitgenommen hatte, zurück in die Kassenschublade, ging in das Hinterzimmer und fingerte dort einen Moment lang an einem Gegenstand herum, den er aus der Tasche gezogen hatte und der einem Spielzeug ähnelte, zusammengebastelt von irgendeinem Straßenjungen: zwei durch eine Art Schnur miteinander verbundene Holzstücke.
Noch immer hatte er seinen durchnässten Mantel an, und als er sich vorbeugte, tropfte es von seinem Hut. Er nahm ihn erst ab am Fuß der Treppe, wo ein Kleiderständer war und wo er unter der Küchentür einen Lichtstreifen sah.
Der Tisch war gedeckt, mit einem einzelnen Teller und Besteck, einer weißen Decke, einer Flasche Wein, in der ein Korken mit silberner Kappe steckte.
»Guten Abend, Louise. Madame hat nicht gerufen?«
»Nein, Monsieur.«
Das Hausmädchen blickte auf seine Füße, während er sich vor den Ofen setzte, kam mit Pantoffeln in der Hand und kniete sich hin. Nie hatte er sie dazu aufgefordert. Bestimmt war sie auf dem Bauernhof dazu abgerichtet worden, den Männern die Schuhe auszuziehen, ihrem Vater und ihren Brüdern, sobald die vom Feld zurückkamen.
Es war genauso warm wie im Laden, die Luft stand, war ebenso drückend, fasste die Gegenstände ein und verlieh ihnen ein starres, unabänderliches Aussehen.
Hinter dem Fenster, das auf den Hof ging, war immer noch der Regen zu hören, und hier war es eine alte Uhr in ihrem Kasten aus Nussbaum, die eine kupferne Scheibe hin und zurück bewegte, langsamer, hätte man schwören können, als überall sonst. Die angezeigte Zeit war nicht dieselbe wie in der Hutmacherei, weder auf Monsieur Labbés Uhr noch auf dem Wecker im ersten Stock.
»Ist niemand vorbeigekommen?«
»Nein, Monsieur.«
Sie zog ihm seine Pantoffeln aus feinem Ziegenlackleder an. Der Raum war eher ein Esszimmer als eine Küche, denn Herd und Spüle waren nebenan, in einer schmalen Abseite. Der Tisch war rund, die lederbezogenen Stühle mit Nägeln beschlagen. Es gab viel Kupfergeschirr und, auf einer Bauernanrichte, alte, in Auktionslokalen erstandene Fayencen.
»Ich geh nach oben und sehe nach, ob Madame etwas braucht.«
»Kann ich die Suppe servieren?«
Er verschwand auf der Wendeltreppe, und sie hörte oben im Ersten die Tür aufgehen, Schritte, ein Murmeln, das Geräusch der Rollen des Sessels, der durchs Zimmer geschoben wurde, so wie jeden Abend. Als er wieder nach unten kam, sagte er, indem er sich an den Tisch setzte:
»Sie möchte nur ein bisschen. Was gibt es zu essen?«
Er hatte sein Buch vor sich hingelegt, seine Hornbrille aus ihrem Etui genommen. Der Ofen wärmte ihm den Rücken. Er ließ sich Zeit beim Essen. Louise trug ihm auf, und zwischen den Gängen wartete sie, den Blick leer, reglos in ihrer schmalen Abseite.
Sie war noch keine zwanzig. Ziemlich dick und sehr dumm war sie, ausdruckslos glotzten ihre Froschaugen vor sich hin.
Das Kabuff, das als Küche diente, war nicht breit genug, um einen Tisch hineinzustellen. Manchmal aß sie dort im Stehen, manchmal wartete sie, bis der Hutmacher fertig und gegangen war, und setzte sich auf seinen Platz.
Er konnte sie nicht ausstehen. Sie einzustellen war ein schlechtes Geschäft für ihn gewesen, aber es war noch genug Zeit, später darüber nachzudenken.
Um Viertel vor acht wischte er sich den Mund ab, schob seine zusammengerollte Serviette in den Silberring, steckte den Korken zurück in seine Flasche, von der er bloß ein Glas getrunken hatte, und stand seufzend auf.
»Ist fertig«, sagte sie.
Daraufhin nahm er das Tablett, auf dem ein weiteres Abendessen angerichtet war, und ging erneut zur Treppe. Wie oft am Tag ging er sie hinauf, diese Treppe?
Das Schwierige war, mit der einen Hand das Tablett zu halten, ohne etwas zu verschütten, während die andere den Schlüssel aus der Tasche holte und im Schloss drehte, denn diese Tür war immer verschlossen, selbst wenn er im Haus war. Er drehte den Lichtschalter, sodass von gegenüber Kachoudas das Rollo hell werden sah. Er stellte das Tablett ab, immer an denselben Platz, und schloss hinter sich die Tür wieder ab.
Alles das war sehr kompliziert. Es sich einspielen zu lassen hatte Zeit gekostet. Das Kommen und Gehen des Hutmachers folgte einer präzisen Ordnung, die enorme Bedeutung besaß.
Zunächst musste gesprochen werden. Er machte sich nicht immer die Mühe, die Wörter deutlich auszusprechen, denn unten kam davon ohnehin nur wirres Gemurmel an. Heute zum Beispiel sagte er immer wieder mit gewisser Befriedigung:
»Du würdest einen Fehler begehen, Kachoudas!«
Es gab diesen Abend kein besonders gutes Essen, er nahm sich aber trotzdem das zarteste Stück Kalbskotelett. Es gab Tage, da aß er auch das zweite Abendessen ganz auf.
Er trat ans Fenster. Er hatte Zeit. Er schob das Rollo etwas beiseite und bemerkte den kleinen Schneider, der mit dem Essen schon fertig war und wieder Platz nahm auf seinem Tisch, während die Mädchen in der Stube auf dem Boden spielten und die Älteste zusammen mit ihrer Mutter bestimmt das Geschirr abwusch.
Mit lauter Stimme sagte er, indem er zu dem Tablett zurückging:
»Hast du gut gegessen? Bestens.«
Und daraufhin leerte er die Teller – bis auf den Kotelettknochen – in die Toilette, wobei er darauf achtete, nicht die Spülung zu betätigen. Zuerst hatte er das noch gemacht, aber das war ein Fehler gewesen. So wie diesen hatte es eine Menge Fehler und Unvorsichtigkeiten gegeben, die er nach und nach korrigiert hatte.
Mit den leeren Tellern ging er wieder nach unten, wo Louise auf seinem Platz zu Abend aß. Um nicht so viel Geschirr spülen zu müssen, nutzte sie zum Essen den Teller und zum Trinken das Glas ihrer Herrschaft. Sie las während des Essens, sie genauso, allerdings Groschenheftchen.
»Sie gehen nicht raus, Louise?«
»Hab keine Lust, mich erwürgen zu lassen.«
»Gute Nacht.«
»Guten Abend, Monsieur.«
Es war fast geschafft. Noch ein paar tagtägliche Verrichtungen waren auszuführen: sich vergewissern gehen, dass die Ladentür gut abgeschlossen war, das Licht ausmachen, noch einmal die Treppe hinaufsteigen, den Schlüssel aus der Tasche holen, aufmachen, zumachen.
Nachher würde Louise raufgehen, um sich im Hinterzimmer schlafen zu legen, und er für eine gute Viertelstunde noch ihre schweren Schritte hören, bis der Bettrost kreischte unter ihrem Gewicht.
»Ein Kalb ist das!«
Er hatte das Recht, die Stimme zu erheben. Von Zeit zu Zeit war das fast eine Notwendigkeit. Er konnte jetzt ebenso die Toilettenspülung ziehen, sich des Kragens, der Krawatte, des Jacketts entledigen, seinen braunen Morgenmantel überziehen. Nur war er ja noch nicht ganz fertig mit allem, denn es blieben drei, vier Scheite im Kamin nachzulegen.
Louise war es, die sie morgens nach oben schaffte und stapelte auf dem Treppenabsatz im ersten Stock.
Alle Häuser in der Straße hatten das gleiche Alter, sie stammten aus der Zeit Ludwigs XIII. Von außen waren sie mit ihren Arkaden und ihrem steil abfallenden Dach gleich geblieben, im Lauf der Jahrhunderte aber hatte jedes im Inneren diverse Veränderungen erfahren. Über dem Kopf von Monsieur Labbé beispielsweise existierte ein zweites Stockwerk, das man allerdings nur über die Straße erreichte. Neben dem Geschäft war eine Tür zu einem schmalen Gang, der zum Innenhof führte. Und dort fing die Treppe an, die in den zweiten Stock führte, ohne aber mit dem ersten irgendwie in Verbindung zu stehen.
Früher, als dort oben noch Mieter wohnten, war das praktisch gewesen. Die Zimmer standen seit Langem jedoch leer, nämlich seit dem ersten Jahr der Erkrankung von Mathilde, die es nicht aushielt, den ganzen Tag lang Schritte über sich zu hören.
Einen Prozess hatte man anstrengen müssen, um die Leute aus dem Zweiten loszuwerden. Und noch viel größere Schwierigkeiten als das hatte es gegeben!
Vergaß er auch nichts? Die Scheite brannten. Die Rollos waren ordentlich zu. Das Deckenlicht, es war ihm eh zu grell, konnte er noch löschen, anlassen nur die Lampe, die auf dem Sekretär stand, denn zu allen Zeiten schon war in einer Ecke dort ein kleiner Sekretär gewesen, voll mit winzig kleinen Schubladen, und jetzt war das ganz praktisch.
Er nahm den Packen Zeitungen, die Schere, stopfte seine alte Meerschaumpfeife. Zwei-, dreimal drehte er sich zum Fenster und dachte an Kachoudas.
»Armer Kerl!«