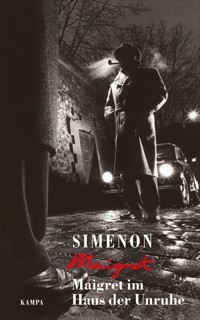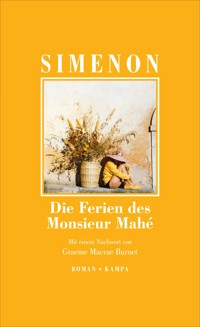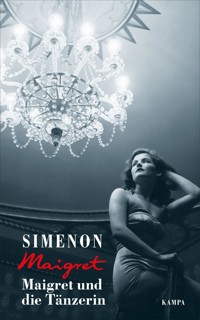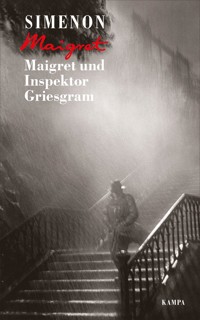Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Georges Simenon
- Sprache: Deutsch
Maigret sitzt im Hôtel de l'Amiral und raucht eine Pfeife nach der anderen. Eigentlich wurde er nach Rennes beordert, um die mobile Einsatzbrigade neu zu organisieren, doch seit in Concarneau ein angesehener Weinhändler fast erschossen und in den Flaschen des Hotels Gift gefunden wurde, herrscht helle Aufregung in der Hafenstadt. Während sich ein junger Inspektor aus Rennes auf Spurensuche begibt, beobachtet Maigret das Kommen und Gehen im Café des Hotels und die verängstigten Stammgäste. Warum glauben sie, die nächsten Opfer zu sein? Und was hat es mit dem gelben Hund auf sich, der an jedem Tatort auftaucht?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der 6. Fall
Georges Simenon
Maigret und der gelbe Hund
Roman
Aus dem Französischen von Elisabeth Edl und Wolfgang MatzMit einem Nachwort von Marcel Aymé
Kampa
1Der herrenlose Hund
Freitag, 7. November. Concarneau ist wie aus- gestorben. Die leuchtende Turmuhr der Altstadt, gut sichtbar über dem Festungswall, zeigt fünf Minuten vor elf.
Die Flut ist auf dem Höhepunkt, und ein Sturm aus Südwest wirft im Hafen die Kähne gegeneinander. Der Wind drückt mit Macht in die Straßen, und man sieht, wie hier und da ein Papierfetzen über das Pflaster fegt.
Am Quai de l’Aiguillon brennt nirgendwo Licht. Alles hat zu. Alles schläft. Nur die drei Fenster im Hôtel de l’Amiral, an der Ecke von Platz und Quai, schimmern noch hell.
Die Fensterläden sind nicht geschlossen, durch das grünliche Glas erkennt man gerade eben ein paar schemenhafte Gestalten. Und der Zöllner in seinem Wachhäuschen beneidet diese späten Cafégäste, keine hundert Meter entfernt.
Direkt gegenüber im Hafenbecken hat am Nach- mittag ein Küstenfahrer festgemacht, zur Sicherheit. Kein Mensch auf der Brücke. Die Taue knarren, und ein schlecht gerefftes Klüversegel klatscht im Wind. Dazu das dauernde Tosen der Brandung, ein Klick von der Turmuhr, gleich schlägt sie elf.
Die Tür des Hôtel de l’Amiral geht auf. Ein Mann erscheint, und eine Weile noch spricht er durch den Spalt zu ein paar Leuten da drin. Die Bö packt zu, zerrt ihm am Mantelschoß, greift nach seinem Hut, doch er hält ihn im letzten Moment fest und drückt ihn sich beim Weitergehen auf den Kopf.
Selbst aus der Entfernung spürt man, der Mann ist ziemlich blau, wacklig auf den Beinen, und er summt vor sich hin. Der Zöllner folgt ihm mit dem Blick, er lächelt, denn jetzt setzt sich der Mann noch in den Kopf, eine Zigarre anzustecken. Und es beginnt ein komischer Kampf zwischen dem Betrunkenen, seinem Mantel, den der Wind ihm beinah wegreißt, und dem Hut, der sich über den Gehsteig davonmacht. Zehn Streichhölzer verlöschen.
Der Mann mit Hut entdeckt einen Hauseingang, zwei Stufen, stellt sich unter, krümmt den Rücken. Ein Lichtblitz, sehr kurz. Der Raucher wankt, greift nach dem Türknauf.
Hat der Zöllner da nicht etwas gehört, ein anderes Geräusch, mitten im Sturm? Er ist nicht sicher. Er lacht noch, als er sieht, wie der Nachtschwärmer das Gleichgewicht verliert, ein paar Schritte rückwärts macht, seine gekrümmte Haltung ist ganz unglaublich.
Er fällt zu Boden, am Gehsteigrand, den Kopf im Dreck des Rinnsteins. Der Zöllner schlägt sich die Arme um die Brust, will sich wärmen, schaut schlecht gelaunt zum Klüversegel, weil ihn das Klatschen stört.
Eine Minute verstreicht, dann eine zweite. Noch ein Blick auf den Betrunkenen, er rührt sich nicht. Doch da ist ein Hund, aufgetaucht aus dem Nichts, der ihn beschnuppert.
»Erst in dem Augenblick hatte ich das Gefühl, da ist irgendwas passiert!«, sagt der Zöllner später, im Lauf der Untersuchung.
Das Hin und Her, das dieser Szene folgte, lässt sich nur schwer rekonstruieren in seinem genauen Ablauf. Der Zöllner geht hinüber zu dem daliegenden Mann, vorsichtig, wegen des Hundes, ein riesiges Tier, bissig und gelb. Acht Meter daneben brennt eine Gaslaterne. Zunächst sieht der Beamte nichts Ungewöhnliches. Dann bemerkt er ein Loch im Mantel des Betrunkenen, und aus dem Loch sickert eine zähe Flüssigkeit.
Jetzt rennt er zum Hôtel de l’Amiral. Das Café ist fast leer. Hinter der Kasse, Ellbogen aufgestützt, die Kellnerin. An einem Marmortisch rauchen zwei Männer ihre letzte Zigarre, zurückgelehnt, die Beine ausgestreckt.
»Schnell! Mörder! Ich weiß nicht …«
Der Zöllner dreht sich um. Der gelbe Hund kommt ihm hinterher, und jetzt legt er sich der Kellnerin zu Füßen. Ein Zögern, ein unbestimmter Schrecken ist in der Luft.
»Ihr Freund, der eben raus ist …«
Ein paar Augenblicke später beugen sich drei Mann über den Körper, der hat sich inzwischen nicht gerührt. Das Rathaus, wo sich auch die Polizeiwache befindet, ist nur zwei Schritt entfernt. Der Zöllner setzt sich lieber in Bewegung. Atemlos läuft er hinüber, dann klingelt er Sturm bei einem Arzt.
Und er wiederholt, weil er das Bild nicht loswird:
»Er ist gewankt, rückwärts, wie ein Betrunkener, mindestens drei Schritte hat er gemacht.«
Fünf Männer, sechs, sieben. Und überall gehen Fenster auf, Geflüster …
Der Arzt kniet im Dreck und erklärt:
»Eine Kugel aus nächster Nähe, mitten in den Bauch. Eine Notoperation, sofort. Man muss im Krankenhaus anrufen.«
Alle kennen den Verletzten. Monsieur Mostaguen, der größte Weinhändler in Concarneau, ein gutmütiger Dicker, hat nur Freunde.
Die zwei Polizisten in Uniform – einer hat sein Käppi nicht gefunden – wissen nicht recht, wo sie anfangen sollen mit ihrer Untersuchung.
Jemand spricht, Monsieur Le Pommeret, und an Haltung und Stimme erkennt man gleich den angesehenen Bürger.
»Wir haben eine Runde Karten gespielt, im Café de l’Amiral, mit Servières und Doktor Michoux. Doktor Michoux ist als Erster gegangen, vielleicht vor einer halben Stunde. Mostaguen hat Angst vor seiner Frau, aufgebrochen ist er deshalb Punkt elf.«
Ein tragikomischer Zwischenfall. Alle horchen auf Monsieur Le Pommeret. Der Verletzte ist vergessen. Und da öffnet er die Augen, will aufstehen, murmelt mit Verwunderung in der Stimme, so leise, so sacht, dass die Kellnerin in nervöses Lachen ausbricht:
»Was ist denn los?«
Dann schüttelt ihn ein Krampf. Seine Lippen zittern. Die Gesichtsmuskeln ziehen sich zusammen, und währenddessen kümmert sich der Arzt um eine Spritze.
Der gelbe Hund streunt allen um die Beine. Irgendjemand fällt das auf.
»Kennt einer das Vieh?«
»Nie gesehen …«
»Bestimmt der Hund von einem Schiff.«
In dieser dramatischen Atmosphäre bekommt der Hund etwas Bedrohliches. Seine Farbe vielleicht, dieses schmutzige Gelb? Er ist hochgewachsen, sehr mager, und sein großer Kopf erinnert zugleich an Fleischerhund und Deutsche Dogge.
Fünf Meter neben der Gruppe befragen die Polizisten den Zöllner, den einzigen Zeugen des Vorfalls.
Sie betrachten den Hauseingang und die zwei Stufen. Es ist der Eingang zu einem großen bürgerlichen Gebäude, die Fensterläden sind geschlossen. Rechts von der Tür hängt eine notarielle Ankündigung für die öffentliche Versteigerung der Immobilie am 18. November:
Schätzpreis: 80000 Franc
Ein Schutzmann müht sich vergebens, das Schloss aufzukriegen, und am Ende schafft es der Chef der benachbarten Autowerkstatt, knackt es mit dem Schraubenzieher.
Jetzt kommt der Krankenwagen. Man hebt Monsieur Mostaguen auf die Trage. Den Schaulustigen bleibt nichts mehr als das leere Haus.
Seit einem Jahr ist es unbewohnt. Im Korridor riecht es stark nach Schießpulver und Tabak. Im Licht einer Taschenlampe sieht man auf den Bodenfliesen Zigarettenasche und Spuren von Straßendreck, also lag hier einer ziemlich lange auf der Lauer, hinter der Tür.
Ein Mann, der über dem Pyjama nur einen leichten Mantel trägt, sagt zu seiner Frau:
»Komm! Gibt nichts mehr zu sehen. Der Rest steht morgen in der Zeitung. Da drüben ist Monsieur Servières.«
Servières ist eine kleine, feiste Gestalt im gelbgrauen Mantel, und er war zusammen mit Monsieur Le Pommeret im Hôtel de l’Amiral. Er ist Redakteur beim Phare de Brest und bringt dort zum Beispiel jeden Sonntag eine humoristische Kolumne.
Er macht sich Notizen, gibt den zwei Polizisten Anweisungen, ja fast Befehle.
Die Türen im Korridor sind abgeschlossen. Ganz hinten, zum Garten hinaus, steht eine offen. Den Garten umfasst eine Mauer von knapp ein Meter fünfzig Höhe. Jenseits der Mauer ist eine kleine Gasse, die hinüberführt zum Quai de l’Aiguillon.
»Der Mörder ist da raus!«, verkündet Jean Servières.
Am nächsten Tag machte Maigret sich schlecht und recht an die Zusammenfassung der Ereignisse. Seit einem Monat war er abkommandiert zur Mobilen Brigade in Rennes, wo einige Bereiche neu organisiert werden sollten. Dann erreichte ihn ein besorgter Anruf des Bürgermeisters von Concarneau.
Und er war in die Stadt gekommen, begleitet von Leroy, ein Inspektor, mit dem er noch nie gearbeitet hatte.
Der Sturm war noch immer nicht vorbei. Zuweilen ließ ein Windstoß die dichten Wolken über der Stadt zerbersten, und sie entluden sich als eisiger Regenguss. Kein Schiff verließ den Hafen, und die Rede war von einem Dampfer in Seenot, draußen vor den Glénan-Inseln.
Maigret ging natürlich ins Hôtel de l’Amiral, das beste Haus der Stadt. Es war fünf Uhr nachmittags und die Nacht schon angebrochen, als er das Café betrat, einen langen, ziemlich düsteren Raum mit grauem, sägemehlbedecktem Boden, Marmortischen, und durch das grüne Fensterglas wirkte alles noch trauriger.
Mehrere Tische waren besetzt. Doch schon beim ersten Blick erkannte man den Tisch der Stammgäste, respektable Herren, bei deren Gesprächen die anderen gern mithörten.
Einer von diesem Tisch erhob sich, ein Mann mit Pausbacken, großen Augen, ein Lächeln um den Mund.
»Kommissar Maigret? Mein lieber Freund, der Bürgermeister, hat mir gesagt, dass Sie kommen. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle! Jean Servières. Äh … Sie sind aus Paris, stimmt’s? Ich auch! Ich war lange Geschäftsführer der Vache rousse auf dem Montmartre. Gearbeitet habe ich für den Petit Parisien, den Excelsior, für La Dépèche … Ich habe einen Ihrer Vorgesetzten bestens gekannt, den guten Bertrand, vor einem Jahr ist er in Pension gegangen, und jetzt pflanzt er seinen Kohl in der Nièvre. Und ich hab’s genauso gemacht! Habe mich sozusagen zurückgezogen aus dem öffentlichen Leben. Für den Phare de Brest arbeite ich nur zum Spaß.«
Er tänzelte, gestikulierte.
»Kommen Sie, ich präsentiere Ihnen unsere Tafelrunde. Das letzte Quartett der lustigen Burschen von Concarneau. Das hier ist Le Pommeret, unverzagter Schürzenjäger, Privatier von Beruf und dänischer Vizekonsul.«
Der Mann, der jetzt aufstand und die Hand ausstreckte, war gekleidet wie ein Landjunker: karierte Reithose, enge Gamaschen ohne den kleinsten Fleck, Hemdbrust und Krawatte aus weißem Pikee. Er hatte einen hübschen silbernen Schnurrbart, glattgekämmtes Haar, einen hellen Teint, und seine Wangen zierte eine Kupferrose.
»Sehr erfreut, Kommissar.«
Und Jean Servières machte weiter:
»Doktor Michoux. Sohn des früheren Abgeordneten. Arzt ist er übrigens nur auf dem Papier, er hat nie praktiziert. Sie werden sehen, am Ende verkauft er Ihnen noch Grund und Boden. Ihm gehören die schönsten Parzellen in Concarneau, vielleicht sogar der ganzen Bretagne.«
Eine kalte Hand. Das Gesicht schmal, die Nase schief. Rotes, bereits schütteres Haar, und doch war der Doktor keine fünfunddreißig.
»Was trinken Sie?«
Zur selben Zeit war Inspektor Leroy auf dem Rathaus und in der Gendarmerie und hörte sich um.
Die Atmosphäre im Café hatte etwas Graues, Trübes, genauer konnte man es nicht sagen. Durch die offene Tür sah man in den Speisesaal, wo Kellnerinnen in bretonischer Tracht die Tische fürs Abendessen deckten.
Maigrets Blick fiel auf einen gelben Hund, ausgestreckt unter der Kasse. Er hob die Augen, sah einen schwarzen Rock, eine weiße Schürze, ein nicht sehr hübsches Gesicht, doch so einnehmend, dass er es nun während des ganzen Gesprächs beobachtete.
Jedes Mal, wenn er den Kopf abwandte, starrte die Kellnerin auf ihn mit fiebrigem Blick.
»Wäre der arme Mostaguen nicht fast draufgegangen – er ist übrigens der beste Kerl der Welt, hat eben nur diese höllische Angst vor seiner Frau –, ich würde schwören, da hat sich wer einen schlechten Scherz erlaubt.«
Es war Servières, der sprach. Le Pommeret rief in vertraulichem Ton:
»Emma!«
Und die Kellnerin kam an den Tisch.
»Ja? Was nehmen Sie?«
Auf dem Tisch standen leere Biergläser.
»Zeit für den Aperitif«, bemerkte der Journalist. »Besser gesagt, für einen Pernod. Pernod, Emma. Sie auch, Kommissar?«
Doktor Michoux betrachtete geistesabwesend seinen Manschettenknopf.
»Konnte einer voraussehen, dass Mostaguen im Hauseingang stehen bleibt und sich eine Zigarre anzündet?«, sagte die sonore Stimme von Servières. »Nein, niemand, stimmt’s? Le Pommeret und ich, wir wohnen außerdem auf der anderen Seite der Stadt! Wir kommen gar nicht vorbei an dem leeren Haus. Um die Zeit sind nur noch wir drei auf der Straße. Mostaguen ist nicht der Typ, der Feinde hat. So was nennt man eine gute Haut. Ein Bursche, der nur ein Ziel kennt, nämlich eines Tages die Ehrenlegion …«
»Ist die Operation gutgegangen?«
»Er kommt übern Berg. Und das Komischste, seine Frau hat ihm im Krankenhaus eine Szene gemacht, sie ist nämlich vollkommen sicher, es dreht sich um irgendeine Liebesaffäre! Stellen Sie sich mal vor! Der arme Alte hat sich nicht mal getraut, seine Sekretärin zu kraulen, aus lauter Angst vor Schwierigkeiten!«
»Einen Doppelten!«, sagte Le Pommeret zu der Kellnerin, die jetzt den Absinth-Ersatz einschenkte. »Bring ein bisschen Eis, Emma.«
Manche Gäste brachen auf, denn es war Zeit fürs Abendessen. Eine Windbö kam durch die offene Tür, bauschte die Tischdecken im Speisesaal.
»Sie müssen den Artikel lesen, den ich geschrieben habe, ich denke, ich habe alle Hypothesen durchgespielt. Plausibel ist nur eine: Da wütet ein Verrückter … Aber wir kennen die ganze Stadt, keine Ahnung, wer hier den Verstand verlieren könnte … Wir sind hier jeden Abend. Manchmal kommt der Bürgermeister und spielt auch eine Runde. Oder Mostaguen. Oder wir holen für unser Bridge den Uhrmacher, der wohnt ein paar Häuser weiter.«
»Und der Hund?«
Der Journalist war ratlos.
»Keiner weiß, wo der herkommt. Zuerst haben wir geglaubt, er gehört dem Küstenfahrer, der gestern angelegt hat. Die Sainte-Marie. Stimmt wohl nicht. Die haben schon einen Hund an Bord, aber einen Neufundländer, und ich wette, kein Mensch hier kennt die Rasse von diesem grässlichen Vieh.«
Während er redete, nahm er die Karaffe und goss Wasser in Maigrets Glas.
»Ist die Kellnerin schon lange da?«, fragte der Kommissar halblaut.
»Seit Jahren …«
»Ist sie rausgegangen, gestern Abend?«
»Sie hat sich nicht vom Fleck gerührt. Sie hat gewartet, dass wir endlich gehen, sie wollte ins Bett. Le Pommeret und ich, wir haben uns was erzählt von der guten alten Zeit, als wir noch jung und schön waren und Frauen kriegten ohne Geld … Stimmt’s, Le Pommeret? … Der sagt nichts! Wenn Sie ihn erst besser kennen, dann merken Sie’s: Sobald es sich um Frauen dreht, hält er durch, die ganze Nacht. Wissen Sie, wie wir das Haus nennen, gegenüber der Fischhalle, wo er wohnt? Das Haus des Lasters … hä!«
»Auf Ihr Wohl, Kommissar«, sagte etwas peinlich berührt der, von dem die Rede war.
Maigret bemerkte im selben Moment, dass Doktor Michoux, der kaum die Zähne auseinandergekriegt hatte, sich vorbeugte, und dabei hielt er sein Glas gegen das Licht. Er runzelte die Stirn. Auf seinem Gesicht, von Natur aus blass, lag ein merklicher Ausdruck von Sorge.
»Augenblick!«, rief er, nach längerem Zögern.
Er hielt sich das Glas vor die Nase, tauchte den Finger ein, leckte mit der Zungenspitze.
Servières verfiel in lautes Gelächter.
»Herrlich! Lässt der sich verrückt machen durch die Geschichte mit Mostaguen.«
»Und?«, fragte Maigret.
»Ich glaube, wir trinken das besser nicht … Emma! Lauf und hol den Apotheker. Auch wenn er schon beim Essen sitzt!«
Das war wie eine kalte Dusche. Das Café wirkte noch leerer, noch düsterer. Le Pommeret zwirbelte sich nervös den Schnurrbart. Sogar der Journalist rutschte auf seinem Stuhl herum.
»Was meinst du?«
Der Doktor schaute finster. Er starrte noch immer in sein Glas. Er stand auf und nahm die Pernod-Flasche aus dem Wandschrank, bewegte sie im Licht, und Maigret erkannte zwei oder drei kleine weiße Körnchen oben auf der Flüssigkeit.
Die Kellnerin kam herein, hinter ihr der Apotheker mit vollem Mund.
»Hören Sie, Kerdivon, Sie müssen sofort den Inhalt der Flasche und der Gläser analysieren.«
»Heute noch?«
»Jetzt gleich!«
»Was für eine Probe soll ich machen? Woran denken Sie?«
Noch nie hatte Maigret ihn so schnell herabfallen sehen, den bleichen Schatten der Angst. Ein paar Augenblicke hatten gereicht. Alle Wärme war aus den Augen gewichen, und die Kupferrose auf Le Pommerets Wangen wirkte künstlich.
Die Kellnerin hinter der Kasse hatte die Ellbogen aufgestützt, befeuchtete die Bleistiftmine und notierte Zahlenreihen in ein kleines schwarzes Wachstuchheft.
»Du bist verrückt!« Servières versuchte zu scherzen.
Es klang falsch. Der Apotheker hielt die Flasche in der einen Hand, in der anderen ein Glas.
»Strychnin …«, flüsterte der Doktor.
Und er schob den Apotheker hinaus, kam zurück, den Kopf gesenkt, gelb das Gesicht.
»Wie haben Sie das gemerkt?«, fragte Maigret.
»Ich weiß nicht. Zufall. Da war ein weißes Pulverkörnchen im Glas. Der Geruch seltsam.«
»Kollektive Autosuggestion!«, behauptete der Journalist. »Wenn ich das morgen in meinem Käseblatt schreibe, dann sind sämtliche Bistros im Finistère pleite.«
»Trinken Sie immer Pernod?«
»Jeden Abend, vor dem Essen. Emma ist das gewohnt. Wenn sie sieht, dass unser Bier ausgetrunken ist, bringt sie die Gläser. Wir haben unsere kleinen Gewohnheiten. Am Abend ist’s dann Calvados.«
Maigret stand jetzt vor dem Wandschrank mit den Schnäpsen und musterte eine Calvados-Flasche.
»Der nicht! Die dicke Karaffe.«
Er nahm sie in die Hand, hielt sie vors Licht, sah ein paar weiße Pulverkörnchen. Doch er sagte nichts. Das war unnötig. Sie hatten verstanden.
Inspektor Leroy trat ein, verkündete in gleichgültigem Ton:
»Die Gendarmerie hat nichts Verdächtiges bemerkt. Keine Rumtreiber in der Gegend. Sie verstehen nicht …«
Er wunderte sich über die allgemeine Stille, über die spürbare, erstickende Angst. Tabakqualm waberte um die Glühlampen. Das grünliche Tuch des Billards wirkte wie trockenes Gras. Zigarrenstummel lagen auf dem Boden, irgendwo hatte einer ins Sägemehl gespuckt.
»… sieben, und eins im Sinn …«, rechnete Emma und leckte an der Bleistiftspitze.
Mit einem Ruck hob sie den Kopf und schrie nach hinten:
»Ich komm schon, Madame!«
Maigret stopfte seine Pfeife. Doktor Michoux starrte hartnäckig zu Boden, und seine Nase wirkte schiefer denn je. Le Pommerets Schuhe glänzten, als hätte er sie noch nie benutzt. Jean Servières zuckte von Zeit zu Zeit die Achseln und sprach mit sich selbst.
Alle Blicke richteten sich auf den Apotheker, der mit der Flasche und einem leeren Glas zurückkam.
Er war gerannt. Er keuchte. Neben der Tür machte er die Bewegung eines Fußtritts, um irgendwen zu verscheuchen, und knurrte:
»Dreckiger Köter!«
Und kaum im Café:
»Das ist ein Witz, oder? Hat jemand getrunken?«
»Was ist es?«
»Strychnin, ja! Irgendwer hat es in die Flasche getan, vor höchstens einer halben Stunde.«
Entsetzt starrte er auf die noch vollen Gläser, auf die fünf schweigenden Männer.
»Was soll das bedeuten? Wo gibt’s denn so was? Ich darf ja wohl fragen! Letzte Nacht erschießt man einen Mann, vor meiner Haustür, und heute …«
Maigret nahm ihm die Flasche aus der Hand. Emma kam zurück, gleichgültig, zeigte über der Kasse ihr schmales Gesicht mit den Ringen unter den Augen, den dünnen Lippen, dem schlecht gekämmten Haar, auf dem die bretonische Haube unaufhörlich nach links rutschte, obwohl sie ständig nach ihr griff.
Le Pommeret ging mit großen Schritten auf und ab, betrachtete dabei seine glänzenden Schuhe. Jean Servières starrte reglos auf die Gläser, dann rief er plötzlich mit einer Stimme, die erstickt war von einem entsetzten Seufzer:
»Mein Gott!«
Der Doktor krümmte den Rücken.
2Der Doktor in Pantoffeln
Inspektor Leroy war fünfundzwanzig, glich je- doch eher einem sogenannten braven Jungen als einem Polizeiinspektor.
Er kam frisch von der Schule. Es war sein erster Fall, und seit einer Weile beobachtete er Maigret mit verzweifelter Miene, wollte sich dezent bemerkbar machen.
Schließlich wurde er rot und flüsterte:
»Entschuldigung, Kommissar. Aber … die Fingerabdrücke …«
Er dachte wohl, sein Chef gehöre zur alten Schule und verstehe nichts von wissenschaftlichen Untersuchungsmethoden, denn Maigret nahm einen Zug aus seiner Pfeife und sagte wie nebenbei:
»Von mir aus …«
Inspektor Leroy ließ sich nicht mehr blicken, er trug Flasche und Gläser vorsichtig in sein Zimmer und bastelte den ganzen Abend lang an einer mustergültigen Verpackung, für die er den Bauplan bei sich trug, entwickelt zum Versand von Gegenständen ohne Beschädigung der Fingerabdrücke.
Maigret saß nun in einer Ecke des Cafés. Der Patron, in weißer Jacke und mit Kochmütze, schaute sich um in seinem Haus, als hätte es ein Wirbelsturm verwüstet.
Der Apotheker hatte geredet. Draußen hörte man Leute flüstern. Jean Servières setzte sich als Erster den Hut auf den Kopf.
»Es gibt noch was anderes als das hier! Ich bin verheiratet, und Madame Servières erwartet mich! Bis später, Kommissar.«
Le Pommeret unterbrach sein Auf-und-ab-Gehen.
»Warte auf mich! Ich gehe auch essen. Du bleibst noch da, Michoux?«
Der Doktor antwortete nur mit einem Achselzucken. Der Apotheker legte Wert darauf, dass er eine Hauptrolle spielte. Maigret hörte, wie er zum Patron sagte:
»… und es ist strikt notwendig, dass man den Inhalt sämtlicher Flaschen analysiert! Die Polizei ist schließlich da, und ich brauche nur den Auftrag …«
Im Schrank standen mehr als sechzig Flaschen mit unterschiedlichem Aperitif und Schnaps.
»Was meinen Sie, Kommissar?«
»Warum nicht. Sicher ist sicher.«
Der Apotheker war klein, mager und nervös. Er regte sich dreimal mehr auf als nötig. Er verlangte nach einem Flaschenkorb. Dann telefonierte er mit einem Café in der Altstadt und ließ seinem Gehilfen ausrichten, dass er ihn brauchte.
Ohne Hut machte er fünf- oder sechsmal den Weg zwischen dem Hôtel de l’Amiral und seinem Labor, fand trotz aller Geschäftigkeit noch Zeit für ein paar Worte mit den Neugierigen auf der Straße.
»Und was mache ich, wenn man mir alle Flaschen wegschleppt?«, stöhnte der Patron. »Und kein Mensch denkt mehr ans Essen! Wollen Sie nicht zu Abend essen, Kommissar? Und Sie, Doktor? Gehen Sie nach Hause?«
»Nein. Meine Mutter ist in Paris. Das Dienstmädchen hat frei.«
»Dann schlafen Sie hier?«
Es regnete. Die Straßen waren voll von schwarzem Dreck. Der Wind rüttelte an den Jalousien im ersten Stock. Maigret hatte im Speisesaal gegessen, nicht weit vom Tisch, wo der Doktor brütete.