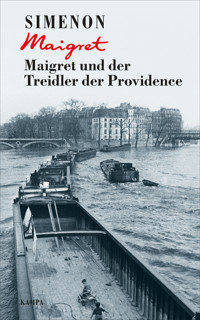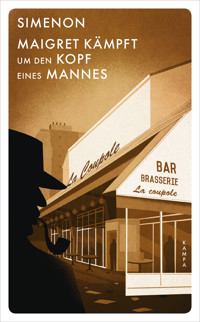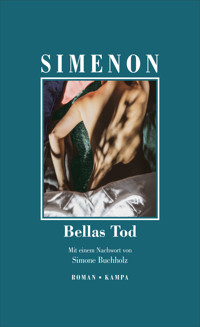Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Georges Simenon
- Sprache: Deutsch
Warum nur kehrt Monsieur Mahé jeden Sommer mit seiner Familie auf die Mittelmeerinsel Porquerolles zurück? Die Sonne brennt erbarmungslos herab, die Kinder vertragen das Essen nicht, nachts stört das unablässige Zirpen und Singen der Zikaden den Schlaf, und nie beißt beim passionierten Angler Mahé auch nur ein Fisch an. Aber die träge, sinnliche Atmosphäre hat es dem Arzt angetan. Im flirrenden Licht verschwimmen allmählich die Konturen des gutbürgerlichen Lebens, ändert sich der Blick auf die Dinge. Und dann ist da noch das Aufblitzen eines Bildes: ein junges Mädchen in einem roten Kleid.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Band 55
Georges Simenon
Die Ferien des Monsieur Mahé
Roman
Aus dem Französischen von Günter SeibMit einem Nachwort von Graeme Macrae Burnet
Kampa
Für Tigy, in Erinnerung an Saint-Mesmin
1Der Doktor und die Rotbrassen
Mit gerunzelter Stirn, die Zungenspitze an der Oberlippe wie ein Erstklässler, saß er mit mürrischem Gesicht da und beobachtete Gène verstohlen. Er versuchte, alles genauso zu machen wie er.
Vergeblich. Irgendetwas klappte nicht, denn das Ergebnis war nicht dasselbe. Er war ehrlich genug, sich das einzugestehen, und hartnäckig genug, um seine Ungeduld zu zügeln. Er ließ seine Hand genau wie Gène über den Bootsrand hängen, kein Stück weiter, ganz unverkrampft; er hatte sofort begriffen, dass er sich nicht verkrampfen durfte. Nur mit dem Zeigefinger hob er leicht die Hanfschnur der Angel.
An der Schnur lag es auch nicht. Gène hatte genau die gleiche. Eben hatte Gène, der, auch ohne ihm ins Gesicht zu sehen, stets erriet, was in ihm vorging, vorgeschlagen:
»Tauschen wir doch die Plätze … Nehmen Sie meine Angel … Vielleicht haben Sie dann mehr Glück …«
Das Meer, ohne Wellengekräusel ein Quecksilberspiegel, atmete langsam, aber machtvoll. Diese fast unmerkliche Dünung machte dem Doktor mehr zu schaffen als hohe Wellen. Bei jeder Regung des Meeres spürte er, wie das Blei an seiner Angel ein Stückchen hochgedrückt wurde. Dann beugte er sich über den Bootsrand und sah vielleicht zehn Meter unter sich eine Unterwasserlandschaft, die ihn immer wieder aufs Neue irritierte. Felsen mit tiefblauen Grotten, eine algenbewachsene Ebene, vor allem aber Fische, ziemlich groß, silbrig oder rötlich, die stumm und geruhsam hin und her schwammen und manchmal kurz vor seinem Köder innehielten. Unwillkürlich zitterte ihm dann die Hand, traten ihm kleine Schweißperlen auf die Oberlippe, war er drauf und dran, die Leine hochzuziehen. Warum kehrten die Fische immer um?
Er richtete sich wieder auf und seufzte. Er konnte nicht lange hinabblicken, ihm wurde davon übel. Seine Augen brannten, und außerdem bekam er Kopfschmerzen. Es wurde ihm auch langsam unheimlich. Jedes Mal, wenn er zum Rocher des Mèdes hinaufsah, hatte er das Gefühl, das kleine Boot sei näher an den Felsen herangetrieben worden. Sie hatten nicht einmal einen Anker. Gène hatte lediglich einen großen Stein an einem Seil auf den Grund plumpsen lassen. Achtete er überhaupt auf den Felsen? Man konnte deutlich sehen, wie das Meer an den Felsen klatschte und beim Zurückfließen einen schmutzigen Schaumrand mit ein paar wenigen Muscheln hinterließ. Auch ohne Brandungsrauschen bedeckte sich das Wasser mit weißem Schaum, und einige große Blasen zerplatzten vorne am Bug.
Gène, der auf der Ruderbank saß, eine alte Schirmmütze auf dem Kopf, verharrte unbeweglich wie eine Statue und ließ den Blick scheinbar gleichgültig bis zum flimmernden Horizont schweifen.
Der Doktor sah dort nur ein Gleißen, das ihm auf der Netzhaut brannte, aber Gène nahm alles wahr und verkündete beiläufig:
»Dort kommt die Cormoran von La Tour Fondue zurück … Joseph legt seine Netze am Leuchtturm aus …«
Gleichzeitig holte er langsam seine Angelschnur ein, eigentlich nur um sich zu vergewissern, dass der Köder noch da war, aber er hatte jedes Mal einen Fisch an der Angel.
»Eine Rotbrasse …«
Er ließ sie in den Korb mit frischem Seetang gleiten, zerdrückte einen Einsiedlerkrebs und befestigte ihn an einer Schnur am Angelhaken.
Aufgeregt holte auch der Doktor seine Angelschnur ein. Die Schnur zuckte, als wäre sie lebendig. Jedes Mal glaubte er einen großen Fang gemacht zu haben und dass ein Wunder geschehen war, das sogar dem Berufsfischer den Atem verschlagen würde. Und jedes Mal war es so ein schreckliches Vieh mit Stacheln, noch nicht einmal ein Drachenkopf, sondern bloß, wie Gène dazu sagte, ein Teufelsfisch, der vorsichtig mit einem Lappen um die Hand vom Haken gelöst und wieder ins Meer geworfen werden musste.
Warum fing er nur Teufelsfische oder höchstens mickrige Barsche? Sie angelten doch beide an derselben Stelle, keinen Meter voneinander entfernt. Unten auf dem Grund sah man ganz deutlich als kleine rosa Flecken die Einsiedlerkrebse herumspazieren, und schon zweimal hatten sich die beiden Angeln ineinander verhakt. Auch die Fische konnte man sehen. Der Doktor war sicher, alles genauso zu machen wie Gène. Schließlich war er kein Anfänger. In Saint-Hilaire beherrschte er als Einziger den Forellenfang mit der Fliege in der Sèvre, was viel schwieriger war als das Angeln im Meer.
Er mochte diesen großen grauen Felsen nicht, der so nahe an ihrem Boot aus dem Meer ragte und ihm aus unerfindlichen Gründen Angst machte. Und er mochte auch das Meer nicht, das spiegelglatte, traumhaft blaue Meer, dabei hatte er sich so gefreut, mit einem kleinen weißen Boot mit blauer Scheuerleiste darauf herumzufahren.
Seine Frau hatte nicht gewagt, ihn zu hänseln, als er mit einer Art strohgeflochtenem Tropenhelm, wie er ihn bei den Einheimischen gesehen hatte, aus dem Supermarkt zurückgekommen war. Sie hatte bloß auf ihre etwas bäurische Art gefragt:
»Hast du dir einen Hut gekauft?«
Wenn er den Kopf hob, konnte er sie sehen, etwa dreihundert Meter weiter; mit dem Wasser dazwischen war die Entfernung schwer abzuschätzen. Hinten um die Bucht zog sich einer der Strände der Inseln, der Strand von Notre-Dame, mit Pinien als Schattenspendern. Der unbewegliche weiße Fleck dort auf dem Sand war seine Frau, die in ihre Näharbeit oder ihr Strickzeug vertieft war. Der schwarze Fleck daneben war Mariette, das Dienstmädchen, das sie aus Saint-Hilaire mitgebracht hatten. Der winzige Knirps dort, der immerzu den Kopf entweder im Sand oder neben einer der beiden Frauen hatte, war sein Sohn Michel und das kleine Mädchen, das sie jedes Mal zurückriefen, wenn es sich bis zu den Knien ins Wasser wagte, seine Tochter.
Er sah sie alle genau, und auch sie mussten ihn dasitzen sehen, am einen Ende von Gènes Boot. Es war heiß. Seine Haut brannte, wo sie der prallen Sonne ausgesetzt war, und würde am nächsten Tag krebsrot sein, wie er bereits aus Erfahrung wusste. Er war mit hochgekrempelten Hemdsärmeln spazieren gegangen. Jetzt sah sein Unterarm aus wie rohes Fleisch, und die Haut oberhalb des Ellbogens wirkte weißlich und ungesund.
Ihm war schwindlig. Er bereute, Gène für einen Angelnachmittag angeheuert zu haben. Am liebsten wäre er zurückgefahren, traute sich aber nicht, diesen Vorschlag zu machen.
Es war vor allem das Hinuntersehen auf den Meeresgrund … Die Landschaft da unten war so deutlich und zugleich so fremdartig und menschenfeindlich, dass er meinte, auf einen fremden Planeten zu blicken … Eigenartig auch der Geruch des Wassers, seiner Hände, mit denen er Fische und Einsiedlerkrebse angefasst hatte, und der Duft des sonnendurchglühten Maquis, den ein Windhauch herübertrug …
Er klammerte sich an die kindliche Hoffnung, einen großen Fang zu machen und Gène damit zu verblüffen. Er legte seine Stirn noch mehr in Falten und beugte sich über den Wasserspiegel, bis ihm noch schwindliger wurde.
Erst vier Tage zuvor waren sie auf Porquerolles angekommen, und er war jetzt schon müde. Es war echte Müdigkeit. Er war von der Sonne wie erschlagen. Alles war anstrengend, und er hatte Mühe, sich einzugewöhnen. Dabei war es schön auf der Insel, genau wie ihm sein Freund Gardanne, der Maler von Sèvre Nantaise, versichert hatte. Lag es vielleicht daran, dass er nicht hierherpasste?
»Anschlagen!«, kommandierte Gène.
Hastig zog er an seiner Schnur. Irgendetwas zappelte daran, aber er hatte keine zwei Meter Schnur eingeholt, als der Fisch wieder freikam.
Seine Kopfschmerzen überlagerten alles. Er rauchte, und das war nicht gut, weil es Durst machte und der Wein von der Insel, den sie mit im Boot hatten, lauwarm geworden war und ihm davon schlecht wurde.
Von Zeit zu Zeit näherte sich Motorengeräusch. Dann kam ein Boot wie das ihre vorbei, nur ein bisschen größer oder kleiner. Fast immer war es mit einem oder mehreren Feriengästen besetzt. Am Ruder saß unbeweglich ein Einheimischer, der im Vorbeifahren grüßend den Arm hob, worauf Gène zurückgrüßte.
»Das war Ferdinand!«, sagte er dann beiläufig, als wäre das bereits Erklärung genug und Ferdinand weltberühmt.
Eines dieser tuckernden Boote fuhr direkt auf sie zu. Es kam aus dem Hafen, nicht vom Meer. Als es noch ein paar Meter entfernt war, wurde der Motor gestoppt, das Boot trieb heran und stieß sacht gegen ihres.
»Sind Sie der Doktor? Würde es Ihnen etwas ausmachen mitzukommen? Da liegt nämlich eine Frau im Sterben.«
Für Gène fügte der Ankömmling lakonisch hinzu:
»Die Frau von Frans …«
Dann erläuterte er:
»Wir haben auf der Insel einen Arzt, aber er ist gerade auf einer Hochzeit in Fréjus und kommt erst nächste Woche zurück.«
»Steigen Sie zu ihm hinüber«, riet Gène. »Sein Boot ist schneller als meins.«
Der Doktor war schwer. Seine neunzig Kilo ließen Gènes Boot gefährlich schaukeln, und in das Boot daneben fiel er fast, hart plumpste er auf eine Ruderbank.
»Fährst du zurück, Gène?«
»Nur noch die Angelschnüre aufrollen.«
»Rotbrassen?«
»Etliche …«
Der Motor spuckte, tuckerte los, das Boot beschrieb einen Halbkreis, und jetzt hatte der Doktor den Strand von Notre-Dame mit seiner Frau und seinen Kindern zur Linken. Im Vorbeifahren winkte er ihnen zu. Erst hatte er sie in Gènes Boot hinbringen und nachher wieder abholen wollen, aber Hélène wollte nichts davon wissen. Schon als sie mit dem Auto am Ende der Halbinsel Giens angekommen waren und sie das Meer und die zur Überfahrt auf die Insel bereitliegende Cormoran erblickt hatte, war sie ganz blass geworden. Sie hatte sich überwinden müssen, an Bord zu gehen, und sie bekam schon jetzt Albträume, wenn sie an das Urlaubsende und die Rückfahrt mit dem Boot dachte.
Sie umrundeten ein paar Felsen, auf dem ein altes, von der Sonne ausgedörrtes und nur von Eidechsen bevölkertes Fort stand. Dort waren sie am Vorabend spazieren gegangen. Der Boden war mit einem merkwürdigen Bewuchs von Sukkulenten mit roten Beeren bedeckt gewesen, die unter den Sohlen zerplatzten. Das verlassene Fort hatte keine Fenster und Türen mehr. Die Mauern schienen wie aus weißem Staub, von der Sonne im Laufe der Jahrhunderte zusammengebacken.
Auch dort hatte sich der Doktor unbehaglich gefühlt. Er hatte ans Mittelalter denken müssen und an die Kreuzzüge. Er schrak jedes Mal zusammen, wenn eine unbeweglich dasitzende Eidechse oder eine Schlange plötzlich forthuschte, obwohl man ihm hoch und heilig versichert hatte, auf der Insel gebe es keine Vipern.
»Was hat sie?«
»Sie hat’s auf der Lunge … Schon seit Jahren ist sie so schlapp, aber jetzt geht’s wohl mit ihr zu Ende …«
Hie und da, am Strand oder auf einem der Saumpfade der Insel, standen oder gingen Gruppen von Leuten, Leute von seinem Schlag, Sommerfrischler auf Entdeckungstour um die Insel, weiß gekleidet, mit Strohhüten auf dem Kopf. Die Mole. Der Hafen mit einem Dutzend Jachten vor Anker, ein Mann, der unter einem Ladebaum ein Boot knallblau strich.
»Es ist nicht weit, gleich hinter der Kirche … Ich bring Sie hin … Machst du mein Boot fest, Polyte?«
Man ließ es einfach im Hafenbecken treiben. Die Luft war drückend und stickig. Der Boden, die Bäume, die Mauern sandten regelrechte Hitzewellen aus. Anstatt den kahlen gelben Platz zu überqueren, wo einige Gruppen Boule spielten, wandten sie sich nach rechts, erklommen einen Steilpfad, kamen an einem Trümmerhügel vorbei. Der Doktor lief hinterher und spürte dabei im Kopf immer noch die Meeresdünung, er lebte noch mit dem ganzen Körper derart in diesem ungewohnten, zu langsamen und übermächtigen Rhythmus, dass er kurz den Drang verspürte, sich den Puls zu fühlen und sich zu vergewissern, dass er noch normal ging.
»Hier lang …«
Sie überquerten ein Sträßchen. Noch ganz nah beim Dorf, etwas weiter oben, etwa in Höhe der Dächer, gelangten sie unter Bäumen und am Rand einer Brachfläche zu einer Reihe alter Gebäude, ehemaligen Kasematten oder vielleicht auch alten Depots des Pionierkorps. Zwei Frauen standen in der prallen Sonne davor und blickten ihnen entgegen. In ihrer Nähe spielten auf der Erde zwei schmutzige Kinder mit blanken Hintern.
Dann erhaschte er durch eine Türöffnung einen Blick in eine dunkelblaue Dämmerwelt, fast vom selben Blau wie der Meeresgrund.
Die beiden Frauen sahen ihnen wortlos nach. Beinahe hätte er sich in den langen, stachelbewehrten Blättern von Berberfeigen und Kakteen verfangen, die dort wuchsen, Gott weiß, warum.
»Kommen Sie herein, Doktor …«
Zuerst sah er gar nichts. Dann trat eine Frau aus dem Dunkel auf sie zu, als Silhouette erkennbar. Sie sagte:
»Ich glaube, sie ist gerade gestorben …«
Der Blick des Doktors blieb an einem roten Fleck hängen: ein Mädchen in einem Kleid von grellem Rot wie eine Fahne, mit mageren nackten Beinen, das in einer Ecke an der Wand kauerte und die Eintretenden fixierte.
Endlich sah oder besser erahnte er am Boden auf einem Strohsack die Frau, zu der man ihn gerufen hatte, ein regloses Bündel unter einer Decke, das Gesicht schrecklich ausgemergelt, die Augen aufgerissen und starr.
Sie musste gerade eben gestorben sein. Ihr Körper war noch warm.
Der Doktor roch den Duft von Fleischbrühe und sah eine Schüssel, gewiss von einer der Frauen gebracht und noch unberührt.
»Sie ist tot, nicht wahr?«
Die Augen des Mädchens in Rot fixierten ihn immer noch durch das Dämmerlicht, und er zögerte mit seiner Antwort. Die Frau berichtete weiter:
»Vor mehr als einer Stunde hat sie an allen Gliedern gezittert, so arg, dass ich sie festhalten musste … Sie hat geschwitzt … Meine Hände riechen immer noch nach ihrem Schweiß …«
Die Kleine rührte sich nicht. Sie hockte dermaßen zusammengekauert da, dass man nicht erkennen konnte, wie alt sie war.
»Sie wollte noch etwas sagen … Sie hat es versucht, aber es ging nicht mehr … Dann sind ihr zwei große Tränen aus den Augen gekullert, und da hab ich gemerkt, dass es das Ende ist … Sie hat mit Armen und Beinen gezuckt wie ein Karnickel nach dem Genickschlag … Da sind Sie gerade im Boot von Bastou in den Hafen eingelaufen … Aber Sie hätten ja wahrscheinlich auch nichts mehr machen können, wenn Sie da gewesen wären, nicht wahr?«
Nein, nichts! Er blickte sich um. Der Mann, der ihn hergebracht hatte, redete draußen mit den beiden Frauen. Man sah sie im blendenden Rechteck der Tür wie eingerahmt. Noch jemand kam langsam den steilen Saumpfad zwischen den Berberfeigen und Kakteen herauf. Auf dem Kopf hatte er einen Gärtnerhut mit breiter Krempe, und das Blau seiner Kittelschürze war noch satter als das Blau des Himmels.
»Sehen Sie, da kommt der Bürgermeister! Ich hab ihn ebenfalls holen lassen …«
Ein richtiges Zimmer war das nicht, in dem sie da standen. So etwas hatte der Doktor noch nie gesehen. Vier Wände, ehemals weiß gekalkt. Ein Fenster schien es nicht zu geben, nur die offene Tür. Neben dem Strohsack der Toten lagen noch andere, mit alten Lumpen und alten Kleidern als Zudecke.
Vielleicht roch es wirklich noch nach Todesschweiß, aber vermischt mit anderen, sauren und muffigen Gerüchen: Kinderpipi und dicke Milch, Knoblauch, Fisch, überlagert von dem unverkennbaren Duft von Pinien und Erdbeerbäumen, der gewissermaßen inseltypisch war.
»Sie ist eben gestorben … Der Doktor ist auch da …«
Der Bürgermeister wurde so von den beiden Frauen ins Bild gesetzt; jetzt füllte seine Gestalt den ganzen Türrahmen aus. Er versuchte seine Augen an das Dämmerlicht zu gewöhnen, trat dann mit entschlossenem Schritt ein und nahm schließlich geistesabwesend den Strohhut ab. Doch wie um von dieser feierlichen Geste abzulenken, kratzte er sich kurz den Kopf mit den schwarzen Stoppelhaaren.
»Ist Frans nicht auf der Insel?«, fragte er.
Der Bürgermeister führte den Lebensmittelladen im Ort, der Doktor erkannte ihn wieder, denn noch am Morgen hatte er bei ihm für seine Tochter Bonbons gekauft.
»Ist sie wirklich tot?«
Statt einer Antwort drückte der Doktor der Toten die Augen zu, mit einem verlegenen Blick zu dem roten Fleck hin, der sich nicht bewegte.
»Nichts als Scherereien«, seufzte der Ladenbesitzer und Bürgermeister und kratzte sich wieder am Kopf.
Und dann, zu den Frauen gewandt:
»Wie lange ist er schon fort?«
»Seit vorgestern …«
»Also kommt er womöglich erst in drei oder vier Tagen wieder … Komm mal her, Kleine … Seit wann ist dein Vater fort?«
Sie wiederholte:
»Seit vorgestern …«
Aber sie kam nicht näher und blieb an die Wand gekauert hocken.
»Weißt du vielleicht, wie viel Geld er dabeihat?«
»Nein …«
»Hat er deiner Mutter was dagelassen?«
»Ich weiß nicht …«
»Wo ist ihr Portemonnaie?«
Er blickte sich suchend um. Das Mädchen zeigte ihm schließlich in Kopfhöhe ein Loch in der Wand, wo sich tatsächlich ein altes, ganz abgeschabtes Portemonnaie fand. Dem Lebensmittelhändler war es vertraut, denn aus diesem Portemonnaie hatte die Frau immer das Geld genommen, wenn sie bei ihm einkaufte.
»Da sind gerade noch sechs Franc drin«, stellte er fest.
Fliegen brummten schon hinten im Raum, wo die Leiche lag.
Der Doktor hatte längst den Überblick verloren. Er machte erst gar nicht mehr den Versuch, zu reagieren oder etwas zu verstehen. Trotzdem prägte sich ihm jedes Wort so tief ins Gedächtnis, dass er sich später ganz genau daran erinnern sollte, wie an ein Kinderlied. Ebenso die Bilder, vor allem das rote Kleid, das rote Baumwollkleid, unter dem die magere Kleine nichts anhatte. Ihre Haare waren hellblond, ihre Augen blau. Auch die Tote war hellblond.
»Wir müssen Polyte bitten, Frans zu suchen … Der findet ihn noch am ehesten … Gott, wie das hier drin stinkt! … Kommen Sie mit raus, Doktor?«
Und die Frau, die den Todeskampf miterlebt hatte, wies auf die Tote und fragte:
»Was soll ich machen?«
Draußen ragten die hellroten Dächer des Dorfes aus dem Grün auf, die gelbe Kirche, auf dem Platz davor konnte man Männer Boule spielen sehen, dahinter den Hafen mit seinen Jachten und Schaulustigen, dann die Reede, die blauen Berge des Festlands; davor, auf dem glatten, sonnenbeschienenen Meer, rauschte in voller Fahrt ein Kriegsschiff vorbei, ein schnittiges Torpedoboot.
»Kommen Sie mit mir ins Gemeindeamt, für den Totenschein?«, fragte der Bürgermeister. Er kratzte sich in der Achselhöhle. »Bestimmt haben wir uns was eingefangen. Da drin wimmelt es von Ungeziefer … Was für ein Glück, dass Sie greifbar waren … Sonst hätte ich für die Formalitäten einen Arzt aus Hyères kommen lassen müssen …«
Der Doktor tappte hinter dem Bürgermeister her, drehte sich immer wieder um, und das Bild brannte sich ihm ein, das niedrige Gebäude mit dem einen bewohnten Raum, die Feigenkakteen und die graugrünen Stachelpflanzen, die hohen Pinien mit ihren schiefen Stämmen, auch die beiden Frauen davor, die näher ans Haus getreten waren und die beiden halbnackten Kinder allein herumkrabbeln ließen.
»Die Einzigen von der Sorte hier bei uns auf der Insel«, erläuterte der Bürgermeister, als er den Steilpfad hinabstieg. »Sie sind noch unter meinem Vorgänger gekommen, vor sechs Jahren, sonst hätte ich nämlich dafür gesorgt, dass sie hier nicht sesshaft werden … Um Erlaubnis haben sie niemanden gefragt … Eines schönen Tages sind sie von der Cormoran an Land gekommen, mit einem alten Militärkoffer als einzigem Gepäck … Da hatten sie erst zwei Kinder, aber die Frau war hochschwanger … Sie haben niemanden um was gebeten … Ich weiß nicht mal, wo sie die erste Nacht geschlafen haben, bestimmt am Strand, und dabei hatten wir damals, wenn ich mich nicht irre, Februar oder März, mit einem eiskalten Mistral …«
Sie gingen über den hitzeflimmernden Platz, der von Eukalyptusbäumen umstanden war, als Schattenspender für die knallbunten blauen, roten, grünen Häuserfronten und die um diese Zeit menschenleeren Café-Terrassen.
»Sie hatten von niemandem eine Genehmigung, sich in dem Bau einzunisten, der dem Pionierkorps gehört. Wir haben nicht mal gleich gemerkt, dass sie da drin wohnten … Meine Frau hat den Mann eines Tages in den Laden kommen sehen … Er hat bei ihr eine Kerze, Zucker und Margarine gekauft und sogar bezahlt … Drei Tage später wollte er dann aufs Gemeindeamt, aber das war zu, wie immer … Da ist er zum Bürgermeister nach Hause gegangen … Er musste warten, bis dieser vom Angeln zurück war, denn der frühere Bürgermeister hatte außer Angeln nichts im Sinn … Der Mann hat Papiere aus der Tasche gezogen und erklärt, er wolle eine Geburt registrieren lassen …
Die Frau hatte ganz allein dort entbunden, wo Sie sie eben haben liegen sehen … Nach seinen Papieren heißt er Frans Klamm … Das muss nicht unbedingt sein richtiger Name sein … Er war fünfzehn Jahre bei der Fremdenlegion … Sie kriegen ihn schon noch zu sehen, wenn Polyte ihn ausfindig macht … Warten Sie mal, Polyte ist um diese Zeit bestimmt am Hafen … Kleine, hast du deinen Vater irgendwo gesehen?«
»Er ist gerade zu Maurice hineingegangen …«
»Polyte! … He! Polyte …«
Ein Mann in blauer Leinenhose und schmuddligem Hemd, eine Schiffermütze auf dem Kopf.
»Sag mal, Polyte … Kannst du nicht hinüberfahren und Frans herschaffen? … Seine Frau ist gestorben …«
»Seit wann ist er weg?«
»Seit vorgestern …«
»Wer zahlt?«
»Ich weiß noch nicht … Wahrscheinlich die Gemeinde … Ich kümmere mich drum … Du weißt, wo du ihn findest?«
»So ungefähr …«
Im Dämmerlicht des Cafés, aus dem matt die Zinkplatte der Theke schimmerte, spitzten Männer die Ohren.
»Ich kann doch Gène mitnehmen, oder?«
»Der ist beim Angeln …«
»Nein, er kommt zurück … In fünf Minuten kommt sein Boot um die Mole …«
»Wie du meinst … Kommen Sie, Doktor? Warten Sie, ich hole den Schlüssel zum Gemeindeamt …«
Und der Bürgermeister trat in seinen Laden, wo es nach Zucker roch, und nahm einen großen Schlüssel aus der Kasse. Das Gemeindehaus lag fast daneben, nur zehn Meter weiter, ein einstöckiger weißer Bau mit nur einem Raum und einem Gärtchen davor.
»Gehen Sie vor … Anfangs hofften wir, die Pioniere würden sie fortjagen … Aber denen war das völlig egal … Nehmen Sie Platz … Ich suche noch die Formulare heraus … Gleich …«
Er stieß das Fenster auf, um Licht hereinzulassen, und kramte in Aktenschränken voller Papiere. Der Raum war eng. An den Wänden hingen Papiergirlanden und hinter der weißen Gipsbüste der Marianne, dem Sinnbild der Französischen Republik, die Trikolore.
»Wären sie mittellos gewesen, hätte man was machen können … Aber sie waren schlau und haben niemanden um etwas gebeten … Sie verstehen? … Nicht einmal um die kostenlose Geburtsnachsorge … Und die Frau hätte es weiß Gott nötig gehabt! …«
»Arbeitet der Mann?«, fragte der Doktor, vom Klang seiner eigenen Stimme überrascht.
»Wenn er Lust dazu hat … Sie sehen ihn bestimmt noch … Er ist nicht ungeschickt … Er hilft den Fischern beim Netzeflicken oder macht sogar Aushilfe beim Fischen … Er werkelt und hilft ab und zu, ein Boot aus dem Wasser zu ziehen und den Rumpf abzukratzen … Ein bisschen hier, ein bisschen da … Sie leben sozusagen von der Hand in den Mund … Dann, ganz plötzlich, wenn er ein paar Sous übrig hat und den Rappel kriegt, haut er ab … Hier auf der Insel besäuft er sich nie … Er kauft sich eine Fahrkarte für die Cormoran … Dann weiß jeder, was die Glocke geschlagen hat … Manchmal kann er einem in Toulon über den Weg laufen … Da fährt er immer schnurstracks hin … Und dann beginnt die Sauftour, verstehen Sie? … Sie dauert ein paar Tage, vier oder fünf, selten länger … Polyte kennt ein paar von den Bars, wo er wahrscheinlich zu finden ist … Dann will er niemanden mehr kennen … Er ist nie in Begleitung … Selber komme ich nie in solche Spelunken, aber ich hab’s mir erzählen lassen … Ich weiß doch genau, dass ich die Papiere hier irgendwohin geräumt habe … Da sind sie! … Haben Sie einen Stift? … Nein? … Ich weiß nicht, ob dieser Füller schreibt …«
»Wie war doch gleich der Name?«, fragte der Doktor nach, den Füller in der Hand.
Er musste sich Stirn und Wangen abwischen, weil ihm der Schweiß übers Gesicht lief.
»Frans Klamm … Wie sie heißt, muss ich im Register nachsehen … Auch so ein ausländischer Name … Aber sie ist Französin … Immerhin sind sie verheiratet … Ich hab