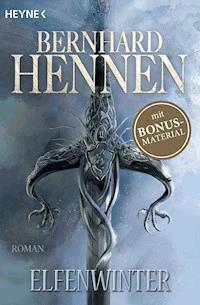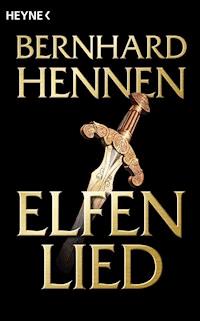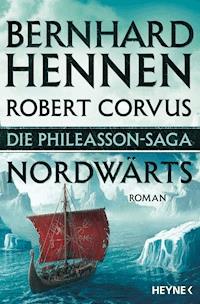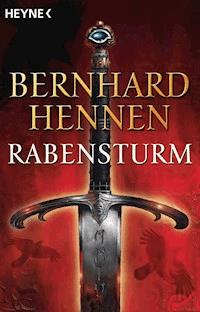13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Phileasson-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Es ist die größte Wettfahrt aller Zeiten: Die beiden legendären Kapitäne Asleif Phileasson und Beorn der Blender sind aufgebrochen, um den ganzen Kontinent Aventurien zu umrunden. Dabei müssen sie sich heroischen Prüfungen stellen, und der Sieger allein wird sich mit dem Ehrentitel »König der Meere« schmücken dürfen. Ihr siebtes Abenteuer führt sie in die endlose Wüste. Dort inmitten turmhoher Sanddünen und unter der glühend heißen Sonne müssen sich die beiden Seebären ihrer nächsten Prüfung stellen – und ein Geheimnis ergründen, dass unter dem Staub von Jahrtausenden begraben liegt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 919
Ähnliche
DAS BUCH
»Findet den, der sprechet wahr, im Basar der Stadt Fasar. Erfüllt des Träumers Visionen, er wird euch sicher führen, lebendigen Stein zu berühren, tief im Sand der Äonen.«
Sie ist die älteste Stadt der Menschen in ganz Aventurien: Fasar mit ihren Basaren, Karawansereien und den mächtigen Türmen, zwischen denen sich Brücken spannen, damit die Füße der Erhabenen niemals den Staub der Straßen berühren müssen. Und doch waren es nicht die Menschen, die Fasar erbauten. Einst herrschten hier die Echsen, deren unaussprechliche Gräuel sie am Ende in die Finsternis stürzten. Ihr Untergang sollte den Menschen Mahnung sein, nicht mit Mächten zu spielen, die sie nicht verstehen, doch in den lauten und bunten Gassen der Stadt geizen die Propheten nicht mit düsteren Warnungen. Unter ihnen sollen Asleif Phileasson und Beorn der Blender nun den Einen finden, dessen Vision sie ihrem großen Ziel, König der Meere zu werden, näherbringt. Schon bald müssen sie erkennen, dass zu diesen Meeren auch der gewaltige Ozean aus Sand gehört, der in jede Richtung bis zum Horizont reicht: die gnadenlose Wüste Khôm …
DIE AUTOREN
Bernhard Hennen, 1966 geboren, studierte Germanistik, Geschichte und Vorderasiatische Altertumskunde. Als Journalist bereiste er den Orient und Mittelamerika, bevor er sich ganz dem Schreiben fantastischer Romane widmete. Mit seiner Elfen-Saga stürmte er alle Bestsellerlisten und schrieb sich an die Spitze der deutschen Fantasy-Autoren. Hennen lebt mit seiner Familie in Krefeld.
www.bernhard-hennen.de
Robert Corvus, 1972 geboren, studierte Wirtschaftsinformatik und war in verschiedenen internationalen Konzernen als Strategieberater tätig, bevor er mehrere erfolgreiche Fantasy-Romane veröffentlichte. Er lebt und arbeitet in Köln.
www.robertcorvus.net
Mehr über die Phileasson-Saga erfahren Sie auf:
www.phileasson.de
BERNHARD
HENNEN
ROBERT CORVUS
ROSENTEMPEL
DIE PHILEASSON-SAGA
SIEBTER ROMAN
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
PROLOG
Ryl’Arc,
sechsterTag im Kornmond, vor 887 Jahren
Eine kühle Berührung an seiner Kehle ließ Galayne den-die-Göttin-liebt erwachen. Er hielt die Augen geschlossen. Witterte. Es war Lossyril Spinnenhaar, die noch immer neben ihm lag. Er roch auch den Stahl. Und den Duft ihrer Liebesnacht. Er hörte das leise Tuscheln vor der Tür. Wie viele erwarteten ihn dort wohl? Mindestens fünf. Da war der Geruch von Waffenfett und Leder. Gegen Klingen würde er siegen. Wenn sie Armbrüste mitgebracht hatten, wäre es etwas anderes …
»Habe ich dich verärgert, meine Liebe?« Sein Herzschlag blieb ruhig. Er war den Shakagra’e, den Nachtalben, überlegen. So lange Zeit hatte er sich von ihnen genährt, ihr Sikaryan getrunken. Auch bei Lossyril. Vor allem nach dem Liebesspiel, wenn sie erschöpft in seinen Armen lag und ihr Herz noch wild vor Leidenschaft schlug. Dann schmeckte die Essenz des Lebens besonders süß.
»Du hast mich betrogen!«, zischte die Nachtalbe. »Du lebst nur deshalb noch, weil du ein Liebling der Göttin bist.«
Galayne öffnete die Lider und betrachtete ihr blasses, ebenmäßiges Antlitz, die fein geschwungenen, fast farblosen Lippen. Ihre Augen, deren Farbe irgendwo zwischen Blau und Lila lag. Sie war hübsch.
Spielerisch tastete er nach ihrem langen, silbrigen Haar, so fein wie Spinnenseide. »Du begehrst mich noch immer«, sagte er lächelnd. »Ich kann es riechen.« Seine Sinne übertrafen die der Shakagra’e bei Weitem. Er war ihnen in allen Aspekten überlegen. Der Erste, der so vollkommen war.
»Du musst nicht sterben«, sagte Lossyril selbstsicher. »Aber du wirst dafür bestraft werden, was du uns angetan hast.«
Galayne ahnte, was kommen würde. Jeden überraschenden Tod würde man ihm anlasten. Jedes Neugeborene, das im Kindbett gestorben war. Jeden, der erkrankt war oder sich einfach nur schwach gefühlt hatte.
»Was bin ich denn?«, fragte er.
»Ein Feylamia! Du trinkst heimtückisch von unserer Lebenskraft, du Vampir!«
Wie viel konnten Lossyril und jene vor der Tür von ihm wissen? Er hatte die Bücher vernichtet, in denen von Feylamia und ihren Schwächen die Rede war, ja, er hatte sogar einige gefälschte Texte in die Bibliotheken gestellt, für den Fall, dass sie ihm einmal auf die Schliche kamen. So viele Jahrzehnte lebte er schon unter dem Himmelsturm. Seit die Göttin ihn erschaffen hatte, war Galayne ihr Liebling und ihr Geliebter. Das hatte seine Stellung gleichermaßen geschwächt und gestärkt. Geschwächt, weil es unter den Nachtalben viele gab, die auf den Günstling Pardonas eifersüchtig waren. Und gestärkt, weil er unberührbar gewesen war, denn keiner in den Tiefen Städten wollte den Zorn der Göttin auf sich lenken, selbst die mächtigsten Priester nicht. Aber Pardona – oder Bhardona, wie die Altvorderen sie noch immer nannten – war nun schon seit vielen Jahren verschwunden. Und die Eifersucht begann schwerer zu wiegen als die Furcht vor ihrem Zorn.
»Was hat mich verraten?«, wollte Galayne wissen.
»Du bist anders als wir, das haben wir gespürt …«
Das hielt Galayne für leeres Gerede. Er sah kaum anders aus als die Nachtalben. Helle Haut, silberweißes Haar … Allein die Augen. Bei ihm waren lediglich die Iriden gefärbt, bei den Nachtalben die kompletten Augäpfel, und sie besaßen auch keine Pupillen. Aber daran hatten sie sich gewöhnt, sie hielten es für eine Missbildung, über die sie hinter vorgehaltener Hand tuschelten. An seinen Augen konnte es nicht liegen.
»Es waren die Buntkarpfen, die dich letztlich verraten haben.« Sie wies auf das Fischglas in der Wand. Einige der farbenfrohen Karpfen trieben mit dem Bauch nach oben an der Wasseroberfläche. »Sie waren krank, aber nicht so schwach, dass sie die Nacht nicht überlebt hätten.«
Galayne hatte sich über die Jahrzehnte angewöhnt, ein wenig vom Sikaryan aller Lebewesen in etlichen Schritt Umkreis zu stehlen, um zu verschleiern, was er tat. Dass er dabei einige der Fische versehentlich getötet hatte, war ihm nicht aufgefallen. Ein dummer Fehler, der aus Überheblichkeit resultierte.
»Und wenn ich Widerstand leiste, schneidest du mir die Kehle durch, obwohl wir so viele berauschende Nächte miteinander verbracht haben?«
»Worauf du dich verlassen kannst, Feylamia!«, zischte Lossyril, griff nach seinem rechten Arm und versuchte, ihn ihm auf den Rücken zu drehen.
Er riss sich los.
Das Messer schnitt über seine blasse Haut. Die Wunde war nicht tief und schloss sich augenblicklich wieder. Nur ein paar Blutspritzer sprenkelten die blütenweißen Laken.
Er drehte sich um, entwand der überraschten Nachtalbe die Waffe und setzte die Spitze der langen, schmalen Klinge unmittelbar unter Lossyrils linke Brust. Er hatte die Form ihrer Brustwarzen immer besonders gemocht. Sie waren größer als gewöhnlich und annähernd rund. Seine Zeit in den Tiefen Städten kam nun wohl zum Ende, dachte er betrübt. »Du wirst jetzt deine Freunde vor der Tür hereinbitten, Lossyril.« Er wollte sie nicht töten. Er empfand keinen Hass gegen sie. Nur Traurigkeit, dass der Tag gekommen war, der wohl unausweichlich gewesen war.
»Kommt herein!«
Sie hielt sich gut, dachte Galayne. Da war kein Zittern in ihren Stimmen. Lossyril Spinnenhaar war die Hüterin des Tempels der Schatten. Ihr Herz konnte wie Eis sein. Vor allem aber war sie hart gegen sich selbst.
Galayne zog sie vor sich und legte ihr das eigene Messer an die Kehle. Sie würde sein lebender Schild sein. Seine Gedanken überschlugen sich. Bislang hatte er immer geglaubt, er würde Zeit haben, wenn der Tag kam, zu gehen. Dass er sich durch den Himmelsturm zurückziehen würde, um dann durch das ewige Eis gen Süden zu wandern. Nun kam es anders.
Die Tür zu dem Schlafgemach schwang auf. Fünf Shakagra’e in den langen, roten Waffenröcken der Tempelwachen traten ein. Sie alle hielten schussbereite Armbrüste. Ohne ihn auch nur einen Herzschlag lang aus den Augen zu lassen, verteilten sie sich rechts und links der Tür.
Galayne sah, wie sich das Kerzenlicht golden auf den Spitzen der Bolzen brach. Stahl, dachte er. Sie würden ihn nicht ernsthaft verletzen können.
»Schießt!«, befahl Lossyril.
Die Wachen gehorchten ihr nicht, tauschten zögerliche Blicke.
Galayne spürte, wie sich die Hohepriesterin anspannte. Er ließ das Messer fallen, genau in dem Augenblick, in dem sie ihre Kehle gegen die Klinge drücken wollte, um den Wachen die Entscheidung abzunehmen, ob sie verletzt würde.
Galayne stieß sie von sich. Er wirbelte um die eigene Achse, griff nach seinem Schwert, das auf dem großen Tisch mit den goldgeprägten Folianten lag.
Die Abzugsbügel der Armbrüste klackten.
Ein schwerer Schlag traf ihn in den Rücken zwischen die Schulterblätter. Er wurde nach vorne geschleudert. Mit vorgestreckten Händen fing er sich auf der Tischplatte ab. Ein Bolzen steifte seinen linken Arm. Auch wenn der Stahl keine tiefen Wunden zu schlagen vermochte, nahm das den Treffern nichts von ihrer Wucht.
Er griff nach einem der Folianten, drehte sich und nutzte das schwere Buch als Schild. Ein Bolzen hämmerte in das dunkelblaue Leder.
Dann traf ihn ein Geschoss mitten auf der Stirn, und Finsternis umfing Galayne.
Ryl’Arc,
achterTag im Kornmond, vor 887 Jahren
Galayne den-die-Göttin-liebt spürte ihre Angst und wie ihnen diese Angst zugleich peinlich war. Sie hatten ihn in schwere Eisenketten geschlagen und ihm einen eisernen Helm mit schmalen Sehschlitzen aufgesetzt. Das Metall lag kühl an seinen Wangen. Er gestattete sich ein Schmunzeln, da sie ihn ja nicht sehen konnten. Sie mussten in den alten Schriften gelesen haben, die die Nachtalben auf ihren Kriegszügen durch Myranor in Baan-Bashur erbeutet hatten. Galayne hatte diese Texte vor mehr als dreißig Jahren mit Hingabe gefälscht. Er hatte dort hineingeschrieben, dass Eisen den Feylamia unangenehm war, dass es ihre Fähigkeit, Sikaryan zu trinken, blockierte und ihr Blut schmerzlich erhitzte, auch wenn man ihnen äußerlich nichts ansah. Natürlich hatten die Nachtalben, denen die Berührung von Eisen Schmerzen bereitete, diese Lügen nur zu gern geglaubt.
Nur sieben Shakagra’e hatten sich versammelt. Er kannte sie alle. Sie repräsentierten alle drei großen Sippen: die vom ersten Blut, die vom letzten Blut und die Schöpfer der Generationen.
Lossyril Spinnenhaar saß dem Tribunal vor. Sie war schön wie immer. Er bereute nicht, ihr nicht die Kehle durchschnitten zu haben. Wenn er hier gefangen stand, dann hatte er das vor allem seiner eigenen Überheblichkeit zuzuschreiben. Er hätte längst die Tiefen Städte verlassen können, statt sich hier einzunisten wie ein Parasit.
Auch Kayil’yanka gehörte zu seinen Richtern. Ihre silbern schimmernden Augen hatten es ihm stets besonders angetan. Sie war noch sehr jung, und es verwunderte Galayne, sie hier im Tribunal zu sehen. Mit ihr war er durch die verlassenen Paläste des Himmelsturms gestreift. Ihr war die Welt am Meeresboden, wo die Shakagra’e unter mächtigen, gläsernen Kuppeln in den beiden Städten Ryl’Arc – dem unheimlichen Schwarzwasser – und Tieaha Mhagra – der Wasserstadt des Tobenden Traums – lebten, zu eng. Ihr war es nicht genug, die Geheimnisse der ölig schimmernden Basalttürme des verschwundenen Volks der Schwarzen Mahre zu ergründen, um welche die Städte der Shakagra’e erwachsen waren. Kayil’yanka war zu spät geboren, um an den Feldzügen ihres Volks nach Myranor teilzunehmen. Jener Epoche, in der die Göttin selbst sie von Schlacht zu Schlacht und von Sieg zu Sieg geführt hatte, bis sie sogar die unüberwindlichen Wälle von Baan-Bashur erstürmt hatten. Wie keine andere, der Galayne begegnet war, strebte Kayil’yanka zum Licht. Sie wollte immerzu hinauf in die Klirrfrostwüste und dann nach Süden, um die kleineren Königreiche der Menschenvölker Aventuriens zu erkunden. Dieses Licht, nach dem sie sich so sehr sehnte, war in ihren Augen gefangen. In den silbern glänzenden Partikeln, die Galayne stets an Kristallsplitter in Granit erinnert hatten. Stundenlang hatte er in diese Augen blicken können, die ihn nun so kalt musterten wie die Augen der übrigen Mitglieder des Tribunals.
Auch Feyangola Finsterblick, der Heerführer Pardonas mit seinen verschiedenfarbigen Augen – eines nachtblau, eines von veränderlichem Purpur – war gekommen. Er trug volle Rüstung, als erwarte er einen Kampf.
Feyangola zur Seite stand Kydhan spricht-mit-Götterstimme, der Galayne stets besonders um Pardonas Gunst beneidet hatte. Kydhan war von schönem Wuchs, sein langes Haar schillerte wie frisch poliertes Silber. Er war der einzige Mann, bei dem Galayne sich je hatte vorstellen können, mit ihm das Lager zu teilen. Freilich war es dazu nie gekommen. Doch das hatte einzig an Kydhan gelegen.
»Du hast uns über dein wahres Wesen getäuscht, Galayne den-die-Göttin-liebt«, sagte Lossyril Spinnenhaar, Hüterin des Tempels der Schatten, in feierlichem Ernst. »Du hast uns hintergangen, hast von unserem Sikaryan gestohlen und hast heimtückisch getötet. Hast du etwas dazu zu sagen?«
Galayne versuchte, einen Arm zu heben, doch die eisernen Fesseln verhinderten es. »Ihr alle wisst, dass unsere Göttin stets darauf bedacht ist, ihre Schöpfung zu verbessern. Seht euch an, ihr Shakagra’e haltet euch für den Gipfel der Vollkommenheit, doch das ist nicht länger wahr. Ich unterscheide mich von euch, so wie ihr euch von den missgestalteten Wächtern mit ihren Krabbenscheren und Tentakelarmen unterscheidet. Ich bin die vollkommenste Schöpfung Pardonas. Kein Stahl kann mich töten, und mich verbrennt kein Sonnenlicht. Ich muss mich nicht am Grund der Meere verbergen oder hinter Rüstungen aus legiertem Endurium.« Er konnte einfach nicht anders. Er musste sie provozieren. Er hatte keine Ahnung, was sie ihm antun würden, doch nun hatte er als letzten Triumph die Gelegenheit, einen Samen des Zweifels in ihre Herzen zu pflanzen, den sie niemals würden herausreißen können. »Ich bin der Erste ihres neuen Volks. Und euer Zweck wird es in Zukunft sein, diejenigen, die mir gleich sind, zu nähren, so wie ihr mich so viele Jahre genährt habt, ohne es zu bemerken. Eure Zeit der Größe ist vorüber. Künftig seid ihr das Vieh des Volks der Göttin, das da kommen wird.«
Sie waren so gut darin, sich zu beherrschen, die Shakagra’e. Keiner verzog eine Miene. Keiner ballte die Hände zu Fäusten. Man konnte meinen, seine Worte hätten sie nicht im Mindesten berührt. Aber Galayne roch, was ihre Beherrschung verbarg. Die feinen Veränderungen ihres Körpergeruchs, in denen sich Zorn, Angst und Zweifel offenbarten.
»Wir haben deine Worte gehört«, sagte Lossyril Spinnenhaar kühl. »Daran, dass du eine Schöpfung der Göttin bist und du ihr Wohlgefallen genießt, herrscht hier kein Zweifel. Wir sind jedoch überzeugt, dass die Göttin nicht weiß, welchen Schaden du uns gebracht hast, Galayne. Wir, die Shakagra’e, sind ihr Volk. Wir sind ihre Freude, weil wir uns vermehren. Ich weiß, wie vielen Frauen du beigelegen hast, Galayne. Ein Kind ist keiner dieser Begegnungen entsprungen. Dir fehlt, was die Göttin sich als Erstes von ihrem Volk wünscht: Fruchtbarkeit. Daran, dass sie dir keine Gefährtin erschaffen hat, erkenne ich, dass es auch niemals das Ziel der Göttin gewesen sein kann, dich zum Ersten eines neuen Volkes zu machen. So hast du mit den unfruchtbaren Wächtern mehr gemeinsam als mit uns.«
Sie wusste, wie sie ihn berühren konnte, erkannte Galayne. So wie sie ihn zum Gipfel der Lust geführt hatte, öffnete sie seinem Blick nun einen Abgrund der Finsternis. Was er ihr hatte antun wollen, hatte Lossyril nun gegen ihn gekehrt.
»Die Göttin selbst hat dich erschaffen, Galayne. Und als ihre erste Dienerin werde ich nicht zerstören, was ihr Wille geformt hat. Aber ich werde dafür sorgen, dass du keine Gefahr mehr für mein Volk bist, Galayne den-die-Göttin-liebt. Du sollst verbannt sein, an einen Ort, an dem du keinen Schaden mehr anrichten kannst. Und sollte es der Göttin gefallen, dann wird sie dich dort holen.« Sie lächelte. »Doch glaube mir, ich kenne meine Gebieterin. Sie ist launisch, sie ist sprunghaft und in so vieles verstrickt, dass ihr entfallen mag, was sie nicht mehr vor Augen hat, und wir, die Shakagra’e, werden sie nicht an dich erinnern. Wir werden dich vergessen, Galayne, der du dich von uns genährt hast. Und solltest du jemals in den Himmelsturm oder die Tiefen Städte zurückkehren, ohne unter dem Schutz der Göttin zu stehen, dann werden wir dich töten.«
Eiswüste,
elfterTag im Kornmond, vor 887 Jahren
Der eisige Nordwind schnitt Galayne den-die-Göttin-liebt wie mit Messern ins Gesicht. Raureif verkrustete die schweren Eisenketten, die noch immer eng um seinen Leib geschlungen lagen. Der große Eissegler Licht der Göttin war etwa hundert Schritt vor der Grenze, wo der feste Eisschild in Packeis aufsplitterte, vor Anker gegangen.
Neugierig sah sich Galayne um. Er konnte keine kleineren Eissegler entdecken. Die Felsnadel des Himmelsturms war lange außer Sicht. Irgendwo im Süden musste die Insel der Schneeschrate liegen, von der er gelesen hatte. Würden sie ihn hier im ewigen Eis ausstoßen? War das seine Verbannung? Die Kälte war ihm zwar unangenehm, aber sie konnte ihn nicht töten.
Galayne blickte nach Norden. Ein Unwetter zog herauf. Ein dunkelgraues Wolkenband nahm fast den gesamten nördlichen Horizont ein. Böiger Wind eilte dem Sturm voraus. Er peitschte Eissplitter über die Ebene.
Das Packeis knirschte im Wellengang. Die Böen sangen ihr Lied in der Takelage des Dreimasters. Ein schönes, schlankes Schiff, das auf zwei hohen Kufen stand, die dem eleganten Rumpf auf ganzer Länge folgten.
Eine mit vergoldetem Schnitzwerk geschmückte Vordertrutz erhob sich über den Bug. Im Heck lag eine geräumige Kajüte, die Galayne gut vertraut war. Vor zwei Monden erst hatte er mit Lossyril Spinnenhaar eine mehrtägige Reise über das Eis unternommen. Vielleicht war damals ihr Verdacht aufgekeimt, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Fast die halbe Besatzung war erkrankt, weil er von ihrem Sikaryan getrunken hatte. Er hatte sich zu sehr dem Rausch hingegeben. Lossyril ließ einen Mann leicht alle Vernunft vergessen.
Das Geräusch von Hacken, die auf Eis schlugen, schreckte ihn aus seinen Gedanken. Galayne stand mittschiffs, nahe beim Hauptmast. So konnte er nicht sehen, wer auf das Eis einschlug.
Ein besonders heller Pfeifton ertönte am Fockmast. Es wurde schnell dunkel.
Über ihm am Hauptmast befestigten drei Shakagra’e den Schwenkarm eines Krans. Sie trugen Helme, ihre empfindlichen Augen vertrugen das Sonnenlicht nicht. Sie mussten sie hinter geschliffenem Kristall verbergen, der die tropfenförmigen Sichtöffnungen verschloss.
Die schweren Ketten verhinderten, dass Galayne sich vom Fleck rührte. Seit das Tribunal seine Verbannung beschlossen hatte, waren ihm diese Fesseln nicht abgenommen worden. Er lächelte über die Angst, die er den selbstherrlichen Nachtalben machte.
Die Tür der Heckkabine schwang auf. Lossyril Spinnenhaar und Kayil’yanka betraten das Hauptdeck. Der eisige Wind spielte mit ihrem langen Haar, hob es an, ließ es tanzen, wehte es um die silbernen Masken, die ihre schmalen Gesichter vor dem spärlichen Sonnenlicht schützten. Die beiden Frauen waren ins Gespräch vertieft.
Mit einem Anflug von Eifersucht bemerkte Galayne, wie Kayil’yanka verstohlen und doch voller Absicht die Hand der Priesterin streifte. Sie waren ein Paar geworden, begriff er. Lossyril genoss es, die Stärkere zu sein. Gewiss war Kayil’yanka auf ihre Einladung an Bord. Ihr Traum, unter freiem Himmel zu reisen, hatte sich endlich erfüllt.
Die beiden schlenderten ihm entgegen, und er genoss trotz seiner misslichen Lage, sie zu betrachten und sich an jene Stunden zu erinnern, die sie geteilt hatten. Er dachte daran, wie verschieden sie waren. An Lossyrils ungezügelte Sinnlichkeit, geboren aus Jahrhunderten der Erfahrung. Und Kayil’yankas unbedachte Unschuld, verbunden mit der Neugier, Unbekanntes zu entdecken.
Lossyril winkte den Shakagra’e, die sich am Kranarm zu schaffen gemacht hatten. Ein Seil mit einem schweren Eisenhaken daran wurde herabgelassen.
»Es wird mir schwerfallen, dich gänzlich zu vergessen«, sagte die Priesterin und strich ihm sanft über die Wange. Sie schob den Haken in eines der Kettenglieder.
Dann tat sie etwas sehr Ungewöhnliches, das auch Kayil’yanka ein erstauntes Keuchen entlockte: In einer plötzlichen Laune nahm sie die Maske vom Gesicht. Das Sonnenlicht musste auf Lossyrils bleicher Haut brennen wie eine nahe Fackel, aber sie ließ sich den Schmerz nicht anmerken, während sie sich ihm näherte. Sie raubte ihm einen Kuss, atemlos, voller Leidenschaft, und biss ihm in die Lippe, als sie von ihm abließ. Galayne sah sein Blut auf ihrer spitzen Zunge, bevor sie die Maske wieder aufsetzte.
»Dir Lebewohl zu sagen wäre selbst für mich zu ironisch, mein schöner Betrüger. Wohlsein ist das Letzte, was dich an dem Ort erwartet, zu dem du nun gehen wirst. Also wünsche ich dir: Sei stark, Galayne den-die-Göttin-liebt.« Sie winkte den Nachtalben an der Ankerwinde. »Hoch!«
Kayil’yanka legte die Fingerspitzen an die silbernen Lippen ihrer Maske und hauchte einen Kuss zu ihm hinüber.
Mit einem Ruck wurde Galayne emporgehoben. Nicht weit. Er schwebte nur wenig mehr als einen Schritt über dem Deck, gerade hoch genug, um über die Reling geschwenkt zu werden. Der Kranarm drehte sich zur Seite. Nun sah er das dunkle Loch im Eis. Der Haken öffnete sich. Er stürzte, wurde verschlungen von schwarzen Fluten.
Ifirns Ozean,
elfterTag im Kornmond, vor 887 Jahren
Galayne den-die-Göttin-liebt schrie auf. Eiswasser füllte seinen Mund, erstickte seine Stimme. Er sank schnell tiefer. Schon war das Loch im Eis nur noch ein winziger Punkt in der Dunkelheit. Dann war er verschwunden.
Es fühlte sich an, als presse ihm jemand die Daumen in die Ohren. Widerstrebend öffnete Galayne den Mund. Es kostete ihn Überwindung, das Wasser einzuatmen. Kalt füllte es ihm Kehle und Lunge. Er bäumte sich in den Fesseln auf, würgte, dann wurde ihm schwindelig. Sein Bewusstsein schwand …
Als er erwachte, sank er noch immer tiefer. War er nur einige Augenblicke ohnmächtig gewesen? Oder eine halbe Stunde? Die Finsternis um ihn war vollkommen. Er fror und wusste doch, die Kälte würde ihn nicht töten. Ebenso wenig wie das Wasser in seiner Lunge. Er war ein Feylamia. Er musste nicht atmen. Hitze und Kälte schadeten seinem Körper nicht, wenngleich er behagliche Wärme vorzog.
Galayne schloss die Augen. Würde Pardona ihn hier finden? Würde sie ihn vergessen haben? Er tastete in Gedanken nach Leben. Da war etwas. Winzige Tiere, die im Wasser schwebten. Verhungern würde er nicht, aber darben. Anders als andere Feylamia war er nicht darauf beschränkt, sich ausschließlich vom Sikaryan von Elfen zu nähren. Er nahm die Essenz des Lebens von allem, das Leben in sich trug. Dennoch war der Unterschied erheblich. So als vegetiere man bei Wasser und Brot, statt an festlich gedeckter Tafel zu speisen.
Sanft schlug er auf schlammigem Boden auf. Schmutz wirbelte im Wasser. Er drang ihm in den Mund. Legte sich schleimig auf Hals und Gaumen. Irgendwo in weiter Ferne ertönte das einsame Lied eines Buckelwals. Dann war es wieder still.
Schlamm zu schmecken … Ein einzelnes Geräusch hören … Galayne wurde bewusst, dass dies von nun an seine kostbarsten Augenblicke sein würden. Seine Sinne waren jeglichen Reizes beraubt. Noch fror er, aber bald würde er für dieses Gefühl taub werden, da sich an der Temperatur um ihn herum nichts ändern würde. Auch würde er bald das Salz im Wasser nicht mehr schmecken. Dann gab es nur noch endloses, stumpfes Vegetieren. Sein einziges Maß dafür, wie die Zeit verstrich, wäre sein Herzschlag. Seine Unsterblichkeit würde ihm zum Fluch werden.
Diese Strafe hatte Lossyril Spinnenhaar ersonnen, dachte er. Sie wusste wie keine andere, wie sehr er es liebte, das Leben mit all seinen Sinnen zu genießen. Sie wollte, dass er wahnsinnig wurde, aber den Gefallen würde er ihr nicht tun. Er war stärker, als sie sich vorzustellen vermochte. Eines Tages würde er diese Ketten sprengen. Die Zeit würde das Eisen zermürben, so wie sie alles zermürbte … Nein, wurde ihm bewusst, das war der falsche Gedanke! Wenn er daran glaubte, dann würde die Zeit auch ihn zermürben. Es würde ein Wettlauf. Würde er zuerst wahnsinnig, oder würden zuerst die Ketten von ihm abfallen?
Pardona liebte ihn, das war der Gedanke, der ihn überdauern lassen würde. Sie würde kommen. Sie würde nach ihm suchen. Sie war eine Göttin! Nichts war unmöglich für sie. Und sie hatte ihn stark gemacht. Er würde überdauern!
Um das zu schaffen, würde er seine Sinne verfeinern. Er würde lauschen, bis er ein Geräusch fand. Und sei es Meilen entfernt. Er würde von dem Wasser kosten, bis er die feinsten Veränderungen schmeckte. Er würde in das Dunkel starren, bis es vor seinem Blick wich und er mindestens so deutlich sah wie an einem grauen Wintertag.
Er war nicht länger Galayne den-die-Göttin-liebt. Das würde er in Zukunft wieder sein. Jetzt war er: Galayne den-das-Schicksal-nicht-beugt.
Ifirns Ozean,
zweiundzwanzigsterTag im Grimfrostmond, vor 829 Jahren
Der Wasserdruck hatte sich verändert. Sie war wieder vorübergeschwommen. Die riesige Schlange, die sich von Walen nährte. Sie suchte nach Beute. Aber sie musste mehr als zwei Meilen entfernt sein. Er konnte nicht von ihrem Sikaryan kosten. Nur ein einziges Mal war ihm das geglückt. Sie hatte es gespürt, ihn aber nicht gefunden. Seitdem kam sie ihm nicht mehr nahe. Sie war klug. Anders als die Oktopoden, die Ifirnshaie und meisten Wale, die sich hierher verirrten. Seine Gier sprang sie an. Trank sie aus. Manchmal, bis es sie tötete.
Galayne Teil-der-Finsternis vermochte sich nicht zu beherrschen. Er löschte Leben aus, das ihm zu nahe kam, denn er war immer hungrig.
Ihm wurde bewusst, dass er vor Aufregung über die große Schlange innegehalten hatte zu zählen. Er zählte schon lange. Sehr lange. Er war bis zu Zahlen vorgedrungen, die er sich zuvor nie vorgestellt hatte. Er tat alles, um dem Wahnsinn zu entgehen. Oder war er schon längst verrückt geworden? Wer verbrachte mehr als drei Jahre damit, unablässig zu zählen? Und das nur, um wieder ein Gefühl für Zeit zu bekommen.
Es war ihm unmöglich zu sagen, wie lange seine Verbannung schon andauerte. Mehr als ein Jahrhundert mochte vergangen sein. Seine Kleider waren längst verrottet und von ihm gefallen. Nicht aber die schweren Ketten.
Er spannte sich, lauschte auf das leise Knirschen des Metalls, schmeckte, wie sich das Wasser veränderte, als Rostflocken von den Kettengliedern abgerieben wurden. Sein Tag war noch fern.
Pardona hatte ihn vergessen. Sie war nicht gekommen. Er war weniger für sie gewesen, als er sich erhofft hatte. Ganz gewiss hätte sie den Shakagra’e das Geheimnis, was aus ihm geworden war, entreißen können, wenn sie es gewollt hätte. Er würde zu ihr kommen müssen.
Wieder bäumte sich Galayne gegen die Ketten auf. Nichts! Sie waren zu stark. Er musste ausharren. Durfte sich nicht von Verzweiflung und Wahnsinn überwältigen lassen und von dem ewigen Gefühl nagenden Hungers.
Er war Galayne Teil-der-Finsternis. Und solange er Teil von ihr war, war er in Sicherheit! Solange er sich mit ihr anfreundete, sie in sich aufnahm, konnte die Finsternis seinen Verstand nicht brechen.
Man musste sich mit dem verbinden, was man nicht besiegen konnte!
Ifirns Ozean,
achter Tag im Vinmond, vor 429 Jahren
Hunger. Essen …
Kleines Tier.
Reißen.
Der stärkere …
Hungrig.
Dunkelheit war er. Durch und durch.
Fressende Dunkelheit.
Er war der Schlinger in der Tiefe.
Hunger!
Es war nie genug …
Gier. Das Tier mit den Laternen …
Er zwang es, im Kreis um ihn zu schwimmen, bis sein Lebensfunke erlosch. Die Laternen leuchteten weiter … Eine Zeit …
Hunger! Die Muskeln spannen …
Knirschen.
Unfrei!
Hunger.
Ifirns Ozean,
siebter Tag im Eimond, vor 289 Jahren
Blaues Licht.
Treiben. Ohne Ketten.
Schmerz, der über seinen Bauch kroch.
Hunger!
Seine Augen …
Etwas stach in seine Augen.
Wie der Wurm, der sich irgendwann durch ihn hindurchgefressen hatte.
Er hatte den Wurm genossen. Eine Abwechslung, etwas fühlen. Er hatte ihn gewähren lassen. Hatte ihn in sich gehegt. Ihn genährt. Bis der Wurm gestorben war. Gut erinnerte er sich an die dumpfe Traurigkeit, wieder nichts zu spüren.
Blaues Licht …
Ein Traum?
Er konnte sehr tief träumen.
Von Augen, in denen silbernes Funkeln gefangen war.
Blaues Licht.
Schmerz, der über seinen Bauch kroch.
Hatte er die Augen offen? War es ein Traum von blauem Licht und Schmerz?
Er wusste es nicht.
Er musste die Augen öffnen … sich beherrschen.
Träumte er, dass er die Augen geöffnet hatte?
Blaues Licht.
Schmerz, der über seinen Bauch kroch.
Er streckte die Hände vor. Seine Gelenke krachten. Dumpf. Weit fort das Geräusch …
Träumte er?
Seine Hände glitten über glattes, blaues Licht. Kalt.
Er zog sich an dem blauen Licht entlang. Es schrammte über seinen Bauch. Über seine Glieder. Er trieb darunter hinweg.
Da war eine Säule aus blauem Licht. Wenn er den Kopf in den Nacken legte, konnte er sie in die Tiefe reichen sehen.
Eine Hand griff ins Leere.
Panik überkam ihn. Er wollte diesen Traum nicht verlieren. Er war anders, fremd. Alles, was anders war, war gut.
Jetzt griffen beide Hände ins Leere.
Panik.
Er schlug um sich.
Sein Kopf stieß in Kälte.
Über ihm Blau!
Tasten … Blinzeln. Scharfe Kanten. Festkrallen! Zerren!
Sein Leib bäumte sich auf. Schmerz! Erbrechen. Husten. Wieder erbrechen … Krallen. Zerren.
Eine Ebene von Weiß.
Erschöpfung.
Wieder würgen.
Kälte, die tief in ihn hineinglitt. Mit jedem Atemzug.
Atmen?
Atmen!
Er blinzelte. Etwas schien über seinen Augen zu liegen. Als ein Schleier direkt auf den Augen. Fest verwachsen. Noch unter den Lidern.
Er tastete um sich. Weich. Kalt.
Tasten?
Wo waren die Ketten?
Gewicht … Etwas hing an ihm. Schwer, von seinem Kopf herab. Endlos. Es wollte ihn hinabziehen, in die Tiefe. Er krallte sich fest, zog sich voran. Eine Hand lang. Noch eine Hand.
Etwas streichelte über sein Gesicht. Kalt. Schön. Ein verlorenes Gefühl, zurück. Er kannte dieses Streicheln. Vor der langen Dunkelheit war es manchmal da gewesen.
Etwas hielt ihn fest. Von seinem Kopf! Es ging nicht mehr voran. Er bäumte sich auf. Kämpfte. Schmerz!
Dann Dunkelheit.
Packeis,
achter Tag im Eimond, vor 289 Jahren
Streicheln.
Er blieb reglos liegen, wollte nicht, dass der Traum endete und er wieder inmitten von Dunkelheit war, ganz ohne Streicheln.
So sanft. Über all seine Glieder.
Er wollte sich bewegen.
Unmöglich!
Er war mit etwas verwachsen. Das war kein guter Traum mehr! Er riss die Augen auf. Weiß. Endloses Weiß. Und darüber … Blau. Endloses Blau.
Er lag auf Eis!
Die Ketten … Sie mussten abgefallen sein! Oder war es doch nur ein Traum?
Aber dann war es ein fremder Traum. Anders.
Anders war gut!
Er würde sich diesem Traum hingeben. Ihn formen.
Er versuchte, sich aufzurichten. Unmöglich. Er war wieder gefangen. Eine Kruste, die über seinen Rücken lief, über seine Flanken … Eisig kalt.
Er kämpfte. Presste die Hände auf das Eis.
Knirschen. Knacken. Schmerz! Knirschen.
Langsam konnte er sich aufrichten. Da lag die Fessel. Verwachsen mit dem Eis. Silberblond. Sie kroch in das Loch, aus dem er gekommen war.
Er tastete nach seinem Kopf. Sein Haar … Gefroren. Es war sein eigenes Haar, das ihn auf dem Eis gefangen gehalten hatte. Festgefroren, eine neue Fessel.
Er wollte aufstehen, doch seine Beine trugen ihn nicht. Er sah an sich hinab. Sein Leib war von fahlem Weiß. Jede Rippe malte sich ab. Seine Beine, spindeldürr. Seine Arme ebenfalls. Er war völlig ausgezehrt. Nur noch Wille. Sein Körper eine geschundene Hülle ohne Kraft.
Er schlug auf das gefrorene Haar ein, das ihn auf dem Eis festhielt. Es splitterte, gab ihn frei.
Er kroch. Starrte in das schwarze Loch. Dort sah er sein Haar. Lang … Es wogte in der Strömung. Verlor sich im Dunkel. Wie lang war es? Bedeutungslos!
Wie lang? Seine Verbannung … Wie viel Zeit war vergangen? Er musste das Dunkel abstreifen, das tief in seinen Verstand gedrungen war.
Er drehte sich auf den Rücken. Blickte in das weite Blau, versuchte zu verstehen.
Er musste unterhalb des Eispanzers getrieben sein. Wie lange? Er wusste es nicht.
Wann waren die Ketten gebrochen? Er wusste es nicht.
Was wusste er noch?
Er konnte nicht mehr unterscheiden, wann er geträumt hatte und wann gelebt. Einst hatte er einen Namen gehabt. Alles in der Welt hatte einen Namen. Er versuchte, sich zu erinnern.
»Ga…?« Seine Zunge formte die Silbe nur schwerfällig. Es klang, als würden zwei sprechen. Musste das so sein?
»Ga!« Da war mehr gewesen. Er hatte es vergessen. So vieles hatte er vergessen!
Er hatte auf jemanden gewartet. Aber auch dessen war er sich nicht ganz sicher.
Er starrte hinauf ins grenzenlose Blau. Das war besser als das Schwarz.
Er schloss die Augen. Spürte das Leben unter dem Eis. Hier gab es so viel mehr Leben als in der Dunkelheit. Er würde sich daran laben.
Er spürte die vielen kleinen Tode. Spürte winzige Tiere in der Strömung davontreiben. Sie würden in das Schwarz sinken, aus dem er sich erhoben hatte.
Ein vages Gefühl von Gefahr beschlich ihn. Hier auf dem Eis war er nicht sicher. Er sollte sich an etwas erinnern, das wichtig war.
Wieder blickte er zum Himmel hinauf. Die Bedrohung kam von dort, glaubte er. Doch was wusste er noch von der Welt, die jenseits der ewigen Finsternis lag? Er musste sie sich langsam zurückerobern.
Langsam … Trotz der Kälte überkam ihn eine wohlige Schläfrigkeit. So lange schon hatte er nicht mehr so viel Sikaryan getrunken wie an diesem Tag. Er war satt. Ein unvertrautes Gefühl. Jetzt konnte er schlafen. Oder würde er stattdessen erwachen und feststellen, dass all dies nur ein wunderbarer Traum gewesen und er noch immer in Ketten geschlagen in der lichtlosen Tiefe gefangen war?
Packeis,
achter Tag im Eimond, vor 289 Jahren
Schmerz riss ihn aus dem Erschöpfungsschlaf. Es fühlte sich an, als stünde er in Flammen.
Silbernes Mondlicht zeigte ihm, wie seine Haut Blasen warf. Zum Himmel hinaufzublicken fühlte sich an, als würden ihm Speere aus Licht durch die Augen gestoßen.
Erinnerung kam mit dem Schmerz. Der Mond! Er musste ihm entkommen, oder die Qual würde tödlich enden.
Er stemmte sich vom Eis hoch.
Keine Wolken standen am Himmel.
Das Loch … Er folgte der Spur seines auf dem Eis festgefrorenen Haars.
Da war kein Loch mehr!
Er schrie, warf sich auf den Boden, hämmerte mit den Fäusten auf das Eis, doch es war zu dick.
Seine Haut zischte. Schuppen aus verbranntem Fleisch schälten sich ab. Das Eis wurde rot unter den Hieben seiner geschundenen Hände.
Hier würde er sterben, begriff er und sprang auf.
Der Schmerz trank seine Stärke. Jetzt vermochte er nicht mehr zu laufen. Halb hüpfend, halb hinkend kämpfte er sich mit aller Kraft, die er aufbrachte, voran. Dem Knirschen der Packeisgrenze entgegen.
Er blickte aus dem Augenwinkel zu dem mächtigen, fahlen Gestirn, erschaffen, ihn zu peinigen. Wenn er seine Haut bedecken könnte … Sein Blick huschte über das Eis. Eine dünne Schicht funkelnden Schnees lag darauf. Das würde nicht helfen.
Er quälte sich weiter voran, bis er die erste Spalte im Eis erreichte. Das Wasser dort unten sah schwarz aus. Alles in ihm bäumte sich auf. Nicht zurück in die kalte Dunkelheit! Doch hier oben erwartete ihn der Tod. Mit jedem Herzschlag wichen seine Kräfte. Er starrte in den Spalt. Zu schmal. Zu ungewiss. Das Eis bewegte sich, er könnte dort unten zerquetscht werden.
Er humpelte am Spalt entlang. Leise wimmernd. Er konnte nicht mehr. Der Schmerz nahm ihm jede Selbstbeherrschung.
Endlich fand er eine Stelle, wo er mit einem weiten Schritt über die klaffende Öffnung im Eis hinwegkam. Weiter! Schnell.
Er sah, dass er blutige Fußabdrücke auf dem Eis hinterließ. Lange würde er nicht mehr durchhalten. Ein Fuß vor den anderen … Weiter … Das Glitzern des Lichts auf der dünnen Schneeschicht war schön. Es erinnerte ihn an etwas … Augen? Konnte es Augen geben, in denen solch ein Glanz gefangen war?
Er erreichte einen weiteren Spalt. Immer noch schmal. Voller Sorge sah er, wie die Eiswände gegeneinander rückten und wieder zurückwichen, wenn sie sich mit der Dünung bewegten.
Springen? Weit würde er nicht mehr kommen. Das silberne Licht, das die Nacht verzauberte, brannte das Leben aus ihm heraus. Wenn er Pech hatte, würde er zwischen dem Eis zerquetscht. Fand er kein Versteck vor dem Mondlicht, würde er ganz gewiss sterben.
Er beobachtete die Drift der Eiswände. Wartete, bis der Spalt im Eis am weitesten auseinanderklaffte. Dann tat er den Schritt in den Abgrund.
Das Eiswasser löschte den brennenden Schmerz auf seiner geschundenen Haut. Er sank hinab. Unter seinen Füßen war nichts als Dunkelheit. Jene Finsternis, die immer noch seinen Verstand umfangen hielt. Er durfte dorthin nicht zurück. Dieses Mal würde sie ihn endgültig verschlingen, selbst wenn er nicht in Ketten geschlagen war.
Verzweifelt begann er mit den Armen zu paddeln. Das Eis über ihm erstrahlte bläulich im Mondlicht. Schatten huschten darunter hinweg. Seine Lunge brannte. Er musste nur einatmen … Das Wasser würde ihn nicht töten. Aber wenn keine Luft mehr in seiner Lunge war, würde er noch leichter sinken.
Er kämpfte, gab seine letzte Kraft. Erreichte das Eis. Glatt wie Glas wies es seine tastenden Hände ab. Dann fand er einen Spalt, in dem Luft eingeschlossen war. Gierig atmete er. Seine zerschundenen Finger krallten sich in winzige Höhlungen.
Er starrte zum Mond hinauf, der hier nur als verzerrter Fleck aus Helligkeit jenseits des Eises lauerte. Er würde warten. Würde sich erholen. Würde sich erinnern. Er hatte einen Namen gehabt. Alle Dinge in der Welt trugen einen Namen … Er versuchte, zu der Zeit vor der Finsternis zurückzugelangen. Doch die Pforten der Erinnerung blieben ihm verschlossen.
Packeis,
achtzehnter Tag im Eimond, vor 289 Jahren
Er erbrach blutiges Robbenfleisch auf das Eis. Unsicher betrachtete er die Klumpen. Er musste sich nicht auf diese Art ernähren, das war ihm bewusst.
Unter dem Eis hatte er gesehen, wie die Robben Fische jagten. Jede Nacht versteckte er sich dort vor dem Mond. Er hasste es, in das eisige Wasser zu steigen, doch ihm blieb keine Wahl.
Als er die Robben gesehen hatte, hatte er sich an ihren Namen erinnert. Und daran, dass er schon einmal von ihrem Fleisch gegessen hatte … In der Zeit, die hinter der ewigen Dunkelheit lag und die fast ganz aus seinen Erinnerungen getilgt war.
Er betrachtete die Fleischbrocken. Er hatte sich eine der kleinen Robben geholt. Die mit dem weißen Fell. Warum etwas Großes töten, wenn man nicht wusste, ob es schmecken würde?
Er strich über das blutbesudelte Fell. Es war angenehm weich. Er glaubte sich zu erinnern, auch einmal so ein Fell getragen zu haben. Aber jetzt war es ihm ausgefallen, wie es schien.
Große schwarze Augen beobachteten ihn vom Wasser her. Er war weit hinaus auf das Packeis gewandert. Bis an die Grenze, wo es in Schollen im Meer trieb. Dazwischen tummelten sich Robben.
Wenn er die Lider schloss, konnte er von ihnen trinken. Sie spürten, wie er sich an ihrer Lebenskraft labte, tauchten unter und versuchten, ihm zu entfliehen. Aber er war anders. Er brauchte keine Zähne, um etwas dazwischen zu zermalmen. Er hielt an ihnen fest, ohne sie zu berühren. Trank … Und ließ sie dann entkommen. Sie waren anders als die kleinen, treibenden Dinge, von denen er sich in der dunklen Tiefe genährt hatte. Diese Dinger, für die er keinen Namen hatte, hatten nur winzige Lebensfunken besessen. Wenn er etwas davon nahm, starben sie sofort. Robben waren anders … Er ließ sie ziehen.
Das Jungtier zu seinen Füßen tat ihm leid. Es war einen nutzlosen Tod gestorben. Es würde ihn nicht nähren. Es mundete nicht. Er hatte einen Geschmack vom Rost der Ketten im Mund.
Er klaubte Schnee zusammen, schob ihn sich über die Lippen, kaute, ließ ihn schmelzen und dann das Wasser im Mund kreisen, um es auszuspeien. Das tat er so lange, bis ihn der Rostgeschmack wieder verlassen hatte.
Versonnen blickte er zum Horizont. Dort, weit, weit fort war etwas anders. Zuerst hatte er es für Wolken über dem Wasser gehalten. Doch diese Wolken bewegten sich nicht.
So weit sein Blick reichte, gab es nur eine endlose, weiße Ebene. Er würde dorthin gehen, wo es so kalt war, dass die Wolken auf dem Eis festgefroren waren.
Insel der Schneeschrate,
dreiundzwanzigster Tag im Eimond, vor 289 Jahren
Vorsichtig schob er den Schnee zur Seite und blickte zum Himmel hinauf. Der Mond war verschwunden, wenngleich es immer noch dunkel war.
Diese Insel war voller Wunder. Sie half ihm, das Dunkel in seinem Kopf zu vertreiben. Wenn er Dinge sah, dann fiel ihm der Name ein. Es war ein mühseliges Unterfangen, die Vergangenheit zurückzugewinnen. Aber sein Kopf war voller Worte. Stein, Berg, Granit, Schneewehen … So viel kehrte zurück. Und die Insel hatte ihm noch mehr zu geben, da war er sich sicher!
Er hatte einen Felsgrat erreicht und auf ein Tal geblickt, in dem Wolken geboren wurden. Der felsige Boden selbst schien sich die Wolken abzuringen. Sie wurden hervorgepresst.
Gestern hatte er gesehen, wie ein Firnyak ein Kalb herausgepresst hatte. Fast den ganzen Tag hatte er das kleine Fellknäuel beobachtet. Wie seine Mutter ihm Blut und Schleim aus dem braunen, zotteligen Fell geleckt hatte. Wie es unsicher auf seinen dünnen Beinchen zu stehen gelernt hatte. Wie es zum ersten Mal die Zitzen seiner Mutter gefunden hatte.
Er hatte sich gefragt, ob auch er einmal an Zitzen getrunken hatte. Aber da war nichts. Keine Erinnerung. Schließlich war er fortgelaufen. Das Kalb und die Kuh zu beobachten hatte einen süßen Schmerz tief in seiner Brust geweckt. Er wollte das nicht ertragen. Schmerzen hatte er genug gelitten.
Bis zum Felsgrat war er gestiegen, als der Mond an den Himmel getreten war und er sich in den Schnee hatte eingraben müssen, um nicht vom silbernen Licht gepeinigt zu werden.
Eilig stieg er den Hang hinab. Seine Beine trugen ihn wieder gut. Sein Körper veränderte sich von Tag zu Tag. Er setzte mehr Muskeln an. Er konnte nun lange Zeit gehen, ohne zu ermüden. Und überall war Sikaryan. Die Zeit des Darbens war vorüber.
Das Tal unter ihm war voller Wolken. Manchmal rissen sie auseinander, und er konnte etwas Grünes sehen, das sich im Wind beugte.
Ein merkwürdiges Geräusch ließ ihn innehalten. Ein Krachen … Es hatte anders geklungen als aufeinanderprallende Eisblöcke. Etwas war zerbrochen. Er musste sich nur links halten, um dorthin zu gelangen. Kurz zögerte er, dann gab er seiner Neugier nach.
Er ging in die Wolken. Nein … Nebel, das war das Wort! »Ne…bel«, sagte er leise und kostete genüsslich die beiden Silben auf seiner Zunge. Seine Welt wurde größer! Er würde das Dunkel, das seine Vergangenheit verschlungen hatte, besiegen.
Etwas bewegte sich im Nebel. Groß und behäbig.
Ein scharfes Knacken erklang.
Er wurde langsamer. Setzte seine Schritte behutsam, ganz darauf bedacht, sich nicht durch ein unnötiges Geräusch zu verraten. Dort vor ihm war sehr viel Lebenskraft. Er spürte das pulsierende Sikaryan.
Ein plötzlicher Windstoß teilte den Nebel. Da waren riesige Tiere mit einem langen, weißen Fell. Schwarze Augen musterten ihn misstrauisch. Augen, die dicht neben einem Schwanz lagen! Und rechts und links vom Schwanz schoben sich zwei lange, nach oben gekrümmte Rippen aus dem Fell, die rötlich schimmerten.
Atemlos starrte er diese Ungeheuer an. Die größten von ihnen waren mehr als drei Schritt hoch. Sie hatten einen Baum niedergetreten und fraßen grüne Nadeln von den Ästen. Eine Kiefer …
Er erinnerte sich, diese Tiere gemalt gesehen zu haben. Da war auch ein Name gewesen: »Mam…mut.«
Das größte von den Biestern machte zwei Schritte in seine Richtung.
Er hob beschwichtigend die Hände. »Mam…mut.«
Mit seinem Namen angesprochen zu werden beeindruckte den Koloss nicht.
Im Nebel erklang ein unheimlicher Schrei. Eine fauchende Herausforderung. Das große Mammut wandte den Kopf.
Er nutzte die Gelegenheit, sich in den Nebel zurückzuziehen. Er ging einen weiten Bogen, stieg weiter hinab ins Tal, vermied es aber, in die Richtung zu gehen, aus der er den Schrei gehört hatte.
Bald erreichte er ein Kiefernwäldchen. Und dort fand er den ersten Flecken Erde. Nicht Fels, nicht Schnee oder Eis. Erde. Er stellte sich darauf, wühlte die Zehen hinein. Sie war nasskalt. Er mochte das schmatzende Geräusch, das seine Füße darin machten.
Gut gelaunt wanderte er weiter. Es wurde wärmer. Der Nebel schmeichelte seiner Haut. Das war ganz anders als der Wind draußen auf der Eisebene, der allzu oft stechenden Schnee vor sich herpeitschte.
Er entdeckte Gras. Die Bäume veränderten sich, als er tiefer stieg. Da waren Eichen und Linden, aber auch welche, für die er keine Namen kannte.
Er überquerte eine Lichtung voller hüfthoher Farnwedel. Er spürte das Sikaryan kleinerer Tiere, die sich unter dem wogenden Grün versteckten.
Der Nebel wurde dichter. Der Boden unter seinen Füßen fühlte sich warm an. Gezwitscher erklang hoch über ihm zwischen den Ästen.
»Vö…gel.«
Er lauschte den Liedern. Hin und wieder erhaschte er einen Blick auf buntes Gefieder. Und dann sah er den Quell des Nebels. Den Ort, an dem die Wolken geboren wurden. Es war kein Spalt in der Erde, aus der sie hervorgepresst wurden, so wie er sich das gestern vorgestellt hatte. Es war ein See, der den Nebel gebar.
Er trat an ein schlammiges Ufer. Nicht weit fort trank ein großes Tier, dem drei Hörner aus dem Kopf wuchsen. Seine Haut sah seltsam aus. Wie aus bunten Steinen zusammengefügt. »Schup…pen …«
Er trat an das Wasser. Der Nebel umschmeichelte ihn wie warmer Atem.
Vorsichtig trat er ins Wasser und stöhnte auf vor Wohlbehagen. Es war angenehm warm. Dies hier war das genaue Gegenteil der nasskalten Finsternis, die ihn so lange verschlungen hatte.
Er watete bis zu den Hüften in den See, genoss mit jeder Faser seines Leibes hier zu sein.
Er stand ganz still. Auch das Wasser bewegte sich nicht. Er spürte, wie seine Füße langsam im Schlamm einsanken. Beiläufig bemerkte er das Bild im Wasser. Ein Spiegelbild. Ein schmales Gesicht über hagerem Körper. Silberblondes Haar, struppig, ungleich lang, so, wie es gefroren zerbrochen war. Vertraute Augen, blau wie der Himmel, wenn er strahlend und wolkenlos war. Er kannte dieses Antlitz!
»Ga…layne«, sagte er leise. »Galayne!«
Tal der Donnerwanderer,
dreißigster Tag im Eimond, vor 289 Jahren
Das Tal gefiel Galayne der-im-Licht-badet. Er mochte die schwüle Hitze, den treibenden Nebel und die vielen Tiere, die es hier gab. Er hatte sich gut erholt, war wieder bei Kräften, doch seine Sehnsucht nach Licht und Sikaryan war noch lange nicht gestillt.
Einzig ein Paar großer Räuber, das durch das Tal streifte, machte ihm Sorgen. Er hatte keinen Namen für sie. Es waren Echsen, die auf starken Hinterbeinen gingen und sich dabei auch auf ihren Schwanz stützten. Zu den Drachen gehörten sie wohl nicht … Mit kleinen, verkümmerten Vorderbeinen und einem großen Kopf, der von einem riesigen Maul voller dolchlanger Zähne beherrscht wurde, sahen sie eindrucksvoll aus.
Galayne der-im-Licht-badet wich diesen Raubechsen aus. Sie waren die Könige des Tals. Einmal hatte er den Kadaver einer dreigehörnten Echse gefunden, die von den beiden Bestien geschlagen worden war. Furchterregende Wunden hatten Rücken und Flanken des toten Tiers entstellt. Wahrscheinlich würden sie auch ihn töten und verschlingen können. Aber sein Gespür für das Sikaryan aller Lebewesen in seiner Nähe half ihm, den Räubern aus dem Weg zu gehen. Und so genoss er das Nebeltal.
Manchmal, an wolkenlosen Tagen, suchte er sich einen großen Stein, kauerte darauf und verbrachte Stunden damit, in den Himmel zu schauen. Er liebte es zuzusehen, wie das Blau sich veränderte, oder wenn Wolken oder Nebel aufzogen, zu beobachten, wie Licht in breiten, goldenen Streifen vom Firmament herabstach.
Seltsame Geräusche schreckten Galayne der-im-Licht-badet aus seinen Tagträumen. Ein Grunzen, wie er es im Tal noch nicht vernommen hatte. Manchmal gab es auch bellende Laute, die aufgeregt wirkten.
Er glitt von seinem Felsen und folgte den Geräuschen, die langsam erstarben. Sie waren von weit oben an den Berghängen gekommen, dort wo das Grün dem Weiß von Schnee und Eis wich. Seine Neugier war stärker als der Widerwille gegen die Kälte. Er pirschte durch ein weites Farnfeld hinauf zu den Kiefernwäldern am Südrand des Tals.
Die fremden Laute waren nun verklungen, die Sonne hinter den Bergkämmen verschwunden. Höchstens eine Stunde noch, bis der Mond am Himmel stünde.
Galayne beschleunigte seine Schritte. Am Waldrand verharrte er. Nebel trieb vom Tal hinauf zu den schneebedeckten Berghängen. Er entdeckte etwas Dunkles im Schnee … Vorsichtig, geduckt schlich er durch den treibenden Dunst.
Da war ein Kadaver. Ein großes Tier mit einem mächtigen Horn auf der Nase und einem zweiten, kleineren, auf der Stirn zwischen den Augen. Es trug ein zotteliges Fell wie die Mammute. Ein Ast ragte aus seiner Flanke. Der Bauch war aufgeschnitten, breite Bahnen von Fleisch von seinen Rippen gelöst.
Galayne untersuchte die Wunden und schob seine Hände in den Kadaver. Leber und Herz fehlten. Die anderen Innereien schienen noch am Platz zu sein. Das war kein Raubtier gewesen!
Er ging in weitem Kreis um das Tier mit dem Nasenhorn. Seine Fährte wirkte, als habe es sich mit letzter Kraft in das Tal geschleppt. Blut war zwischen den Abdrücken, die es im Schnee hinterlassen hatte. Aber auch auf seinem größeren Horn glänzte Blut. Es musste einen seiner Jäger verwundet haben.
Nachdenklich betrachtete Galayne die anderen Abdrücke im Schnee. Füße mit fünf Zehen. So wie seine … Nur deutlich größer. Gab es mehr Geschöpfe wie ihn? Bislang hatte er angenommen, der Einzige seiner Art zu sein. Vielleicht war er ja ein Jungtier? So wie das Firnyakkalb, das er gesehen hatte. Möglicherweise war darum sein Wissen so lückenhaft? Aber weshalb war er seiner Herde verloren gegangen? Warum suchte ihn niemand?
Er sah den Spuren nach. Sie führten zum Felsgrat hinauf. Die Jäger schienen jemanden getragen zu haben, der durch das Horn verletzt worden war.
Wenn er der Fährte folgte, würde er sich bald vor dem Mondlicht unter dem Schnee verstecken müssen. Beim Gedanken daran schüttelte es ihn. Die Kälte war ungefährlich für ihn, aber er mochte sie nicht.
Morgen, im ersten Licht, würde er zurückkehren.
Er ging zurück zu dem Kadaver. Dieser Ast in der Flanke … Er zog daran, löste ihn aus dem Fleisch und war überrascht, am Ende einen behauenen Stein mit scharfen Kanten zu finden.
»Speer«, erinnerte er sich. Doch diese Waffe sollte anders aussehen. Die Spitze musste silbrig sein und viel flacher. War es doch nicht seine Herde, die hier gejagt hatte? Die Seinen schienen andere Speere benutzt zu haben … Wenn er sich doch nur besser erinnern könnte!
Das letzte Rot der Dämmerung verblasste. Er eilte in den Kiefernwald zurück und weiter hinab zum Talgrund, bis zu seinem Nest unter den großen Farnwedeln, wo er sicher war vor dem Mond, der mit seinen Speeren aus silbernem Licht Jagd auf ihn machte.
Insel der Schneeschrate,
erster Tag im Faramond, vor 289 Jahren
Das konnte nicht seine Herde sein. Galayne der-im-Licht-badet war den Spuren fast den ganzen Tag lang gefolgt. Sie hatten ihn weit ins zerklüftete Bergland geführt. Jetzt endlich, als das Abendrot seine glutfarbenen Finger über die Hänge streckte, hatte er die Jäger entdeckt. Große Gestalten mit dichtem weißen Fell. Das konnte nicht seine Herde sein! Selbst wenn er noch ein sehr junges Jungtier sein sollte, würde er sich niemals so sehr verändern.
Die Jagdgruppe schleppte einen schwer verletzten Gefährten. Sie wirkten aufgebracht. Es waren sechs. Galayne war sich unsicher, wie er sie nennen sollte. Sie hatten etwas von Bären, gingen allerdings aufrecht, so wie er. Zwei von ihnen stützten den Verwundeten. Es schien, als seien sie alle sehr erschöpft.
Galayne hielt etwa dreihundert Schritt Abstand zu ihnen und achtete darauf, dass der Wind seine Witterung nicht zu den Kreaturen tragen konnte. Fröstelnd kauerte er im Schnee. Er dachte an den warmen See. Er schien für das Leben dort geschaffen. Die Tiere nahe beim See hatten die seltsam raue Haut in verschiedenen Farben, die an bunte Steinchen erinnerte. Die anderen Tiere, die im Schnee und am Rand des Tals lebten, trugen alle ein dichtes Fell. Er hatte nur Fell auf dem Kopf. Ganz sicher war er nicht für Schnee und Eis geschaffen.
Hier würde er keine weitere Erkenntnis gewinnen, überlegte Galayne. Wäre es weniger ungemütlich, würde er diese seltsamen Kreaturen noch etwas beobachten. So aber sehnte er sich zurück nach warmem Wasser und seinem Lager im dichten Farn. Er würde noch ein wenig Sikaryan von den Pelztieren trinken und dann den Rückweg antreten. Ihm stand ohnehin noch eine Nacht im Schnee bevor.
Er schloss die Lider, konzentrierte sich darauf, von den bärenähnlichen Kreaturen zu kosten. Er schmeckte ihre Verzweiflung, ihre Traurigkeit, aber auch die wilde Kraft, die sie in diesem unwirtlichen Land überleben ließ. Und plötzlich war da noch etwas anderes. Köstlich! Ein Sikaryan, das ihn aufleben ließ.
Verwundert blickte er ins Tal hinab. Der Quell der wunderbaren Kräftigung lag nicht bei den Geschöpfen, die den Verwundeten umringten. Er kam aus Richtung Sonnenaufgang. Galayne erkannte eine kleine weiße Gestalt. Sie stützte sich auf einen Stab und wanderte in der Spur, die eine der großen Kreaturen vor ihr durch den Schnee bahnte. Beide wirkten, als seien sie in Eile.
Galayne verließ seine Deckung. Er ignorierte die Kälte und robbte im Schnee näher. Die kleine Gestalt war ganz anders als die Kreaturen. Sie war mehr wie er, aber doch nicht gleich. Sie wirkte viel fülliger …
»Klei…dung.« Er erinnerte sich, selbst Ähnliches getragen zu haben. Seide, die seiner Haut schmeichelte. Pelze, die ihn wärmten. Nackt zu sein war ungewöhnlich, begriff er.
Die fremde Gestalt erreichte den verwundeten Jäger. Sie hatte langes weißes Haar. Obwohl sie den bärenartigen Kreaturen nur bis zur Hüfte reichte, behandelten alle sie mit großem Respekt.
Galayne war versucht, erneut von ihr zu trinken. Sie war zu köstlich!
Jetzt beugte sie sich über den Verletzten. Sie tat etwas … Legte die Hände auf die schwere Wunde.
Galayne spürte, wie sie ihr Sikaryan schwächte. Wie ungewöhnlich! Im gleichen Maße erstarkte der Verwundete. Er war nicht geheilt, aber doch so stark, dass Galayne sich gewiss war, dass er die kommende Nacht überleben würde.
Eine heiße Berührung am Rücken ließ ihn zusammenzucken. Er blickte über die Schulter. Der Mond schob sich über die Berge. Fasziniert von der Fremden dort unten, war ihm die Zeit wie im Fluge vergangen.
Solche wie sie hatte er schon gesehen. In Fesseln geschlagen, geschunden und viel schwächer als jene dort unten. Sie hatten an einem Ort großer Hitze arbeiten müssen. »El…fen…skla…ven.« Er wiederholte die Silben. Mehrfach. Es verwunderte ihn, wie lang ein Wort sein konnte. Lag es daran, dass diese El…fen…skla…ven wichtig waren? Maß sich die Länge eines Worts nach der Bedeutung dessen, das es benannte?
Widerwillig schob sich Galayne in den Schutz des Schnees. Er hätte gern noch länger beobachtet. Die Fremde berührte etwas in ihm. Es war ein Schmerz, der etwas Süßes in sich trug. Das Gefühl, etwas von Bedeutung versäumt zu haben. In ferner Vergangenheit hatte er eine Wahl gehabt, glaubte er. Und er hatte die falsche Entscheidung getroffen. Das mochte sich jetzt wiederholen.
Wenn er ihr ganzes Sikaryan in sich aufnahm, würde er es wissen! Morgen! Er wollte sie sehen, wenn er das Leben aus ihr zog.
Insel der Schneeschrate,
zweiter Tag im Faramond, vor 289 Jahren
Galayne hatte die ganze Nacht keinen Schlaf gefunden. Zweimal hatte er ein wenig von der El…fen…skla…vin getrunken. Er hatte gespürt, wie sie schwächer wurde. Sie gab sich noch immer dem verwundeten Jäger. Auch schien ihr die Kälte zuzusetzen, die im Mondlicht schlimmer wurde. Zudem zog ein Unwetter auf, das sich am frühen Morgen mit eisigen Sturmböen aus dem Norden ankündigte.
Die Jäger hatten sich eng um die Elfensklavin gekauert und wärmten sie so gut es ging mit ihren Leibern.
Die Heilerin war erschöpft eingeschlafen. Ein Funke neuer Kraft erwuchs dabei in ihr.
Als sich Galayne aus dem Schnee schob, zerrte eisiger Wind an seinem Haar, und feine Schneekristalle stachen wie Nadeln in sein Gesicht. Es gab fast keinen Unterschied zur Nacht, so dunkel war es. Schwarze Wolken hatten die Weite des Himmels verschlungen. Für einen Augenblick erschien es Galayne, als habe sich die Finsternis aus der Tiefe des Meeres erhoben, um ihn zurückzuholen. Dann entschied er, dass dies nicht geschehen konnte. Sie war unter dem dicken Eispanzer gefangen. Sie würde ihm nicht folgen. Oder doch …? Zwei…fel. Er erinnerte sich an dieses Wort und seine Bedeutung.
Hatte er von dem Dunkel etwas mit sich genommen? War es in seinem Inneren?
Die Dinge hatten sich verkehrt, seit die Ketten von ihm abgefallen waren. Er konnte sich nicht einmal erinnern, wann das geschehen war. Oder wie lange er unter dem Eis getrieben war. Die Dunkelheit hatte ihn fast ganz verschlungen, das war ihm bewusst. Viel hatte nicht gefehlt, und er hätte nie wieder einen klaren Gedanken gefasst.
Er spürte die Elfensklavin. Sie war aus dem Schlaf erwacht. Das wenige Sikaryan, das sie angesammelt hatte, verschenkte sie sofort wieder. Er konnte spüren, wie es sie schwächte. Sie würde nicht mehr aus eigener Kraft gehen können, und der Sturm würde noch zunehmen. Dennoch verschenkte sie sich. Gab sich auf, für diese große, haarige Kreatur, die von einem Horn durchbohrt worden war. Seltsam …
Er hatte nie etwas aufgegeben in der kurzen Zeit, an die er sich erinnern konnte. Allerdings hatte sich alles in seiner Welt verkehrt. Er war nicht mehr in der Tiefe in der Dunkelheit gefangen. Er war aufgestiegen und hatte das Licht gefunden. Er war nicht gefesselt. Er war frei, sich zu bewegen, wohin er wollte. Alles hatte sich umgekehrt und ihn dadurch reicher gemacht. Nur eines nicht. Er hatte immer nur Sikaryan genommen. Es nie gegeben. Konnte er das überhaupt?
Warum nicht? Wenn eine Elfensklavin es doch konnte? Da war eine neue Erinnerung. Eine an goldene Augen und eine samtweiche Stimme, die ihn aufforderte, sich zu nähren. Er erinnerte sich auch an andere Augen. Hellbraun mit bernsteinfarbenen Einsprengseln. Sie waren angstgeweitet. Da war schmutziges, braunes Haar. Spitze Ohren. Er hatte seine Hand auf eine verschwitzte Stirn gelegt, hatte zum ersten Mal Sikaryan getrunken. Gierig. Bis zur Neige. Die braunen Augen waren verloschen. Aber in den goldenen Augen hatte Stolz gestanden. Es waren die Augen seiner Mutter. Aber er konnte sich nicht an ihr Gesicht erinnern. Nur an die samtweiche Stimme, die ihn lobte und ihm schon bald das nächste köstliche Mahl versprach.
Galayne blickte in das Schneegestöber. Er hörte die Gestalten mit den Fellen grunzen. War das eine Sprache? Er roch ihre Sorge. Sie fürchteten sich vor dem aufziehenden Sturm. Und sie fürchteten um die Elfensklavin.
Galayne war sich sicher, dass er sich wegen des Sturms keine Sorgen zu machen brauchte. Er war nur unangenehm, aber keine Gefahr für ihn.
»Alles hat sich umgekehrt, nur eines nicht …« Er stand auf, ging durch das Schneegestöber.
Galayne musste bis auf zehn Schritt herankommen, bis die Jäger, deren Sikaryan er so deutlich spürte, auch als Schemen im Schneegestöber sichtbar wurden.
Einer von ihnen richtete sich auf, knurrte.
Galayne ignorierte das. Er trat mitten zwischen sie. Sah die Elfensklavin, die über den Verwundeten gebeugt lag. Bewusstlos. Sie hatte zu viel von sich gegeben. Hatte sich verschenkt … Er schüttelte den Kopf, verstand den Sinn dieser Tat nicht. Jetzt würden sie beide sterben, der verletzte Jäger und die Heilerin.
Galayne trat ganz dicht an sie heran. Er streckte die Hand vor und legte sie auf die schweißnasse Stirn. Er gab ihr zurück, was er ihr gestohlen hatte, und mehr. Er gab auch dem Verwundeten etwas von seinem Sikaryan. Alles musste sich umkehren in seinem Leben, damit es wieder vollständig wurde. Er hatte immer nur genommen. Es war an der Zeit zu geben.
Ihm wurde schwindelig. Er brach in die Knie.
Einer der Jäger stützte ihn. Er blickte in die braunen Augen der Kreatur. Sah dort ein Gefühl. Eine riesige Pranke deutete auf die Elfensklavin.
»Muddär Galandel.«
»Mut…ter.« Es war, als öffneten sich riesige Pforten tief in ihm. »Mutter.« Eine Sturzflut aus Erinnerungen brach auf ihn nieder. Er erinnerte sich. Einst war er Galayne den-die-Göttin-liebt gewesen. Doch sie hatte nie nach ihm gesucht. Weil sie eine Göttin war und nicht wirklich eine Mutter. Auch das war ihm jetzt völlig klar.
Er wusste um all seine Fähigkeiten. Er konnte zaubern. War ein großer Krieger mit dem Schwert und mit vielen anderen Waffen. Und er vermochte, anderen kraft seines Blicks seinen Willen aufzuzwingen. Fast allen … Er konnte sogar seine Gestalt verändern.
Grüne Augen blickten zu ihm auf. Die Lider flatterten. »Du … du hast mir … mein Leben geschenkt«, hauchte die Elfensklavin schwach.
»Nein, es war andersherum.« Allerdings war sich Galayne jetzt, da er wieder alles wusste, nicht sicher, ob es ein Geschenk war. Er musste allein sein. Musste noch einmal zu sich finden. Er blickte auf die Elfe hinab. »Du hast mich niemals gesehen«, sagte er mit zwingender Stimme.
»Ich habe dich niemals gesehen«, wiederholte sie tonlos.
Galayne löste sich vom Griff des Jägers, taumelte ein paar Schritt zurück. Schon verwischte das Schneetreiben wieder alles zu undeutlichen Schemen. Nicht jedoch seine Erinnerungen. All das Wissen, um Lust und Gewalt und um die Dunkelheit, die tief in ihm gewesen war, schon lange bevor die Shakagra’e ihn im Meer versenkt hatten.
Insel der Schneeschrate,
neunter Tag im Faramond, vor 289 Jahren
Sie sah in seine Richtung, schon zum dritten Mal an diesem Morgen und das, obwohl er sich so weit entfernt hielt, dass er kaum ihr Sikaryan spüren konnte. Er sollte von ihr lassen!
Die Elfe hatte die Schneeschrate zurück zu einer kleinen Siedlung geführt. Eine Handvoll Hütten, errichtet aus Knochen und Fellen. Dort lebte sie mitten unter ihnen. Und sie schien es zu genießen. Obwohl sie völlig verschieden von diesen Kreaturen war, denen sie kaum zur Hüfte reichte, war sie von den Schraten anerkannt, ja respektiert.