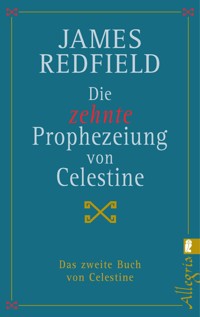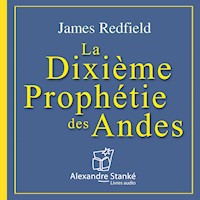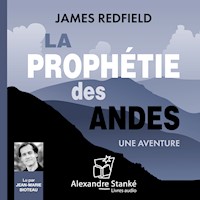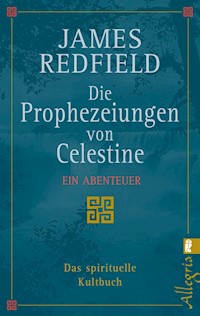
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2010
Ganz allmählich tritt seit einem halben Jahrhundert ein neues Bewusstsein in unsere Welt, ein Bewusstsein, das sich mit Begriffen wie transzendental und spirituell bezeichnen lässt. Sobald wir lernen, diese Entwicklung zu fördern und aufrechtzuerhalten, wird unsere Welt einen Quantensprung machen. James Redfields Bestseller beschreibt diesen Quantensprung in Form einer spannenden Erzählung. Abenteuergeschichte und Buch der Erkenntnisse in einem, trifft dieser Roman den Nerv der Zeit und hat bereits Millionen von Lesern die geistigen und spirituellen Voraussetzungen für das neue Zeitalter nahegebracht
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 437
Ähnliche
James Redfield
Die Prophezeiungenvon Celestine
Ein Abenteuer
Aus dem Amerikanischen von Olaf Krämer
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullsteinbuchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektionieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-548-92111-2
Allegria im Ullstein Taschenbuch Herausgegeben von Michael Görden Aus dem Amerikanischen übersetzt von Olaf Krämer Titel der Originalausgabe THE CELESTINE PROPHECY, AN ADVENTURE Erschienen bei Warner Books, Inc., New York, NY Neuausgabe im Ullstein Taschenbuch 1. Auflage November 2008 2. Auflage 2008 © der deutschen Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2004 © der deutschsprachigen Ausgabe 1994 by Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München © der Originalausgabe 1993 by James Redfield Umschlaggestaltung: FranklDesign, München Titelabbildung: www.alestinefilm.de
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
eBook-Produktion:
Anmerkung des Autors
Seit nunmehr einem halben Jahrhundert tritt allmählich ein neues Bewußtsein in unsere Welt, ein Bewußtsein, das sich nur mit den Worten transzendental und spirituell bezeichnen läßt. Wenn Sie sich entschlossen haben, dieses Buch zu lesen, so haben Sie möglicherweise schon eine Idee davon, was in der Welt vorgeht.
In diesem Moment der Geschichte scheinen wir uns so stark wie noch nie auf unseren Lebensprozeß zu konzentrieren, auf die vermeintlich seltsamen Zufälle, die gerade zur rechten Zeit in unser Leben treten, oder die Menschen, die unserem Leben unvermittelt eine neue Richtung geben. Und mehr als je zuvor messen wir diesen mysteriösen Begebenheiten intuitiv eine höhere Bedeutung zu. Wir wissen jetzt, daß es im Leben um eine Entfaltung unserer Spiritualität geht – eine persönliche und zauberhafte Entfaltung, die bisher keine Philosophie oder Religion imstande war, zufriedenstellend zu erklären.
Und noch etwas anderes wissen wir: Wir wissen, daß unsere Welt einen Quantensprung machen wird, sobald wir gelernt haben, diese Entwicklung zu fördern und aufrechtzuerhalten. Einen Quantensprung, auf den unsere gesamte bisherige Historie zusteuerte.
Die jetzt folgende Geschichte soll zu diesem neuen Verständnis beitragen. Werden Sie davon berührt, oder sollte Ihre bereits existierende Lebenssicht dadurch verstärkt werden, dann geben Sie weiter, was Sie im Laufe dieser Geschichte erfahren haben – auf diese Weise wird sich unser neues spirituelles Bewußtsein erweitern, nicht länger durch Moden oder vergängliche Trends, sondern mittels eine Art positiver persönlicher und psychologischer Ansteckung durch die Berührung mit anderen Menschen.
Alles, was wir dazu tun müssen, um diese Realität zu unserer eigenen werden zu lassen, ist, unsere Zweifel und Ablenkungen lange genug an den Nagel zu hängen..., dann gehört sie auf wunderbare Weise uns.
Danksagung
So viele Menschen hatten Einfluß auf das Entstehen dieses Buches, daß es mir unmöglich ist, ihnen allen an dieser Stelle zu danken. Besonderer Dank gebührt Alan Shields, Jim Gamble, Mark Lafountain, Marc und Debra McElhaney, Dan Questenberry, BJ Jones, Bobby Hudson, Joy und Bob Kwapien, Michael Ryce und allen voran meiner Frau Salle.
Eine kritische Masse
Ich parkte meinen Wagen vor dem Restaurant und lehnte mich im Sitz zurück, um mich einen Moment zu sammeln. Drinnen würde Charlene darauf warten, mit mir zu reden, und ich fragte mich, weshalb gerade jetzt? Seit sechs Jahren hatte ich kein Sterbenswort von ihr gehört. Weshalb tauchte sie ausgerechnet auf, nachdem ich beschlossen hatte, mich für einige Zeit in die Einsamkeit der Wälder zurückzuziehen?
Ich stieg aus dem Wagen und ging in Richtung Restaurant. Hinter meinem Rücken versank die Sonne und tauchte den Parkplatz in ein tiefes, bernsteinfarbenes Gold. Vor kaum einer Stunde noch war die ganze Gegend von einem kurzen, aber heftigen Gewittersturm gebeutelt worden. Jetzt hatte der Sommerabend sich abgekühlt und erfrischt, und das allmählich schwindende Tageslicht verlieh der Szenerie eine fast surreale Stimmung. Über mir schob sich der Halbmond durch die Wolken.
Während ich auf das Restaurant zuging, schössen mir alte Bilder von Charlene durch den Kopf. Würde sie noch so schön und ernsthaft sein wie früher? Wie sehr würden die Jahre sie verändert haben? Und was sollte ich von dem Manuskript halten, das sie erwähnt hatte – jene seltsame und scheinbar uralte Handschrift, die man vor kurzem in Südamerika gefunden hatte und von deren Inhalt sie mir jetzt so dringend berichten wollte?
»Ich werde zwei Stunden Aufenthalt am Flughafen haben«, hatte sie am Telefon gesagt. »Können wir uns zum Abendessen treffen? Die Botschaft der Handschritt wird dich begeistern – du magst doch diese Art von Geheimnissen.« Welche Art von Geheimnissen? Ich hatte keine Ahnung, wovon sie redete.
Das Restaurant war überfüllt. Einige Paare standen herum und warteten auf ihre Tische. Als ich endlich die Empfangsdame aufgetrieben hatte, erklärte sie mir, daß Charlene mich bereits an einem der Tische erwartete, und führte mich dann zu einer kleinen Galerie über dem eigentlichen Speisesaal.
Ich ging die Stufen hoch, und mir fiel auf, daß einer der Tische dort von einer Gruppe Menschen regelrecht belagert wurde. Unter ihnen auch zwei Polizisten, die sich unvermittelt umdrehten und an mir vorbei die Stufen hinabeilten. Während sich die Umstehenden zerstreuten, gelang es mir endlich, einen Blick auf die Person zu werfen, die derart im Mittelpunkt des Interesses stand – es war Charlene.
»Was ist los, Charlene? Stimmt was nicht?«
Mit gespielter Erschöpfung warf sie den Kopf in den Nacken, erhob sich und schenkte mir ihr berühmtes Lächeln. Ich bemerkte, daß sie ihre Haare irgendwie anders trug, ansonsten war ihr Gesicht jedoch noch genauso, wie ich es in Erinnerung hatte, die gleichen feinen und sensiblen Züge, ein breiter Mund und riesige blaue Augen.
»Du wirst es nicht für möglich halten«, sagte sie und zog mich freundlich an sich. »Aber vor ein paar Minuten hat mir, als ich auf der Toilette war, jemand meinen Aktenkoffer gestohlen.«
»Wichtige Sachen?«
»Nichts Besonderes, bloß ein paar Bücher und Zeitungen, die ich im Flugzeug lesen wollte. Eine verrückte Sache. Die anderen Gäste sagten, daß jemand schnurstracks auf meinen Tisch zugegangen sei, den Koffer griff und wieder verschwand. Sie gaben der Polizei eine Beschreibung der Person, und die Cops durchsuchen jetzt die Gegend.«
»Soll ich ihnen dabei helfen?«
»Ach was, vergiß es. Ich habe kaum noch Zeit und will mit dir reden.«
Ich nickte, und Charlene schlug vor, wir sollten uns endlich setzen. Ein Kellner näherte sich, also überflogen wir die Speisekarte und bestellten. Danach plauderten wir ein paar Minuten. Obwohl ich mich bemühte, die Folgen meiner selbstauferlegten Einsamkeit herunterzuspielen, hatte Charlene meine Geistesabwesenheit sofort bemerkt. Sie beugte sich vor und lächelte.
»Also, was ist nun wirklich mit dir los?« fragte sie.
Ich blickte ihr in die Augen und merkte, daß sie echtes Interesse an der Frage zu haben schien. »Du mußt immer gleich die ganze Geschichte hören, stimmt´s?«
»Immer«, bestätigte sie.
»Nun, um ehrlich zu sein, nehme ich mir einfach etwas Zeit für mich. Ich lebe unten am See und denke daran, meinem Leben eine völlig andere Richtung zu geben.«
»Ich erinnere mich an den See. Ich dachte, deine Schwester und du, ihr hättet das Haus dort verkauft.«
»Bisher noch nicht. Aber da das Land so nah an der Stadtgrenze liegt, werden andauernd die Steuern erhöht.«
Sie nickte. »Und was dann?«
»Ich weiß noch nicht. Irgend etwas ganz anderes.«
Sie sah mich neugierig an. »Klingt, als seist du ebenso rastlos wie alle anderen heutzutage.« »Möglich«, sagte ich. »Wie kommst du darauf?«
»Es steht in dem Manuskript.«
Schweigend erwiderte ich ihren Blick.
»Erzähl mir von dieser Handschrift«, sagte ich.
Sie lehnte sich zurück, als müßte sie ihre Gedanken sammeln, dann blickte sie mir wieder in die Augen. »Ich glaube, ich habe dir bereits am Telefon erzählt, daß ich vor einigen Jahren meinen Job bei der Zeitung aufgegeben habe und bei einem Forschungsunternehmen anfing, das im Auftrag der UN mit der Erhebung kultureller und demographischer Veränderungen beauftragt ist. Mein letzter Auftrag dort führte mich nach Peru.
Während einiger Recherchen an der Universität von Lima stieß ich immer wieder auf Gerüchte über den Fund einer alten Handschrift – allerdings schien niemand in der Lage, mir Genaueres zu sagen, nicht einmal das Archäologische oder das Ethnologische Institut. Als ich mich mit der Regierung in Verbindung setzte, leugnete man dort jede Kenntnis von der Schrift. Schließlich erzählte mir jemand, daß die Regierung die Existenz des Dokumentes aus irgendeinem Grund zu unterschlagen versuchte. Doch Genaueres wußte er auch nicht.
Du weißt ja, wie neugierig ich bin«, fuhr sie fort. »Sobald mein eigentlicher Auftrag erfüllt war, entschied ich mich, noch ein paar Tage zu bleiben und der Sache auf den Grund zu gehen. Zuerst geriet ich von einer Sackgasse in die nächste. Aber eines Tages aß ich in einem Café außerhalb von Lima zu Mittag und bemerkte, daß ich von einem alten Priester beobachtet wurde. Nach ein paar Minuten trat er schließlich an meinen Tisch und gestand, daß er am Morgen des gleichen Tages von meiner Suche nach dem Manuskript gehört hatte. Er weigerte sich zwar, mir seinen Namen zu geben, willigte aber ein, mir alle meine Fragen zu beantworten.«
Einen Augenblick zögerte sie und schaute mich dabei unverwandt an. »Er behauptete, daß die Handschrift aus dem Jahr 600 vor Christus stamme und eine massive Transformation der menschlichen Gesellschaft voraussagt.«
»Für wann?«
»Für die letzten Jahrzehnte des zwanzigsten Jahrhunderts.« »Für jetzt?« »Ja, jetzt.«
»Um was für eine Transformation soll es sich denn handeln?« fragte ich.
Sie wirkte ein wenig verlegen, bevor sie mit Nachdruck weitersprach. »Der Priester ließ mich wissen, daß es sich um eine Wiedergeburt des Bewußtseins handelt, die sehr langsam vonstatten geht. Sie ist spiritueller und nicht religiöser Natur. Wir sind angeblich dabei, etwas bahnbrechend Neues über die menschliche Lebensform auf diesem Planeten zu entdecken, etwas, das uns den Sinn unserer Existenz erklären und unsere Kultur dramatisch verändern wird.«
Wieder hielt sie inne und fügte dann hinzu: »Der Priester sagte mir, daß die Handschrift aus unterschiedlichen Abschnitten bestehe, von denen jeder eine besondere Erkenntnis über unser Leben enthält. Die Schrift sagt voraus, daß die Menschen unserer Zeit damit beginnen werden, diese Erkenntnisse eine nach der anderen zu verstehen, und sich dadurch auf eine vollkommen spirituelle Daseinsform zubewegen.«
Ich schüttelte den Kopf und hob zynisch eine Augenbraue. »Und das glaubst du?«
»Nun«, sagte sie. »Ich bin zumindest der Ansicht ...«
»Schau dich doch um«, unterbrach ich sie und zeigte auf die Gäste des Restaurants im Raum unter uns. »Das hier ist die Realität. Kannst du irgendeine Veränderung erkennen?«
Gerade als ich das gesagt hatte, dröhnte eine zornige Bemerkung von einem der Tische an der Wand gegenüber durch den Raum. Ich verstand nicht, worum es ging, doch war die Bemerkung laut genug gewesen, um das gesamte Lokal verstummen zu lassen. Zunächst dachte ich, es sei ein weiterer Diebstahl passiert, dann merkte ich, daß es sich lediglich um eine gewöhnliche Auseinandersetzung handelte. Eine etwa dreißigjährige Frau war erregt aufgesprungen und starrte angewidert auf den ihr gegenüber sitzenden Mann.
»Nein«, schrie sie, »das Problem ist, daß diese Beziehung nicht so läuft, wie ich sie mir vorstelle! Verstehst du? Sie läuft verdammt noch einmal nicht!« Sie rang um ein wenig Fassung, warf ihre Serviette auf den Tisch und verließ das Lokal.
Charlene und ich starrten uns einen Augenblick lang an, einigermaßen schockiert über den Ausbruch, der sich genau in dem Augenblick ereignet hatte, als wir über die Leute im Lokal unter uns gesprochen hatten. Schließlich deutete Charlene mit einer Kopfbewegung in Richtung des Tisches, an dem der Mann jetzt allein saß, und sagte: »Genau diese Realität ist dabei, sich zu verändern.«
»Wie?« fragte ich, immer noch leicht genervt.
»Die Transformation beginnt mit der sogenannten Ersten Erkenntnis, und wenn man dem Priester glauben kann, steigt diese Erkenntnis zunächst aus dem Unterbewußten auf und äußert sich in Form einer tiefen inneren Unruhe.«
»Unruhe?«
»Genau das.«
»Und dann?«
»Genau das ist es! Zuerst sind wir verunsichert. Dem Manuskript zufolge beginnt damit unsere Einsicht in eine andere, neue Form des Erlebens... Gewisse Lebenssituationen scheinen urplötzlich eine andere Qualität zu haben, sie sind intensiver und anregender. Doch wissen wir weder, was das Wesen dieser Erfahrung ist, noch wie wir diese inspirierenden Momente halten können. Und wenn sie vorüber sind, fühlen wir uns unbefriedigt und rastlos, gefangen in einem Leben, das nun wieder gewöhnlich und uninteressant zu sein scheint.«
»Du meinst, daß innere Unruhe hinter dem Ausbruch der Frau gestanden hat?«
»Ja. Sie unterscheidet sich darin kein bißchen von uns. Wir alle suchen nach einem kleinen bißchen mehr Erfüllung und wollen nichts mehr mit Dingen zu tun haben, die uns runterziehen. Diese Unruhe steht hinter dieser ›Ich-zuerst‹-Einstellung der letzten Jahrzehnte und betrifft jeden, von den Jungs auf der Wall Street bis hin zu denen in den Straßengangs.«
Sie sah mir direkt in die Augen. »Und was Beziehungen angeht, haben wir so hohe Anforderungen entwickelt, daß wir sie nahezu unmöglich machen.«
Automatisch erinnerte ich mich bei diesen Worten an meine beiden letzten Beziehungen. Beide hatten mit der gleichen Intensität begonnen und waren vor Ablauf eines Jahres gründlichst gescheitert. Als ich meine Aufmerksamkeit wieder Charlene zuwandte, wartete sie noch auf meine Antwort.
»Und was machen wir in unseren Beziehungen falsch?« fragte ich.
»Auch darüber habe ich mit dem Priester lange Zeit gesprochen«, erwiderte sie. »Er meint, daß ein Krieg der Egos unvermeidlich ist, wenn beide Partner innerhalb einer Beziehung zu fordernd sind und vom anderen verlangen, in seiner Welt aufzugehen oder für seine Aktivitäten dauernd verfügbar zu sein.«
Was sie sagte, kam mir nur allzu bekannt vor. Meine beiden letzten Beziehungen waren im wahrsten Sinne des Wortes zu reinen Machtkämpfen verkommen. In beiden hatte sich ein starker Interessenkonflikt gezeigt, war alles zu schnell gegangen. Wir hatten uns zuwenig Zeit genommen, um über unsere unterschiedlichen Ansichten zu sprechen, Ansichten darüber, was wir mit unserer Zeit anfangen sollten, welchen Weg wir einschlagen und welchen Interessen wir gemeinsam nachgehen sollten. Am Ende war der Streit darüber, wer den Ton angab und den Tagesablauf bestimmte, zu einem unüberwindlichen Hindernis geworden.
»Aufgrund dieser Machtkämpfe«, fuhr Charlene fort, »wird es immer schwieriger, mit einer Person für längere Zeit zusammenzubleiben.«
»Klingt nicht sonderlich spirituell.«
»Das habe ich dem Priester auch gesagt«, erwiderte sie. »Doch er gab zu bedenken, daß die meisten gesellschaftlichen Mißstände auf diese innere Unruhe zurückzuführen seien; daß diese Probleme nur vorübergehender Natur sind und schließlich überwunden werden. Dann werden wir endlich verstehen, wonach wir eigentlich suchen und was diese scheinbar so erfüllende Erfahrung in Wirklichkeit ausmacht. Und in dem Augenblick werden wir die Erste Erkenntnis gewonnen haben.«
Das Essen kam, und wir unterbrachen unser Gespräch, während der Kellner Wein nachschenkte und wir gegenseitig von unseren Tellern naschten. Als sie über den Tisch langte, um sich einen Bissen Lachs von meinem Teller zu angeln, rümpfte sie die Nase und kicherte. Mir fiel wieder auf, wie sehr ich ihre Gesellschaft genoß.
»Okay«, sagte ich schließlich. »Nach welcher Erfahrung suchen wir? Wie lautet die Erste Erkenntnis?«
Sie zögerte, als sei sie sich nicht sicher, wo genau sie anfangen sollte. »Das läßt sich nicht so einfach erklären«, sagte sie. »Der Priester hat es folgendermaßen ausgedrückt. Er sagte: Die Erste Erkenntnis wird wirksam, sobald wir uns der Zufälle in unserem Leben bewußt werden.«
Sie beugte sich vor. »Hast du jemals eine Eingebung oder Ahnung bei irgendeinem Vorhaben gehabt, vielleicht wenn es um eine Veränderung in deinem Leben ging? Dich gefragt, wie genau es funktionieren könnte? Und nachdem du die Sache wieder halb vergessen hattest, führte dich eine Begegnung, irgendein Buch oder ein bestimmter Ort genau zu deinem Ziel.
Im Augenblick häufen sich diese Zufälle, und jedesmal, wenn sie sich ereignen, scheint es uns, als reichten sie weit über unseren Begriff von reinem Zufall oder Glück hinaus. Ein Gefühl der Vorherbestimmung tritt ein, so als würde unser Leben durch eine unerklärliche Kraft gesteuert. Dieses Erleben hat etwas Geheimnisvolles und Aufregendes, und deshalb fühlen wir uns lebendiger.
Der Priester erklärte, daß wir alle bereits kurze Momente dieser Empfindung hatten und bemüht sind, diesen Zustand festzuhalten. Jeden Tag sind mehr Menschen davon überzeugt, daß diese mysteriösen Gefühlsregungen echt sind, daß sie etwas zu bedeuten haben, daß noch etwas anderes hinter unserem Alltag liegt. Sich dessen voll bewußt zu sein, darin besteht die Erste Erkenntnis.«
Sie blickte mich erwartungsvoll an, doch ich sagte nichts.
»Verstehst du nicht?« fragte sie. »Die Erste Erkenntnis ist eine neue Sicht auf das Geheimnis des menschlichen Lebens. Wir alle unterliegen diesen merkwürdigen Fügungen, und obwohl wir sie noch nicht verstehen, wissen wir doch, daß sie real sind. Wie damals in unserer Kindheit fühlen wir, daß noch eine andere Seite des Lebens existiert, eine, die es noch zu entdecken gilt – etwas, was sich hinter den Kulissen abspielt.«
Charlene lehnte sich noch weiter vor und gestikulierte wild, während sie sprach.
»Du glaubst wirklich daran, nicht wahr?« fragte ich.
»Ich erinnere mich an Zeiten«, sagte sie streng, »in denen du derjenige gewesen wärst, der über derartige Erfahrungen gesprochen hätte.«
Diese Bemerkung traf mich. Sie hatte recht. Es hatte in meinem Leben tatsächlich eine Zeit gegeben, in der ich derartige Fügungen erlebt und sogar versucht hatte, sie psychologisch zu verstehen. Doch irgendwann hatte sich meine Betrachtungsweise verändert. Aus irgendeinem Grund hatte ich damit begonnen, derartige Betrachtungen für unreif und unrealistisch zu halten, und schließlich ganz aufgehört, sie zur Kenntnis zu nehmen.
Ich blickte Charlene in die Augen und verteidigte mich. »Vermutlich beschäftigte ich mich zu jener Zeit gerade mit östlicher Philosophie oder christlicher Mystik. Wie dem auch sei, das, was du die Erste Erkenntnis nennst, ist bereits tausendfach beschrieben worden. Was soll jetzt plötzlich neu daran sein? Auf welche Weise kann die Wahrnehmung irgendwelcher geheimnisvoller Begebenheiten zur Transformation der menschlichen Kultur führen?«
Charlene blickte einen Moment lang vor sich auf den Tisch und dann wieder mir in die Augen.
»Versteh mich nicht falsch«, sagte sie. »Dieses Bewußtsein ist natürlich schon vorher erfahren und beschrieben worden. Der Priester wies mich extra darauf hin, daß es sich bei der Ersten Erkenntnis nicht um etwas sonderlich Neues handelt. Er sagte, daß sich einzelne Menschen immer dieser unerklärlichen Fügungen bewußt gewesen seien und daß sie hinter vielen großen philosophischen und religiösen Ansätzen stehen. Der Unterschied besteht in der Häufigkeit ihres Auftretens. Dem Priester zufolge ist jetzt die Zeit für die Transformation gekommen, weil sich immer mehr Individuen dieser Fügungen bewußt sind«.
»Und was genau soll das bedeuten?« fragte ich.
»Er sagte, daß sich die Anzahl dieser Menschen mit dem Einsetzen der sechsten Dekade des zwanzigsten Jahrhunderts sprunghaft vermehren würde. Er meinte weiterhin, daß die Zahl bis zum Beginn des nächsten Jahrhunderts drastisch zunehmen wird, bis die kritische Masse erreicht ist.
Das Manuskript sagt voraus, daß unsere Kultur die schicksalhaften Fügungen ernst nehmen wird, sobald die kritische Masse erreicht ist. Dann werden Menschen massenhaft vor der Frage stehen, welchem geheimnisvollen Prozeß menschliches Leben auf unserem Planeten unterliegt. Und genau diese Frage, zur gleichen Zeit von genügend Menschen gestellt, wird dafür sorgen, daß weitere Erkenntnisse in unser Bewußtsein drängen. Wenn eine ausreichende Menge von Leuten ernsthaft beginnt zu hinterfragen, was Leben eigentlich bedeutet, so werden wir es auch herausfinden. Dann werden weitere Erkenntnisse enthüllt werden..., eine nach der anderen.«
Sie nahm einen Bissen von ihrem Teller.
»Und haben wir diese Erkenntnisse erst einmal verstanden«, so hakte ich nach, »dann wird sich die gesamte menschliche Kultur verwandeln?«
»Das hat der Priester jedenfalls gesagt«, versicherte sie mir.
Für einen Augenblick starrte ich sie an und ließ die Idee einer kritischen Masse auf mich wirken. »Weißt du was? Für ein Manuskript aus dem Jahre 600 vor Christus klingt das ziemlich fortgeschritten.«
»Ich weiß«, gab sie zurück. »Diesen Einwand hatte ich auch. Doch der Priester versicherte mir, daß die Gelehrten, die als erste mit der Übersetzung der Handschrift beauftragt waren, absolut keinen Zweifel an ihrer Authentizität hegen. Vor allem deshalb, weil das Manuskript in der gleichen Sprache geschrieben wurde wie auch ein Großteil des Alten Testaments, in Aramäisch.«
»Aramäisch in Südamerika? Wie soll das 600 vor Christus möglich gewesen sein?«
»Das wußte der Priester auch nicht.«
»Steht seine Kirche hinter den Aussagen des Manuskriptes?« fragte ich.
»Nein«, sagte sie. »Die meisten Geistlichen versuchen die Existenz der Handschrift mit allen Mitteln geheimzuhalten. Deshalb wollte er mir seinen Namen nicht nennen. Offenbar stellte schon die Tatsache, daß er darüber sprach, eine große Gefahr für ihn dar.«
»Hat er erwähnt, weshalb die meisten der Kirchenleute dagegen sind?« »Weil es die Allmacht ihrer Religion in Frage stellt.« »Wie das?«
»Ich weiß es nicht genau. Er hat nicht viel darüber gesagt, aber offensichtlich gehen einige der Erkenntnisse so weit, daß manche der Kirchenältesten die traditionellen Inhalte ihrer Kirche in Frage gestellt sehen. Man ist offenbar der Ansicht, alles sei gut so, wie es ist.«
»Verstehe.«
»Der Priester war nicht der Meinung, daß die Handschrift die Grundsätze der Kirche untergrabe. Sie erklärt einfach die Bedeutung der spirituellen Wahrheit. Er war fest davon überzeugt, daß die Kirchenführer es ebenso sehen würden, sollte es ihnen gelingen, das Leben wieder als Mysterium zu begreifen und dadurch zu den anderen Erkenntnissen vorzudringen.«
»Hat er gesagt, wie viele dieser Erkenntnisse es gibt?«
»Nein, aber er hat die Zweite Erkenntnis erwähnt. Er sagte, daß es sich um eine wahrhaftigere Interpretation unserer jüngsten Geschichte handele, eine, die die Transformation angeblich noch weiter erhellt.«
»Hat er das ausgeführt?«
»Nein, dazu hatte er keine Zeit. Er mußte fort, um sich um seine Angelegenheiten zu kümmern. Wir verabredeten uns für den Nachmittag in seinem Haus, doch als ich dort eintraf, war er nicht dort. Ich habe drei Stunden vergebens auf ihn gewartet. Schließlich mußte ich gehen, um meinen Flug noch zu erwischen.«
»Willst du damit sagen, daß du danach nie wieder mit ihm gesprochen hast?«
»Genau das. Ich habe ihn nie wieder zu Gesicht bekommen.«
»Und von Regierungsseite hat dir auch niemand die Existenz dieses Manuskriptes bestätigt?«
»Niemand.«
»Wann war das?«
»Ungefähr vor sechs Wochen.«
Wir aßen eine Weile schweigend. Schließlich sah Charlene von ihrem Teller auf und fragte: »Was hältst du von der Sache?«
»Ich weiß nicht«, sagte ich. Ein Teil in mir bezweifelte zutiefst, daß Menschen überhaupt in der Lage waren, sich grundlegend zu verändern. Ein anderer Teil von mir war fasziniert von der Idee, daß ein derartiges Manuskript existierte.
»Hat er dir eine Kopie oder sonst einen Beweis für die Existenz der Schrift gezeigt?« fragte ich.
»Nein, alles, was ich habe, sind meine Aufzeichnungen.«
Wir schwiegen wieder.
»Um ehrlich zu sein«, sagte sie, »habe ich gedacht, daß dich diese Sache ein bißchen mehr begeistern würde.«
Ich sah sie an. »Ich schätze, ich brauche einen Beweis dafür, daß das alles wahr ist.« Sie grinste.
»Weshalb grinst du?« fragte ich. »Genau das habe ich auch gesagt.« »Zu wem, dem Priester?« »Ja.«
»Was hat er geantwortet?«
»Daß die Erfahrung der Beweis ist. Er meint, daß die Aussagen des Manuskriptes nur durch persönliche Erfahrungen gültig werden. Wenn wir wirklich darauf achten, wie wir uns fühlen und wie sich unser Leben zu diesem Zeitpunkt entwickelt, dann werden wir erkennen, daß die Handschrift einen Sinn ergibt, sie uns sogar bekannt vorkommt.« Sie zögerte einen Augenblick. »Geht es dir nicht so?«
Ich überlegte einen Augenblick. Ergab es wirklich einen Sinn? War jeder so rastlos wie ich, und wenn ja, resultierte diese Rastlosigkeit aus der simplen Einsicht – einer simplen Einsicht, die dreißig Jahre gebraucht hatte, um sich mitzuteilen –, daß mehr hinter dem Leben steckt, als wir wahrhaben wollten, mehr, als wir in der Lage waren zu erfahren?
»Ich bin mir nicht ganz sicher«, sagte ich schließlich, »vermutlich brauche ich ein wenig Zeit, um darüber nachzudenken.«
Ich trat hinaus in den Garten neben dem Restaurant und stellte mich hinter eine Bank aus Zedernholz, die vor einem Springbrunnen stand. Rechts von mir sah ich die blinkenden Lichter des Flughafens und hörte die brüllenden Turbinen eines Jets, der sich zum Start bereit machte.
»Was für wunderschöne Blumen«, sagte Charlene von hinten. Ich drehte mich um und sah, wie sie den kleinen Pfad entlang auf mich zukam und dabei die Beete mit Petunien und Begonien bewunderte. Sie stellte sich neben mich, und ich legte ihr meinen Arm um die Schultern. Vor Jahren hatten wir beide in Charlottesville, Virginia, gewohnt und viele Abende mit Gesprächen verbracht. Meistens war es dabei um akademische Theorien oder psychologisches Wachstum gegangen. Uns hatten diese Gespräche gleichermaßen fasziniert – und wir uns gegenseitig auch. Trotzdem fiel mir mit einem Mal auf, wie platonisch unsere Beziehung immer verlaufen war.
»Ich kann dir gar nicht sagen, wie schön es ist, dich wiederzusehen«, eröffnete sie das Gespräch.
»Geht mir auch so«, gab ich zurück. »Eine Menge Erinnerungen kommen bei mir hoch, wenn ich dich so sehe.«
»Ich frage mich, weshalb wir uns aus den Augen verloren haben«, sagte sie.
Ihre Frage brachte mich wieder auf den Boden der Tatsachen. Ich erinnerte mich, wie ich Charlene das letzte Mal gesehen hatte. Sie hatte mir am Auto auf Wiedersehen gesagt. Damals war ich voller neuer Ideen und Vorsätze gewesen und gerade dabei, meine Heimat zu verlassen, um mit mißhandelten Kindern zu arbeiten. Ich bildete mir ein zu wissen, wie diese Kinder ihre intensiven Reaktionen und ihr obsessives Verhalten, das sie an ihrer Weiterentwicklung hinderte, überwinden konnten. Doch mit der Zeit hatte mein Ansatz versagt, und ich war gezwungen worden, mir meine völlige Unwissenheit einzugestehen. Auf welche Weise Menschen sich von ihrer Vergangenheit befreien konnten, war mir weiterhin ein Rätsel geblieben.
Blickte ich jetzt auf die letzten sechs Jahre zurück, so merkte ich, daß die Erfahrung sich gelohnt hatte. Trotzdem war mein innerer Drang, mich weiterzubewegen, stärker geworden. Doch wohin sollte ich gehen? Und was tun? Seit Charlene mir geholfen hatte, meine Theorien über Traumata der Kindheit auszuarbeiten, hatte ich nur ein paar Mal an sie gedacht, und jetzt war sie wieder hier, und unsere Unterhaltung schien mir genauso aufregend wie damals in Charlottesville.
»Ich glaube, ich bin vollkommen in meiner Arbeit untergetaucht«, sagte ich.
»Ich auch«, erwiderte sie. »Bei der Zeitung jagte eine Story die nächste. Zwischendurch hatte ich kaum Zeit aufzuschauen. Ich habe alles andere um mich herum vergessen.«
Ich drückte ihr sanft die Schulter. »Weißt du, Charlene, ich hatte völlig vergessen, wie gut wir uns unterhalten können; unsere Gespräche sind so spontan und mühelos.« Ich wollte noch mehr sagen, als Charlene mir plötzlich über die Schulter sah und in Richtung des Restaurants starrte. Ihr Gesicht war bleich, und mit einem Mal wirkte sie nervös.
»Was ist los?« fragte ich und drehte mich ebenfalls um. Ein paar Leute schlenderten beiläufig über den Parkplatz, doch sonst war nichts Außergewöhnliches zu sehen. Charlene schien immer noch alarmiert und verwirrt.
»Was war?« fragte ich wieder.
»Dort drüben, bei der ersten Reihe des Parkplatzes – hast du dort den Mann im grauen Hemd gesehen?«
Wieder ließ ich meinen Blick über den Parkplatz schweifen. Eine weitere Gruppe von Leuten verließ das Restaurant. »Welchen Mann?«
»Ich glaube, jetzt ist er weg«, sagte sie und streckte sich, um einen besseren Überblick zu bekommen.
Sie sah mir wieder in die Augen. »Man hat den Dieb, der meinen Aktenkoffer gestohlen hat, als Mann mit schütterem Haar und grauem Hemd beschrieben. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich ihn gerade drüben bei den Autos gesehen... Er hat uns beobachtet.«
Mein Magen zog sich vor Angst zusammen. Ich versicherte ihr, daß ich gleich wieder bei ihr sein würde, und inspizierte den Parkplatz, wobei ich sie nicht aus den Augen ließ. Doch ich entdeckte niemanden, auf den die Beschreibung gepaßt hätte.
Als ich wieder neben ihr stand, trat Charlene einen Schritt näher und sagte mit ruhiger Stimme: »Meinst du, dieser Kerl glaubt, daß ich eine Kopie des Manuskriptes habe? Hat er vielleicht deshalb meinen Aktenkoffer gestohlen?«
»Ich weiß nicht«, sagte ich. »Aber wir werden jetzt wieder die Polizei einschalten und sie darüber informieren, was du gesehen hast. Ich werde außerdem dafür sorgen, daß die Passagierliste deines Fluges überprüft wird.«
Wir begaben uns wieder ins Innere des Restaurants und riefen die Polizei. Als sie eintraf, lieferten wir eine kurze Beschreibung des Mannes. Zwanzig Minuten verbrachten sie damit, jeden Wagen auf dem Parkplatz zu überprüfen, dann erklärten sie uns, daß sie nicht noch mehr Zeit mit dem Fall verbringen könnten. Allerdings waren sie bereit, die Passagiere von Charlenes Flug zu überprüfen.
Nachdem die Polizei gegangen war, standen Charlene und ich allein am Springbrunnen.
»Wovon haben wir noch mal geredet, bevor der Kerl auftauchte?« fragte sie.
»Wir haben über uns gesprochen«, antwortete ich. »Charlene, warum in aller Welt hast du mich in dieser Angelegenheit aufgesucht?«
Sie sah mich perplex an. »Als der Priester in Peru mir von dem Manuskript erzählte, mußte ich immer wieder an dich denken.«
»Was du nicht sagst.«
»Damals habe ich mir nicht viel dabei gedacht«, fuhr sie fort. »Doch später, in Virginia, mußte ich jedesmal an dich denken, wenn mir das Manuskript einfiel. Ich hatte schon ein paar Mal den Hörer in der Hand, um dich anzurufen, doch es kam immer etwas dazwischen. Dann kam der Auftrag in Miami, und an Bord der Maschine stellte ich fest, daß ich hier Aufenthalt habe. Nach der Landung suchte ich im Telefonbuch nach deiner Nummer. Obwohl dein Anrufbeantworter sagte, daß man dich nur in Notfällen am See stören sollte, entschied ich, daß du in meinem Fall eine Ausnahme machen würdest.«
Einen Augenblick sah ich sie schweigend an und wußte nicht, was ich von ihr halten sollte. »Ich bin froh, daß du angerufen hast«, sagte ich schließlich.
Charlene warf einen schnellen Blick auf ihre Uhr. »Es wird Zeit. Ich muß zurück zum Flughafen.«
»Ich bringe dich hin«, sagte ich.
Wir fuhren zum Hauptgebäude und näherten uns den Schaltern. Aufmerksam hielt ich Ausschau nach etwas Außergewöhnlichem. Als wir den Schalter erreicht hatten, gingen die Passagiere bereits an Bord, und ein Polizist war damit beschäftigt, die Fluggäste zu observieren. Er versicherte uns, daß sich niemand an Bord der Maschine befinde, auf den die Beschreibung zutreffe.
Wir dankten ihm, und nachdem er gegangen war, drehte Charlene sich um und lächelte mich an. »Ich glaube, ich geh' jetzt besser«, sagte sie, legte ihren Arm um meinen Hals und zog mich an sich. »Hier sind meine Telefonnummern. Diesmal sollten wir uns nicht aus den Augen verlieren.«
»Ich möchte, daß du auf dich aufpaßt«, sagte ich. »Wenn irgend etwas Ungewöhnliches passiert, ruf sofort die Polizei!«
»Mach dir um mich keine Sorgen«, antwortete sie. »Mir passiert schon nichts.«
Einen Moment lang blickten wir einander tief in die Augen.
»Was wirst du nun in bezug auf das Manuskript unternehmen?« fragte ich.
»Ich weiß nicht. Auf neue Informationen warten, vermutlich.«
»Was, wenn sie unterdrückt werden?«
Sie schenkte mir ein bezauberndes Lächeln. »Wußte ich's doch«, sagte sie. »Du kannst jetzt schon an nichts anderes mehr denken. Ich habe dir ja gesagt, daß du begeistert sein würdest. Was wirst du wegen des Manuskriptes unternehmen?«
Ich zuckte mit den Achseln. »Aller Wahrscheinlichkeit nach werde ich versuchen, mehr darüber herauszufinden.«
»Gut. Wenn du es schaffst, laß es mich wissen.«
Wir verabschiedeten uns zum zweiten Mal, dann ging sie. Ich sah, wie sie sich noch einmal umdrehte, mir zuwinkte und dann in dem langen Korridor verschwand, der das Flughafengebäude mit der Maschine verband. Ich schlenderte zu meinem Geländewagen zurück und machte mich ohne Umwege auf den Rückweg zum See.
Daheim angekommen, setzte ich mich in einen der Schaukelstühle auf der mit Fliegendraht vergitterten Veranda. Die Grillen und Baumfrösche machten einen Heidenkrach, und in weiter Ferne hörte ich den unverwechselbaren Ruf des Schreienden Ziegenmelkers. Der Mond weiter westlich hing nun tiefer über dem See, sein Licht lief als durchbrochene Linie über die Oberfläche des Wassers direkt auf mich zu.
Es war ein interessanter Abend gewesen, doch was ihre Theorie der kulturellen Transformation anging, blieb ich weiterhin skeptisch. Wie viele in meiner Generation war auch ich dem sozialen Idealismus der Sechziger und Siebziger verfallen, selbst die spirituelle Suche der Achtziger hatte ich nicht ausgelassen. Was in Wirklichkeit vor sich ging, war allerdings weitaus schwerer zu beurteilen. Was sollte das für eine neue Information sein, die imstande wäre, die Welt des Menschen auf grundlegende Weise zu verändern? Das klang mir alles zu idealistisch und zu weit hergeholt. Schließlich und endlich lebten wir seit ewigen Zeiten auf diesem Planeten. Weshalb sollten wir ausgerechnet jetzt eine Erkenntnis über den Sinn unserer Existenz erhalten? Ich starrte noch ein paar Minuten auf das Wasser, dann löschte ich das Licht und ging ins Schlafzimmer, um zu lesen.
Am nächsten Morgen erwachte ich unvermittelt aus einem Traum, der mich bis weit in den Tag hinein verfolgte. Ein oder zwei Minuten lag ich auf dem Rücken im Bett, starrte an die Decke und konnte mich dabei an jedes Detail erinnern. Auf der Suche nach etwas hatte ich mir den Weg durch einen Wald gebahnt, einen Wald von immenser Größe und außergewöhnlicher Schönheit.
Im Lauf meiner Suche war ich immer wieder in Situationen geraten, in denen ich mir vollkommen verloren und verwirrt vorgekommen war und in denen ich beim besten Willen nicht mehr gewußt hatte, wie es weitergehen sollte. Auf geradezu unglaubliche Art war in diesen Momenten wie aus dem Nichts jedes Mal eine Person aufgetaucht, um mir dabei zu helfen, den nächsten Schritt zu planen. Der Gegenstand meiner Suche war mir nicht klargeworden, doch nach dem Traum fühlte ich mich unwahrscheinlich gut gelaunt und voller Selbstvertrauen.
Ich setzte mich im Bett auf und bemerkte einen Sonnenstrahl, der durch das Fenster in den Raum drang. Staubkörnchen tanzten glitzernd darin. Ich stand auf und zog die Vorhänge zurück. Der Tag war wunderschön: blauer Himmel und strahlender Sonnenschein, eine schwache Brise bewegte die Baumwipfel. Um diese Tageszeit würde der See bewegt und glitzernd vor mir Hegen und der Wind kühl über meine nasse Haut streichen, wenn ich aus dem Wasser kam.
Ich ging vor die Tür, und kopfüber sprang ich in den See. Ich kam an die Oberfläche und schwamm auf dem Rücken hinaus in die Mitte des Gewässers, um die vertraute Silhouette der Berge im Auge zu behalten. Der See lag in einem tiefen Tal, von drei Bergketten umgeben: ein perfektes Stück Natur, das mein Großvater in seiner Jugend entdeckt hatte.
Hundert Jahre war es mittlerweile her, seit er zum ersten Mal über diese Gipfel gewandert war, ein jugendlicher Entdecker, ein Naturkind, in einer wilden, intakten Welt voller Pumas, Wildschweine und Creek-Indianer, die in primitiven Behausungen auf der nördlichen Bergkette lebten. Er hatte sich geschworen, eines Tages an diesem Ort seine Zelte aufzuschlagen, zwischen riesigen Bäumen und sieben Frischwasserquellen, und schließlich hatte er sich seinen Traum erfüllt und einen See angelegt; er baute eine Hütte und unternahm zahllose Spaziergänge mit seinem jungen Enkel. Ich hatte die Faszination meines Großvaters, was das Tal betraf, nie ganz verstanden, doch hatte ich mich immer bemüht, den ursprünglichen Zustand des Landes zu erhalten, selbst als die Zivilisation immer näher rückte und den Ort schließlich eingezingelt hatte.
Von der Mitte des Sees konnte ich einen besonderen Felsen sehen, der zwischen den Gipfeln der nördlichen Kette hervorragte. Am Vortag war ich, der Tradition meines Großvaters folgend, dort hinaufgeklettert und hatte versucht, ein wenig inneren Frieden zu finden in der Aussicht, dem Geruch und der Art und Weise, wie der Wind durch die Baumkronen wirbelte. Und während ich dort oben gesessen und den See und das spärliche Laubwerk im Tal unter mir betrachtet hatte, fühlte ich mich langsam besser, als ob die Atmosphäre und die Aussicht dort oben eine Blockade in meinem Kopf gelöst hätten. Wenige Stunden später hatte ich mit Charlene gesprochen und von der Existenz der alten Schrift erfahren.
Ich schwamm zurück und zog mich auf den alten Holzsteg vor der Hütte. Es war alles etwas viel auf einmal. Eben war ich noch ein Eremit in den Bergen gewesen, völlig unzufrieden mit meinem Leben, bis aus heiterem Himmel Charlene aufgetaucht war und mir den Grund für mein Unwohlsein erklärte – dabei zu allem Überfluß aus irgendeiner alten Handschrift zitierte, die vorgab, die Geheimnisse der menschlichen Existenz offenzulegen.
Trotzdem wußte ich, daß Charlenes Ankunft genau jene Art von Fügung war, auf die das Manuskript anspielte, eine, bei der es sich nicht um bloßen Zufall gehandelt haben konnte. Sollte dieses uralte Dokument am Ende recht haben? Waren wir trotz unseres Zynismus und unserer Selbstverleugnung dabei, eine kritische Masse von Leuten zu bilden, die ein Bewußtsein für diese schicksalhaften Fügungen entwickelte? Hatte der Mensch endlich eine Position erreicht, die es ihm ermöglichte, diese Phänomene zu verstehen und damit endlich den Sinn des Lebens zu erfassen?
Wie, so fragte ich mich, könnte ein derartiges Erfassen aussehen? Würden die in der Schrift verbleibenden Erkenntnisse uns Aufschluß darüber geben – so wie der Priester gesagt hatte?
Ich stand vor einer Entscheidung. Durch das Manuskript hatte mein Leben eine neue Perspektive bekommen, und es stellte eine Herausforderung für mich dar. Die Frage war jetzt, was ich tun sollte. Ich konnte entweder hierbleiben oder eine Möglichkeit finden, der Sache auf die Spur zu kommen. Der Gedanke an die Gefahren einer derartigen Unternehmung schoß mir durch den Kopf. Wer hatte Charlenes Aktenkoffer gestohlen? War jemand daran interessiert, die Nachricht von der Existenz des Manuskriptes zu unterschlagen? Wie sollte ich das herausfinden?
Ich wägte die möglichen Risiken sorgfältig ab, und schließlich gewann mein Optimismus die Oberhand. Ich entschied, mir vorerst keine Sorgen zu machen und mich langsam vorzutasten. So begab ich mich ins Innere des Hauses und wählte die Nummer der Reiseagentur mit der größten Anzeige auf den Gelben Seiten. Der Mann von der Agentur sagte, er könne in der Tat eine Reise nach Peru organisieren.
Um genau zu sein, habe sich in letzter Minute ein Reiserücktritt ereignet – ein Flug inklusive Hotelreservierung in einem Hotel in Lima. Ich würde das gesamte Paket zu einem Sonderpreis übernehmen können, so sagte er ..., vorausgesetzt, ich wäre in drei Stunden abreisebereit.
Drei Stunden?
Das verlängerte Jetzt
Nach einem wahren Packanfall und einem Höllenritt über die Autobahn traf ich gerade noch rechtzeitig genug am Flughafen ein, um mein Ticket in Empfang zu nehmen und mich an Bord des Flugzeuges nach Peru zu begeben. Als ich mich zum Heck des Fliegers vorgearbeitet hatte und mich endlich in meinen Fenstersitz fallen ließ, übermannte mich tiefe Erschöpfung.
Eigentlich wollte ich ein Nickerchen machen, doch nachdem ich mich ausgestreckt und die Augen geschlossen hatte, merkte ich, daß es mir unmöglich war, mich zu entspannen. Ich war mit einem Mal nervös und hatte nun mehr als gemischte Gefühle, was diese Reise anging. Hatte ich den Verstand verloren, so ohne Vorbereitungen aufzubrechen? Wohin sollte ich in Peru? Mit wem dort Kontakt aufnehmen?
Die Zuversicht, die mich am See erfüllt hatte, verwandelte sich jetzt in Windeseile in tiefe Skepsis. Die Erste Erkenntnis und der Gedanke an eine kulturelle Transformation schienen nun geradezu abstrus und unrealistisch. Und je länger ich darüber nachdachte, desto unwahrscheinlicher erschien mir die Idee von der Existenz einer Zweiten Erkenntnis. Wie um alles in der Welt sollte eine neue Sichtweise der Geschichte unsere Einstellung gegenüber schicksalhaften Fügungen verändern – ein ohnehin heikles Thema – und jene zudem noch im Bewußtsein einer breiten Öffentlichkeit manifestieren?
Ich streckte meine Beine noch ein wenig weiter unter den Vordersitz und atmete tief durch. Möglicherweise war dies ein nutzloses Unterfangen, ein schneller Trip nach Peru und retour. Geldverschwendung vielleicht, doch ansonsten würde mir aus dieser Entscheidung wohl kein weiterer Schaden entstehen.
Der Flieger setzte sich mit einem Ruck in Bewegung und rollte hinaus auf die Startbahn. Ich schloß die Augen und gab mich einem leichten Schwindel hin, der einsetzte, als der Riesenjet die kritische Geschwindigkeit erreicht hatte, abhob und in eine dichte Wolkendecke eintauchte. Als wir die Flughöhe erreicht hatten, gelang es mir endlich, ein wenig zu entspannen, und wenig später war ich eingeschlafen. Nach dreißig oder vierzig Minuten wurde ich durch Turbulenzen geweckt und beschloß, die Waschräume aufzusuchen.
Während ich mich durch die Sitzreihen kämpfte, bemerkte ich einen großgewachsenen Mann mit einer runden Brille, der in der Nähe des Ausgangs mit einer Stewardeß sprach. Er musterte mich scheinbar flüchtig und wandte sich dann wieder seiner Unterhaltung zu. Er hatte dunkelbraunes Haar und war nicht älter als fünfundvierzig. Einen Moment lang glaubte ich, ihn zu kennen, doch nachdem ich seine Gesichtszüge genauer in Augenschein genommen hatte, entschied ich, daß ich mich geirrt haben mußte. Im Vorbeigehen schnappte ich einen Fetzen der Unterhaltung auf.
»Trotzdem noch einmal vielen Dank«, sagte der Mann. »Ich dachte nur, daß Sie vielleicht etwas von diesem Manuskript gehört hätten, so oft wie Sie nach Peru fliegen.« Er drehte sich um und ging in den vorderen Teil des Flugzeugs.
Ich war wie vor den Kopf geschlagen. War etwa von dem gleichen Manuskript die Rede? Ich schloß die Tür des Waschraumes hinter mir und überlegte, was zu tun sei. Ich neigte dazu, dem Vorfall keinerlei Bedeutung beizumessen, vermutlich war irgendein anderes Manuskript gemeint.
So kehrte ich zu meinem Sitzplatz zurück und schloß wieder die Augen, froh darüber, den Vorfall abgeschrieben zu haben und den Mann nicht weiter belästigen zu müssen. Doch dann überkam mich wieder die Erregung, die ich am See gespürt hatte. Was, wenn dieser Mann tatsächlich Informationen über das Manuskript hatte? Ich würde es nie herausfinden, wenn ich ihn nicht fragte.
Meine Entscheidung geriet noch ein paarmal ins Wanken, dann stand ich auf und begab mich in den vorderen Teil der Maschine, wo er etwa auf mittlerer Höhe saß. Direkt hinter ihm befand sich ein leerer Sitz. Ich ging wieder zu meinem Sitz zurück und ließ die Stewardeß wissen, daß ich meinen Sitzplatz wechseln würde, dann nahm ich meine Sachen und bezog den neuen Platz. Nach einigen Minuten tippte ich ihm von hinten auf die Schulter.
»Entschuldigen Sie«, sagte ich. »Ich habe eben zufällig gehört, wie Sie ein Manuskript erwähnten. Handelt es sich dabei zufällig um eines, das gerade in Peru gefunden wurde?«
Er sah mich zunächst überrascht, dann mißtrauisch an. »Ja, in der Tat«, gab er zögernd zu.
Ich stellte mich vor und erklärte ihm, daß eine Bekannte von mir kürzlich aus Peru zurückgekehrt sei und mich von der Existenz der Schrift informiert hatte. Er entspannte sich sichtlich und stellte sich dann als Wayne Dobson vor, Professor an der Geschichtlichen Fakultät der Universität von New York. Im Laufe unserer Unterhaltung bemerkte ich den irritierten Blick meines Nachbarn, der seinen Sitz in Liegeposition gebracht hatte und versuchte zu schlafen. »Haben Sie das Manuskript je zu Gesicht bekommen?« fragte ich den Professor.
»Teile davon«, sagte er. »Und Sie?«
»Nichts. Meine Bekannte hat mich allerdings mit der sogenannten Ersten Erkenntnis vertraut gemacht.« Mein Nachbar wechselte unbehaglich die Stellung.
Dobson warf einen Blick in seine Richtung. »Entschuldigen Sie die Störung. Wäre es zuviel verlangt, wenn Sie den Sitzplatz mit mir tauschen?«
»Nein«, sagte der Mann. »Im Gegenteil.«
Wir traten alle in den Gang hinaus, dann quetschte ich mich ans Fenster, und Dobson nahm den Platz neben mir ein.
»Erzählen Sie mir, was Sie über diese Erste Erkenntnis gehört haben«, sagte Dobson.
Ich besann mich einen Moment und versuchte zu rekapitulieren, was ich davon behalten hatte. »Meiner Ansicht nach handelt es sich bei der Ersten Erkenntnis um das Bewußtsein darüber, daß jene seltsamen lebensverändernden Schicksalsfügungen Teil eines umgreifenderen Prozesses sind.«
Das kam mir jetzt selbst absurd vor.
Dobson fing mein Unbehagen auf. »Was halten Sie von dieser Erkenntnis?« fragte er.
»Ich weiß es beim besten Willen nicht genau«, sagte ich.
»Paßt nicht so recht in unser durchschnittliches Alltagsdenken, nicht wahr? Wäre es nicht viel angenehmer, die ganze Idee über den Haufen zu werfen und sich wieder den praktischen Aspekten des Lebens zuzuwenden?«
Ich mußte lachen und nickte zustimmend.
»Nun, einen Hang dazu hat wohl jeder. Obwohl uns allen gelegentlich ganz klar ist, daß mehr hinter unserem Leben steckt, halten wir derartige Ideen gewöhnlich für rein spekulativ und legen sie, zusammen mit dem Bewußtsein darüber, zu den Akten.
Deshalb wird die Zweite Erkenntnis vonnöten sein. Sobald wir den geschichtlichen Hintergrund unseres Bewußtseins verstehen, wird es auch für uns gültig werden.«
Ich nickte. »Sind Sie als Historiker der Meinung, daß die Voraussage des Manuskriptes von einer umfassenden Transformation zutrifft?«
»Ja.«
»Als Wissenschaftler, als Mann der Tatsachen?«
»Gewiß! Doch dazu müssen Sie Geschichte in der richtigen Weise betrachten.« Er atmete tief ein. »Glauben Sie mir, ich sage dies als jemand, der Jahre damit verbracht hat, Geschichte auf eine falsche Art zu studieren und zu lehren. Ich konzentrierte mich ausschließlich auf die technischen Errungenschaften unserer Zivilisation und die großen Männer, die diese Fortschritte herbeiführten.«
»Was soll daran falsch sein?«
»Soweit nichts. Aber wirklich wichtig ist der globale Überblick über jeden Zeitabschnitt, der Überblick darüber, was Menschen fühlten und dachten. Ich selbst habe lange gebraucht, um das zu verstehen. Es ist die Aufgabe der Geschichtswissenschaft, einen größeren Rahmen für das Verständnis unseres individuellen Lebens zu liefern. Geschichte besteht nicht nur aus technischem Fortschritt; sie ist ebenso die Entwicklungsgeschichte des Geistes. Wenn wir die Realität der Menschen vor uns verstehen lernen, dann werden wir auch verstehen, weshalb wir die Welt sehen, wie wir sie sehen, und worin unser Beitrag zu weiterem Fortschritt bestehen kann. Wir wissen genau, zu welchem Zeitpunkt der Evolution der Mensch ins Spiel gekommen ist, diese Tatsache sollte es doch ermöglichen, eine Idee davon zu bekommen, in welche Richtung wir uns bewegen.«
Er schwieg einen Augenblick und fügte dann hinzu: »Die Zweite Erkenntnis wird uns exakt die benötigte historische Perspektive liefern – zumindest vom Standpunkt unserer westlichen Zivilisation aus. Sie stellt die Vorhersagen des Manuskriptes in einen größeren Rahmen, der ihr Eintreffen nicht nur plausibel, sondern sogar unvermeidlich erscheinen läßt.«
Ich fragte Dobson, wie viele Erkenntnisse er mit eigenen Augen gesehen hatte, und er sagte, daß ihm nur die ersten beiden bekannt seien. Er war auf sie gestoßen, nachdem die Gerüchte über die Existenz der Schrift ihn vor drei Wochen zu einer Reise nach Peru veranlaßt hatten.
»Nach meiner Ankunft in Peru«, so fuhr er fort, »traf ich auf ein paar Leute, die die Existenz des Manuskriptes bestätigen konnten, allerdings geradezu eine Todesangst davor hatten, mit mir darüber zu sprechen. Sie sagten, die Regierung sei verrückt und würde jeden körperlich bedrohen, der Kopien der Schrift besitze oder Informationen darüber weitergebe.«
Sein Gesichtsausdruck wurde ernst. »Das hat mich ziemlich nervös werden lassen. Später erzählte mir dann ein Kellner in meinem Hotel von einem bekannten Priester, der das Manuskript anscheinend des öfteren erwähnte. Der Kellner berichtete, daß der Priester das Bestreben der Regierung bekämpfe, die Existenz der Handschrift zu verheimlichen. Ich konnte der Versuchung nicht widerstehen, das Haus aufzusuchen, in dem der Mann angeblich die meiste Zeit verbrachte.«
Ich muß ihn erstaunt angesehen haben, denn Dobson erkundigte sich, ob mit mir alles in Ordnung sei.
»Meine Bekannte hat ihre Informationen ebenfalls von einem Priester bekommen«, erwiderte ich. »Ihr gegenüber wollte er seinen Namen nicht nennen, doch es gelang ihr, mit ihm über die Erste Erkenntnis zu sprechen. Sie hat sich ein zweites Mal mit ihm verabredet, doch er tauchte nicht wieder auf.«
»Es könnte ein und derselbe Mann sein«, sagte Dobson. »Auch ich konnte ihn nicht mehr finden. Das Haus war verriegelt und schien verlassen.«
»Sie haben den Mann niemals zu Gesicht bekommen?«
»Nein, aber ich beschloß, mich umzuschauen. Es handelte sich um ein altes Lagerhaus, und aus irgendeinem Grund entschied ich, es mir von innen anzusehen. Hinter einem Haufen Gerümpel versteckt und durch ein loses Brett in der Wand verdeckt, fand ich die Übersetzungen der Ersten und der Zweiten Erkenntnis.«
Er sah mich wissend an.
»Sie lagen dort einfach herum?«
»Ja.«
»Haben Sie das Manuskript zufällig bei sich?«
Er schüttelte den Kopf. »Nein. Ich beschloß, es gründlich zu studieren und es dann einigen meiner Kollegen zu überlassen.«
»Würden Sie sich in der Lage sehen, mir eine Zusammenfassung der Zweiten Erkenntnis zu geben?« fragte ich.
Es entstand eine ausgedehnte Pause, dann lächelte Dobson und nickte. »Ich schätze, deshalb sind wir hier.
Die Zweite Erkenntnis«, so fuhr er fort, »setzt unseren augenblicklichen Bewußtseinszustand in eine größere historische Perspektive. Am Ende dieser Dekade werden wir nicht nur das zwanzigste Jahrhundert beendet haben, sondern auch eine tausendjährige Geschichte. Wir sind dabei, das zweite Jahrtausend abzuschließen. Bevor der Westen seinen Standpunkt begreifen kann und versteht, was als nächstes passieren wird, müssen wir verstehen lernen, was in den vergangenen tausend Jahren wirklich geschehen ist.«
»Was genau steht diesbezüglich im Manuskript?«
»Dort steht, daß wir gegen Ende des zweiten Jahrtausends – also jetzt – in der Lage sein werden, unsere gesamte Geschichte als Ganzes zu begreifen. Es steht dort auch, daß wir in der zweiten Hälfte unseres Jahrtausends, also im sogenannten modernen Zeitalter, eine bestimmte Befangenheit erkennen werden. Unser Bewußtsein über die heutzutage so häufig auftretenden Schicksalsfügungen ist ein Zeichen für die Befreiung von dieser Befangenheit.«
»Worin besteht diese Befangenheit?« fragte ich.
Er grinste beinahe schelmisch. »Sind Sie bereit, das Jahrtausend noch einmal zu durchleben?«
»Sicher, schießen Sie los.«
»Es wird nicht ausreichen, wenn ich Ihnen davon lediglich erzähle. Erinnern Sie sich daran, was ich vorhin sagte, daß man lernen muß zu verstehen, wie sich die alltägliche Weltsicht entwickelt hat, wie sie durch die Realität der Menschen, die vor uns lebten, kreiert wurde? Es hat tausend Jahre gebraucht, unseren modernen Standpunkt zu entwickeln, und um zu verstehen, wo genau wir heute stehen, müßten Sie sich eigentlich ins Jahr 1000 zurückversetzen und dann von dort durch das gesamte Jahrtausend schreiten. Ganz so, als ob Sie diesen Zeitabschnitt tatsächlich im Laufe eines Lebens durchlebt hätten.«
»Und wie soll das funktionieren?«
»Ich werde Sie führen.«
Einen Augenblick zögerte ich und starrte aus dem Fenster auf die Landschaftsformationen unter mir. Der Faktor Zeit hatte bereits begonnen, eine andere Rolle zu spielen.
»Ich werde mir Mühe geben«, sagte ich schließlich.
»Okay, stellen Sie sich vor, im Jahr 1000 zu leben. In einer Zeit, die wir das Mittelalter nennen. Das erste, was Sie sich vergegenwärtigen müssen, ist der enorme Einfluß der christlichen Kirche und ihrer mächtigen Vertreter auf die Wahrnehmung der Realität dieser Zeit. Begünstigt durch ihre Position, hatten diese Männer einen gewaltigen Einfluß darauf, was die Bevölkerung dachte. Und die Welt, die diese Kleriker als Realität vorgaben, war vor allen anderen Dingen eine spirituelle. Sie kreierten eine Wirklichkeit, die ihre Auffassung von Gottes Vorhersehung für die Menschheit ins Zentrum des damaligen Lebens rückte.
Versuchen Sie, sich dies genau vorzustellen«, fuhr er fort. »Sie werden in den Stand Ihres Vaters geboren – entweder Bauer oder Aristokrat –, und Sie leben in der Gewißheit, daß Sie für immer auf Ihren angeborenen Stand beschränkt sein werden. Vollkommen unabhängig von Ihrer Standeszugehörigkeit oder davon, welcher Tätigkeit Sie nachgehen, werden Sie bald bemerken, daß Ihre soziale Stellung im Vergleich zu der von den Klerikern definierten spirituellen Realität nur sekundär ist.
Sie entdecken, daß es im Leben scheinbar darum geht, eine Art spirituellen Test zu absolvieren. Die Kleriker behaupten, daß Gott die Menschheit aus einem einzigen Grund zum Mittelpunkt des gesamten Universums gemacht habe: um entweder Erlösung zu erreichen oder aber verdammt zu werden. Und in diesem Prozeß müssen Sie die korrekte Wahl zwischen zwei sich diametral gegenüberstehenden Kräften treffen: der göttlichen Kraft und den heimtückischen Versuchungen des Teufels.
Aber denken Sie daran, daß nicht Sie allein vor dieser Entscheidung stehen«, fuhr er fort. »Genaugenommen sind Sie als einfaches Individuum gar nicht in der Lage, Ihren Status in dieser Angelegenheit selbst zu bestimmen. Dies ist das Vorrecht der Kleriker, ihre Aufgabe ist es, die Schriften zu deuten und über jeden Ihrer Schritte zu richten, darüber zu urteilen, ob er im Einklang mit Gott geschieht oder ob Sie sich vom Satan haben täuschen lassen. Nur wenn Sie den Anweisungen der Kleriker folgen, können Sie auf ein sorgenfreies Leben nach dem Tod hoffen. Doch wehe, es gelingt Ihnen nicht, dem schmalen Pfad ihrer Vorschriften zu folgen, dann, nun..., dann folgen eben Exkommunizierung und ewige Verdammnis.«
Dobson blickte mich begeistert an. »Das Manuskript spricht davon, wie wichtig es sei zu verstehen, daß jeder Aspekt der mittelalterlichen Welt durch die Begrifflichkeiten des Überirdischen bestimmt wurde. Jede Erscheinung des Lebens – vom zufälligen Gewittersturm oder Erdbeben bis hin zur guten Ernte oder dem Tod einer Geliebten – wurde durch den Willen Gottes oder die Böswilligkeit des Teufels definiert. Es existierte kein Konzept über die wahre Natur von Phänomenen wie Wetter oder geologischen Kräften, von Gartenbaukunst oder Krankheit. Das kam alles erst viel später. Im Augenblick jedoch schenken Sie nur den Klerikern Glauben; Ihre Welt wird einzig durch das Vorhandensein einer spirituellen Realität bestimmt.«
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.