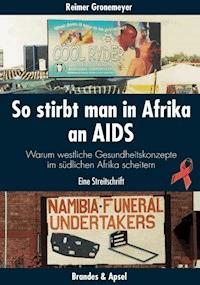17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel-Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Die Pflegekatastrophe kommt gleich nach der Klimakatastrophe
6 Millionen Pflegebedürftige werden für 2030 erwartet, voraussichtlich fehlen dann 500.000 Pflegekräfte. Der deutsche Pflegerat fordert ein Einstiegsgehalt für Pflegekräfte von 4.000 Euro, aber schon jetzt kann kaum jemand einen Platz im Pflegeheim selbst bezahlen. Und mit Geld allein wird sich die Pflegekatastrophe nicht abwenden lassen, davon sind Reimer Gronemeyer und Oliver Schultz überzeugt.
Die Pflege braucht einen Aufbruch. Das Zukunftsszenario, das uns sonst erwartet, ist ernüchternd: Eine ambulante und stationäre Pflege, die – hoch subventioniert – pflegebedürftige Alte in sozial entkernten Arealen professionell versorgt. Das wäre der Schrecken für alle, die dem entgegenwarten. Der positive Gegenentwurf dazu ist eine partizipative, gesellschaftlich getragene Pflege.
Gronemeyer und Schultz skizzieren das Bild der »Caring Society«: Nur wenn alle gemeinsam anpacken, wird sich die Pflegekrise abwenden lassen. Nur, wenn wir als Gesellschaft bereit sind, umzudenken, wird in Zukunft menschenwürdige Pflege und ein besseres Leben im Alter möglich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Alle ahnen, dass wir in der Pflege in die falsche Richtung gegangen sind. Die Betroffenen zuerst, die Angehörigen, die Pflegenden, aber wo ist der Ausgang? Niemand will in einem Pflegeheim leben, aber genau das wartet auf sehr viele Alte – ein vollkommen absurder Tatbestand.
Was wir brauchen, ist ein Aufbruch, sagen Reimer Gronemeyer und Oliver Schultz. Ist die Ermutigung, die Fähigkeiten zu nutzen, über die wir ganz einfach als Menschen verfügen. Nicht als Ausdruck einer romantischen Hoffnung, sondern als Einsicht in die Notwendigkeit. Pflegen kann im Prinzip jeder, es will nur keiner. Wir haben uns so sehr an die bezahlte Dienstleistung als Antwort auf soziale Probleme gewöhnt, dass eine andere Welt gar nicht mehr vorstellbar scheint. Doch die Zukunft wird ein Mix sein müssen: ein Mix aus wiederentdeckter vielfältiger eigener Kompetenz und professioneller Hilfe. Deshalb suchen Gronemeyer und Schultz nicht etwa nach einem neuen Pflege-Modell, sondern sie fragen nach der real existierenden »Ars curandi«, einer neuen Kunst des Pflegens.
Die Autoren
Prof. Dr. Reimer Gronemeyer zählt zu den führenden Sozialexperten in Deutschland, seit mehr als 30 Jahren forscht er zu Fragen des Alterns in unserer Gesellschaft. Er ist Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Deutscher Hospiz- und Palliativverbands, Erster Vorsitzender der »Aktion Demenz« und war Mitglied der Kommission zur Erstellung einer Nationalen Demenzstrategie.
Dr. Oliver Schultz ist Mitherausgeber der Zeitschrift »demenz: das Magazin« und arbeitet seit mehr als 20 Jahren künstlerisch mit Menschen mit Demenz in Pflegeeinrichtungen. Er ist zudem wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Gießen und beteiligt an Forschungsprojekten zu den Themen Demenz, Alter, Ehrenamt sowie den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Altenpflege.
Reimer GronemeyerOliver Schultz
DIE RETTUNG DER PFLEGE
Wie wir Care-Arbeit neu denken und zu einer sorgenden Gesellschaft werden
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit konnte eine gendergerechte Schreibweise nicht durchgängig eingehalten werden. Bei der Verwendung entsprechender geschlechtsspezifischer Begriffe sind im Sinne der Gleichbehandlung jedoch ausdrücklich alle Geschlechter angesprochen.
Copyright © 2023 Kösel-Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch Aenne Glienke | Agentur für Autoren und Verlage, www.AenneGlienkeAgentur.de.
Redaktion: Hendrik Heisterberg
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Umschlagmotiv: FinePic®, München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-29772-5V001
www.koesel.de
Inhaltsverzeichnis
1. Was ist los? – Bestandsaufnahme einer Notlage
Die Rettung der Pflege?
Wer schreibt da eigentlich?
Anspruch und Wirklichkeit
Pflege als Dienstleistung hat keine Zukunft
Die Hoffnung der »Caring Society«
Vom Fall der Pflege – Erzählungen aus dem Pflegenotstand
Die Rettung der Sinne
Eine unerwartete Begegnung
Ein Tag im Krankenhaus
Durchhalten bis zum bitteren Ende
Was heißt pflegen in unserer Gesellschaft?
Die Geschichte von Frau L.
Die Mobilisierung der Pflege
Die sterbende Flamme der Empathie
Und wenn wir alle Pflegeheime schließen?
2. Was passiert? – Die Pflege als Spiegel unserer Zeit
Eine Krise kommt selten allein
Die Folgen der Corona-Pandemie
Handlungsunfähig angesichts all der Krisen?
Senizid – Die Rückkehr der Altentötung
Wider die Monokultur in der Pflege
Was jetzt auf der Agenda steht
Pflege um zwölf
Fluch und Segen der modernen medizinischen Technik
Allein auf weitem Flur
Die Dokumentation entscheidet
Der Normalfall: Diskriminierung der Alten
Er lag da in seiner Küche
Elend mit Zuschauern
Die fatale Trennung von professioneller und ehrenamtlicher Pflege
Rufe in der Dunkelheit
Elend
»Übelbleibsel«: Pflege und Demenz
Pflege à la AIDA
Die Grenzen der Resilienz
Zuschauen, um zu vergessen
Absurdistan: Wie Sicherheitspflege den Tod vorwegnimmt
Anspruch und Mündigkeit im Alter
3. Was muss geschehen? – Die Rettung der Pflege kommt von außen
Die Zukunft der Pflege – Drei Szenarien
Horrorszenario
Technoszenario
Caring-Society-Szenario
Warum wir die Caring Society brauchen
Caring Society – eine Herausforderung unserer Zeit
Vision einer neuen Solidarität in der Caring Society
Ist die Caring Society ein romantisches Projekt?
Die Caring Society mit dem Janusgesicht
Eine Rettungsgasse für die Pflege
Das Versprechen der Caring Society – Eine Antwort in 7 Schritten
Dank
Anmerkungen
1. Was ist los? – Bestandsaufnahme einer Notlage
Die Rettung der Pflege?
Das klingt nach Größenwahn. Was versprecht ihr da? Die Rettung der Pflege? Jeder, der die Situation kennt, weiß doch, dass wir am Abgrund stehen. Wer noch keinen Eins-zu-sechzig-Nachtdienst mitgemacht hat, kann nicht mitreden, hören wir immer wieder. Das ist der Nachtdienst, in dem drei Pflegekräfte für 180 Betten zuständig sind. Der Pflegenotstand ist gerade im Begriff, zur Pflegekatastrophe zu werden. Denn die Zahl der Pflegebedürftigen wächst, und die Zahl der Pflegekräfte nimmt gleichzeitig ab. Sechs Millionen Pflegebedürftige werden für 2030 erwartet, voraussichtlich fehlen dann 500.000 Pflegekräfte.
Der deutsche Pflegerat fordert ein Einstiegsgehalt für Pflegekräfte von 4.000 Euro. Aber schon jetzt kann kaum jemand einen Platz im Pflegeheim selbst bezahlen. Wir brauchen – das ist unübersehbar – andere Wege, Geld allein ist keine Antwort. Wir brauchen eine partizipative, gesellschaftlich getragene Pflege. Wir brauchen den Mut zur Erneuerung der Pflege. Natürlich ist das ein interessanter Gedanke: Pflegekräfte besser bezahlen als Professoren. Dann stünde die Wertepyramide auf dem Kopf, und die schwierigste Arbeit, die diese Gesellschaft zu vergeben hat, würde endlich angemessen gewürdigt.
Aber woher soll das Geld kommen? Wer soll das bezahlen? Wird so die Pflege der Alten zu einem gigantischen Subventionsprojekt, etwa wie in der Agrarindustrie? Und sieht man nicht in der Landwirtschaft, wie verheerend ein solcher Gedanke ist? Jeder Pflegebedürftige müsste in etwa mit dem Gehalt eines Ministerialrats finanziert werden. Was sagen die Jungen dazu? Ist die Gesellschaft bereit für einen neuen Stellenwert der Pflege nicht nur in wohlfeilen Statements, sondern in Form einer wirklichen Anstrengung?
Drängt sich nicht vielmehr der Gedanke in den Vordergrund, die Alten seien eine Last? Erhält die Kluft zwischen den Generationen eine neue, schwindelerregende Dimension, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt bedroht? Könnte infolgedessen die zynische Frage »Müssen wir abschalten?« Konjunktur bekommen? Das Instrument des assistierten Suizids steht schon bereit.1
Wer glaubt übrigens eigentlich, dass eine hoch bezahlte Pflege automatisch eine bessere Pflege ist? Eine Heimleiterin sagt: »Bessere Bezahlung allein kann nicht zu besserer Pflege führen. Es braucht die Haltung.« Pflege muss besser bezahlt werden. Aber Geld allein ist nicht die Antwort auf die Pflegekatastrophe. Diese Gesellschaft setzt auf professionelle, bezahlte Dienstleistungen. Damit ist die Pflege unrettbar an die Idee von Wachstum gebunden: teurere Pflege, teurere Interventionen, teurere Technologien, teurere Verwaltung.
Das aber ist genau jenes Wachstumsmodell, das – wir alle können es jetzt schon sehen, können es wissen – zum Scheitern verurteilt ist. Wo immer wir mit Pflegenden darüber gesprochen haben, überall kommt die gleiche resignative Kälte zum Vorschein, die sagt: Das deutsche Pflegesystem erlebt aktuell einen für alle Beteiligten leidvollen Kollaps. Eine hoffnungslose Lage also?
Wir stellen die irrwitzig anmutende Frage: Könnte es nicht eine andere Art von Pflege sein, die uns vormacht, wie wir dem Wachstumsmodell mit seinen verheerenden Folgen entgehen? Pflege betrifft uns alle, von Geburt an. Könnte sich nicht gerade aus der erneuernden Pflege heraus auch der Zusammenhalt unserer Gesellschaft erneuern lassen? Weg von den sichtlich überforderten Pflegeprofis und Experten und hin zu einer »Caring Community«, hin zu einer »Caring Society«? Eine professionelle und gut bezahlte Pflege muss durch die Beiträge ergänzt werden, die eine wiedererwachte, nachbarschaftlich gesonnene Zivilgesellschaft erbringen kann. Die zukünftige Postwachstumsgesellschaft droht, in katastrophaler Kälte zu versinken, wenn sie nicht auf eigene Kräfte und auf nachbarschaftliche Kontexte setzt.
Wir wagen zu behaupten: Im Prinzip kann jeder pflegen, es will nur keiner. Was wir brauchen, ist ein Aufbruch. Ist die Ermutigung, die Fähigkeiten zu nutzen, über die wir ganz einfach als Menschen verfügen. Nicht als Ausdruck einer romantischen Hoffnung, sondern als Einsicht in die Notwendigkeit. Wir haben uns so sehr an die bezahlte Dienstleistung als Antwort auf soziale Probleme gewöhnt, dass wir uns eine andere Welt gar nicht mehr vorstellen können.
Die Zukunft wird ein Mix sein müssen: ein Mix aus wiederentdeckter vielfältiger eigener Kompetenz und professioneller Hilfe. Viele Angehörige praktizieren das im Übrigen heute schon. Zu oft aber stoßen sie bei den Professionellen auf Abschottung. Im Angesicht der Krise wird allenthalben von der Notwendigkeit eines zivilgesellschaftlichen Aufbruchs gesprochen, von neuer Gemeinschaft. Aber die »Schmuddelecke Pflege« kommt da nicht vor.
Wenn wir nicht umdenken, erwartet uns das Zukunftsszenario einer ambulanten und stationären Pflege, die – hoch subventioniert – pflegebedürftige Alte in sozial entkernten Arealen professionell versorgt. Das wäre der Schrecken für alle, die dem entgegensehen.
Wenn wir aber umdenken, würde es das Leiden der Pflegebedürftigen zwar nicht zum Verschwinden bringen, doch es könnte in einer zivilgesellschaftlich aufgewachten und reformierten Gesellschaft das Alter vor professioneller Kälte bewahren.
Wer schreibt da eigentlich?
Es ist keine kleine Forderung, die wir mit diesem Buch stellen. Aber wir wollen auch unsere Hintergründe transparent machen und erklären, was die Grundlagen für unsere zum Teil durchaus harsche Kritik sind.
Wir Autoren sind beide mit dem Thema Pflege in Forschung und Lehre befasst. Und wir kennen nicht nur die Theorie, sondern auch die Praxis. Einer, Oliver Schultz, kommt ursprünglich aus der bildenden Kunst. Seit Langem arbeitet er in Pflegeeinrichtungen künstlerisch mit Menschen mit Demenz und begegnet so den Realitäten und Phantasmen des Lebens und Sterbens im Heim. Er war zudem in einem Pflegeheim angestellt, hat dort die soziale Betreuung konzipiert und den täglichen Pflegenotstand ganz direkt miterlebt.
Der andere, Reimer Gronemeyer, ist mit bald Mitte achtzig allein durch sein Alter dem Pflegethema nahe. Er hat aber als Theologe und Professor für Soziologie schon viel früher angefangen, sich mit der Frage, was gutes Altern ist, zu befassen. Seit Mitte der Neunzigerjahre liegt sein Forschungsschwerpunkt bei den Themen Demenz, Pflege und der Hospizbewegung.
Zwei verschiedene Generationen schreiben hier. Zwei Stimmen mit ganz verschiedenen Lebenserfahrungen. Seit Langem führen wir einen Dialog über Demenz, über Pflege, über das Alter und das Sterben. Jetzt schreiben wir gemeinsam ein Buch und lassen unsere Stimmen zusammenkommen. Wir glauben und hoffen, dass daraus eine Stimmigkeit entsteht, die gerade nicht mit Einstimmigkeit verwechselt werden darf. Die auch ihre Dissonanzen und Widersprüche wahrt, aber immer um die gemeinsame Frage kreist: Wie ist die Rettung der Pflege denkbar?
Wir beide verneigen uns respektvoll vor den Leidenden, vor den pflegenden Angehörigen und vor den professionell Pflegenden. Aber wir sehen und fühlen, dass mit der Entwicklung dieses Dienstleistungsapparates ein falscher Weg eingeschlagen ist.
Also was tun? Alles zumachen? Pflegeheime, ambulante Dienste canceln? Wer wagt, das zu denken oder auszusprechen? Sollen wir alle diese Bedürftigen zu ihren Familien zurückschicken? Geht nicht. Sollen wir sie alle auf die Straße setzen? Geht erst recht nicht. Aber glauben wir wirklich, dass dieser Pflegedienstleistungsapparat immer weiterwachsen kann? Und glauben wir wirklich, dass wir Wege finden werden, den Apparat so zu humanisieren, dass weder die Patienten noch die Pflegenden verzweifeln müssen?
Ich, Oliver Schultz, erinnere mich an ein Gespräch mit einer Kollegin. Sie verfügte über jahrzehntelange, beeindruckende Erfahrung. Wir sprachen, wieder einmal, über den Pflegenotstand. Sie gab zu bedenken, wie schwer vorstellbar sei, was pflegen im Alltag bedeutet: »Weder Sie noch ich aus der Pflegeleitung haben wirklich eine Vorstellung davon, wie sich zehn Tage Waschstraße anfühlen.«
Waschstraße? Der Vergleich mit der KFZ-Pflege tut weh. Ich denke, das soll er auch. Denn Pflege ist ein harter beruflicher Alltag und verdient eine klare, unmissverständliche Sprache. Kann über Pflege nur sprechen, wer Pflege auch selber im unmittelbaren Alltag erleidet?
Wir sind nicht mitten auf der Pflegestraße unterwegs. Aber doch nah, sehr nah dran. Und haben ratlos geschwiegen, bis jetzt. Dieses Buch ist unser Versuch, uns den Fragen, auf die wir keine Antworten haben, zu stellen.
Hier schreiben zwei Männer. Aber Pflege ist weiblich: In der Altenpflege dominieren auf beiden Seiten Frauen. Die Gepflegten sind mehrheitlich Frauen, und die Pflegenden sowieso. Was haben wir als Männer in diesem Zusammenhang überhaupt zu sagen? Da Sorgearbeit nun einmal vor allem weiblich ist, sollten wir Männer da nicht besser »die Klappe halten«? Sind Männer nicht längst als die Vertreter einer eurozentrischen, patriarchal dominierten Wissenschaft und Praxis entlarvt, die noch nicht begriffen haben, dass ihre Stunde geschlagen hat, während andere das Totenglöckchen schon längst läuten hören?
Bisher konnten (alte) weiße Männer sich darauf verlassen, dass ihre Perspektive unbesehen als valide angesehen wurde, und davon ausgehen, dass der Ausschluss anderer (insbesondere weiblicher) Perspektiven funktionierte. Diese Sichtweise gilt glücklicherweise nicht mehr unwidersprochen. Mit der unbesehenen Dominanz der Männerperspektive ist es vorbei.
Feministische Gesellschaftskritik hat deutlich gemacht, dass Care-Arbeit Herrschaftsverhältnissen unterliegt, zu denen »Bodyismen, Klassismen, Heteronormativismen und Rassismen« gehören.2 Die normierte Wahrnehmung von Körpern, die Realität von Unterdrückungen, die Fixierung von Geschlechterrollen und ethnische Diskriminierungen durchziehen das patriarchalisch dominierte Sorgepaket. Feministische Gesellschaftskritik spricht dagegen vom »unterjochten Wissen«, sie lässt neue Formen des methodischen Vorgehens zu, die zwischen »Teilnahme und Beobachtung« oszillieren.3
Unsere Aufgabe ist heikel, und weil wir das wissen, hoffen wir, dass wir gewarnt sind. Wir versuchen, uns ein Beispiel zu nehmen an den selbstreflexiven Sätzen von Lina Hansen. Sie beschreibt sich als Menschen, der als »weiße, erbende, able-bodied Cis-Frau in Deutschland aufgewachsen ist«. Das »Cis« ist das Adjektiv, das dem Adjektiv »trans« gegenübersteht.4 Sind wir also weiße, erbende, able-bodied Cis-Männer, die in Deutschland aufgewachsen sind, ohne Chance, die Perspektiven der anderen ausreichend einzubeziehen? Es gibt ihn, den arroganten, sich selbst überlegen wähnenden Cis-Mann. Wir fühlen uns damit nicht treffend beschrieben.
Die weit verbreitete Dominanz der Männer ist ein Konflikt, dessen wir uns bewusst sind. Sie leiteten die Heime, machten die Politik, dominierten die Diskurse – während die Frauen die Pflege am Bett erledigten. Wir wollen Pflege als ein gesellschaftliches Herzensanliegen bedenken. Und zwar nicht nur, weil gute Pflege in unserer älter werdenden Gesellschaft immer wichtiger wird, sondern weil sich in der Pflege zentrale Konflikte unserer Zeit spiegeln. Es ist klar: Nur wenn die Pflege auch Herzensanliegen der Männer ist, kann sie gesellschaftlich leben. Umgekehrt kann die Gesellschaft nur eine sorgende Gesellschaft werden, wenn auch die Männer pflegen.
Anspruch und Wirklichkeit
Marcel Proust hat einmal über die moderne Medizin gesagt: Sie kennt das Geheimnis der Heilung nicht. Die Diagnose der heutigen Pflege muss wohl heißen: Sie kennt das Geheimnis der Sorge nicht. Dabei ist es gerade die Pflege, in der dieses Geheimnis jeden Tag und jede Stunde aufs Neue entdeckt und gemeinsam wiederbelebt werden kann.
Aber hat es denn nicht eine Pflegereform nach der anderen gegeben? Man sieht die Staatssekretäre und Ministerialdirigentinnen ratlos in ihren Büros sitzen. Sie sehen, wie wir in einen Pflegeabgrund rutschen. Kann man denn gar nichts machen? Die alten Pflegekräfte, am Rande des Zusammenbruchs, geben auf oder werden bald verrentet. Stehen bei dem jüngeren Pflegepersonal allmählich die im Vordergrund, die in der Pflege einfach einen Job sehen, der mit technokratischer Kühle absolviert wird, weil es sonst nicht auszuhalten ist? Da treten jetzt junge Frauen und Männer auf, die nicht mehr bereit sind, sich wie die älteren Pflegerinnen und Pfleger an den Rand des Zusammenbruchs manövrieren zu lassen.
Nüchtern betrachtet wird einem jeder, der die Branche kennt, sagen: Es geht nicht mehr um Verbesserung, es geht jetzt um Katastrophenmanagement. All die Expertisen zur Pflege, all die Altenberichte, die von der Bundesregierung in Auftrag gegeben wurden, sind Makulatur. Wie sagte kürzlich der einst reformfreudige Inhaber und Leiter eines Pflegeheims? »Ich habe verkauft, ich habe aufgegeben.« Geschüttelt und zerrüttet von unlösbaren Personalproblemen, entnervt von Überregulierungen und Dokumentierungszwängen.
Schweigen wir von den zahllosen Expertinnen und Experten der Pflegewissenschaft, von Heimleitungen, von Interessenvertretungen, von Reformplanern – eine Sammlung gescheiterter Hoffnungen. Schränke, Regale, Schubladen voller Papier, und überall steht »gute Pflege« drauf. Tatsächlich trägt der Alltag der Pflege vielerorts die Aufschrift »Das nackte Elend«.
Wer kümmert sich nicht alles um eine gute Pflege, wer verspricht nicht alles lächelnde Senioren, die in sonnendurchfluteten Rosengärten ihren Lebensabend genießen? Aus einem Prospekt: »So unterschiedlich die Aufgaben auch sind, immer steht der Mensch im Mittelpunkt unseres Handelns. Mit großer Sorgfalt und hohem Verantwortungsbewusstsein ermöglichen wir ein individuelles und selbstständiges Leben in der Gemeinschaft. Maßstab unserer Arbeit – und zusätzliche Motivation – ist dabei die Zufriedenheit der Bewohner.«5
Wer würde das nicht gern glauben? Und manchmal wird es stimmen. Aber häufiger eben nicht. Da wird die alte Dame angeschrien, weil sie den Mund nicht für den Löffel aufmacht. Weil sie schon wieder die Klingel gedrückt hat. Weil sie heute zum dritten Mal die Windel beschmutzt hat.
Aber wer möchte schon freiwillig diesen runzligen, widerspenstigen, oft undankbaren Alten die Windeln wechseln? Wer wagt zu verlangen, dass der schwierige, manchmal eklige Job mit Freude und Engagement gemacht wird? Wo soll denn die Empathie herkommen, wenn alles unter Zeitdruck geschieht? Da wird der fast blinden Bewohnerin das Wasserglas irgendwo auf den Nachttisch geknallt, grußlos natürlich, weil aus dem Nachbarzimmer schon wieder geklingelt wird … und dann ist auch noch die Dokumentation zu machen. Wir wissen, dass in der Pflege oft Gewalt stattfindet – darf man sich darüber angesichts der Umstände noch wundern? Das, was darüber bekannt wird, dürfte jedenfalls nur die Spitze des Eisbergs sein.
Pflege als Dienstleistung hat keine Zukunft
Wir wollen nicht das Schlechte besser machen, sondern wir wollen über einen Neuanfang reden, ihn anstoßen und da, wo er schon begonnen hat, stärken. Einen Neuanfang, der nicht die große Vision auf den Tisch legt, sondern von radikalen, kleinen Schritten spricht. Wir beabsichtigen keine Vorschläge, wie die Pflege zu optimieren ist. Wir gehen aus von der Feststellung: Die professionelle, bezahlte Dienstleistung, die sich in der Pflege durchgesetzt hat, ist offensichtlich gescheitert. Sie hat keine Zukunft. Obwohl sie wächst, obwohl sie alle anderen Formen der Sorge verdrängt, ist sie so überholt wie der Braunkohletagebau in der Lausitz. Weil sie die Eigenkräfte der Menschen zerstört. Weil sie aus der Sorge um die Nächsten, die zum Menschen gehört wie die Luft zum Atmen, eine Ware macht, die kaufen kann, wer Geld hat. Weil alle zu Kunden werden sollen.
Inzwischen kann sich kaum jemand mehr etwas anderes vorstellen. Was weg ist, ist weg. Wo die lebendige, die unprofessionelle, die selbstverständliche, die wilde, die gelingende Pflege verschwunden ist, da kehrt sie so nicht mehr wieder.
An diesen Zerstörungsprozess wollen wir erinnern. Dabei reden wir nicht von einem verlorenen Paradies, nicht von einem Gestern, in dem alles besser war. Aber davon, dass den Menschen die Fähigkeit genommen wurde, füreinander zu sorgen, für die Kinder und die Alten, für die Kranken und die Behinderten. Familienpflege hat immer noch einen hohen Anteil in der Sorge um alte Menschen. Sie wird vor allem von Frauen geleistet. Doch diese Familienpflege ist auf dem Rückzug. Es war einmal möglich, sich umeinander zu kümmern. Heute glauben die Menschen, dass das Leben ohne Experten nicht mehr zu bewältigen ist. Wo der Pflegeexperte auftritt, da werden Angehörige, Freunde, Nächste, Nachbarn zu unmündigen Hilfskräften herabgestuft. Die Dienstleistungsbranche modelt alles, was Subsistenz war, in Ökonomie um. Aus dem, was die Menschen selbst konnten, wird eine professionell verwaltete Ware.
Unser Plädoyer für eine »wilde Pflege«, unsere Vorstellung einer Pflege »durch einander«, erinnert sich an die Vernichtung der traditionellen Sorge der Menschen füreinander, wohl wissend, dass der Weg nicht zurückführt. Wir ziehen keinen Joker aus dem Ärmel und sagen: Hier ist unsere Patentlösung. Macht es so oder so – dann ist die Pflegekatastrophe vom Tisch. Damit würden wir uns in die lange Folge der gescheiterten Pflegereformer einreihen. Was wir wollen, ist ein radikaler Neuanfang.
Sicher werden viele sagen: Das geht doch gar nicht. Aber das, was wir heute Pflege nennen, ist ein Hochgeschwindigkeitszug, der auf eine Betonmauer zurast. Alle werden zu Opfern, sowohl die Pflegebedürftigen als auch die Pflegekräfte. Die einen sterben mittelfristig, die anderen landen im Burn-out. Oder suchen sich gleich einen anderen Beruf. Soll das so weitergehen?
In der Tat, wir versuchen etwas, das eigentlich unmöglich ist. Wir sind leidenschaftlich naiv: Wir glauben, dass es jetzt um den Versuch geht, etwas ganz Neues zu tun. Der amerikanische Autor Charles Eisenstein hat enthusiastisch von einer ähnlichen Naivität gesprochen. Von dem Versuch, trotz zerstörerischer Konzernkräfte, die den Klimawandel vorantreiben, die Katastrophe aufzuhalten. Das sei naiv und dennoch unabdingbar.6 Ein Neuanfang in der Pflege? Auch das ist naiv. So naiv wie der Versuch, den gesamten Wirtschaftszweig der fossilen Brennstoffe zu stoppen, um den Klimawandel aufzuhalten. Vielleicht ein aussichtsloser Versuch, aber unsere einzige Hoffnung auf Rettung, wenn es denn eine gibt.
Wer wollte es wagen, diesen Riesenapparat, den medizinisch-pflegerischen Komplex, in Frage zu stellen? Hohngelächter ist uns sicher. Mittlerweile gibt es europaweite Pflegekonzerne, die über Hunderte, ja Tausende ambulante und vor allem stationäre Pflegeeinrichtungen verfügen. Da kann man eigentlich nur die Konsequenz ziehen: Investieren Sie in Pflegeimmobilien! Da sind noch Renditen zu erwarten! Es geht um hunderttausende Arbeitsplätze in der Pflegeindustrie, allein in Deutschland. Aber alle wissen oder ahnen, dass das Wachstum dieses technophilen und zugleich brüchigen Pflegeapparates die falsche Richtung ist, dass es nicht funktioniert.
Wir wagen die Behauptung: Im Blick auf die Pflegefrage ist diese Gesellschaft in die falsche Richtung gegangen. Einige hunderttausend Jahre ist der Homo sapiens ohne Pflegeeinrichtungen ausgekommen. Nun, in den letzten Sekunden dieser langen Geschichte, in den Sekunden, in denen wir leben, ist das Dienstleistungsgewerbe implodiert und alle stöhnen – die gegenwärtigen und die künftigen Kunden, die Politiker und die Professoren, die sich mit diesem Thema befassen, und die Pflegepraktiker sowieso.
Überall sehen wir die Auswirkungen menschlicher Fehlentscheidungen: Artensterben, Verlust der Biodiversität, Klimawandel, Armut, Rassismus. Im Pflegebereich sehen wir die Abgeschobenen, die Unbrauchbaren, die Leistungsunfähigen, immer deutlicher einer industriellen Versorgung ausgeliefert. Werden sie bald gänzlich von Avataren und Robotern betreut? Pharmazeutisch ruhiggestellt, herabgewürdigt zum menschlichen Müll einer Leistungsgesellschaft, deren unausgesprochene und heimliche Antwort auf die wachsende Lebenserwartung bei gleichzeitiger Abnahme der Leistungsfähigkeit lautet: Warum verschwindet ihr nicht? Schaltet euch ab, oder wir tun das.
Die Alten sind die sichtbaren Opfer einer Geschichte der Trennung. Wer hinfällig wird, wird ausgesondert. Wenn die Familie (immer noch meistens: die Frau) pflegt, geschieht mit ihr dasselbe. Wer sich auf Familienpflege einlässt, wird ins Abseits gestellt. Familienpflege bringt Menschen oft an den Rand, Isolation kann die Folge sein, weil für Kontakte nach außen keine Zeit mehr bleibt. Die moderne Gesellschaft hat die Familie zerstört oder fragmentiert. Natürlich waren die früheren Zeiten nicht idyllisch, auch und gerade nicht für die Alten. Aber was wir gerade erleben, ist die immer weiter voranschreitende Geschichte einer Separation aller von allen: Immer mehr Menschen leben allein, vereinzelt.
Es ist unübersehbar: Vor allem die alten Menschen, die Hinfälligen, sind Opfer dieser Trennung. Sie werden wie herabgesunkene Gesellschaftsteilchen am Boden abgelagert. Sie sind Aussätzige. Die moderne Gesellschaft führt einen Krieg gegen Leiden, gegen Schmerz, gegen das Altwerden. Für die Verlierer in diesem Krieg, die Alten, gibt es nur den Weg bergab. Sie werden separiert, versorgt, und abgesehen davon will man vor allem eines: an ihnen verdienen.
Wir sitzen auf den Trümmern des scheiternden Pflegekomplexes. Gestehen wir uns ein, dass es der falsche Weg war. Und suchen wir nach Auswegen. Man muss sich die dringlichen Fragen noch einmal vor Augen führen: Die heute dominierende professionelle Dienstleistungspflege treibt die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen viel zu oft in den finanziellen Ruin. Ist das vermeidbar? Deutschland ist übersät mit Einrichtungen, die stolz sind auf ihre standardisierten, qualitätskontrollierten, dokumentierten Angebote. Warum will eigentlich keiner freiwillig da hin?
Eine Schlucht tut sich auf zwischen den pflegewissenschaftlichen Konzepten, die Pflege optimieren wollen, und der resignativen Realität, in der man sich durchwurstelt, um über die nächste Nachtwache zu kommen, ohne einen Gast zu vernachlässigen oder zu misshandeln. Wann gestehen sich die Beteiligten ein, dass den raffinierten theoretischen Konzepten in der Realität des Pflegealltags nichts entspricht?
Die Angehörigen sind froh, wenn sie ihre pflegebedürftigen Verwandten in die ambulante oder stationäre Pflege abgeben können, weil sie es selbst nicht schaffen. Die Folge ist ein Gefühlschaos, ein Mix aus Erleichterung und Schuldgefühl. Diese Gefühlskonsequenzen – so lautet der heimliche Befehl – muss jeder mit sich selbst ausmachen. Das ist der falsche Weg, den die Gesellschaft, den wir gemeinsam eingeschlagen haben. Die Betroffenen sind dazu aufgefordert, diese Bürde finanziell und emotional privat zu bewältigen. Warum gibt es keine gemeinsame, öffentliche, gesellschaftliche Debatte über diese Privatisierung des Unglücks?
Gern wird an diesem Punkt neuerdings von »Resilienz« geredet. Eine Modevokabel, die nichts anderes sagt als: Mit deinen Problemen musst du selbst klarkommen. Die Risiken, die gesellschaftlich produziert worden sind, werden privatisiert. Du wachst morgens auf und hast das alles am Hals. Und fürchten nicht viele Menschen, dass eine fehlentwickelte Medizin, die vor allem an Karriere und Geld interessiert ist, sie als menschliche Ruinen am Leben hält, obwohl sie das gar nicht wollen?
Über die Versorgung der Alten wird viel geredet, zur Last fallen will niemand. Mit welchen Gefühlen die Pflegebedürftigen in Einrichtungen leben, danach fragt keiner. Ist das unvermeidlich? Ist es normal, dass abhängige Alte die letzte Lebensstrecke mit einem Rucksack voller Schuldgefühle auf dem Rücken zurücklegen müssen? Dass sie zu viel kosten? Dass das Erbe der Kinder von einer teuren Pflege aufgefressen wird?
1993/94 wurde die Pflegeversicherung eingeführt. Sie entfaltete eine Sogwirkung, rein in die Pflege. Für die Betreiber, die auf die Bilanz schielen, wurde die Pflegeversicherung zur Goldgrube unter der Devise: Nun muss die Hütte aber auch voll werden. Was die Frage aufkommen lässt, wie viele Menschen in Pflegeheimen liegen, sitzen und leiden, die da gar nicht hingehören, weil sie auch ambulant zu versorgen wären. Aber da knistert schon wieder das Geld. Stationäre Pflege ist billiger, weswegen der Ruf nach mehr ambulanter Pflege wohl weniger Gehör finden wird als erhofft.
Alle Kräfte konzentrieren sich darauf, dieses kaputte System aufrechtzuerhalten. Da werden Frauen gruppenweise aus dem Ausland geholt und flüchtig zu Helferinnen in der Altenpflege ausgebildet. Es sollen Pflegekräfte aus Osteuropa, aber auch aus Mittelamerika oder der Sahelzone herbeigeschafft werden, dort gibt’s ja in Hülle und Fülle Menschen, die auf bessere Gehälter hoffen. Die Reichen müssen sich doch eigentlich keine Sorgen machen. Wenn aus Polen oder Rumänien nicht mehr genug Hilfswillige kommen, dann holen wir sie aus China.
Natürlich ist das ein schräges Bild, das da entsteht: Hunderttausende gut situierte, vor allem weiße Alte werden von Hunderttausenden PoC (People of Color) gewaschen oder mit Brei gefüttert. Irgendwie ein kolonial parfümiertes Sittengemälde. In den Pflegeheimen stehen sich PoC und PoP gegenüber – People of Color und People of Pain. Diese zweite Umschreibung meint nicht unbedingt, dass alle Pflegebedürftigen somatische Schmerzen haben, aber sie leiden unter dem Schmerz der Verlassenheit. Daran, dass sie sich überflüssig fühlen, dass sie sich als Leistungsversager in der Leistungsgesellschaft offenbaren.
Die Hoffnung der »Caring Society«
Caring Society, sorgende Gesellschaft: Ist das eine Vision, die eine andere Zukunft denkbar macht? Ist das ein Plastikwort, das nichts sagt? Ist das die gescheiterte Dienstleistung in neuem Gewand (jetzt angereichert durch ehrenamtliche Hilfskräfte und dienstbare Angehörige)? Hatte doch Margaret Thatcher 1987 gefragt: »Was ist das – Gesellschaft? So etwas wie Gesellschaft gibt es nicht.« (»There’s no such thing as society.«) Ein soziales Auffangnetz sei laut der »Eisernen Lady« zwar wichtig, aber die Leute manipulierten das System, um sich versorgen zu lassen, meinte die britische Premierministerin. »Ich bin obdachlos, die Regierung muss mir eine Wohnung besorgen.« Für Thatcher gab es anstelle der Gesellschaft nur einzelne Männer, Frauen und Familien. Keine Regierung könne etwas erreichen, außer durch Leute (people), und die Leute müssten in erster Linie für sich selbst sorgen.7
Aus diesen Formulierungen der »Eisernen Lady« spricht natürlich der arrogante und erbarmungslose Blick von oben. Aber der moderne Wohlfahrtsstaat hat unfraglich entmündigende und lähmende Züge. Die Sorge für alte, hinfällige, pflegebedürftige Menschen war einmal Sache der Familie, der Nachbarschaft, der lokalen Gemeinschaft. Jetzt möchte man diese Sorge eigentlich an ein Konsortium abgeben, das sich aus öffentlichen Geldern und den Einnahmen privater Unternehmen speist. Ein Prozess, der einerseits in die Verstaatlichung des Alters und andererseits in dessen Ökonomisierung mündet.
Die Versorgung des Alters ruht heute auf zwei Säulen: Administration und Geld. Staat und Unternehmen machen – so könnte man auch sagen – die Versorgung des Alters unter sich aus. Gefühle, Leiden, Schmerz, Wärme oder Sehnsucht haben dabei oft wenig Platz. Doch langsam findet ein Umdenken statt, es werden andere Stimmen laut: Gefordert werden quartiersnahe Sorgekonzepte, die bürgerschaftliche Eigenverantwortung stärken und Mitgestaltung ermöglichen.
Es werden Rufe nach einer Kommunalisierung der Pflege laut, und endlich, im Hinblick auf soziale, kulturelle und wirtschaftliche Unterschiede vor Ort, auch regionale Voraussetzungen wahrgenommen.8 Die nicht eben sympathische Vokabel »Empowerment« gewinnt dabei Raum. Unter Rückgriff auf die Bürgerinitiativbewegung, die seit den Sechzigerjahren sichtbar wurde, und auf die psychosoziale Arbeit, die seit den Neunzigerjahren wuchs, kommt nun die Frage nach selbstverantworteter Lebensgestaltung auf.9 Es sind die ersten Lichter, die einen neuen Weg in der Altenarbeit sichtbar machen.
Die Caring Society ist eine Chance, aber es gehen auch Risiken damit einher. Ein Missbrauch der Idee wäre es, wenn der immer fressgierige Dienstleistungsapparat mit dem Konzept einer Caring Society neue Ressourcen entdeckte und sich aneignete: Freiwillige, Ehrenamtliche, Angehörige, Nachbarschaften und Freunde können funktionalisiert werden, eingebunden in das alt-neue Dienstleistungskonzept, das Alte zu Kunden macht. Dienstleistungen kennen die Begrenzungen nicht, denen die Produktion von Gütern unterliegt. Sie sind nicht auf Ressourcen, Kapital und Standorte angewiesen – ein gefundenes Fressen.10