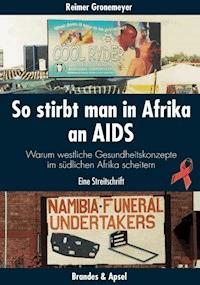17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Pattloch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der medizinische Kampf gegen den Tod hat absurde Züge angenommen. Technik und Bürokratie haben sich in Kliniken und Hospizen breitgemacht; das »qualitätskontrollierte Sterben« wird zur Realität. Reimer Gronemeyer und Andreas Heller fordern angesichts dieser Fehlentwicklung eine Umkehr: Am Lebensende brauchen wir vor allem die freundschaftliche Sorge anderer, eine fürsorgliche Begleitung, in der die sterbenden Menschen der Maßstab allen Handelns sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Reimer Gronemeyer / Andreas Heller
In Ruhe sterben
Was wir uns wünschen und was die moderne Medizin nicht leisten kann
Knaur e-books
Über dieses Buch
In den Hospizen, die einst gegründet wurden, um ein menschenwürdiges Sterben zu ermöglichen, wird das ehrenamtliche Engagement zugunsten einer kalkulierbaren Professionalität zurückgedrängt. Und in den Krankenhäusern haben sich Technologie und Bürokratie breit gemacht. Der medizinische Kampf gegen den Tod hat absurde Züge angenommen. Alte, todkranke Menschen werden ohne Rücksicht auf ihre Bedürfnisse therapiert, weil unser Gesundheitssystem nur mehr die Therapie und nicht mehr die Begleitung kennt. Denn nur Therapie bringt Einnahmen, Begleitung verursacht Kosten. Diese Fehlentwicklung zwingt zum Einspruch, so Gronemeyer und Heller. Sie fordern: Wir brauchen keine neuen Versprechen der Pharmaindustrie, keine kosmetische Reparatur der Körper, keine Schaffung neuer technischer Identitäten. Stattdessen muss die Medizin endlich in die Schule des Sterbens gehen und jenes Selbstverständnis entwickeln, wonach Sterben und Tod zentrale Dimensionen des menschlichen Lebens sind. Dafür braucht es ein Gesundheitswesen, das sich an den Bedürfnissen der Menschen und nicht an den Kalkulationsmodellen der Kliniken orientiert. Was jeder Mensch am Lebensende braucht, ist die freundschaftliche Sorge anderer. Wir können nicht menschenwürdig sterben ohne die sorgende Wärme anderer Menschen.
Inhaltsübersicht
Gewidmet der Geschäftsführung, den Leitungskräften,
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Rheinischen Gesellschaft, Leichlingen,
für ihre eindrucksvollen Bemühungen
um ein gutes Leben und ein gutes Sterben
1. Kapitel
Was wir uns wünschen und was die Medizin nicht leisten kann
»Die Sorge für den Schwachen schützt den Starken selbst. (…) Der Mensch, der es ablehnt, dem sinkenden Leben gut zu sein und der fortschreitenden Einengung, die es erfährt, zu Hilfe zu kommen, versäumt eine wichtige Chance, zu verstehen, was überhaupt Leben ist, wie unerbittlich seine Tragik, wie tief seine Einsamkeit, und wie sehr wir Menschen miteinander solidarisch sind.«
Romano Guardini
Wir leben heutzutage länger, und wir sterben länger. Wir sterben nicht plötzlich und unerwartet, sondern eher langsam und vorhersehbar. Zudem: Sterben ist längst kein sprachloses Tabu mehr. Eine »Überredseligkeit« (Martina Kern) ist beobachtbar. Wie kommt es, dass jetzt so viel über Sterben und Tod geredet wird? Ist da nichts spürbar als ein allgemeines Zähneklappern, das durch Geschwätz überdeckt werden soll? Werden Sterben und Tod gegenwärtig und – das hat es noch nie gegeben – zum Projekt von Experten, zum Marketingmodell von Klinik- und Pflegeheimketten? Wird Sterben zum Geschäftszweig, und übertönt diese Sterbegeschäftigkeit die Möglichkeit des »eigenen Todes«?
Der Wunsch, einen eigenen Tod zu haben, steht auf der roten Liste. Die verlorene Transzendenz, der Himmel als Horizont des Lebens und Sterbens, ist abgedunkelt und wird durch eine Technokratie ersetzt. Hinter der gegenwärtig erkennbaren Sturzflut von palliativen Angeboten wird eine Heimatlosigkeit des Sterbens erkennbar, die aller lokalen Formen des Umgangs mit dem Lebensende entkleidet ist. Sterben wird hergestellt, wenn nötig geplant, assistiert vollzogen und so zum neutralisierten kontrollierten Verfahren. Dem fügen wir uns ängstlich, manchmal wortlos, oft hilflos und ohnmächtig. Die Möglichkeit zum eigenen Tod wird herausoperiert aus dem Leben. Die moderne Medizin hat uns unfähig gemacht, mit dem Schmerz, der Einsamkeit, den Demütigungen des Alterns und dem Sterben sozial und menschlich umzugehen.
Der medizinische Kampf gegen den Tod hat absurde Züge angenommen. Dieser medizinische Kampf, den Tod zu überwinden, erfordert Einspruch und Widerspruch. Wir brauchen keine neuen Versprechungen von »magischen« (und oft exzessiv teuren) Medikamenten, von der Heilung aller Krankheiten, von der kosmetischen Reparatur der Körper, der Schaffung neuer technischer Identitäten. Die Medizin muss selbst in die Schule des Sterbens gehen. Dort wird sie lernen, das Sterben in ihr Selbstverständnis aufzunehmen. Sie wird erkennen, dass Sterben und Tod immer zentrale Dimensionen menschlichen Lebens bleiben. Erst indem die moderne Medizin eine Beziehung zum Sterben gewinnt, wird sie wieder in Beziehung kommen mit den Sterbenden und gutes Leben bis zuletzt ermöglichen.
Die Kunst des Sterbens ist mit der Kunst des Lebens verschwistert, und wenn die Kunst des Sterbens ausgelöscht ist, dann schwindet auch die Lebenskunst. Anders gesagt: Die Abwesenheit einer sozial getragenen Kunst des Sterbens enthüllt, dass die Kunst des gemeinsamen Lebens verschwunden ist.
Was aber macht unser Leben gut und sinnvoll? Was lässt sich von sterbenden Menschen lernen? Was bedauern sie eigentlich am meisten? Angesichts der radikal verkürzten Lebenszeit, mit der Sterbende konfrontiert sind, gilt das größte Bedauern der Erkenntnis, das eigene Leben nicht gelebt zu haben. Man war gefangen im gesellschaftlichen Spiel, zu tun, was »man« von einem erwartet und was andere von einem wollten. Niemand ist traurig darüber, zu wenig gearbeitet zu haben. Im Gegenteil, die Arbeit war zu dominant im Leben. Es blieb zu wenig Zeit, um mit Freunden und Freundinnen wärmend verbunden gewesen zu sein.[1]
Vom todsicheren Tod her zu leben heißt, wesentlicher zu leben. Entscheidungen darüber, was wichtig und unwichtig ist, wofür Zeit investiert wird und wofür nicht, werden im Sterben klarer. Man muss aber nicht erst schwerkrank und sterbend sein, um verpasste Begegnungen, ungelebte Beziehungen zu bedauern, zu beklagen, dass Dankbarkeit und Freude, Liebe und Lust unausgedrückt blieben. Vielleicht leisten wir uns zu wenig »Verrücktsein«, ein »Wegrücken« von den allgemeinen Erwartungen, den sozialen Konventionen, von den Spielregeln des gesellschaftlichen Leistungsspiels. Achten Sie darauf, den eigenen Lebensfaden zu spinnen, den Intuitionen des Glücks, der Freiheit, der Liebe, der Leidenschaft und der Freundschaft zu folgen?
Was wir aber brauchen, ist die freundschaftliche Sorge anderer. Wir Menschen sind eben überaus sorgebedürftig. Die Fürsorge anderer begleitet unser Leben. Ihr Sorgen ermöglicht unser Leben. Diese Sorge ist ein Geschenk, das wir empfangen und dann erst weitergeben. Am Lebensende sind wir radikal auf eine Umsorge angewiesen, die sich nicht berechnen und verrechnen lässt, nicht im Planungsprojekt einer standardmäßigen gesellschaftlichen Sterbeentsorgung aufgeht. Wir können eben nicht leben und nicht sterben ohne das Wohlwollen, die sorgende Wärme und das Geschenk der »Umsonstigkeit« (wie der Priester und Autor Ivan Illich es genannt hat[2]) freundschaftlich Sorgender.
Wovon handelt dieses Buch? Wir haben nicht die Absicht, jene Medizin zu kritisieren, der es um das Heilen geht und die, wenn nichts mehr zu heilen ist, sich um eine gute Zuwendung und Sorge am Lebensende müht. Wir kritisieren aber einen Gesundheitsapparat, der das Lebensende zu einem Behandlungsprojekt macht, in dem eine schwer zu entwirrende Mischung aus Profitinteresse und Standespolitik vorzuherrschen beginnt; bei dem Sterben zu einer Krankheit gemacht wird, die kontroll- und überwachungsbedürftig ist. Dieser Vorgang – die Verkrankung des Sterbens – entzieht sich immer mehr der Kritik, weil die Betroffenen selbst inzwischen gar keine andere Vorstellung mehr haben als diese: dass der Sterbende ein Fall für die Medizin ist, ein Objekt und ein Kunde der Gesundheitsindustrie.
Innerhalb weniger Jahre ist es gelungen, um das Lebensende herum eine palliative Versorgungsindustrie aufzubauen, die dazu tendiert, besinnungslos flächendeckend zu werden. Jeder, der außerhalb des inkludierenden palliativ-medizinischen Komplexes stirbt, wird allmählich zum Irrläufer, zum bedauerlich schlecht Versorgten. Schritt für Schritt ist der, der nicht plötzlich am Infarkt stirbt oder am Steuer seines Autos umkommt, zum selbstverständlichen Adressaten der ambulanten oder institutionellen Fachversorgung geworden. Innerhalb kurzer Zeit ist ein Projekt realisiert worden, das den Sterbenden, der nicht professionell versorgt ist, zum Unglücklichen und bald wohl auch geradezu zum Außenseiter, zum Dissidenten und (bald vielleicht schon) zum Saboteur macht.
Es wird heutzutage viel über das Sterben geredet. Aber man hat das Gefühl: Wir wissen biologisch-medizinisch alles, aber zugleich wissen wir über das, was sterben heißt – nichts. Der Gedanke an den Tod ist wie ein Eisklumpen in uns. Wir ahnen gerade noch, dass das Leben mit dem Tod zu tun hat, aber ansonsten schieben wir den unangenehmen Gedanken, dass alles irgendwann ein Ende hat, weg. Das große Geheimnis lassen wir nicht an uns heran. Woran liegt es? Vielleicht ist uns die Frage nach dem Sinn des Lebens schon so abhandengekommen, dass die Sinnlosigkeit des Todes uns nur noch schwach berührt? Je weniger der Mensch sich derartige Gedanken und Gefühle noch leistet, desto leichter lässt sich der Tod vergessen. Nein, verdrängt werden Sterben und Tod nicht mehr, sie werden unablässig beredet, aber sie sind auf das Niveau eines organisatorischen Problems abgestürzt, nicht verdrängt, sondern weggeordnet.
Der Apostel Paulus konnte noch mit provozierender Kühnheit sagen: »Der Tod ist der Sünde Sold!« Pustekuchen! Auch eine so ekstatische Formulierung, wie sie Rainer Maria Rilke gewagt hat: Der Tod sei der »trauliche Einfall der Erde«, taugt allenfalls für die Ansprache eines professionellen Trauerredners. Dass der Tod die »Gipfelung des Lebens« sei – so hat Friedrich Hölderlin zugespitzt –, das können wir nicht einmal zu denken wagen. Gern wird gesagt, dass das palliative Projekt ja nur die Voraussetzung dafür schaffen wolle, dass man seinen eigenen Tod sterben könne. Das wird zur schönen Floskel – wenn die Betroffenen vom Versorgungsrauschen so eingelullt sind, dass die eigenen Gedanken und Empfindungen zum Nebenschauplatz werden –, für die dann die Experten für Spiritualität und Gespräch zuständig sind.
Jeder stirbt den Tod, den er verdient. Sollte diese finstere Vermutung stimmen? Dann müsste unsere Zeit, die das Leben vor allem als einen Akt des Verbrauchs von Waren und Dienstleistungen zu verstehen lehrt, auch das Lebensende auf dieses Niveau herunterbringen: Verbraucher und Kunde bis zuletzt. Eingebettet in ein palliatives Rundum-Sorglos-Paket, kann der homo consumens tatsächlich seinem Ende in bedauernder Ruhe entgegensehen: Eine gut organisierte Versorgung, zu der garantierte Schmerzfreiheit ebenso wie professionelle Versorgung und im Zweifelsfall terminale Sedierung gehören, lässt die empörte Frage nach dem Sinn oder Unsinn des Todes nicht mehr aufkommen. Wir bekommen den Tod, den wir verdienen: Mit der Patientenverfügung ausgestattet, im Bewusstsein der Gegenwart von Spezialisten, die Versorgungsbedürfnisse aller Art zu managen wissen – für den Dekubitus der Seele gibt es den Spiritualitätsbeauftragten –, gaukeln wir uns vor, das Lebensende in den Griff zu bekommen.
Der »Triumph der Medikalisierung« – den schon der französische Historiker Philippe Ariès konstatiert[3] – bringt die Gefahr mit sich, dass der Tod zum Projekt einer professionellen, qualitätskontrollierten, standardisierten Ablauflogik wird. Möglicherweise ist die Medikalisierung des Sterbens die einzige tragbare Antwort, die wir haben – nachdem die religiösen Hoffnungen abgeräumt sind.
Aber zwei Fragen bleiben. Die eine lautet: Bringt die Medikalisierung des Sterbens die schwere, unabweisbare Frage zum Schweigen: Hat das Sterben einen Sinn, oder ist es der Sieg des Sinnlosen über das Leben? Die andere: Wie kann die Frage nach der wärmenden Nähe von Menschen wieder in den Vordergrund rücken, die jetzt hinter dem Ausbau von Professionalisierung zu verschwinden droht?
Das sind die Fragen, die die Menschen bedrängen: Will ich unter diesen Umständen eigentlich noch leben? Darf ich im Innersten auf den erlösenden Tod meines leidenden Angehörigen hoffen? Warum kann jeder leidende Hund durch eine Spritze »erlöst« werden, wir Menschen aber nicht? Darf ich mir die Beschleunigung meines Sterbens wünschen, darf ich sie fordern? Übertrete ich da religiöse oder juristische Grenzen – oder beides? Die Gefahr, mit der wir heute konfrontiert sind, besteht darin, dass diese ernsten und innersten Fragen nur noch als technische auftauchen: Diese medizinische Maßnahme, ja oder nein?
Bei allem Respekt vor den palliativen Bemühungen beschleicht uns der Eindruck, dass die immer perfektere professionelle Kompetenz das verschüttet, was einmal die wichtigen Fragen waren. Was geschieht mit mir? Was geschieht mit den Menschen, die ich liebe, was ist der Tod? Was heißt es für mich, zu sterben, was für andere? Die perfekte Versorgung – stopft sie vielleicht den Sterbenden den Mund? Lenkt die überorganisierte Versorgung systematisch ab von den Fragen der Sterbenden, die die Überlebenden nicht hören wollen? Dient die professionelle Versorgung am Lebensende zuerst den Versorgenden, weil so drohende Fragen auf ein medizinisch-pflegerisch-technisches Gleis geschoben werden können?
Vom Tod in seiner metaphysischen, kosmischen, ungeheuerlichen Dimension ist nicht mehr die Rede – unablässig aber von seiner Verwaltung. Das Sterbegeschnatter ist vielleicht der nervöse Ausdruck für den Versuch, das Nachdenken über den Tod zu vermeiden. Es ist, als würden im Angesicht des professionalisierten Umgangs mit dem Lebensende die inneren Resonanzräume der Menschen verschwinden. Doch wenngleich die Sehnsucht nach Sinn und Bedeutung vielleicht unter dem palliativen Projekt verborgen ist, so ist sie nicht zum Verschwinden gebracht. Sie meldet sich, sie klopft an. Wir werfen uns der palliativen Technik verzweifelt in die Arme, weil es keine Alternative zu geben scheint. Aber die Verzweiflung und die Hoffnung und die Sehnsucht sind durch die Verprojektung des Lebensendes nicht zum Schweigen zu bringen.
Im alten Japan gab es Meister des Zen, die dem Tod als dem Geleiter in das alles aufhebende Sein in besonderer Weise entgegengingen: Wenn sie den Augenblick ihres Sterbens für gekommen erkannten, luden sie ihre Freunde zu einem letzten gemeinsamen Mahl ein. Wenn das Mahl zu Ende war, begaben sie sich in die Mitte des Kreises, schrieben ein letztes Gedicht und gingen in die Versenkung, die Meditation – aus der sie nicht mehr zurückkamen.[4]
Natürlich ist das eine außerordentliche Heiligengeschichte, keine Möglichkeit für uns. Aber sie erzählt, dass die Weise des Sterbens aus dem Leben kommt. Und das gibt uns etwas zum Nachdenken. Welche Weisen des Sterbens können sich aus dem ergeben, was wir leben? Bleibt uns wirklich nur eine Existenz als Palliativkunde im System – begleitet vom ultimativen patientenverfügten Schutzbrief in einer vom Sicherheitswahn besessenen Gesellschaft?
Wir sind Diesseitskrüppel: Die Hoffnung auf etwas, was nach dem Tod kommt, ist den meisten abhandengekommen. Deswegen sind die Menschen vor allem auf ein schmerzfreies Lebensende und auf das Bleiben bedacht. Dass zum Leben das Leiden gehört, lässt sich zwar leicht sagen, aber schwer ertragen. Sieht man im Tod nur das Ereignis, das das Leben unerbittlich beendet, dann ist es unmöglich geworden, den Tod als etwas zu begreifen, was zum Leben gehört; was die Kehrseite des Lebens ist; was dem Leben erst seinen Sinn und seine Bedeutung verleiht.
Es bleibt – wenn man es riskiert, über Sterben und Tod nachzudenken – ein merkwürdig zwiespältiger Eindruck: Wir sind gut ausgestattet, die von Experten getragene Versorgung am Lebensende wird immer besser, sie ergänzt unser Eingebettetsein um den letzten noch fehlenden Mosaikstein. Gut so. Reichtum und Sicherheit überall. Sogar am Ende. Und dennoch breitet sich bei uns – umringt und gesichert von Expertenstandards – eine unendliche Armut aus: Noch nie waren Menschen dem Tod so hoffnungslos ausgeliefert wie heute.
Der Tod ist kein Tor zu einem anderen Leben – wie fast alle Religionen es auf ihre je eigene Weise formuliert haben –, sondern das unwiderrufbare Ende. Wer da angekommen ist, warum sollte der nicht den sedierten, professionell verwalteten Tod als die logische Konsequenz ansehen?
Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur
Wir sind so reich.
Deshalb ist das Ende so schwer.
Reich sind wir im materiellen Sinn, aber nicht nur darin. Die Zahl der Gegenstände, die wir besitzen. Die Zahl der Quadratmeter, die wir bewohnen. Un-tragbar eigentlich, wenn wir an unsere nomadischen Vorfahren denken. Niemand kann bei uns noch tragen, was er besitzt. Darum ist unser Leben unerträglich. Und das Sterben auch. Deshalb ist der Ruf nach einem leichten Leben angebracht, nach dem »Lifestyle des Loslassens (…). Was man nicht hat, braucht keinen Raum, was man nicht hat, kann nicht geklaut werden, was man nicht hat, braucht man nicht umzuziehen, was man nicht hat, kostet nichts«, wie der Soziologe Harald Welzer es formuliert.[5]
Vielleicht ist die Familie vorbildlich, von der berichtet wird: Sie bringt einmal im Jahr alles, was in der Wohnung steht, auf die Straße, um dann gemeinsam zu entscheiden, was wieder hereingeholt werden soll. Möglicherweise müssen wir darüber nachdenken, was »leicht sterben« heißt, was loszulassen ist, worauf verzichtet werden muss (nicht erst) am Lebensende?
Aber reich sind wir, wie gesagt, nicht nur im Blick auf die Objekte, mit denen wir uns ausgestattet haben. Die Schränke quellen über von Hemden, Pullovern, T-Shirts, Anzügen, Kleidern, Outdoorsachen, Indoorkleidung – Schuhen für das Joggen, das Theater, die Freizeit usw. Vielmehr drohen wir auch am Überfluss der nichtmateriellen Güter zu ersticken. Bildungsgüter, die uns umstellen, Gesundheitsdienstleistungen, die uns aufgedrängt werden, Freizeitangebote, die uns verkauft werden; der Dreitagetrip nach Lanzarote, die Wellnesstage zwischendurch. Inmitten der Tabletten, Rehamaßnahmen, Last-Minute-Angebote, Festspielbesuche und Internetsurfereien entgleitet uns das Leben, das ahnen wir immer wieder. Die wachsende Zahl der Dinge, die Springflut der Unterhaltungen, das Rauschen des Lebens, der anschwellende Lärm – das alles verdeckt die Einsicht, dass das Leben woanders ist.
»Wenn ich Arzt wäre und mich einer fragte: ›Was meinst du, muß getan werden?‹, so würde ich antworten: ›Das erste, was getan werden muß, und die unbedingte Voraussetzung dazu, daß überhaupt etwas getan werden kann, ist: ›Schaffet Schweigen!‹ Der Mensch, dieser gewitzigte Kopf, sinnt fast Tag und Nacht darüber nach, wie er zur Verstärkung des Lärms immer neue Mittel erfinden und mit größtmöglicher Hast das Geräusch und das leere Gerede möglichst überallhin verbreiten kann. Ja, was man auf solche Weise erreicht, ist wohl bald das Umgekehrte: Die Mitteilung ist an Bedeutungsfülle wohl bald auf den niedrigsten Stand gebracht, und gleichzeitig haben umgekehrt die Mittel der Mitteilung in Richtung auf eilige und alles überflutende Ausbreitung wohl das Höchstmaß erreicht; denn was wird wohl hastiger in Umlauf gesetzt als das Geschwätz?«[6] Søren Kierkegaard, der dänische Philosoph und Theologe, hat nicht ahnen können, wie viel größer der Lärm noch werden konnte: In der Raserei der Informationsgesellschaft hat sein »Schaffet Schweigen!« noch eine ganz andere Dimension bekommen – und verhallt gänzlich ungehört. Das Getöse des materiellen und immateriellen Reichtums ist lebensverhindernd, das ahnen wir und erkennen es in klaren Augenblicken. Aber das Getöse hält uns im Griff, es lähmt, es sediert. Das Getöse ist ein pain killer, das die schmerzvolle, quälende Wahrnehmung abtötet, die uns ahnen lässt, dass wir das Leben versäumen. Total pain management: Das ist unser Alltag, in dem wir das Leben ertränken. Bisweilen kann man den Eindruck haben, dass dieses Getöse heute auch in den letzten Lebensabschnitt eindringen will. Sind die palliativen Orte nicht in der Gefahr, zu Orten anschwellenden Getöses zu werden? Konzepte, Therapien, Dienstleistungen, Programme und natürlich auch Apparate, Ausstattungen, Ärzte. Wann schreit der erste palliative Patient: »Wie kann ich hier irgendwo in Ruhe sterben?« Natürlich ist an diesen Orten für Ruhe gesorgt und an spirituelle Zuwendung längst gedacht. Aber ist die organisierte, ausgeklügelte palliative Stille das, was Kierkegaard herbeiruft: »Schaffet Schweigen!«?
Man mache sich die Beschaffenheit der palliativen Orte an diesem Beispiel klar: Ein Kind, das in den Straßen von New York groß wird, berührt niemals etwas, »was nicht wissenschaftlich entwickelt, fabriziert, geplant und irgendjemandem verkauft worden ist. Sogar die Bäume sind dort, weil die Gartenbaubehörde beschlossen hat, sie dorthin zu setzen. Die Witze, die das Kind im Fernsehen hört, sind kostspielig produziert worden. Der Müll, mit dem das Kind auf Harlems Straßen spielt, besteht aus kaputten Packungen, die für jemand anderen geplant worden waren. (…) Selbst das Lernen wird als Konsum von Themen definiert, die das Ergebnis eines auf Forschung und Planung beruhenden Programms sind. Um welche Ware es sich auch handeln mag, sie ist das Produkt einer spezialisierten Institution.«[7]
Täuscht der Eindruck? Oder nähern sich die palliativen Orte, die Sterbeorte, diesem Bild, das von dem Kind in New York gezeichnet wird? Das Kind kann auf nichts mehr stoßen, was nicht geplant, gekauft, gemacht ist. Der Sterbende wird in ein palliatives Paket gewickelt, das immer mehr zu einem hervorragenden, perfekten Produkt wird – das aber gerade dadurch so unheimlich wird, weil in ihm das Ungeplante, das Überraschende nicht mehr vorkommt, zumindest nicht vorkommen soll. Das New Yorker Kind und der Palliativpatient sind in einer Kunstwelt angekommen. Es wäre darüber nachzudenken, was da ausgesperrt bleibt. Füllen sich die Menschen am Lebensende noch einmal die Taschen mit Angeboten, mit Dienstleistungen, Waren? Kunde bleiben bis zuletzt? Ist der palliative Ort die Fortsetzung des konsumistischen Alltags – bis zum Ende? Überraschungsfrei, so sicher wie die All-inclusive-Reise? Der Verdacht keimt, dass die palliative Betreuung vielleicht, vielleicht die Erfahrung ausschließt, so wie das New Yorker Kind vom Umgang mit dem nicht Geplanten ausgeschlossen ist.
In Begegnungen mit Menschen, die nicht aus unserer Überflussgesellschaft kommen, etwa mit Menschen in Afrika, könnte man den Eindruck gewinnen, dass unser materieller und immaterieller Reichtum auch eine Beschwernis zur Folge hat, die Leben und Tod mit einem bleiernen Gewicht belastet. Wir sind so vollgestopft mit Individualität, dass unser Ende dem Ende der Welt gleichzukommen scheint. Vielleicht sind Menschen, die in eine große Familie oder Gruppe eingebunden sind, die es gewohnt sind, sich nicht zu wichtig zu nehmen, dem Leben und dem Sterben gegenüber freier – unbeschwerter?
In der langen Geschichte der Individualisierung löst sich das Einzelwesen allmählich aus der Gruppe – und damit erst scheint der Tod zum wirklichen Schrecken werden zu können. Das Bewusstsein vom Tode ist der Begleiter der Geschichte der Individualisierung, die für unseren Kulturkreis ab der griechischen und hebräischen Antike sichtbar wird. Die in der Antike aufkommenden Mysterien, die philosophischen Sekten bereiten vor, was das Christentum dann dieser individualisierten Todesangst entgegensetzen wird: die Hoffnung auf ein ewiges Leben. Christentum und Buddhismus finden angesichts des Prozesses der Individualisierung jeweils Antworten auf das Todesthema, die einerseits ganz gegensätzlich wirken, aber doch heimlich tief verbunden sind. Christus – so der Philosoph Paul Ludwig Landsberg – verspricht eine Geburt, der kein Tod mehr folgen kann, Buddha verspricht einen Tod, dem keine Geburt mehr folgen kann und nur darum kein neuer Tod mehr. »Das Christentum ist die höchste Bejahung eines über den Tod siegreichen Lebens. Der Buddhismus ist die Verneinung des Lebens um der Wirklichkeit des Todes willen.«[8]
Es gibt eine biblische Geschichte, in der sich diese christliche Hoffnung ebenso radikal wie brutal liest. Es ist die Geschichte vom reichen Mann und vom armen Lazarus. »Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Türe; der war mit Geschwüren bedeckt und begehrte sich von dem zu sättigen, was vom Tisch des Reichen abfiel; dagegen kamen die Hunde und beleckten seine Geschwüre.« So steht es im Lukasevangelium (Kapitel 16,19–31). Beide sterben – so wird erzählt. Und im Totenreich schlägt der Reiche – von Qualen geplagt – die Augen auf und sieht Abraham und in seinem Schoß Lazarus. Und er ruft nun mit lauter Stimme: »Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers in Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme.« Abraham antwortet ihm: »Kind, bedenke, dass du in deinem Leben dein Gutes erfahren hast und Lazarus gleichermaßen das Böse. Jetzt wird er getröstet und du leidest Pein.« Die Kluft zwischen dort und hier sei – so Abraham – zudem so groß, dass man sie nicht überqueren könne. Darauf bittet der reiche Mann, Abraham möge sein Haus und seine Familie warnen vor dem, was sie an Qual erwarte. »Sie haben Mose und die Propheten, sie sollen auf sie hören«, sagt Abraham. Nein, antwortet der reiche Mann, nur wenn einer von den Toten käme, würden sie Buße tun. Aber Abraham gibt nicht nach: »Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht gewinnen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht.«
Eine harte, eine unerbittliche Geschichte, die – religionsgeschichtlich – wohl darauf reagiert, dass die Botschaft vom auferstandenen Christus nicht gehört wurde. Deshalb erzählte man diese Drohgeschichte. Das Böse wird sich rächen, lautet die Botschaft.
Man möchte zustimmen, man möchte sagen: Ja, der reiche Mann hat es nicht anders verdient. Man möchte hoffen, dass es so etwas wie eine ausgleichende Gerechtigkeit gibt, dass die Unbarmherzigen gestraft und die Leidenden getröstet werden. Man möchte auch da zustimmen: Ihr hättet es wissen können, was gut ist und was böse. Aber die Reichen – so kann man der Geschichte entnehmen – hören nicht und werden nicht hören. So einfach ist es. Und fallen nicht in unserer Zeit die Welt der Reichen und die Welt der Armen immer weiter auseinander? Würde man sich nicht wünschen, dass da Gerechtigkeit wiederhergestellt wird, dass irgendwann und irgendwo gestraft und belohnt wird? Gleichzeitig drängt sich die beklemmende Frage auf: Würde ich selbst eher auf die Seite des Lazarus oder auf die Seite des reichen Mannes, der sich in Purpur kleidet, gehören?[9]
Verwirrende Fragen tauchen auf: Sind unsere palliativen Einrichtungen der Schoß Abrahams, in dem wir geborgen, geschützt und getröstet sind? Oder sind es die Gemächer der Reichen, in denen man das Flehen derer, die mit Hungergeschwüren vor der Tür liegen, nicht hören kann und muss? Hieße das: Purpur für alle? Palliative Versorgung als weltweite, globale Struktur, die allen Menschen zur Verfügung steht? Jeder weiß, dass das so nicht sein wird.
Die Grenzen der Reichtümer der Erde sind heute für alle, die das sehen wollen, sichtbar geworden. Kein Durchbruch in Wissenschaft oder Technik könnte jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt die Waren und Dienstleistungen verschaffen, die heute in den reichen Ländern zur Verfügung stehen. Stattdessen wird unablässig neue Nachfrage nach institutioneller Behandlung geschaffen, und die Nachfrage wächst schneller, als die Dienstleistungsinstitutionen sie liefern können.[10] Insofern muss man befürchten, dass die palliativen Orte doch eher dem Purpur ähneln, in den sich der reiche Mann kleidet, als dem Schoße Abrahams.
Wer hat dieses Buch geschrieben und warum?
Reimer Gronemeyer ist 1939 geboren, Andreas Heller 1956. Wir haben beide unterschiedliche Erfahrungen mit dem Sterben gemacht und machen müssen. Gemeinsam ist uns, dass in unserem Umfeld lange Zeit darüber nicht gesprochen wurde, über Jahre und Jahrzehnte unseres Lebens nicht.
Reimer Gronemeyer ist ein Kriegskind, hat die Bombenangriffe auf Hamburg in Erinnerung, die Feuerstürme, die Nächte in Bunkern, die Hakenkreuzfahnen in den Straßen. Und später das eisige und eiserne Schweigen über die Nazizeit in der Familie. In der Schule und in der Familie atmete man die stählerne Disziplinargesellschaft ein, die sich allmählich in eine Leistungsgesellschaft verwandelte. Die Erwachsenen versuchten, ihre emotionale Verkrüppelung auf die nächste Generation zu übertragen. Sexualität und Tod waren die zentralen Tabus dieser Gesellschaft, in der ein Junge nicht weinte und elterliche Zuwendung eher als ein Zeichen von Schwäche galt.
Andreas Heller gehört der sogenannten Babyboomer-Generation an, also den geburtenstarken Jahrgängen der fünfziger und sechziger Jahre. Er ist ein Nachkriegskind, hineingeboren in eine Zeit, in der die Tabus der Disziplinargesellschaft nachwirkten und weder Eltern noch Lehrer über die Erfahrungen des Krieges, über Gewalt, Sterben, Tod sprechen wollten und konnten. Im Gegenteil, in der Volksschule war die Prügelstrafe an der Tagesordnung. Die Turnstunden im Jahr 1966 in Düsseldorf bestanden aus Exerzierübungen auf dem Schulhof, und am Gymnasium pflegte der Lateinlehrer seine Bestrafungsaktionen faschistisch zu begründen: Wegen Zersetzung der Wehrkraft.
Wir verkörpern also zwei verschiedene Lebensgeschichten, zwei Generationen, die doch verbunden und aufeinander bezogen sind. Wir haben selbst erst lernen müssen, miteinander zu reden über das, was uns und anderen passiert ist. Wir haben Menschen und Orte aufgesucht, die für unsere Spurensuche auskunftsfähig und von Bedeutung sind.
In unseren beruflichen Tätigkeiten an der Universität entdeckten wir viele gemeinsame Interessen. Wir wollten Studierende und Doktoranden dabei unterstützen, sich diesen Themen zuzuwenden. Über Forschungen und Beziehungen, in Seminaren, öffentlichen Vorträgen, Beratungen haben wir den Alltag des Sterbens in Deutschland besser verstehen gelernt. Wir versuchen im wissenschaftlichen Beirat und im Stiftungsrat des Deutschen Hospiz- und PalliativVerbands (DHPV, Berlin) unsere Perspektiven einzubringen für die Stärkung der ehrenamtlichen Hospizarbeit. Wir sind überzeugt, dass die Hospizidee und die Praxis einer umfassenden hospizlich-palliativen Sorge eine große humanitäre Möglichkeit für die Gesellschaft eröffnet, Prozesse der Empathie und Reflexion, des friedlichen und freundschaftlichen Verstehens in Gang zu setzen. Schließlich geht das Sterben alle an und wird alle betreffen. Und wir wissen, dass die Auseinandersetzung mit dem Sterben das Leben befördert, ein gutes Leben hier und jetzt ermöglichen kann. Gleichzeitig sind wir in Sorge und Unruhe, dass diese wunderbare Möglichkeit zerbricht und deformiert wird und vor unseren Augen abgelöst und aufgelöst wird in eine »Verprojektung des Sterbens«, in eine kontrollierte Sterbebürokratie.
In einem lang herrschenden kulturellen Muster sind wir im sogenannten Abendland seit den Pestzeiten immer wieder der Versuchung erlegen, Schwache, Kranke, Hilfsbedürftige, Menschen, die anders sind, zu isolieren, in Quarantäne zu schicken, in Lagern zu konzentrieren, sie aus der Gemeinschaft auszusondern und zu töten. Das beginnt mit dem kollektiven Im-Stich-Lassen der Pestkranken seit dem 14. Jahrhundert[11] und setzt sich fort in den kolonialen und von Amnesie[12] begleiteten Praxen der sogenannten concentration camps, der Vorläufer der gegen die europäischen Juden und Jüdinnen gerichteten nationalsozialistischen Vernichtungspolitik. Wir sind beunruhigt, wenn wir sehen, wie alte Menschen, die mit Demenz leben müssen, in musealisierten Heimen leben, in Dörfern mit ihresgleichen gebündelt werden, wie in hochtechnisch aufgerüsteten sogenannten modernen Pflegeeinrichtungen eine elektronische Ruhigstellung dieser Generation betrieben wird, indem auf jedem Zimmer die Möglichkeit besteht, sich den ganzen Tag mit Musik aus den zwanziger, dreißiger und vierziger Jahren zu beschallen und sich mit dem Filmprogramm seiner jungen Jahre einlullen zu lassen. Konsum und Ablenkung bis zum letzten Augenblick.
Was bedeutet es, wenn heute mit viel architektonischem und ästhetischem Aufwand neue Pflegeheime errichtet werden, mit entsprechenden Farb- und Kunstkonzepten, die sich die jüngere Generation ausdenkt, natürlich ohne Beteiligung der älteren Menschen, die in diesen Heimen wohnen werden? Es wird in Mauern, in Steine, in totes Material investiert statt in Menschen, statt Beziehungen zu pflegen und menschliche Zuwendung möglicher zu machen. Vielleicht drückt sich hier ein tiefliegendes kollektives Schuld- und Schamgefühl aus. Man arrangiert halt alles im Äußerlichen, um sich innerlich nicht einzulassen und persönlich nicht auszusetzen. Der Aufwand um die »Kosmetisierung der Gebäude« ist vielleicht Ausdruck einer Absicht, den Alten und Sterbenden nicht ins Gesicht schauen zu müssen. Es wird berichtet, dass die Alten die innenarchitektonisch abgestimmten Drucke der Impressionisten von den Wänden ihrer Zimmer reißen, um sie durch Bilder von röhrenden Hirschen zu ersetzen. Das sind eindeutig symbolische Handlungen, nicht ohne Agressivität. Vielleicht wollen sie nicht in diesen Häusern leben. Vielleicht empfinden sie sie nicht als ihre Häuser.
Uns machen viele Entwicklungen im Umgang mit dem Lebensende große Sorge. Also begannen wir darüber zu reden und zu schreiben, im Rundfunk und Fernsehen Öffentlichkeit zu erzeugen, im direkten Kontakt mit der Bevölkerung auf vielen öffentlichen Veranstaltungen zu sprechen. Die Menschen hörten zu, und was noch wichtiger war, sie stimmten oft genug zu.
Es gibt in Deutschland ein weitverbreitetes Gefühl: Irgendetwas läuft hier falsch. Es muss sich etwas ändern. Wir stehen an einer Weggabelung. Es muss ein Alarmsignal sein, wenn aus den Hospizen der Eindruck wiedergegeben wird: Wir sind die Abschiebestationen der Gesellschaft. Die Patienten und Patientinnen werden immer häufiger sterbend aus den Krankenhäusern in die Hospize verbracht, oder in die Kurzzeitpflege, in die Pflegeheime. Eine dramatisch kurze »Verweildauer« lässt sich beobachten. Es gelingt nicht mehr, den Kontakt zu diesen Menschen, ihren Familien vertrauensvoll zu entwickeln.
Eine Aufnahme in einem deutschen Pflegeheim erfordert mehr als zwanzig Assessments, also Einschätzungen über den »Status« des künftigen Bewohners. Die Pflegenden nehmen alles in den Computer auf. Es kommt vor, dass während dieser verordneten »bürokratischen Initiation« der Betroffene stirbt. Alles umsonst, die ganze Arbeit. Zurück bleiben ein toter Mensch, der im Korridor der Bürokratie starb, eine aufgelöste und entsetzte Pflegekraft, Verzweiflung, eine tränenreiche Hilflosigkeit, Wut und Empörung auf das System.
Der Alltag geht aber weiter. Das System der Medizinischen Dienste der Krankenkassen (MDK), die die Heime beaufsichtigen und die »Qualität kontrollieren«, bläht sich seit Jahren immer mehr auf. Immer neue Bürokratisierungszumutungen sind die Folge. Es müssen nicht nur die Urinmengen und Ausscheidungen beobachtet und gemessen werden, schon ist die Rede davon, »Folterbeauftragte« in die Heime zu schicken. Sie sollen Menschenrechtsverletzungen beobachten und melden.
Was steht hinter dieser »Kontrollmanie«? Drückt sich hier das schlechte Gewissen der Gesellschaft aus über die Abschiebepraxis gegenüber den Alten, die längst zu den Asylbewerbern der modernen Gesellschaft geworden sind? Ist der Kontrollwahn Ausdruck dafür, dass alles korrekt und »in Ordnung« zu sein hat, sozusagen »nach Vorschrift« gehandelt wird?
Der Deutsche Caritasverband, unter dessen Dach etwa zwanzig Prozent der Pflegeheimbetten organisiert sind, hat jetzt angekündigt, aus diesem System aussteigen zu wollen. Ein erster Schritt, verbunden mit der Einsicht, dass die Qualität des Lebens und Sterbens in deutschen Pflegeheimen von den Betroffenen her ermittelt und besprochen werden muss. Eine Wende kündigt sich an.
Dieses Buch ist erwachsen aus vielen Kontakten, offenen Begegnungen, intensiven Gesprächen mit Menschen, die unsere Sorge teilen, dass die Möglichkeit, menschlich und authentisch zu sterben, erdrückt wird von einer sozialtechnologischen Bürokratisierung und einer Vergeldlichung des Sterbens. Wir haben dieses Buch mit kritischer Sympathie geschrieben, getragen aus der Hoffnung, dass unsere manchmal zornige Bewegtheit auch andere bewegt und in Bewegung setzt, hoffentlich in Richtung einer menschlicheren Gesellschaft, die an einem menschenwürdigeren Sterben zu erkennen sein wird und in der nicht die auf der Strecke bleiben, die sich alltäglich sorgen.
2. Kapitel
Was hat sich heute im Umgang mit dem Sterben verändert?
»Der moderne Tod hat nichts, das ihm Transzendenz verleiht oder sich auf andere Werte bezieht. Fast immer ist er das unvermeidliche Ende eines natürlichen Vorgangs. In einer Welt der Tatsachen ist der Tod nur eine Tatsache mehr. Da er aber eine unangenehme Tatsache ist, die all unsere Auffassungen und den Sinn unseres Lebens in Abrede stellt, versucht die ›Philosophie des Fortschritts‹ (…) seine Existenz hinwegzuzaubern. In der modernen Welt ›funktioniert‹ alles, als gäbe es den Tod überhaupt nicht.«
Octavio Paz
Mit Blick auf das heutige Sterben sind es vor allem drei Entwicklungen, die zunächst Aufmerksamkeit verdienen. Unsere Lebensspanne, die durchschnittliche Lebenserwartung, hat sich in den letzten mehr als hundert Jahren deutlich verlängert. Wir leiden an unterschiedlichen Erkrankungen, die oft genug chronisch werden und dann zu einem langsamen Sterben führen. Wir leben länger als unsere Vorfahren, und wir sterben länger. Und schließlich hat sich der demographische Aufbau der Gesamtbevölkerung verändert. Wir haben immer weniger jüngere Menschen im Unterschied zu immer mehr älter werdenden Menschen.
Heute dominieren in unseren Breitengraden die sogenannten »Zivilisationskrankheiten« bzw. die »degenerativen Gefäßerkrankungen«; siebzig Prozent aller Todesfälle sind auf Herz-Kreislauf-, Krebs- und Lungenerkrankungen sowie Skelettveränderungen zurückzuführen. Die Krankheitsverläufe verändern sich, verglichen mit früheren Zeiten, auch und gerade im Alter. Wir stehen heute vor der Herausforderung, das hohe Alter und das lange, langsame Sterben bewältigen zu müssen. Daran entzünden sich alle Diskussionen zu diesem Thema. Langes Siechtum und Sterben werden gefürchtet, individuell wie volkswirtschaftlich. Nicht der Tod als solcher und die Tatsache, sterben zu müssen, beschäftigen uns daher heute, sondern die Umstände, das »Wie« des Sterbens. Und es ist die soziale Kernfrage des beginnenden dritten Jahrtausends, wie es gelingen kann, die wachsende Zahl älterer, hochaltriger und sterbender Menschen so zu umsorgen, dass sie nicht als ein Entsorgungsproblem gesehen werden, sondern als Aufgabe einer humanen Gesellschaft und einer kompetenten, empathischen und würdigenden Sorge.
Männer werden heute älter als Männer vor hundert Jahren, Frauen überleben im Durchschnitt Männer um eine Reihe von Jahren: Ihre statistische Lebenserwartung liegt bei mehr als achtzig Jahren. Der Anteil der über fünfundsechzigjährigen Menschen in der Gesamtbevölkerung hat sich von knapp fünf Prozent auf etwa fünfzehn Prozent erhöht. Kurz: Die Menschen in unseren Breitengraden werden immer älter, und damit steigt die Zahl der Hochaltrigen. Für Europa werden im Jahr 2050 etwa siebzig Millionen hochaltrige Menschen erwartet.
Verschiedene Faktoren haben zu dieser veränderten Lage beigetragen: Die Verbesserung der gesundheitlichen Gesamtversorgung wie der hygienischen Lebensbedingungen, das Sinken der Kindersterblichkeit und Errungenschaften durch medizinisch-technisch-pharmakologische Entwicklungen. Zusammengenommen sind das die wichtigsten Gründe dafür, dass sich die durchschnittliche Lebenszeit in den industrialisierten Ländern erheblich erhöht hat. Viele ehedem lebensbedrohende Krankheiten sind verschwunden. Noch bis zum Zweiten Weltkrieg dominierten ansteckende Infektionskrankheiten, die sich oft genug epidemisch ausbreiteten: Cholera, Tuberkulose, Diphtherie, Pocken, Scharlach, Masern. Erst durch Entwicklungen in der Hygiene, durch medizinische Interventionen – vor allem die Impfkampagnen –, durch die Einführung und Verbreitung von Antibiotika und durch eine grundlegende Neuorganisation der Gesundheitsvorsorge konnten ansteckende Krankheiten besser unter Kontrolle gebracht werden, zumindest in den mitteleuropäischen und den industrialisierten Ländern.
Aber diese Erfolgsgeschichte der modernen Gesundheitspolitik und Medizin hat Schattenseiten. Sie ist nämlich auch eine Geschichte der staatlich und obrigkeitlich geduldeten und geförderten Menschenexperimente. Im Dienste des sogenannten medizinischen Fortschritts und legitimiert durch eine darwinistische Selektionstheorie wurden Menschen, zunächst gesellschaftlich stigmatisierte Gruppen wie Zuchthäusler, Kindsmörderinnen, Prostituierte, Bettler, »Arbeitsscheue«, als medizinische »Untersuchungs- und Experimentier-Fälle« missbraucht. Exemplarisch wird von der Kulturwissenschaftlerin Anna Bergmann auf die Forschungen des Nobelpreisträgers Robert Koch nicht nur an der Charité in Berlin, sondern auch in den ehemaligen deutschen »Schutzgebieten«, den Kolonien, aufmerksam gemacht: »Im Frühjahr 1906 begab er sich als Protagonist der deutschen medizinischen Kolonialforschung auf eine ›Schlafkrankheitsexpedition‹ nach ›Deutsch-Ostafrika‹ (heute: Republik Tansania, Republik Ruanda, Republik Burundi), das 1885 als ›Schutzgebiet‹ in deutschen Besitz genommen worden war. In sogenannten Sammel- und Konzentrationslagern wurden Kranke isoliert, und Kolonialforscher errichteten dort ihre bakteriologischen Labore. Koch experimentierte hier in einem Barackenlager an Tausenden von Menschen. Er selbst regte 1907 beim Reichsgesundheitsrat systematische Isolationsmaßnahmen gegenüber Personen an, die von der Schlafkrankheit betroffen waren: Infizierte sollten ›herausgegriffen‹ werden, um sie in Konzentrationslagern zu sammeln. Koch bezog sich dabei explizit (…) auf das britische Modell der Concentration Camps, die sowohl zur politischen Internierung der Burenfamilien als auch zur Isolation von Seuchenkranken eingerichtet worden waren. An 2461 Einheimischen, die von der Schlafkrankheit befallen oder nur seuchenverdächtig waren, erprobten 1907 Kolonialärzte in einem deutsch-ostafrikanischen Konzentrationslager Atoxyl (…), ein Präparat, das in Deutschland wegen seiner schweren Vergiftungswirkungen kaum angewendet wurde und neben Erblindung auch Injektionsschmerzen, Koliken und Störungen des Zentralnervensystems hervorruft. Ohne Angabe der Todesursachen starben laut Statistik der Jahre 1908/09390 Personen, und die Experimentatoren konzedierten, dass mehrere erblindet waren.«[13] Die weiße koloniale Macht erlaubte es, Menschen neben allen rechtlichen Rahmenbedingungen als Material zu benutzen, den Verlauf der Infektionen und des Sterbens zu beobachten, wobei ihr Tod im Dienst des medizinischen Fortschritts in Kauf genommen wurde. Menschenexperimente und Forschunsgdesigns entsprachen durchaus den geltenden empirischen Standards und wurden selbstverständlich bis weit ins 20. Jahrhundert fortgesetzt. Die Kulturwissenschaftlerin Anna Bergmann führt diese Praxis der Menschenversuche auf das Selbstbild einer Medizin zurück, die im Prozess radikaler Vernaturwissenschaftlichung die Opfer entpersonalisierte und diese ohne jede Affektregung als »Krankenmaterial« betrachtete.
Warum machen wir auf diesen Zusammenhang aufmerksam? Die Entpersonalisierung von Menschen, die Tendenzen, sie als Objekte der Versorgung zu sehen, von ihnen als »Fällen«, als »Krankenmaterial« zu sprechen, sind nicht aus der Welt. Die deutlichen Veränderungen im sozialen Gefüge unserer Gesellschaft, eine wachsende Verbetriebswirtschaftlichung des Gesundheitssystems verleiten zudem zu Problembeschreibungen, die sich in scheinbar versachlichenden Begriffen wie »Rentenberge«, »Altenlast«, »Demenzlawine« Ausdruck verschaffen. Kollektive Distanzierungen lassen sich auch heute beobachten. Das Muster der Aussonderung findet eine Fortsetzung, subtiler und möglicherweise schwerer zu erkennen. Erkennbar sind schon jetzt distanzierende Tendenzen, auf den langen Prozess des Sterbens mit dem kurzen Prozess des assistierten Suizids oder der aktiven Sterbehilfe zu reagieren.
In Europa wächst dazu die Zustimmung bei Experten und in der Bevölkerung. So spricht sich die französische Ärztekammer dafür aus, aktive Sterbehilfe unter bestimmten Umständen zu legalisieren. Damit würde legalisiert, was schon passiert: Der Mediziner Didier Sicard, von Präsident Hollande mit der Entwicklung einer Gesetzesvorlage beauftragt, hatte 5000 Todesfälle untersucht. In jedem zweiten Fall sollen die Medizinerinnen oder Mediziner den Tod durch Schmerz- bzw. Betäubungsmittel beschleunigt haben.
In Belgien wird die aktive Euthanasie seit dem Jahr 2002 praktiziert. (Unter Euthanasie wird das medizinische Eingreifen in den Sterbeprozess verstanden, bei dem das Sterben durch Medikamente herbeigeführt wird.) Derzeit wird durch eine Senatskommission die Legalität der Euthanasie bei Minderjährigen und bei Menschen mit Demenz erörtert.
In den Niederlanden, das als erstes europäisches Land 2002 ein Gesetz zur Euthanasie verabschiedete, werden jährlich etwa 2500 Menschen euthanasiert. Seit 2012 gibt es ein mobiles Team, das eine »ambulante Euthanasie« in der eigenen Wohnung anbietet. 714 Menschen haben davon Gebrauch gemacht.
Das britische Oberhaus beschäftigte sich 2006 und 2009 mit einer Gesetzesvorlage für ein Recht auf assistierten Suizid bei unheilbarer Erkrankung und einer Lebenserwartung von einem halben Jahr, die beide Male abgelehnt wurde. Eine revidierte Fassung der Vorlage ist erneut eingereicht. Diese Nachrichten zeigen einen Trend: Euthanasieverbote werden in Europa gelockert oder sollen gelockert werden. Das gibt Anlass zu großer Sorge.
Die Diskussion um die Erweiterung der »therapeutischen Möglichkeiten« am Lebensende ist in einer neoliberalen Gesellschaft, deren Blick vor allem der unbeschränkten Kapitalakkumulation gilt, alles andere als harmlos. Die neuen therapeutischen Möglichkeiten, die Euthanasie hoffähig machen, kommen als marktförmige Erweiterungen von Dienstleistungsangeboten daher, die man – wie andere Konsumgüter auch – wählen oder ablehnen kann. Die freie Wahl ist eine Scheinwahl. Der Druck auf Selbstentsorgung steigt, je deutlicher das Ideal der Fitness, der Jugendlichkeit und der Gesundheit unser Empfinden beherrscht und jeden, der pflegebedürftig oder sterbend ist, zum Outcast macht.
Und auch dies gilt: Arme sterben früher. Arme, besonders Bildungsarme, bekommen schon jetzt weniger Behandlung und Betreuung. Asylbewerber werden von Untersuchungen ausgeschlossen, Transplantationslisten werden gefälscht. Hinweise, wenn man sie sehen will, auf eine gefährliche soziale Ungerechtigkeitsdynamik und eine neue, schleichende Selektionspraxis.
Wir sterben nicht mehr plötzlich und unerwartet, sondern langsam und vorhersehbar
Unsere Vorfahren fürchteten den plötzlichen Tod, und so beteten sie jahrhundertelang: »Vor einem plötzlichen Tod bewahre uns, o Herr.« Das Lebens- und Zeitgefühl war vom Jenseits her bestimmt. Um dorthin zu gelangen, braucht es den Frieden mit Gott und die Versöhnung mit den Menschen und eine gute unmittelbare Vorbereitung auf den Tod, eine Vorbereitung auf die Sterbestunde. Martin Luther schreibt 1519 in einem sehr frühen Text, dem Sermon von der Bereitung auf das Sterben (nicht zur Begleitung!), ganz in dieser Haltung: Am Ende des Lebens, nachdem man die irdischen Angelegenheiten geordnet habe, sei eigentlich nur eines wichtig, nämlich Versöhnung: Wem muss ich noch etwas verzeihen und wen muss ich noch um Verzeihung bitten?
Wichtig war für den Übergang, das viaticum, die Kommunion als Wegzehrung zu empfangen, durch Gebete, Segnungen, Rituale und Salbung (»Letzte Ölung«) vorbereitet zu sein auf den Tod. Es galt als schlechtes Zeichen, wenn Sterbende nicht die »Gnadenmittel« der römisch-katholischen Kirche empfangen konnten, wenn sie also keine »gute Sterbestunde« hatten. Es gehörte mit zur Inszenierung eines guten Sterbens, dass sich beim Sterbenden kurz vor dem Tod eine gewisse Beruhigung und Ruhe einstellte, ein Zeichen seines Glaubens, bald in die Nähe Gottes zu gelangen. »In dem Maße, in dem nicht die Seelenverfassung in der Todesstunde, sondern das gesamte Leben über das ewige Leben entschied und schließlich der Glaube an ein Jenseits überhaupt in den Hintergrund trat, verlor dieses Ideal an Bedeutung. Dann wurde ein schnelles unerwartetes Ende erstrebenswert, weil es unnötige Leiden ersparte.«[14]
Im Gegensatz zu unseren Vorfahren haben sich Lebensgefühl und -planung am Ende des Lebens also grundlegend verändert. In früheren, agrarisch geprägten Gesellschaften war man sich täglich bewusst, dass das Leben plötzlich enden konnte. Die durchschnittliche Lebenserwartung war für die meisten gering, ein paar Jahrzehnte in der Regel. Das Leben war bedroht. In jedem Augenblick konnte man vom Tod »ereilt« werden. Insofern galt es, das Leben nutzbringend zu verbringen (carpe diem, tempus fugit – nutze den Tag, die Zeit eilt dahin). Der Alltag war ein harter Überlebenskampf. Krankheit bildete eine ständige Lebensgefahr. In einem archaischen Verständnis galt sie lange Zeit als eine Strafe Gottes.
Nicht zufällig betete man stereotyp über Jahrhunderte: »Vor Krankheit, Hunger, Pest und Krieg bewahre uns, o Herr.« Diese Geißeln der Menschheit schlugen unbarmherzig, und so war der Tod eine fast selbstverständliche alltägliche Erfahrung. Man konnte nicht überrascht sein, wenn er vor der Tür stand, aber man sollte vorbereitet sein.
Ganz anders heute. Wir sterben in der Regel langsam und vorhersehbar, die 1923 geborene österreichische Schriftstellerin Ilse Helbich nennt das »die Langeweile des allmählichen Sterbens«[15]. Insofern wird der Wunsch vieler Menschen verständlicher, kurz und schmerzlos, »im Stehen« zu sterben, wie der Liedermacher Reinhard Mey singt.