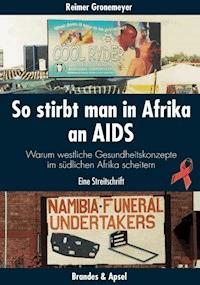Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition Körber-Stiftung
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Alten sind die Musterschüler der Leistungsgesellschaft, die digitale Avantgarde im Vitaldaten-Monitor, die umworbene Kundschaft eines verantwortungslosen Marktes. Schonungslos schreibt Reimer Gronemeyer über das Altwerden im Würgegriff von Konsum und Jugendwahn. Sein hoffnungsvolles Gegenbild ist eine neue Kultur der Nachdenklichkeit. Sie entfaltet sich im unermüdlich bewussten Unterwegssein. Und in der Entscheidung, Verantwortung zu übernehmen, Nähe zu wagen, neu aufzubrechen. Denn es geht immer um Befreiung. Das persönlichste Buch des renommierten Soziologen Reimer Gronemeyer ist eine Einladung, einen eigenen Umgang mit der großen Aufgabe Alter zu finden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
»Man muss schon sehr lange leben, um jung zu werden.«
Pablo Picasso im Alter von 91 Jahren
Kapitel 1: Altern in Würde?
Wie die Altersbilder mit der Wirklichkeit zusammenstoßen
»Er fühlte sich alt in der Jugend und jung im Alter.«
Hugo Ball über Hermann Hesse
Alt sein – so kommt es mir vor – ist ein Zustand der Betäubung. Ich spüre das Alter nicht oder nur, wenn ich in den Spiegel schaue. Und auch da sehe ich es mehr, als dass ich es empfinde. Meine Falten sind mir gewissermaßen voraus. An ihnen kann ich ablesen, dass ich alt bin, aber ich glaube ihrer Botschaft nicht. Von Zeit zu Zeit klopft das Alter an und will mich beugen, doch gehe ich dann besonders aufrecht, obwohl mir vielleicht gerade nach ›gebeugt‹ zumute ist. Manchmal bewege ich mich auch – die Betäubung weicht für kurze Zeit – extra krumm. Eine Art Probehandeln, ich versuche zu spüren, wie es sein würde, wenn ich einmal wirklich alt wäre. Ich flaniere dann, denke ich, auf dem Seniorenlaufsteg. Ein Catwalk für Auslaufmodelle.
Kürzlich ging ich am Rande eines unbeleuchteten Grabens, es war dunkel, meine Schritte waren wohl etwas unsicher, da ergriff eine jüngere Kollegin meinen Arm, um mich schützend durch die unübersichtliche Situation zu geleiten. Ich habe mich leise abwehrend entzogen. Brauch’ ich das schon? Geht es los? Ich dachte an Henry David Thoreau, der im 19. Jahrhundert allein in den Wäldern Kanadas lebte und gesagt hat: »Wüsste ich gewiss, dass jemand zu mir käme, mit der bewussten Absicht, mir eine Wohltat zu erweisen, ich würde davonlaufen, so schnell mich meine Füße tragen wollten … aus Angst, er könne mir etwas von seinem Guten antun.«1
Da ist ja ohnehin ein Begleiter im Alter, der irgendwann auftaucht und dann dauerhaft neben einem hergeht und nicht mehr verschwinden will. Ein Gespenst im T-Shirt, auf dem die Schreckmitteilung prangt: »Jetzt geht es los!« Ja, wann schlägt das Alter zu? Heute? Morgen? Da sind die Namen, die ich plötzlich vergesse. Oder: Ich höre von jemandem, der morgens aufwacht und am Auge eine Ausbeulung feststellt. Einige Wochen später ist er tot. Was wird mich hinfällig machen? Was lauert mir hinter der nächsten Ecke auf? Und dann erinnere ich mich zur Aufmunterung an die Nachricht vom 92-jährigen Inder, der jetzt beschlossen hat, seinen letzten Marathon zu laufen. Ein Schwanken zwischen innerer Belustigung und angespannter Hoffnung: Na ja, es kommt ja vielleicht doch noch was? Vielleicht sind wider Erwarten Aufbrüche möglich? Hat nicht Johann Sebastian Bach seine wichtigsten Werke als Uralter geschrieben? Sind nicht Verdis Spätwerke (Falstaff!) die ergreifendsten? Sieht man nicht den greisen Michelangelo schöne junge Knaben aus dem Marmor schlagen? Schon vor vielen Jahren, als ich noch jung war, hat mich dieses Bild tief berührt: Der alte, sehr alte und fast blinde Ernst Bloch liegt auf einer Wiese und der junge Rudi Dutschke neben ihm, die beiden ins Gespräch vertieft. Das Alter kann offenbar mit dem Neuen, dem Jungen, dem Überraschenden verbunden sein. Aber man ist ja nicht Bach oder Verdi oder Bloch …
»Was ich bereue?«, fragt der alt gewordene Schriftsteller Hermann Peter Piwitt. »Dass ich ständig verliebt war, ohne das Zeug dazu zu haben? … Ich habe einige unglücklich gemacht und dafür selbst mächtig an die Backen gekriegt. So, wie es sich gehörte … Ich brauchte fast zwei Jahre, eh ich begriff, warum die Mädchen nicht mehr zurückguckten. Sie strichen nicht mehr ihr Haar hinter die Ohren oder ordneten es oder verwuselten es ein bisschen im Vorübergehen. Sie schwebten einfach vorbei, die kleinen Rotzlöffel, an dem Mann, dem doch nichts fehlte, als dass er sein schönes blondes Haar verloren hatte: aber sonst tipptopp.«2
Ich frage mich, ob es früher leichter war, den Verfall des Körpers, den das Alter mit sich bringt, zu ertragen. Gehe ich durch einen Bahnhofskiosk, wo jede noch so fade Fernsehprogrammzeitschrift einen mit Jugendlichkeit überschüttet, ist man mit seinen Falten eigentlich schon eine Missgeburt. War das – sagen wir mal: für Cicero – auch eine so allgegenwärtige Provokation, obwohl ihn nicht unablässig vervielfältigte Blondchen anglotzten? Wahrscheinlich ja. Er zitiert in seinem großen Werk De senectute (Über das Alter) die Klage des Anakreon:
Grau sind schon meine Schläfen und weiß das Haar am Kopfe, fort ist der Reiz der Jugend, es wackeln meine Zähne. Vom süßen Leben bleibt mir nicht mehr viel Zeit noch übrig. Deswegen muß ich jammern, es graut mir vor dem Hades – Das ist ein garstiger Winkel, und schlüpfrig ist der Abstieg, und ist man einmal drunten, dann gibt es kein Zurück mehr.3
Der Altersschmerz war wohl ähnlich präsent. Aber vielleicht zieht das mediale Blondchenfeuer uns auf eine nur noch physische Verkrampfung herunter – was das Altwerden zu einer primitiven Verteidigungsschlacht macht, die von vornherein verloren ist. Je mehr wir auf das äußere Erscheinungsbild des Altwerdens festgelegt sind und damit auf das »Nicht mehr«, desto schwieriger wird es, sich auf die Innenlage zu besinnen. Verleugnung des Alters und nicht Akzeptanz möchte in den Vordergrund treten. Das Innenleben sklerosiert: Mir kommt es so vor, als wenn das innere Tunnelsystem, in dem ich nach der Bedeutung und den Folgen des Altwerdens suchen müsste, völlig von Ablagerungen verstopft ist. Wie bei den Arterien, die mit dem Herzen verbunden sind, so sind heute die Zugänge zum Tunnelsystem der Gefühle in uns verstopft. Und während man vielleicht versucht, in sich zu graben und zu wühlen, um etwas davon zu begreifen, was es heißt: alt werden, kommt bestimmt jemand und spricht von »Altern in Würde«, was bei mir zunächst einmal die Assoziation Rollator, beigefarbene Mütze, Essen auf Rädern oder Apothekenrundschau auslöst.
Ich erinnere mich an zwei Begegnungen mit Menschen, die sich selbst zum Aushängeschild einer Pseudojugendlichkeit haben machen lassen. Ein Schauspieler, mit dem ich in einer Talkshow saß, Mitte fünfzig, glattes Gesicht. Er hatte auch gleich sein eigenes Buch zum Thema Lifting zur Hand, das er unablässig anpries. Ich schaute ihn an und dachte: Ja, man kann sich die Demenz, die Erinnerungslosigkeit, auch ins Gesicht operieren lassen. Das gelebte Leben war erfolgreich aus dem Gesicht entfernt worden. Irgendjemand hat mal gesagt: Ab dreißig ist jeder für sein Gesicht verantwortlich. Wenn das wahr ist, ist das Lifting ja auch eine Antwort. Das Gesicht wird gewissermaßen an das Illustriertencover angepasst.
Es geht übrigens nicht um die sogenannte Natürlichkeit. Der spanische Regisseur Pedro Almodóvar lässt in seinem Film Alles über meine Mutter die transsexuelle Sekretärin Lena vor die Bühne treten und eine Rede über Authentizität halten. Im Grunde sei gerade das Falsche an ihr (die Brüste, das Lifting) authentisch, weil sie endlich die geworden sei, die sie sein wolle.
Die andere Person war eine Frau, mit der ich in einem Café in Windhuk, Namibia, saß. Goldene Ringe, goldene Ketten, blondes Haar, braune Haut, weißes T-Shirt. Irgendwann wurde mir der Grund meiner Irritation bewusst: Die straffe Haut im Gesicht kontrastierte mit den faltigen Händen, die diesem alterslosen Gesicht weit vorausgeeilt waren. Irgendwie passten die rassistischen Sprüche, die sie über ihre schwarzen Angestellten absonderte, zu dieser Pseudoattraktivität, einer vorgespiegelten, operativen Jugendlichkeit, einer leblosen Oberflächlichkeit, die doch mehr aus trauriger Konkurrenz als in lebendiger Anziehungskraft bestand.
Eine solche kostspielige Oberflächenbehandlung erlaubt es dann auch, die inneren Faltenlandschaften zu ignorieren. Äußerlich chirurgisch geglättet, lässt sich verbergen, dass innerlich der Schrecken des Altwerdens in einer Gletscherlandschaft eingefroren ist und zum Schweigen gebracht wurde.
Am anderen Ende, in Opposition zur Lifting-Fraktion, stehen diejenigen, die sagen: »Ich bin stolz auf jede Falte in meinem Gesicht.« Das ist natürlich auch ein Schmarrn. Welche dieser Falten spricht von Gier, welche von enttäuschter Liebe, welche von Schuld, welche von unerhörten Glückserfahrungen, welche von bitteren Niederlagen? Wenn das Gesicht und seine Falten etwas erzählen vom gelebten Leben, dann eine zwiespältige Geschichte. Zu der kann man vielleicht sagen: Es ist, wie es ist. Aber: Ich bin stolz auf jede Falte in meinem Gesicht? Nein, das ist Unsinn oder Arroganz …
Wie macht man das heute? Wie geht das: In Würde altern? Sicher ist es mit dem Altwerden nicht mehr so wie zu den Zeiten meiner Großmutter. Die saß mit ihrem dünn gewordenen, zum Knoten gebundenen weißen Haar in der Sofaecke. Schwarzes Kleid, eine weiße, gestärkte Schleife. Sie strickte, sie flickte Socken, sie schälte Kartoffeln und wünschte sich von ihren Enkeln ein Gummiband für ihr Brillenetui, das nicht mehr schloss. Das wurde von uns aus einem alten Fahrradschlauch geschnitten. Sie lebte ganz selbstverständlich mit ihrer Tochter und deren Familie zusammen und starb auch in ihrem Bett aus weißen Metallrohren. Eine eher düstere Lampe hing von der Decke, die am Rand Troddeln hatte und das Zimmer spärlich beleuchtete. Sie half, sie war da und hatte – wenn ich mich richtig erinnere – keine Ansprüche, sie war zufrieden. Das Wort würdig hätte sie für sich wohl nicht in Anspruch genommen. Respekt hatten wir vor dem strengen Großvater aus der anderen, der väterlichen Familie, der aussah wie Wilhelm II., ein verarmter, gescheiterter, starrsinniger Potentat, der am Schluss auf keinem Thron mehr saß, sondern in einem elenden Heim, dessen Kälte durch einen kleinen Kanonenofen kaum gemildert wurde. Dort fristete er seine alten Tage, angewiesen darauf, dass die Enkel ihm in einem Wehrmachtsgeschirr die Suppe brachten. Eine Versorgung gab es in diesem traurigen Haus nicht. Ich erinnere mich an kalten Zigarrenrauch, einen abgeschabten Anzug mit Weste, die Kette der Taschenuhr und eine schnarrend-brüchige Stimme. Der Respekt vor ihm entstand eher aus dem Aufeinandertreffen von Unnahbarkeit seinerseits und Angst meinerseits.
In Würde altern: Ich habe den Verdacht, das ist eine Abschiebeformel unserer Leistungsgesellschaft, die sich beim Versuch, die Alten irgendwie unschädlich zu machen, ins Fäustchen lacht: »Such, Bello, such!«, sagt man zum Hund, der das Stöckchen herbeibringen soll. »Geh und altere in Würde!«, sagt man jenen, von denen man in Wirklichkeit nichts mehr erwartet. Altern in Würde: Damit ist man schon fast in der Friedhofskapelle.
Die Gesellschaft zwingt den Alten unablässig ihren Maßstab auf, der ihnen das »Nicht mehr!« vor Augen führt und einhämmert. Die Areale des Alters, die nicht vom Leistungsdruck, vom »Nicht mehr«, kolonisiert sind, müssen der Leistungsgesellschaft erst noch abgerungen werden. Gibt es ein Leben im Alter, das sich nicht an der Frage misst, ob man den gesetzten Normen und Ansprüchen noch einigermaßen entspricht? Es steht so etwas an wie die Suche nach einer neuen Souveränität des Alters.
Die Leugnung des Alters ist das Naheliegende. »Man ist so alt, wie man sich fühlt«, sagt der 1937 geborene amerikanische Filmschauspieler Morgan Freeman. Was natürlich eine viel zitierte Banalität ist. »Alter ist willkürlich. Auf dem Golfplatz komme ich mir an manchen Tagen vor wie 90, an anderen wieder wie 50.«4 Wahrscheinlich ist der alte Mann, der auf dem Frankfurter Hauptbahnhof an mir vorbeischlurft und die stählernen Müllbehälter nach Pfandflaschen durchsucht, nicht ganz davon überzeugt, dass Alter »willkürlich« ist. Für ihn ist das Alter wahrscheinlich eher eine schwierige Wegstrecke. Robert de Niro, im Altmänner-Gespräch mit Morgan Freeman, ergänzt: »Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Deshalb stelle ich mir nur das Beste vor.«5 Wenn er die Todesanzeige von jemandem lese, dessen Zeit noch nicht gekommen sei, denke er: »Wow, der war so jung! Wir haben schon Glück, noch hier zu sein.« Wahrscheinlich kann man sagen, dass das alte Memento mori – »Gedenke, dass du sterben musst!« – heute einer Parole gewichen ist, die sich verdächtig nach »Optimismus bis zuletzt!« anhört. Vom Memento mori zum »Think positive!« ist es ein weiter Weg. Aber wer spricht über die Anstrengung und die Mühe, die es kostet, das unvermeidliche Alter und das absehbare Ende unter einem optimistischen Dauergrinsen zu verbergen? Welche Erkenntnisse, Einsichten, Vertiefungen gehen verloren, wenn das Alter weggegrinst wird?
»Vorbei! Ein dummes Wort. Warum vorbei?«6, sagt beruhigend und zugleich tückisch Mephistopheles zu Faust. Nur nicht nachdenken, nicht stehen bleiben. Das ist ein Plädoyer für die Besinnungslosigkeit, die auch das Alter in der Leistungsgesellschaft markiert. Weiter, schnell weiter, bis man – zu spät – wahrnimmt, dass die Zeit verflogen ist und sich plötzlich der Abgrund des Nichts vor einem auftut. Wenn es für ein Innehalten zu spät ist.
Was tun zwischen dieser doppelten Unmöglichkeit? Der verschwundenen wilhelminischen Altrigkeit, die für uns kein denkbares Gewand mehr ist, und der angestrengten und dennoch scheiternden Fesselung an den Jugendlichkeitswahn? Den Alten bei uns geht es finanziell im Großen und Ganzen gut, und sie werden im Allgemeinen sehr alt – aber die Frage, wie man das Alter absolvieren soll: würdig, lustig, gelassen, aktiv, engagiert, sportlich, mürrisch, resigniert …, das kann einem keiner sagen. Und gibt es denn überhaupt eine Wahl, oder absolviert man, was im Angebot steht?
Wird im Alter alles weniger – außer dass die Zahl der Falten zunimmt? Wenn die »Würde« doch eher riecht wie ein alter Pelzmantel, der mit Mottenkugeln im Schrank gehangen hat?
Noch ein kreuzunglücklicher Begriff kommt da angeschlichen: die Weisheit des Alters. Der klingt heute wie ein dürrer Trost. Wenn alle Attraktivität verflogen ist, kannst du noch einen auf »weiser Alter« machen. Ich denke dabei sofort an die berüchtigte weiße Bank unter einer Linde, auf der die Greisin oder der Greis sitzt und Weisheiten absondert wie die Weinbergschnecke den Schleim. Diese trauliche Idylle hat ja im Grunde schon Goethe in Faust II abgefackelt. Dort erzählt er von Philemon und Baucis, die als altes Paar auf ihrem Hof leben. Den aber begehrt Dr. Faustus, weil er sein riesiges Areal abrunden möchte. Mephistopheles hört den Wunsch des Dr. Faust: »So geht und schafft sie mir zur Seite!« und macht sich auf den Weg. Philemon und Baucis, die nicht weichen wollen, werden gewaltsam vertrieben, das Haus verbrannt – und die Alten sterben auf dem Scheiterhaufen, der ihr Haus war: »Das Paar hat sich nicht viel gequält, vor Schrecken fielen sie entseelt«, sagt der Teufel beruhigend zu Faust. Der entfesselte Kapitalismus, den Goethe hier vorausahnt, fegt jede Nische aus und verschont auch kein Altersidyll. Goethe ahnt damit ebenso die gegenwärtige Situation der Alten voraus, die vor die Wahl gestellt sind, sich entweder als mobilisierungsfähig zu erweisen (der Leistungsgesellschaft adäquat) oder zum Untergang verurteilt zu sein – als Pflegefall in irgendeinem »Rosenhof« untergebracht oder im Demenzdorf oder in der geriatrischen Abteilung.
Wenn die Alten heute realistisch sind, dann wissen sie, dass ihre Kenntnisse, ihre Kompetenzen, ihre Erfahrungen nichts mehr zählen. Die Leistungsgesellschaft ist schnell, baut jeden Tag neue Sandburgen, die am nächsten Tag zerstört werden, um dem Neuen zu weichen. Es ist eine fundamentale Ruhelosigkeit, die Alte vor die Wahl stellt, mitzumachen oder auszuscheiden. Es kann eigentlich nicht verwundern, dass die Zahl der Alten, die tablettensüchtig ist, suizidal, depressiv oder dement, wächst. Die Leistungsgesellschaft gebiert nicht den würdevollen Greis, sondern den, dem die Schmach des zunehmenden »Nicht mehr« vor Augen geführt wird. Eine Schmach, die keine Würde ist, sondern ein Defizit bewusst macht.
Die Alten genießen viel mediale Aufmerksamkeit. Aber es wird ihnen fast täglich ein neues Konzept übergestülpt: Mal sollen sie erfolgreich altern, dann wieder ihren Ruhestand genießen. Nur manchmal rutscht einem Sozialpolitiker oder einem Journalisten auch so etwas Garstiges wie »Alterslast« oder »Seniorenlawine« heraus. Aber wenn man hinhört, dann sind die Alten irgendwie doch vor allem ein demografischer Brei, der sich in die Gesellschaft ergießt und in all ihre Kapillargefäße, in Straßen und Gassen, auf Plätze und in Apartments eindringt. Fast wie im Märchen, in dem das hungernde Mädchen von der alten Frau einen Topf geschenkt bekommt, zu dem sie nur sagen muss: »Töpfchen, koch«, dann füllt er sich mit Brei. Mit »Töpfchen, steh« beendet sie die Produktion von Brei. Die Mutter hat das vergessen, und so quillt der Brei aus dem Topf in das Haus, in die ganze Stadt …
Und diese breiige Masse der Alten muss irgendwie gemanagt werden. Das Gesicht des Einzelnen verschwindet in den politischen und sozialen Konzepten zur Regelung dieses demografischen Phänomens, das in den Rentenkassen, den Gesundheitsbudgets und in problematischen Wohnquartieren seine Spuren hinterlässt. Die gegenwärtige »Gesellschaft« – so hat es Peter Sloterdijk beschrieben – ist gar keine Gesellschaft mehr, sondern eher eine Population mit individualistischen Tendenzen.7 Ein Brei eben. Ich denke da an ein Bild, wie es sich in Rimini oder auf Lanzarote im Sommer am Strand bietet: Tausende soldatisch ausgerichtete Sonnenliegen, dem Meer zugewandt, die Menschen mit sich und ihrer Braunfärbung befasst. Sie sind zusammen, aber jeder ist doch für sich. Es ist ein Bild, in dem die Lockerung aller Kollektive, aller Gemeinschaftlichkeiten spürbar wird, in denen die Menschen – und speziell die Alten – einmal zusammengewirkt, gestritten, geliebt, gearbeitet und gefeiert haben. In diesen sozialen Milieus – in Familien, Nachbarschaften, Quartieren, in Vereinen, Parteien, Gewerkschaften – gab es einen »Absolutismus des Gemeinsamen« (Peter Sloterdijk): Die Interessen des Einzelnen waren um des gemeinsamen Überlebens willen beschnitten. An die Stelle ist nun das Einzelwesen getreten, das sich als eine absolute Größe versteht. Das wird immer dann besonders deutlich, wenn in öffentlichen Debatten der Verlust von Werten und Normen beklagt wird. Als wären das Accessoires des Subjektes, die irgendwie in irgendeiner Schublade liegen geblieben und vergessen worden sind. Vom stabilisierenden Gemeinschaftskern waren die Einzelnen einmal abhängig, und jetzt ist es umgekehrt: Das Subjekt steht im Zentrum, die Werte und Normen sind zu Ausstattungsstücken degeneriert. Es ist erstaunlich, dass eine solche lockere Ansammlung von Individuen überhaupt existieren kann, in der die Subjekte eigentlich nur noch sich selber für real halten, während das Gemeinsame zu etwas überflüssig Dekorativem geworden ist.
Peter Sloterdijk wundert sich darüber, dass eine solche Integration individualistischer Populationen in riesenhaften Großkörpern überhaupt gelingt.8 Er meint, dass dieses Gebilde, das kaum noch den Namen Gesellschaft verdient, zunehmend von Unhaltbarkeitsgefühlen unterwandert wird. Mit Blick auf die Alten könnte man tatsächlich den Eindruck gewinnen, dass das Einzige, was sie noch als soziale Wesen auszeichnet, ihre Abhängigkeit von Sorgesystemen ist (sind sie Bürgerinnen und Bürger vor allem und nur noch, weil sie die Partikel eines Sicherheitsstaates sind, der sie mit Dienstleistungen versorgt?).
Die Alten sind da Täter und Opfer zugleich: Gefesselt an die Galeere der Selbstverwirklichung, zappen sie sich durch einige Hundert Fernsehprogramme, werden von Supermärkten und Reiseveranstaltern versorgt und sind in der Gefahr, vollständig entpolitisierte (von der Polis abgelöste) Konsumenten zu werden. In eine parasitäre Existenz gezwungen, in der sich wohlzufühlen sie gelernt haben. Sie sind Nutznießer und Unterworfene einer degenerierten Gesellschaftsform, die im Wesentlichen darauf beruht, dass niemand den anderen braucht.
Die Alten sind so einerseits die virtuell Aussätzigen dieser Gesellschaft – diejenigen, die nun wirklich nicht gebraucht werden, sondern verbrauchen. In ihnen kulminiert andererseits zugleich das Partikelhafte des modernen Gesellschaftsbewohners: Er widmet sein Leben sich selbst, braucht niemanden, sondern kauft sich, was er benötigt – ob es Waren oder Dienstleistungen sind. Die Leistungsgesellschaft hat in den Alten die Figur des vollständig Überflüssigen geschaffen, in der gleichzeitig der Bewohner der Leistungsgesellschaft seine heimliche Apotheose, seine Vergöttlichung, erfährt – die Verwirklichung eines demografischen Orgasmus: das auf niemanden angewiesene Objekt, das im Wesentlichen in der Sammelwut für Jahre, Erlebnisse, konsumistische Exzesse aufgeht – und dabei doch nichts anderes ist als ein armes Schwein.
Das Alter ist eine Aufgabe. Und das heißt auch: Das Alter hat etwas mit Aufgeben zu tun. Aber das muss nicht der Weg in ein tristes »Immer schlechter« sein. Es gibt Phasen des Altwerdens, die Verdichtung mit sich bringen können. Vielleicht kann man manche Musik erst nach einem langen Leben richtig hören? Vielleicht sagt ein Bild, das ich oft angeschaut habe, jetzt im Alter plötzlich etwas zu mir, was es das ganze Leben davor verschwiegen hat?
Das Alter ist eine Chance. Es bietet die Möglichkeit zur Flucht aus der Oberflächlichkeit. Wir sollen zwar ständig verlockt werden, auch das Alter noch als eine Wachstumsangelegenheit zu begreifen: das noch, dies noch, jenes noch. Haben, haben, haben. Das Risiko, dem Haben den Vorzug vor dem Sein zu geben, ist im Alter besonders hoch, weil das Raffen dazu verhilft, den Blick darauf zu verstellen, dass es jetzt endlich, endlich, spätestens jetzt, um Intensität und nicht um das Mehr geht. »Was man nicht hat, braucht keinen Raum, was man nicht hat, kann nicht geklaut werden, was man nicht hat, braucht man nicht umzuziehen, was man nicht hat, kostet nichts.« So sagt es Harald Welzer.9 Eine exzellente Devise für das Alter. Lassen, loslassen, aufgeben ist – so hat es der Mystiker Meister Eckhart schon Jahrhunderte zuvor gesagt – die Voraussetzung für Gelassenheit.
Aufgeben schafft Freiheit. Schärfer noch: Ist es vielleicht die Leere, die zur Voraussetzung für ein erfülltes Alter wird? Wir kennen das Bild von Laokoon, der mit den Schlangen ringt. So geht es mit dem Alter. Die Lockungen der Konsumgesellschaft, die Ablenkungen, die Verlockungen umschlingen uns wie die Schlangen den Laokoon. Ein erfülltes Alter wäre ein »leeres«, eines, in dem Raum geschaffen ist für das Sein statt für das Haben, ein Innenraum, in dem die Dinge und Erlebnisse nicht lärmend herumtoben: Die Betäubung, die dem Alter heute droht, lässt sich nur aufheben, wenn ein Auszug gewagt wird aus der sich unablässig kumulierenden Fülle in die Wüste, in die Leere, in der man den Dämonen und den Göttern begegnen kann und vor allem sich selbst …
Kapitel 2: Endlich frei im Dauerstress
Alt sein in der Leistungsgesellschaft
Im New Yorker Stadtteil Queens gibt es eine McDonald’s-Filiale, um die kürzlich ein Streit entbrannt ist. Eine Gruppe älterer Koreaner trifft sich dort regelmäßig, um Kaffee zu trinken. Das tun sie dann stundenlang und scheren sich nicht um das aufgestellte Schild, welches die Gäste auffordert, ihre Speisen zu verzehren und binnen zwanzig Minuten das Restaurant zu verlassen. Ein 76-jähriger Koreaner erläutert, er wolle nicht in das nahe koreanische Gemeindezentrum gehen, da fühle er sich alt. Die Geschäftsleitung hat schon mehrfach die Polizei gerufen, weil der Umsatz leidet.
In Lindau werde ich Zeuge eines Einfalls von Wolfskin-Senioren. Von einer Wanderung zurück, lässt sich die Gruppe an einem Restauranttisch im Freien nieder. Als es anfängt zu tröpfeln, okkupiert die Gruppe geschwind den einzigen freien großen Tisch im Inneren und verlangt von der gehetzten Bedienung, einer jungen Frau, wahrscheinlich Studentin, dass Getränke und Gerichte umgehend hineingetragen werden.
In beiden Fällen ein Clash der Kulturen: Die beschleunigte Leistungsgesellschaft ist in der Burger-Filiale mit den störrischen alten Koreanern konfrontiert, die ihren Minikonsum und ihren ruhigen Lebensrhythmus genießen wollen. Die in regensicheres Wanderoutfit gekleideten Seniorinnen und Senioren hingegen scheuchen die junge Bedienung im vollen Bewusstsein ihrer Konsumentenmacht und in der Erwartung, dass die Leistungsgesellschaft zu ihren Gunsten funktionieren werde. An diesem Ort, an dem sich vor allem finanziell gut ausgestattete Alte von eher schlecht bezahlten jungen Leuten bedienen, fahren, massieren, rehabilitieren, beraten, kurieren und im Zweifelsfall eines Tages auch pflegen, schieben, windeln und füttern lassen, scheint es für einen Augenblick, als seien die Senioren die Profiteure der Leistungsgesellschaft.
Es ist nicht so ganz klar, wie es den Alten in der Leistungsgesellschaft geht. Sind sie Opfer? Oder Gewinner? Sind sie beides? Sind sie erst Gewinner (als gutsituierte junge Alte) und dann Opfer (als Hinfällige und ihrer Autonomie verlustig gegangene Objekte von Dienstleistungen)?
Alter spielt heute auf einer Bühne, auf der gerade die Kulissen gewechselt werden. Viele der Alten kommen noch aus der Disziplinargesellschaft, sind im Schatten des Wilhelminismus und des Nationalsozialismus aufgewachsen. Familie, Beruf, Nachbarschaft, Milieus (Parteien, Kirchen, Gewerkschaften) waren stabile Möblierungen des Lebens, keineswegs immer harmonisch und glücksbringend, aber stabil. Diese Disziplinargesellschaft mit ihren Werten, festen Orientierungen und ehernen Stabilitäten wird abgeräumt und weicht einer flexiblen Leistungsgesellschaft, in der nahezu nichts mehr von dem gilt, was sie, die Alten, einmal gelernt haben. Ihre Kinder haben keinen Beruf, sondern Jobs, die Nachkommen leben hochmobil, in eher fragilen Beziehungen – und im Zweifelsfall allein. Das bleibt für die Alten keine fremde Welt, längst greift die Leistungsgesellschaft auch nach ihnen: Weggeweht sind die sozialen Milieus, die Familien, die Traditionen. Die Kirche und die Partei spielen auch bei ihnen kaum noch eine Rolle, allenfalls aus Fitnessgründen der Sportverein. Alt sein heißt vor allem: allein sein. Je älter, desto häufiger. Und weil die vielen singularisierten Partikel in keine Familie oder Nachbarschaft eingebunden sind, wartet bei Verschlechterung des Gesundheitszustandes auf sie die Institution, das Pflegeheim, das betreute Wohnen oder der ambulante Pflegedienst, am Ende schließlich das Hospiz oder die Palliativstation.