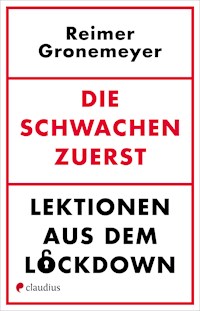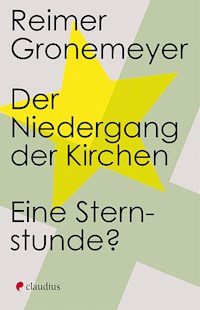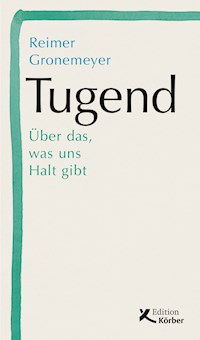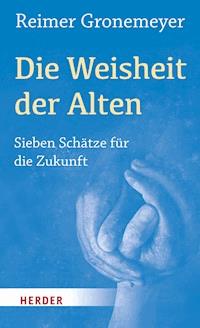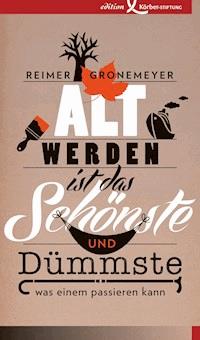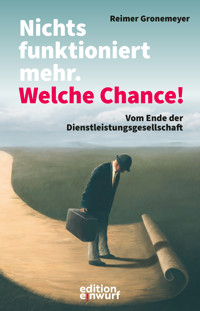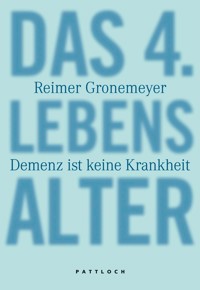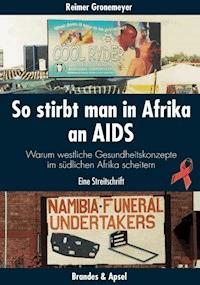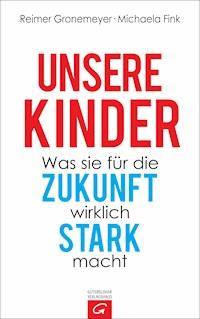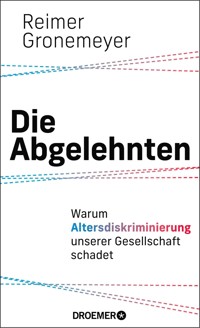
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Die Altersdiskriminierung muss aufhören! Der renommierte Soziologe Reimer Gronemeyer widmet sich in seinem Sachbuch »Die Abgelehnten. Warum Altersdiskriminierung unserer Gesellschaft schadet« einem brisanten Thema, das alle Generationen betrifft, und erläutert, wieso die Ausgrenzung älterer Menschen eine zentrale sozialpolitische Herausforderung ist. Unsere Zeit ist geprägt von rasanten sozialen und demografischen Veränderungen, Fragen der Generationengerechtigkeit und des Umgangs mit dem Alter werden immer dringlicher. Der Wandel in der Altersstruktur, die Debatte um die Rentensysteme und der oft zitierte Generationenkonflikt stehen im Zentrum gesellschaftlicher und soziologischer Diskussionen. Altersdiskriminierung zeigt sich besonders in Bezug auf den Arbeitsplatz. Angehörige der Boomer-Generation, der sogenannten Goldenen Generation, sehen sich Vorurteilen und echten Benachteiligungen ausgesetzt, die viele ihrer individuellen Lebenswege direkt beeinflussen. Von den jüngeren Generationen werden sie wegen ihrer Haltung zu Klima und Umwelt oft pauschal verurteilt. Gronemeyer legt den Finger in die Wunde und zeigt in seinem Sachbuch, wie der demografische Wandel, die Rentenproblematik und die Zukunftsängste der jüngeren Generationen die generationelle Debatte um Wertvorstellungen und Visionen für die Zukunft noch verschärfen werden. Er fordert einen neuen gesamtgesellschaftlichen Austausch und sagt: Jeder Einzelne soll wertgeschätzt werden, unabhängig vom Alter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Reimer Gronemeyer
Die Abgelehnten
Warum Altersdiskriminierung unserer Gesellschaft schadet
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Die Zahl der Senioren steigt, die der Erwerbstätigen und Träger der Rentenlast sinkt. Das traditionelle Rentenmodell wankt. Inmitten dieser Herausforderung werden die Babyboomer kritisiert und zum Zentrum gesellschaftlicher Debatten: Sie kosten zu viel, sie verbrauchen mehr als nötig, sie haben das Klima zerstört. Ihr Platz in der Gesellschaft wird angezweifelt. Doch dürfen wir es uns erlauben, ältere Menschen zu marginalisieren und ihre wertvollen Erfahrungen zu ignorieren?
Reimer Gronemeyer argumentiert eindrücklich gegen die Ausgrenzung älterer Generationen und betont, wie essenziell ihre Lebenserfahrungen in der heutigen Zeit sind. Sein Plädoyer fordert uns auf, den Wert des Alters neu zu erkennen und Brücken zwischen den Generationen zu bauen, um die Altersdiskriminierung zu überwinden.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Aufrecht gehen! Ein Vorwort
Schluss mit dem Jammern!
Bin ich diskriminiert?
Wann fängt Altersdiskriminierung an?
Raus aus der Opferrolle!
Der große Diskriminator
Altersdiskriminierung – eine Variante des Egotrips?
War denn alles falsch?
Faktencheck Altersdiskriminierung
Diskriminierung: Vor allem Frauen sind betroffen
Eine Alltagsgeschichte
Der korrekte Neusprech und die Alten
Das Leiden am Alter – Vorurteil, Diskriminierung, Leugnung
Im Fotokopierladen
Die Abwertung des Alters – und die Folgen
Wie die Wurzeln des Menschen durchschnitten werden
Feindbild alter weißer Mann
Imperiale Jugendkultur statt kulturelle Selbstvergewisserung
Der Fetisch der Inklusion
Hermine weiß nicht, was Altersdiskriminierung ist
Einsam, arm und krank – die Säulen der Altersdiskriminierung
Kulturelle Vereinsamung und die Entfremdung der Generationen
Auf Entfremdung folgt Einsamkeit
Diskriminierung durch Fortschritt
Krank sein – eine Frage der Eigenverantwortung?
»Guten Tag, ich bin Herr Arschloch!«
Eskalation I: Neue Dimensionen des Generationenkonflikts?
Der reißende Strom der Künstlichen Intelligenz
Gibt es ihn überhaupt, den Generationenkonflikt?
Aufsässige Alte
Die Frage des Ofenvogels
Eskalation II: Auf dem Weg zum Senizid?
Ein althergebrachtes Phänomen
Altentötung: die radikale Altersdiskriminierung
Altenstaub
Als ich selbst Staub werden sollte
Szenario 2050: Wie gefährlich wird die Altersdiskriminierung?
So könnte es 2050 aussehen
Robotik und KI und die Lebenswelt hilfsbedürftiger Alter
Transhumanistische Perspektiven: Das Alter abschaffen
Die Zukunft der Alten – Horror oder Kultur der Versöhnung?
Was sollen die Alten machen, was ist ihre Aufgabe?
Erasmus auf dem Pferd
Auswege? Friedensgespräche!
Resümee: Wie steht es um die Altersdiskriminierung?
Strategien gegen Altersdiskriminierung
Verschwinden im Grenzenlosen
Im Tunnel
Dank
Für Reinhilde Stöppler, Freundin und Kollegin
Aufrecht gehen! Ein Vorwort
Ab sechzig haben sie keine Aufstiegschancen mehr im Beruf. Mit siebzig wird ihnen kein Kredit mehr bewilligt. Über achtzig wird es schwer, noch einen Pflegeplatz zu bekommen: Für alte Menschen wird die Lage unübersichtlich – sie müssen mit Ablehnung rechnen. Und die Krise, die inzwischen alle spüren, verschärft die Lage. Bisher konnten die Alten auf gute Renten und eine funktionierende Gesundheitsversorgung bauen und waren in eine sicher geglaubte Wohlstandsgesellschaft eingebettet. Doch das alles bröckelt. Müssen die Alten befürchten, dass sie demnächst aussortiert und ausgegrenzt werden? Droht ein soziokultureller Wandel, der das Alter entwertet? Beispiel Digitalisierung: Kommt sie den Alten zugute? Mit dem Smartphone können sie doch bequem ihre Jalousien und die Heizung steuern. Onlinebanking hilft, den beschwerlichen Gang zur Bank zu vermeiden. Und die Vertragsänderung bei der Telekom klappt mit einem Anruf, auf den sich ein Chatbot aufschaltet und sie an die richtige Stelle weiterleitet.
Fakt ist aber: Alte Menschen sind hier oft überfordert, sie kommen mit den verwirrenden »Serviceleistungen« der Callcenter nicht klar, sie besitzen keinen Laptop oder sind mit den ständigen Updates überfordert. Das Ergebnis: Alte Menschen können vielfach nicht mehr selbstständig agieren, sondern sind auf Hilfe selbst bei einfachsten Alltagsaufgaben angewiesen.
Ich möchte in diesem Buch keine romantische Verklärung der Vergangenheit betreiben, als es noch keine Digitalisierung, keine Callcenter und keine sprechenden Automaten gab. Aber ich stelle fest, dass die Modernisierungsprozesse noch nie so rasend schnell vollzogen wurden wie gegenwärtig – und dass diese Modernisierung so tief in das Leben der Menschen eingreift wie kaum eine Veränderung zuvor. Das hohe Tempo und die Komplexität der notwendigen Anpassungsprozesse überfordern alte Menschen schlicht und einfach. Und grenzen sie damit aus. Kurzum: Aus der Kultur, in der alte Menschen selbstständig und gut leben konnten, ist ein reißender Fluss geworden.
Gewiss: Altersdiskriminierung kommt im Gewand vieler kleiner Maßnahmen und scheinbarer Verbesserungen daher, sie greift dort Platz, wo älteren Menschen ihre Teilhabe am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und beruflichen Leben schwer gemacht oder gar vorenthalten wird und sie damit entmündigt.
In diesem Buch sind die Puzzleteile der kulturellen Entmündigung zusammengetragen. Mir geht es hier aber nicht um eine Aufzählung all dieser Nadelstiche in das Selbstbewusstsein alter Menschen. Ich möchte vielmehr deutlich machen, dass all diese Nadelstiche Ausdruck eines kulturellen Wandels sind, der alte Menschen marginalisiert und das Leben im Alter ablehnt – das ist es, was ich unter Altersdiskriminierung verstehe.
Dieses Buch soll den Blick schärfen für die Bedürfnisse alter Menschen, die in der Leistungsgesellschaft rüde übergangen werden und deren Erfahrungen schon zu Lebzeiten als überholt gelten. Die guten alten Zeiten waren weiß Gott selten gute alte Zeiten, aber die Alten mussten nicht damit rechnen, so alt auszusehen wie heute. Grund genug, an unserer Kultur zu verzweifeln, die eine fragwürdige Jugendlichkeit zur Benchmark des gesellschaftlichen Miteinanders erklärt?
Ganz und gar nicht – aber es ist an der Zeit, dass die Alten aus den Reservaten ausbrechen, die man ihnen eingerichtet hat. Die Devise heißt jetzt: Nicht die Decke über den Kopf ziehen. Umstellt von Anti-Aging-Angeboten, bedroht von einer jugendbesessenen Geräuschkulisse, ausgesetzt in einer sinnentleerten Gegenwart, ist es ein Abenteuer, selbstbewusst, nachdenklich und aufsässig alt zu sein. Ich möchte alte Menschen ermutigen, sich nicht überrollen, nicht wegschwemmen, nicht zu Versorgungsobjekten machen zu lassen. Nicht in der Ecke zu sitzen und zu schmollen, sondern mit den Nachdenklichen, ob jung, ob alt, kleine kühne Schritte in Richtung einer lebenswerten Zukunft zu gehen. Denn dann funktioniert Altersdiskriminierung nicht mehr.
Reimer Gronemeyer,
im Januar 2025
Schluss mit dem Jammern!
For an idea, age is beauty.
Nicholas Taleb1
Bin ich diskriminiert?
Ja, es ist selten, dass im Bus oder in der S-Bahn ein junger Mensch aufsteht, um mir Platz zu machen. Ich brauche das eigentlich auch nicht. Ich erinnere mich aber gern an den türkischen Vater, der seine Tochter aufforderte, für mich aufzustehen. Es gefiel mir, und es war mir peinlich. Mit all meinen Privilegien mache ich nicht oft die Erfahrung, altersdiskriminiert zu sein. Ja, ich bin auch ein Adressat des Noch. Sie reisen noch nach Afrika? Bewundernswert! Sie gehen noch auf Vortragsreisen? Oder, unverblümter: Willst du nicht endlich mal aufhören?
Ich lebe gegen die Erwartungen und gegen die dummen Sprüche. Manche würden mich am liebsten auf die Parkbank unter der Linde drücken – die Krücke mit dem Silbergriff in der Hand und die Apfelsaftschorle daneben abgestellt. Zu meiner Verblüffung hat mir kürzlich bei einer Tagung, auf der ich einen Vortrag zu halten hatte, ein älterer Herr ein Buch, das ich seiner Meinung nach unbedingt lesen sollte, von der Tagungsauslage geholt, mir meine Tasche von der Schulter genommen und das Buch hineingesteckt. Ich fühlte mich entmündigt. Außerdem war er gar nicht viel jünger als ich. Wirke ich vielleicht schütterer, als ich mich selbst empfinde? Oder wollte er sich selbst jung machen? Vielleicht bin ich ja auch blind und lebe in Illusionen? Haben mich meine 85 Jahre schon mehr gekennzeichnet, als ich einsehen will? Falsche Fragen.
»Ernest Hemingway wäre lieber gestorben, als alt zu werden. Er ist lieber gestorben. Er hat sich erschossen.« Das schrieb die wunderbar böse und weise amerikanische Schriftstellerin Ursula Kroeber Le Guin (1929–2018). Und sie ergänzte: »Ich habe mir gestattet, alt zu werden, und habe nicht das Geringste dagegen getan, mit einer Waffe oder sonst was.«
In einer jugendbesessenen Gesellschaft ist das eine Meisterleistung! Mir kommt es so vor, als fehlte den Alten oft vor allem dies: die Selbstironie. Vielleicht die beste Waffe gegen Altersdiskriminierung? Noch einmal Le Guin: Sie sinnierte über Hemingway, charakterisierte ihn als den mit dem Bart und den Waffen und den Ehefrauen und den kurzen, knappen Sätzen. »Ich habe« – schrieb sie – »dieses bartartige Zeug am Kinn, das mir immer wieder wachsen will, so neun oder zehn Haare, manchmal auch mehr. Doch was mache ich mit den Haaren? Ich zupfe sie aus. Würde ein Mann das tun? Männer zupfen nicht. Männer rasieren sich.« Aus der aufgeblasenen Pose weicht die Luft wie aus einem angestochenen Luftballon.
Le Guin hat – soweit ich sehe – nicht von Altersdiskriminierung gesprochen. Sie wusste allerdings genau, wie schwierig es in dieser Zeit und dieser Gesellschaft ist, alt zu sein. Was sagte sie? In der Welt der »Sagenhaber« darf man nicht müde werden, in die Stille hineinzuhorchen: »Und so werde ich Frauen, unseren Kindern und machtlosen Männern lauschen, meinen Leuten. Und ehren nur die Meinen, die Leute ohne Macht.«2 Wer so redet, bietet keine Zielscheibe für Altersdiskriminierung, weil die Pfeile der Altersdiskriminierung abgelenkt vorbeifliegen. Ironie und Machtlosigkeit – bringen sie nicht am ehesten den Versuch der Diskriminierung ins Stolpern? Wir werden sehen.
Wann fängt Altersdiskriminierung an?
Mit Anfang vierzig habe sie zum ersten Mal Altersdiskriminierung erfahren, klagte Isabella Rossellini jüngst, 2024, mit nunmehr 72 Jahren gegenüber dem US-Magazin Variety. Sie war als Model und Schauspielerin berühmt, die Eltern waren Hollywood-Ikonen: Ingrid Bergman, die Schauspielerin (Casablanca), und Roberto Rossellini, der Regisseur. Damals, mit 42 Jahren, sei sie von Agenten und Sponsoren aussortiert worden. Und die Kosmetikfirma Lancôme habe nicht mehr mit ihr werben wollen, die Kundinnen – so hieß es – würden davon träumen, jung zu sein. Da kam die Vierzigerin Isabella Rossellini nicht mehr infrage. Inzwischen, so wird berichtet, verdient Isabella Rossellini ihr Geld auch mit Bed & Breakfast auf Long Island.3
Ist es angebracht, sich darüber aufzuregen? Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) besagt, dass Arbeitgeber sich strafbar machen, wenn sie neue Mitarbeiter ausschließlich in einem ausgesuchten Lebenszyklus suchen – will sagen: die junge Sekretärin oder den erfahrenen Verkaufsleiter. Altersdiskriminierung trifft also nicht nur Achtzigjährige: Berufsanfänger ohne Erfahrung können ebenso wie werdende Mütter Opfer von Altersdiskriminierung werden. Das Gleichbehandlungsgesetz verbietet das, aber nicht immer erfolgreich, denn die Beweislast für eine Diskriminierung liegt beim Arbeitnehmer. Aber Altersdiskriminierung trifft eher ältere Arbeitnehmer als junge Bewerber. Und im Grunde denkt jeder bei dem Wort »Altersdiskriminierung« wohl zuerst an richtig alte Menschen – so was bei siebzig oder gar achtzig.
Von diversity ist heute viel die Rede. Selbstverständlich ist diversity auch ein Altersthema, auch ein Thema der Diskriminierung. Altersdiskriminierung, so scheint es, ist weitverbreitet. So wundert es nicht, dass age inclusion als das Gebot der Stunde propagiert wird. Vielleicht aber hat das auch sehr praktische Gründe: Vielen Unternehmen fehlen die Fachkräfte. Da müssen die Alten ran. Und das läuft gut unter der Überschrift age inclusion. Dann ist man gleich bei den Guten …
Könnte es sein, dass das modische Vokabular (diversity, age inclusion etc.) einen wichtigen Tatbestand verdeckt? Nämlich den, dass wir in einer deutlich gealterten Gesellschaft leben. »Durch die Alterung der Gesellschaft werden für Deutschland massive Wohlstandsverluste entstehen.«4 Die Frage ist, was mit den vielen jungen Alten, alten Alten und Hochaltrigen geschehen soll. War da nicht schon mal von »Friedhofsgemüse« die Rede? Und vom »sozialverträglichen Frühableben«?
Altersdiskriminierung: Ich denke da zuerst an alte Menschen, die bei den Tafeln in der Schlange stehen, weil ihre kargen Renten kaum für das Nötigste reichen. Oszilliert Altersdiskriminierung zwischen einer manchmal modischen diversity-Schutzhülle, die um das Alter gelegt wird, und einer unbarmherzigen Diskriminierung, die aus einer auf Jugendlichkeit getrimmten Gesellschaft wie ein Pesthauch aufsteigt?
Was fange ich mit der Klage von Isabella Rossellini an, die mit vierzig nicht mehr für Lancôme werben darf? Soll ich das skandalös finden? Aber bricht dann nicht das Kartenhaus einer Gesellschaft zusammen, die alles auf Jugendlichkeit setzt und gleichzeitig so viele Alte beherbergt, wie es sie noch nie gegeben hat? Die sind nun mal nicht für Werbebroschüren geeignet. Ganz abgesehen davon, dass Isabella Rossellini ob dieser erlittenen Diskriminierung keine Not leidet. Es ist eben so: Wer vierzig ist, ist nicht mehr jung. Und worüber beklagt sie sich? Sie hat sich als junge Frau auf das Werbegeschäft eingelassen, und sie wusste genau, dass sie als Projektionsfläche für Werbebotschaften infrage kommt, weil sie jung und schön ist. Wie absurd ist ihre Klage eigentlich? Sie macht uns deutlich: Die Rhythmen des Lebens sind uns entschwunden, sodass wir wider besseres Wissen die unvermeidlichen Prozesse des Altwerdens zu leugnen versuchen. Rossellini beklagt die Diskriminierung und hat doch genau von dem Jugendkult gelebt, den sie beklagt. Um dem nicht ins Gesicht sehen zu müssen, kann man sich heute in die Empörung retten, kann man von Altersdiskriminierung sprechen und einen Skandal nach dem anderen entlarven.
Aber besteht der Skandal mittlerweile nicht darin, dass nicht mehr Vierzig-, sondern Sechzigjährige in den Werbespots das Altern leugnen, indem sie Cremes, Medikamente u.Ä. anpreisen? Wer die Werbeclips in ARD und ZDF am frühen Abend sieht, weiß, wovon ich rede. Heute wehren sich die Boomer gegen das Altwerden – wie ihr ergrautes Idol Bob Dylan schon vor fünfzig Jahren sang: May you stay forever young … Mit diesem Song zeigt sich auch die Zweideutigkeit des Jugendwahns: Dylan ging es in diesem Song natürlich nicht um geschmeidige Körper, sondern um ein Jungbleiben im Kopf, im Denken, im Handeln, im Herzen.
Davon ist jedoch nicht die Rede, wenn die Sprache auf das Altwerden kommt, sondern es werden die Veränderungen des alternden Körpers skandalisiert. Wenn ich die aufgepumpten Lippen und die Botoxgesichter sehe, mit der älter werdende Menschen dem Alter zu entkommen versuchen, ergreifen mich eher Melancholie und ein bisschen Ekel. Ja, die Falten, die Krampfadern, die Altersflecken am Körper sind furchtbar. Und ich kann nur lachen über die Selbsttäuschung, die in solchen Sätzen lauert: »Ich bin stolz auf jede Falte in meinem Gesicht.« Das ist ebenso Quatsch wie der Botoxkrampf. Altwerden ist nichts für Feiglinge – so betitelte Joachim »Blacky« Fuchsberger 2011 sein Nachdenken über das Altern. Mittlerweile ist das nicht mehr als ein peinlicher Modeschnack.
Die Frage ist tatsächlich: Wie kann ich alt werden in einer Gesellschaft, die das Alter hasst? Wie kann ich alt werden in einer Gesellschaft, die für die Alten keine Rollen bereithält? Wie kann ich alt werden in einer Gesellschaft, die ihre Diskriminierungen hinter diversity-Attrappen verbirgt? Wie kann ich alt werden in einer Gesellschaft, die für die Alten bestenfalls Mitleid, schlechtestenfalls Abwertung bereithält? Wir Alten lavieren vorläufig zwischen modischem Gesäusel und kaum verhohlener Aggressivität. Was tun? Ich plädiere dafür, nicht zu jammern!
Raus aus der Opferrolle!
»Es liegt ein Widerspruch darin, dass, während alle Menschen alt zu werden wünschen, sie doch nicht alt sein wollen. Der Greis sollte von Dank erfüllt fühlen, dass ihm zur letzten Lebensstufe vorzuschreiten vergönnt war, er hat nicht nötig zu jammern.«5 Das sind die Worte Jakob Grimms, die er 1860 in einer Berliner Rede formulierte – damals war er 75.
Ich finde, das ist ein gutes Stichwort: Nicht jammern! Es gilt, der herrschenden Jammermode zu widersprechen. Deshalb soll es hier um die Alten gehen, die sich nicht kleinkriegen lassen.
Wie ist angesichts des Alters und angesichts der krisenhaften Lebensumstände der aufrechte Gang möglich? Diskriminierungen? Ich pfeife drauf. Das prallt an mir ab. Es geht aber um den Kampf gegen Diskriminierungen. Ich werde abgelehnt? Das wollen wir doch mal sehen! Das lasse ich mir nicht gefallen.
Die Verlockung ist da: Man kann das Alter als die große Jammerchance begreifen. Das ist auch naheliegend. Opferrollen sind heutzutage ganz generell beliebt. Wollen wir das Spiel spielen? Wir suchen und finden ein neues Opfer – diesmal die Alten. Schau doch mal: Sind die Alten nicht unablässig Opfer von Diskriminierung? Gibt es keine Diskriminierungsskandale aufzudecken? Springen nicht jedem, der das sehen will, die persönlichen und strukturellen Gemeinheiten, mit denen Alte konfrontiert sind, ins Auge?
Nein! In diesem Buch geht es nicht darum, schon wieder ein neues Opfer zu finden und zu glorifizieren, diesmal die Alten. Alle sind schon mal dran gewesen oder sind noch dran, um die Opferrolle zu spielen: Arbeiter, Obdachlose, Behinderte, Frauen, Schwarze, Hartz-IV-Empfänger, Drogenabhängige, Migranten, Transmenschen usw. usw. Jetzt also die Alten? Sind sie nicht die Abgelehnten, an den Rand der Gesellschaft gedrängt, verarmt, vereinsamt – kurz: diskriminiert?
Es gibt sogar schon ein Wort für diese Form der strukturellen Diskriminierung: Ageism. Man sieht sie vor sich, die grauen Heerscharen der Runzligen, die sich wie Aussätzige in den Banlieues der globalisierten und digitalisierten Glitzerwelt drängen. Unbrauchbar, unmodern, aus der Mode gekommen. Alt eben. Um die Opferrolle konkurrieren wie gesagt viele, jetzt also die Alten?
Daniele Giglioli, ein italienischer Literaturwissenschaftler, hat auf die Opferfalle hingewiesen, in die wir gelockt werden. Alles und jeder fühle sich, so sagt er, heute als Opfer. Also nun auch die Alten. Die Folge ist – so Giglioli – Handlungsunfähigkeit: Die Selbstwahrnehmung als Opfer führe zu Lähmung. Man will und verlangt Wiedergutmachung, Beachtung, Gerechtigkeit. Andere müssen das tun, man selbst sitzt und wartet, dass etwas geschieht. »Das Opfer ist der Held unserer Zeit. Opfer zu sein verleiht Prestige, verschafft Aufmerksamkeit, verspricht und fördert Anerkennung, erzeugt machtvoll Identität, Anrecht, Selbstachtung. Es immunisiert gegen jede Kritik, garantiert eine über jeden Zweifel erhabene Unschuld. Wie könnte das Opfer schuldig, gar für etwas verantwortlich sein? Es hat nichts getan, es ist ihm etwas angetan worden. Es handelt nicht, es erleidet.« So Daniele Giglioli.6
Wenn wir uns dazu verführen lassen, die Alten pauschal als Diskriminierte zu begreifen, dann sitzen die in der Opferfalle. Schauen wir genauer hin.
Es lassen sich zwei zugespitzte Bilder von der Situation der Alten hierzulande zeichnen: Man kann sie beschreiben als siegreiche Überlebende oder als erbarmungswürdige Opfer:
Sieger
Sie werden sehr, sehr alt. Sie sind ökonomisch gut situiert. Sie haben die schönen Wohnungen und die ansehnlichen Häuser. Sie haben teure Hobbys. Sie sind die Nutznießer des Gesundheitsapparates. Sie entscheiden die Wahlen. Sie sind die gut situierten Silberlocken, die ihre Schäfchen im Trockenen haben und das Erbe ihrer Kinder verprassen, folgt man den Slogans auf den überdimensionierten Wohnmobilen: »Reise vor dem Sterben, sonst reisen deine Erben.«
Verlierer
Wer alt ist, kommt digital nicht mehr mit. Wer alt ist, scheitert an der Bürokratie. Wer alt ist, lebt ohne Liebe. Wer alt ist, kriegt nichts mehr mit. Wer alt ist, ist arm. Wer alt ist, ist einsam.
Beide Bilder sind natürlich falsch, weil sie undifferenziert sind. Aber die Gegenüberstellung beschreibt doch die Grundströmungen, mit denen wir es heute zu tun haben. Und diese beiden »Idealtypen« – die alten Sieger und die alten Verlierer – sind mit unterschiedlichen Diskriminierungen konfrontiert: Die Sieger-Alten geraten ins Visier als unsympathische Kriegsgewinnler, die ihre Privilegien egoistisch und ungerührt genießen. Sind das nicht die alten Männer und Frauen, die auf Kosten der nachfolgenden Generationen leben? Der »alte weiße Mann« ist zum Inbegriff des Verächtlichen geworden, er ist – so sollen wir lernen – selbstbezogen, gewissenlos und zerstörerisch. Die Verlierer-Alten hingegen sind Opfer struktureller Diskriminierungen: Er oder sie hat es nicht zu einer anständigen Rente gebracht, muss sich im Zweifelsfall bei der Tafel in die Schlange stellen. Und hat noch nicht mal das Geld für einen Kinobesuch, muss im Winter wahrscheinlich frieren …
Bei genauerer Betrachtung wird das mit der Altersdiskriminierung schwieriger:
Wer jetzt um die achtzig ist (oder älter), ist ein Kind der Disziplinargesellschaft, in der Gehorsam, Sparsamkeit, Ordnung die Urtugenden waren. Viele von ihnen haben Krieg, Hunger und Kälte erfahren, kommen aus einer Kultur der Bescheidenheit und sind in die Wohlstandsgesellschaft hineingewachsen.
Wer jetzt um die sechzig ist (oder jünger), gehört zu den Babyboomern, deren Heimat die antiautoritäre Leistungsgesellschaft ist. Sie sind an Frieden, Demokratie und Wohlstand gewöhnt, an einen hohen Lebensstandard und an eine Konsumgesellschaft, deren kultureller Grundton die Aussperrung von Leid, Schmerz und Selbstbegrenzung ist.
Ein ebenso heikler wie schwieriger Punkt ist in diesem Zusammenhang die jüngere deutsche Geschichte: Wer ist in der BRD sozialisiert und wer in der DDR? Wie unterscheiden sich die Babyboomer, die aus dem Westen kommen, von denen, die im Osten entscheidende Lebensjahre verbracht haben? Während die »Wessis« in einer (scheinbar) immerwährenden Wohlstandsgesellschaft gelebt haben, hatten die »Ossis« mit sich wiederholenden Engpässen aller Art zu kämpfen. Es sieht so aus, als treibe der westliche Weg kontinuierlich in ein Singledasein, während »Ossis« immer wieder betonen, dass die Gemeinschaftserfahrungen stark waren. Idealtypisch zugespitzt: Hier die weltoffene, von Konsumismus durchtränkte Gesellschaft der Selbstverwirklicher, dort die lokal gut verankerte Gesellschaft, deren traditionelle Bindungen (Heimat, Nachbarschaft) mit einem skeptischen Blick auf das Fremde und Neue verbunden sind. Im Westen reagiert die Mehrheit auf Menschen mit Migrationshintergrund eher mit Schulterzucken, im Osten lösen Migranten bei einer wachsenden Zahl von Menschen Ängste und Zurückweisung aus. Die Ironie der Geschichte: Die Babyboomer werden im Osten wie im Westen im Zweifelsfall von Menschen mit Migrationshintergrund gepflegt werden. Etwas ironisch gesagt: Im Angesicht der Pflegebedürftigkeit werden »Ossis« und »Wessis« dann letztlich doch gleich sein.
Der große Diskriminator
Der letzte Roman, den Fjodor Michailowitsch Dostojewski geschrieben hat, heißt Die Brüder Karamasow. Dort erzählt Gruschenka das Märchen von der Zwiebel: Eine böse Alte stirbt und kommt in die Hölle, aber ihr Schutzengel erinnert sich nach angestrengtem Nachdenken, dass sie einmal, ein einziges Mal, einem Bettler eine Zwiebel aus ihrem Gemüsegarten geschenkt hat. Der Schutzengel hält ihr die Zwiebel hin, aber als er die Alte herausziehen will, klammern sich andere an sie, damit auch sie aus dem See gerettet werden. Doch die Alte wehrt sich und tritt nach den anderen: Dies sei allein ihr Zwiebelchen. Da brach die Zwiebel entzwei, und die Alte stürzte zurück in den See …7
Die Geschichte ist unsympathisch – die böse Alte ohnehin. Aber sie lässt sich auch lesen als eine Geschichte, die an die Frage erinnert: Was ist das Resümee des Lebens der heutigen Menschen? Ist die Frage verschwunden? Ist sie zusammengeschnurrt auf die eher verlogen lobenden Worte des Beerdigungsredners am offenen Grab? Mit dem Verschwinden des Christentums aus dem Alltagsleben der Leute ist die Frage nach dem göttlichen Gericht, nach Himmel oder Hölle als Ergebnis des gelebten Lebens ausgelöscht. Kein Schutzengel mehr, keine Zwiebel, an die ich mich klammern und aus dem Höllenfeuer ziehen lassen kann.
Aber ist damit die Frage nach der summa eines Lebens wirklich aus unserer Welt verschwunden? Meine Großmutter hat gänzlich in dieser Auffassung gelebt, dass ihr Leben im Schatten des Endgerichtes liegt und am jüngsten Tage beurteilt wird. In der für die meisten Gegenwärtigen inzwischen alt gewordenen christlichen Auffassung ist es der Menschensohn, der auf dem Thron sitzt und Gericht hält über die Menschen. Er ist es, der »diskriminiert«, denn diskriminieren heißt zunächst ja nur »unterscheiden«. Er diskriminiert zwischen den Gerechten und den Ungerechten. »Mich hungerte, und ihr gabt mir zu essen, mich dürstete, und ihr gabt mir zu trinken.« Die Gerechten fragen erstaunt: »Wann sahen wir dich hungrig und haben dich gespeist?« Die Antwort, die vom Menschensohn kommt, lautet: »Das, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.« (Matthäusevangelium Kap. 25)
Der große Unterscheider, der Diskriminator – er ist für die meisten Menschen verschwunden. Ob ich einem Bettler eine Zwiebel gegeben habe oder nicht, was spielt das für eine Rolle?
Die große Gefahr, die mit der Frage nach der Diskriminierung im Alter einhergeht, das ist die Gefahr der Oberflächlichkeit und die Gefahr, dass sie beiträgt zur allgegenwärtigen Egomanie, denen auch Alte oft genug erliegen. Stehe ich – in der alten biblischen Sprache – auf der Seite der Gerechten oder auf der Seite der Ungerechten? Wage ich als Alter, diesen Blick auf mein Leben zu werfen, oder bringe ich die Frage zum Verschwinden, indem ich über Diskriminierungen jammere?
Seitdem wir uns den Himmel und die Hölle abgewöhnt haben, ist für alle, aber besonders für die Alten die Versuchung groß geworden, um sich selbst zu kreisen. Solange es den Himmel und die Hölle noch gab, war der Blick auf das eigene Leben ein Blick, der diskriminierte, sprich, der unterschied: zwischen dem Gelingenden und dem Misslingenden. Zwischen dem Guten und dem Bösen. Zwischen Schuld und Unschuld.
Und was ist heute? Heute hoffen und zittern die Menschen nicht vor dem Jüngsten Gericht, sondern fürchten, etwas versäumt zu haben. Was hört man heute von Menschen am Ende des Lebens? Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bedauern, hat Bronnie Ware als Palliativpflegerin gesammelt:
Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben.
Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet.
Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken.
Ich wünschte mir, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechterhalten.
Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein.8