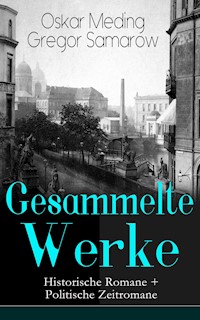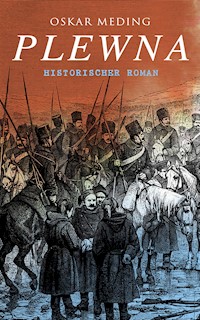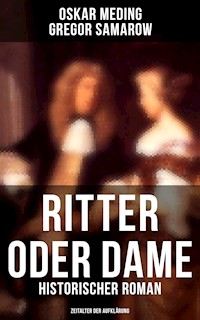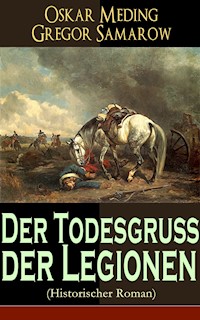Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Die Römerfahrt der Epigonen (Politischer Zeitroman)" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Oskar Meding (1828-1903) war ein deutscher Diplomat und Schriftsteller. Meding verfasste unter dem Pseudonym Gregor Samarow zahlreiche Romane, in denen er häufig Themen der jüngeren Geschichte behandelte: Politische Zeitromane und historische Romane aus der Zeit des deutsch-französischen Krieges 1870-1871. Aus dem Buch: "Der Kaiser Napoleon III. saß in früher Morgenstunde in seinem Cabinet im Schlosse der Tuilerien. Vor ihm lagen auf seinem Schreibtisch eine große Anzahl eingegangener Berichte, welche sein Cabinets-Chef Mocquard nach den Materien geordnet und ihm zur Durchsicht unterbreitet hatte. Wie der Kaiser so da saß, in seinen Fauteuil zurückgelehnt, so daß man die etwas stark gewordene Figur und das Embonpoint, welches seinem früher so schlanken und geschmeidigen Wuchs die anmuthige Eleganz genommen, weniger bemerken konnte - lag auf seiner ganzen Erscheinung noch der Schimmer eines letzten Hauchs der Jugend."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 596
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Römerfahrt der Epigonen (Politischer Zeitroman)
Inhaltsverzeichnis
I. Band.
Erstes Capitel.
Ein reges Leben herrschte in der alten Reichsstadt Goslar, der einst so glänzenden Residenz Kaiser Heinrichs, dessen hochragendes Schloß in Ruinen daliegt und traurig hinabblickt auf die Stadt am Harz.
Lange waren sie vorüber die Tage des alten Glanzes, und still hatte das Leben in der vergessenen Bergstadt sich von Jahr zu Jahr hingezogen – wie träumend nur hatten sie herübergerauscht die Sagen von den verschwundenen Zeiten aus den dunkeln Wäldern des Harzes her, in denen einst der große kaiserliche Vogelsteller sein Netz spannte, – und die alte Kaiserresidenz war zur kleinen Provinzialstadt des Königreichs Hannover geworden, in welche kaum einmal ein Fremder seinen Fuß setzte, wenn nicht ein Alterthumsforscher den Spuren der großen Vergangenheit nachging.
Dann aber war plötzlich in den neuesten Tagen das alte Goslar ein Sammelpunkt von Fremden aus aller Herren Länder geworden, – aber nicht wegen der Alterthümer kamen sie, sondern wegen der wunderbaren Heiltränke, welche der Schuster Lampe aus den Kräutern des Harzes zu brauen verstand und von deren Wirkungen bei sonst unheilbaren Krankheiten man sich die unglaublichsten Dinge erzählte. Wer von den Aerzten aufgegeben war, der kam nach Goslar zu dem wunderthätigen Schuster und verbreitete dann den Ruf von dessen Tränken weiter. Wohl hatten die zünftigen Aerzte den eigenthümlichen Naturarzt verfolgt und ein Verbot seiner Kuren erwirkt, – aber der König von Hannover hatte seine Tränke höchstpersönlich geprüft und ihre heilsame Wirkung empfunden, und der Facultät zum Trotz dem Schuster Lampe die Erlaubniß gegeben, den Leidenden zu helfen mit seinen waldduftenden Harzkräutern. Der König selbst war mit seinem Hof nach Goslar gekommen und brauchte die Lampe'sche Kur, fremde Fürsten waren ihm gefolgt, – die hannöverschen Minister und hohen Staatsbeamten kamen zu den Vorträgen und Berathungen hinüber, und von da ab füllten sich die Häuser der Bürger von Goslar mehr und mehr mit Fremden, – die alte Harzstadt gewann das Ansehen eines frequenten und eleganten Badeortes und ein Strom von Gold ergoß sich aus allen Ländern über ihre glücklichen Bewohner.
Es war im Juli 1863.
Hoch über der Stadt Goslar liegt das alte Klostergebäude, der Frankenberg, ein alterthümliches Haus in schönem Garten mit prachtvoller Aussicht nach den Bergen und über die Stadt hin. Hier hatte der König Georg von Hannover mit der Königin, dem Kronprinzen und den Prinzessinnen ihre Residenz aufgeschlagen, in ländlicher Einsamkeit lebte die Königliche Familie hier still und ruhig, und wenn keine Besuche aus Hannover kamen, die eine größere Entfaltung königlichen Glanzes veranlaßten, so war der Hofhalt von der äußersten Einfachheit, ganz der ziemlich strengen Diät der Lampe'schen Kur angepaßt.
In seinem großen und geräumigen, aber mit einer ganz bürgerlichen Anspruchslosigkeit meublierten Wohnzimmer im ersten Stockwerk des Frankenberger Klosters saß der König Georg V. in einem Lehnstuhl mit hölzernen Seitenlehnen vor seinem Schreibtisch.
Der König war damals vierundvierzig Jahre alt, – sein edles Gesicht mit dem schönen scharf geschnittenen Profil hätte in seiner vollen blühenden Frische und Gesundheit kaum jenes Alter errathen lassen, – der fehlende Blick des sehenden Auges nahm diesem schönen und sympathischen Gesicht nicht den geistig lebensvollen Ausdruck, wie man dies sonst wohl bei blinden Personen findet, – das lebhafte Mienenspiel, die beredte und anmuthig verbindliche Bewegung der Lippen beim Sprechen erfüllt die Züge des Gesichts mit dem Glanze geistigen Lichtes, und bei der eigenthümlichen Sicherheit, mit welcher der König stets die Augen scharf auf denjenigen richtete, mit dem er sprach, wollten die Personen, welche nicht regelmäßig mit ihm verkehrten, selten an den völligen Verlust seines Augenlichtes glauben.
Der König trug die Uniform der Gardejäger ohne Epauletten mit dem kleinen Kreuz des Guelphenordens, – unter dem unterhalb aufgeknöpften Waffenrock sah man das große blaue Band des Ordens vom Hosenbande. Er rauchte eine Cigarre aus einer langen Holzspitze.
Dem Könige gegenüber saß sein Geheimer Cabinets-Rath Dr. Lex, – ein kleiner unscheinbar bescheidener Mann von fünfzig Jahren, mager und trocken, mit kleinem, faltenreichem, bartlosem Gesicht, das fast immer einen leicht mürrischen Ausdruck zeigte und sich nur bei längerer Unterhaltung mit näheren Bekannten zu einer gemüthlichen Heiterkeit aufhellte.
Der Geheime Cabinets-Rath las dem Könige die aus Hannover eingegangenen Berichte vor.
»Der Minister Windthorst berichtet über die Thätigkeit des großdeutschen Vereins,« sagte der Geheime Cabinets-Rath, indem er einen Bogen entfaltete, – »auch der Ober-Gerichts-Director Witte hat mir einen Privatbrief über denselben Gegenstand geschrieben.«
»Nun, was macht denn dieser vortreffliche Verein?« fragte der König mit leichtem Lächeln, indem er eine lange Rauchwolke aus den gespitzten Lippen hervorblies.
»Er bereitet abermals eine Versammlung mit Resolutionen über die deutschen Angelegenheiten vor,« erwiderte der Geheime Cabinets-Rath.
»Und welche Resolution will man fassen,« fragte der König.
Der Geheime Cabinets-Rath blickte in den Bericht und sprach:
»Der großdeutsche Verein erkennt in dem Vorgehn Dänemarks zur völligen Trennung Schleswigs von Holstein eine Beeinträchtigung der Rechte Deutschlands –«
Der König nickte mit dem Kopfe, – »eine unumstößliche Wahrheit!« sagte er halb für sich.
»– und der großdeutsche Verein,« fuhr der Geheime Cabinets-Rath fort, »erwartet daher, daß alle deutschen Regierungen, insbesondere auch die hannöverische diesem Vorgehen energisch entgegentreten werde.«
»Sehr hübsch,« sagte der König, abermals lächelnd, – »es ist gewiß nichts gegen diese Resolution einzuwenden, – nur sollte sie sich in allererster Linie an die beiden ersten Mächte des Deutschen Bundes, an Preußen und Oesterreich richten, – denn wenn diese einig, wahrhaft einig sind, so ist der deutsche Bund die erste Macht in Europa und an keinem Punkte wird deutsches Recht beschädigt werden können. – Daß ich, wo es die Ehre und das Recht Deutschlands gilt, meine Schuldigkeit thun werde, versteht sich von selbst, – aber was kann Hannover allein thun, – warum gerade Hannover besonders hervorheben? – Möchten doch jene beiden großen Mächte an der Spitze des Bundes ernsthaft handelnd auftreten, so wäre ja Alles gethan, – statt dessen lancirt man von Wien aus Ideen über die Bundesreform in die öffentliche Meinung hinein, und greift damit die Grundlage des Rechts, der Ruhe und des Friedens nicht nur in Deutschland, sondern in Europa an. – Der deutsche Bund,« fuhr er lebhaft fort, »ist nicht reformirbar – sein Fehler liegt nur darin, daß er eine Vereinigung rechtlich gleicher Glieder bildet, unter denen zwei an Macht so gewaltig die übrigen überragen, daß ohne sie nichts geschehen kann und daß es keine Gewalt giebt, welche jene zwingen könnte, sich den Gesetzen des Bundes zu unterwerfen, wenn sie es nicht wollen. Keine Bundesreform kann dies Mißverständniß beseitigen, und darum sollte man nicht an Reformen des Bundes denken, sondern alle Fürsten und Regierungen, die es wahrhaft gut mit Deutschland meinen, sollten unablässig danach streben, die beiden deutschen Großmächte in fester Einigkeit aneinander zu schließen und jedes Mißtrauen und Mißverständniß zu beseitigen. Ich wenigstens halte das für meine höchste Pflicht, der gemäß ich auch gehandelt habe – und wie ich glaube, mit Erfolg gehandelt, – als ich den König von Preußen veranlaßte, nicht allein nach Baden-Baden zu gehen, sondern umgeben von den übrigen Königen in Deutschland dem französischen Kaiser entgegenzutreten. – Glauben Sie mir, lieber Lex,« fuhr er nach einem langen Athemzug fort, – »die Einigkeit zwischen Preußen und Oesterreich ist die Lebensbedingung des Deutschen Bundes – keine der beiden Mächte kann und wird die andere unterwerfen, – und an dem Tage, an welchem jene Einigkeit ernstlich gestört werden sollte, wird man sagen können, finis Germaniae!« –
»Hat der großdeutsche Verein also die müßige Theorie der Bundesreform aufgegeben?« fragte er weiter.
»Doch nicht, Majestät,« sagte der Geheime Cabinets-Rath kopfschüttelnd, – »der Verein will in seiner Resolution auf die Nothwendigkeit der Bundesreform hinweisen, – welche,« fuhr er die Stelle des Berichtes vorlesend fort, »insbesondere auch die Herstellung einer auf die Kriegsverfassung des Bundes gestützten schlagfertigen Militairorganisation der Bundesstreitkräfte in's Auge fassen soll. Als Grundbedingung dafür bezeichnet der Verein die Zusammenfassung der Streitkräfte der deutschen Mittel- und Kleinstaaten zu einem selbstständig und einheitlich bewegbaren Armeekörper.«
Der König blies das Ende seiner Cigarre aus der Spitze und rief lebhaft:
»Das ist der einzige vernünftige Gedanke in der ganzen Resolution. Die alleinige Möglichkeit für alle kleineren Glieder des Bundes ernstlich und nachhaltig auf die Einigkeit der beiden Großmächte zu wirken, liegt darin, daß sie zunächst unter einander einig sind, namentlich auch militairisch geeinigt, denn so allein können sie ein wirkliches Gewicht in die Wagschale werfen und ihrem Rath Gehör schaffen.«
Man hörte einen Wagen in den stillen Hof des Klosters rollen, – bald darauf ertönten Stimmen und heiteres Lachen im Vorzimmer.
»Lampe!« rief der König.
Der Kammerdiener erschien in der rasch geöffneten Flügelthür mit den Worten:
»Ihre Majestät die Königin!«
Unmittelbar darauf trat die Königin Marie ein. Sie war mit dem Könige gleich alt, aber noch weniger als dies bei ihrem Gemahl der Fall war, ließ ihr Aussehen dies Alter vermuthen. Ihre Gestalt hatte noch die ganze schlanke Elasticität der Jugend. – Die Züge ihres runden, vollen und anmuthigen Gesichts waren so frisch und heiter, daß man darüber den kränklich blassen Teint vergaß und die vollen Flechten ihres Haupthaares waren weder in ihrem reichen Wachsthum noch in ihrer schönen braunen Farbe von der dahin fliehenden Zeit berührt worden.
Die Königin trug ein leichtes Sommerkleid, einen runden Strohhut mit einem frischen Blumenstrauß geschmückt in der Hand. Sie trat laut und fröhlich lachend in das Cabinet.
Ihr folgte auf dem Fuße eine eigenthümliche Erscheinung, ein Mann von fast siebenzig Jahren, ausgetrocknet und dürr, Ausdruck und Haltung ohne Anmuth, aber doch durch eine gewisse leichte und selbstbewußte Sicherheit über die Gewöhnlichkeit erhaben. Die unregelmäßigen Züge seines Gesichts zeigten eine gewisse verbissene Verschlossenheit, und die tief unter der etwas hervortretenden Stirn heraufblickenden Augen waren ebenso voll kalter scharfer Beobachtung als voll eigenthümlichen, orientalisch glühenden Fanatismus.
Diese sonderbare Erscheinung war der berühmte Naturheilkünstler Lampe – er trug einen kurzen Rock von originellem Schnitt mit aufstehendem Kragen und mit schwarzen Schnüren nach Art der alten polnischen Kurtkas besetzt, und hielt eine österreichische Mütze mit großem Schirm in der Hand.
Der König hatte sich beim Eintritt seiner Gemahlin erhoben und war vor seinem Stuhl stehen geblieben, während der Geheime Cabinets-Rath mit tiefer Verbeugung Ihre Majestät begrüßte.
»Lampe ist sehr ungnädig, Männchen,« sagte die Königin immer noch lachend, – »er hat auf meinem Frühstückstisch Kaffee gefunden, – und ich kann es allerdings nicht läugnen, daß ich mir heute diesen von der Regel seiner Kur abweichenden Genuß erlaubt habe, – da ist er so böse geworden, daß ich mich vor seinem Schelten hier unter Deinen Schutz flüchten muß.«
»Das wird Ihrer Majestät, meiner allergnädigsten Königin gar nichts helfen,« sagte Lampe mit seiner trockenen, kurzen Stimme in sehr ausgesprochenem Harzer Dialect, – »Hier in Goslar sind alle Patienten, welche die Kräuterkur brauchen wollen, meine Unterthanen, und ich kann gar keine Abweichung von meinen Gesetzen dulden, – ich habe keine Instanz über mir und kein Parlament neben mir – ich frage Niemand und gebe keine Rechenschaft, und wer gesund werden will, muß mir gehorchen.«
Der König lachte herzlich.
»Glücklicher Lampe,« rief er, – »das kann kein anderer Souverain von sich sagen, – fast sollte ich Lust bekommen, mein Herrschaftsgebiet mit dem Ihrigen zu vertauschen.«
»Gegen den Tausch würde ich ganz gehorsamst protestiren,« rief Lampe seine Hände gegen den König erhebend, – »Eure Majestät haben mir zu viele gesunde Unterthanen, mit denen mag ich Nichts zu thun haben, – ich ziehe die Kranken vor, – die müssen sich schon fügen, – und haben den Vorzug, daß sie ihre Steuern gern und willig zahlen.«
»Da ich also kein Recht bei Dir finde, sagte die Königin, »so muß ich mich wohl entschließen, die Opposition aufzugeben und den Kaffee von meinem Frühstückstisch zu verbannen.«
»Es wird Eurer Majestät nichts Anderes übrig bleiben,« murrte Lampe, – »ich habe Ihnen in der That noch keine zu strengen Diätregeln vorgeschrieben.«
»Doch jetzt den Kurrapport,« rief der König, – und lächelnd hob er einen Finger empor, »sprechen darf man ja dabei nicht.«
Die Königin trat an ein Fenster.
Lampe betrachtete den König scharf und prüfend aus seinen stechenden Augen und sagte kurz: »Ich werde Eurer Majestät in einer Stunde den heutigen Trank senden.«
»Ich muß Ihnen übrigens sagen, mein lieber Lampe,« sprach Georg V. weiter, »daß Ihr Einreiber Lentje fürchterlich mit mir umgeht, um mir Ihre harzigen Salben in die Haut dringen zu lassen. – Er behandelt mich in der That wenig rücksichtsvoll.«
»Gut, gut,« rief Lampe, – »das ist seine Pflicht, – er muß die Glieder tüchtig kneten, – sonst dringt der Saft nicht ein, – ich würde ihn fortschicken, wenn er Rücksichten nehmen wollte.«
»A propos,« sagte der König lachend, – »was macht denn mein Professor Pernice, den Sie in der Kur haben, ich habe ihn seit einigen Tagen nicht gesehen, – ist er schon schlanker geworden?«
»Bei dem guten Pernice,« sagte die Königin, welche zu ihrem Gemahl getreten war, – »trifft wenigstens zu, was der Bürgermeister Sandvoß über Lampe's Kur sagt, – die Kur ist gewiß ganz gut – aber es gehört eine feste Gesundheit dazu.«
Und schalkhaft lächelnd blickte sie auf den Naturarzt, welcher roth vor Zorn wurde und mit funkelnden Augen rief: »Der Bürgermeister Sandvoß versteht davon gar Nichts, – gar Nichts, – und wenn er seine ungehörigen Bemerkungen nicht unterläßt, so werde ich ihm zeigen, daß ich Herr in Goslar bin und daß die Bürgerschaft mir und nicht ihm gehorcht, – übrigens,« fuhr er fort, – »hätte sich der Professor Pernice viel mehr über meine Vorschriften zu beklagen, als Eure Majestät, – denn ihm habe ich verordnet, jeder Morgen zwei Stunden lang auf einem Beine zu stehen, während er zwei Flaschen Kräutersaft trinkt, – und es bekommt ihm vortrefflich, – ich lasse ihn jeden Abend wiegen und er nimmt täglich um zwei Loth an Gewicht ab.«
Der König rieb sich die Hände und brach in helles Lachen aus.
»Das ist herrlich,« rief er, – »Pernice auf einem Bein stehend, – das ist ja die pikanteste Situation, die man erfinden kann, – jetzt fehlt nur noch, daß Sie meinen Geheimen Cabinets-Rath da in die Kur nehmen, – aber den bekommen Sie nicht so leicht.«
»Wenn ich einmal medicinisch gemißhandelt werden soll,« sagte der Cabinets-Rath trocken, – »so ziehe ich vor, daß dies nach den Regeln der Facultät geschieht.«
Lampe warf ihm einen Blick stummer Verachtung zu.
»Der Geheime Rath Graf Decken von Ringelheim ist angekommen und bittet Eure Majestät um Audienz,« meldete der Kammerdiener.
»Graf Decken!« rief der König lebhaft, – »er soll kommen, führen Sie ihn gleich hierher!«
»Und ich will Lampe mit fortnehmen,« sagte die Königin, – »er soll die Kinder noch sehen, – Graf Decken wird ja nachher wohl zu mir kommen.«
»Er wird zu Tisch hier bleiben, – ich hoffe ihn einige Tage zu behalten,« sagte der König, und küßte die Königin zärtlich auf die Stirn.
Ihre Majestät verließ das Cabinet, Lampe verbeugte sich tief gegen den König und folgte ihr.
»Haben Eure Majestät für mich noch Befehle?« fragte der Geheime Cabinets-Rath.
»Ich danke Ihnen, lieber Lex,« erwiderte der König, – »erholen Sie sich ein wenig – ich werde heute Vormittag nicht mehr arbeiten.«
Der Geheime Cabinets-Rath entfernte sich mit seinen Papieren.
Wenige Augenblicke später trat Graf Decken ein.
Dieser Sohn des berühmten hannöverisch-englischen General-Feldzeugmeisters war ungefähr zehn bis zwölf Jahre älter als der König, hatte indeß in seiner Haltung noch viel jugendliche Frische, die nur durch den in Folge heftigen podagrischen Leidens etwas schleppenden Gang beeinträchtigt wurde. Sein blasses Gesicht war scharf geschnitten und hatte durch den hochaufgedrehten langen Schnurrbart, einen militairischen Ausdruck; seine gutmüthigen blauen Augen blickten lebhaft, und man sah ihnen an, daß sie scharf zu beobachten gewöhnt waren. Er trug die kleine Uniform der Kammerherren, blauen Frack mit roth umgeschlagenem Kragen.
»Wie freue ich mich, mein lieber Graf, Sie hier in Goslar zu begrüßen,« rief der König, dem Eintretenden die Hand reichend, – »setzen Sie sich zu mir, Sie haben mir viel von Ihrer Reise zu erzählen, – ich habe mit großem Interesse Ihre Briefe gelesen, die mir Meding alle mitgetheilt hat, und die mir so viele höchst wichtige Aufschlüsse gebracht haben.«
»Eure Majestät sind sehr gnädig,« erwiderte der Graf, – »ich habe gethan, was ich konnte, um mich über die Lage der Verhältnisse in Deutschland zu unterrichten und bin sehr glücklich, wenn meine Mittheilungen für Eure Majestät von einigem Werth gewesen sind. Ich habe Eure Majestät sogleich hier aufzusuchen mir erlaubt, um Ihnen mündlich noch Manches zu berichten.«
»Ich danke Ihnen dafür,« sagte der König, – »und freue mich besonders, Sie gerade hier in Goslar wieder bei mir zu sehen, wo Sie ja mit mir jene denkwürdigen Tage verlebt haben, als ich die Commission wegen der Katechismusfrage hier versammelt hatte.«
»Zur Zeit des hannöverschen Religionskrieges,« sagte Graf Decken lächelnd.
»Es war eine ernste und eigentlich recht traurige Sache,« sagte der König das Haupt neigend, – »ich glaubte einem von der Geistlichkeit mir kundgegebenen Bedürfniß der Gemeinden zu entsprechen, als ich den alten Katechismus Luthers in seiner Reinheit wieder herstellen wollte, – und fand plötzlich, daß das ganze Land sich dagegen erhob, – es war traurig und schmerzlich.«
»Die Herren Geistlichen hatten sich eben getäuscht und Nichts gethan, um ihre Gemeinden aufzuklären, so daß diese den alten Katechismus für einen neuen hielten und glaubten, es solle ihnen ein neuer Glauben aufgedrungen werden,« bemerkte Graf Decken.
»Bei allem Ernst der Sache,« sagte der König mit leichtem Lächeln, »boten die hiesigen Berathungen doch auch unendlich komische Episoden, – denken Sie sich,« rief er, lebhaft mit der Hand auf sein Knie schlagend, »daß der Erblanddrost von Bar, der damals den Cultusminister vertrat, den Katechismus einfach durch die Gensdarmen einführen wollte und auf die Bemerkung der Consistorialräthe Uhlhorn und Niemann, – die Väter der ganzen Sache, – daß das bei dem Widerstande der Gemeinden ohne Gewissenszwang nicht möglich sei, – einfach erwiderte: ›Das kommt ja gar nicht darauf an, – sie brauchen es ja nicht zu glauben, wenn sie das Buch nur einführen!‹«
Er lachte laut und herzlich.
»Eine vortreffliche Ansicht für einen Cultusminister,« sagte Graf Decken, – »ich hätte wohl die Gesichter der Consistorialräthe sehen mögen!«
»Sie sollen fast von ihren Stühlen gefallen sein,« sagte der König, – doch fuhr er dann ernst fort, – »erzählen Sie nun von Ihrer Reise, ich bin sehr gespannt, die mündliche Ergänzung Ihrer Berichte zu hören.«
»Eure Majestät wissen,« sagte der Graf, »daß ich ein kurzes Memoire über die Vereinigung der Armeen der Mittel- und Kleinstaaten zu einem einheitlichen Heereskörper, und namentlich zur Herstellung eines festen verschanzten Lagers als gemeinsamen permanenten Dienstübungsplatz mitgenommen hatte, um die Ansichten der deutschen Fürsten und Staatsmänner über diesen Gedanken zu erforschen, der ja vollständig die Billigung Eurer Majestät hatte.«
»Weil er die einzige Reform des Bundes ausdrückt, die möglich ist und ohne eine Verletzung der Bundesgesetze ausgeführt werden kann,« rief der König, – »die Kriegsverfassung legt es in die Hände der Regierungen durch entsprechende Institutionen, die Einheit der Bundesarmeekörper herzustellen, – und Alles, was in dieser Beziehung durch gemeinschaftliches Einverständniß geschieht, bedarf keiner besonderen Bundesbeschlüsse.«
»Ganz in diesem Sinne Majestät war die Motivirung meines Memoires, und ich habe den Gegenstand, wie ich Eurer Majestät geschrieben, den Königen von Sachsen, Baiern und Würtemberg vorgetragen, so wie auch dem Kaiser von Oesterreich.«
»Seine Majestät der König von Sachsen,« fuhr der Graf fort, »hörte mich sehr aufmerksam an, – er fand auch den Gedanken sehr richtig, daß eine militairische Einigung der Mittel- und Kleinstaaten die dritte vermittelnde und verbindende Macht zwischen Preußen und Oesterreich bilden solle. Der König wies mich an seinen Kriegsminister von Rabenhorst, einen sehr energischen und entschlossenen Mann, – welcher sogleich die von mir nur flüchtig skizzirte Idee einer militairischen Trias – um mich so auszudrücken, nach ihrer praktischen Ausführbarkeit prüfte und in einer sehr klaren und übersichtlichen Ausführung, die ich bei mir habe und Eurer Majestät lassen werde, den ganzen Plan aufgestellt hat.«
»Vortrefflich, vortrefflich,« rief der König, »also sind wir dort wenigstens der Unterstützung sicher, – wenn diese militairische Einigung der eigentlich rein deutschen Bundesmächte schnell und nachdrücklich ausgeführt wird, so wird hoffentlich bald von allen diesen Bundesreformtheorieen keine Rede mehr sein.«
»Leider, Majestät,« fuhr Graf Decken fort, »kam der hinkende Bote nach. – Seine Majestät der König Johann erklärte mir nämlich, daß er bei allem Interesse für die Sache, bei aller Wichtigkeit, die er derselben beilege, dennoch bei dem beschränkten Militairbudget gar kein Geld zu ihrer Ausführung besitze, und auch nicht abzusehen vermöge, woher dasselbe zu beschaffen sein könne.«
»In Betreff der Mittel für Bundeszwecke haben ja aber die Stände keine Competenz,« sagte der König.
»Allerdings, aber dazu gehört ein formeller Bundesbeschluß,« erwiderte Graf Decken, – »und hier sollen ja nur Bestimmungen der Bundeskriegsverfassung zur Ausführung gebracht werden.«
»Ist das nicht dasselbe?« fragte der König.
»Ich sollte es meinen,« erwiderte Graf Decken, »und wenn alle Regierungen in dieser Auffassung einig wären, so würde dieselbe wohl leicht durchzuführen sein, – indeß schien mir der König Johann nicht geneigt, die Frage auf die Spitze zu treiben –«
»Und Herr von Beust, sein vielgewandter Minister?« fragte der König, »was sagt der dazu?«
»Herr von Beust,« erwiderte Graf Decken, »hat jedenfalls sehr viel Geist, – ich habe mit ihm ausführlich gesprochen, er kam von seinem Landsitz herein, – aber ich muß Eurer Majestät aufrichtig sagen, ihm fehlt eine Eigenschaft, auf welche ich bei einem Staatsmanne, der wirklich etwas Bedeutendes leisten soll, den entschiedensten Werth lege, Herr von Beust hat keinen militairischen Geist.«
Der König lächelte.
»Was verstehen Sie darunter?« fragte er.
»Darunter, Majestät, verstehe ich den klaren scharfen Blick, der die Realität der Dinge erfaßt und sich nicht in die Verfolgung von Theorieen verliert,« erwiderte Graf Decken, »der die Schwierigkeiten prüft, nicht um sich abschrecken zu lassen, sondern um sie zu überwinden, der vor allem den Entschluß fassen kann, vorwärts zu gehen, ohne sich durch den Strohhalm von kleinlichen Rechtsschwierigkeiten und Bedenken abhalten zu lassen.«
»Ich verstehe,« sagte der König.
»Diesen Geist, Majestät, hat Herr von Bismarck in so hohem Grade, er ist Militair in seinem ganzen inneren Wesen und seiner Auffassung der Verhältnisse, insbesondere der Schwierigkeiten, die sich ihm entgegenstellen, – daher seine Erfolge, und nur, wenn man von der großdeutschen Seite sich von demselben Geiste wird durchdringen lassen, wird man im Stande sein, die drohende Gefahr zu beschwören, welche aus dieser Gährung aller Elemente im öffentlichen Leben Deutschlands emporsteigt.«
Der König schwieg und stützte den Kopf in die Hand.
»Von diesem militairischen Geist aber,« fuhr Graf Decken fort, »hat Herr von Beust gar nichts, – er betonte ebenso wie sein allergnädigster Herr die große Schwierigkeit der Beschaffung der Mittel zur Ausführung der militärischen Einigung der jetzt zersplitterten Bundescontingente – und entwickelte nun gerade aus dieser Schwierigkeit die Nothwendigkeit einer schleunigen Reform der deutschen Bundes-Verfassung, namentlich der Berufung eines Parlaments, welches dann durch seine ohne Zweifel ganz großdeutsche Majorität die Geldmittel bewilligen würde.«
»Das ist ja aber,« rief der König, lebhaft auf den Tisch schlagend, »der vollständigste circulus vitiosus, – um diese gefährliche und rechtlich ohne Stimmeneinhelligkeit unmögliche Bundesreform zu beseitigen, wollen wir die einzig praktische und richtige militairische Basis einer gesicherten Machtstellung der Mittel- und Kleinstaaten herstellen, – und Herr von Beust will wieder durch die Reform und das Parlament die Mittel dafür schaffen.«
»Das ist eben, Majestät,« sagte Graf Decken, »was ich den Mangel an militairischem Geist nenne; er versteht es eben nicht, daß es eine Unmöglichkeit ist, eine Batterie zu nehmen, wenn man erst die Kanonen derselben erobern will, um damit die feindliche Position zu beschießen. Leider sind heutzutage die Cabinette voll von solchen eigenthümlichen widerspruchsvollen Auffassungen.«
»Sie haben also kein positives Resultat aus Dresden mitgebracht?« fragte der König.
»Die vortrefflichen praktischen Gesichtspunkte des Generals von Rabenhorst, Majestät,« sagte Graf Decken, »und das ist immer Etwas, außerdem das Versprechen des Königs und des Herrn von Beust, jedem Vorgehen in der besprochenen Richtung ihre Unterstützung und Mitwirkung zu Theil werden zu lassen – und das ist immerhin viel, – wenn auch die Hintergedanken des Herrn von Beust über Bundesreform und Parlament Alles wieder illusorisch zu machen geeignet sind.«
»Ich begreife nicht,« rief der König, »wie Herr von Beust, der doch die Bewegung von 1848 so sehr empfunden hat, jetzt wieder geneigt sein kann, sich mit den Schützen und Turnern zu verbinden und dem parlamentarischen Princip eine Brücke in das Bundesleben zu öffnen.«
»Herr von Beust, Majestät,« sagte Graf Decken, »wird vor allem Anderen von einer ganz ungeheuren persönlichen Eitelkeit beherrscht, welche neben allen seinen hervorragenden Verstandeseigenschaften die besondere Eigenthümlichkeit seines Charakters bildet, – wer ihm Weihrauch streut, hat stets großen Einfluß auf ihn, und die Dosis kann ziemlich stark sein, – außerdem –«
»Außerdem?« fragte der König.
»Man hat mir erzählt,« fuhr Graf Decken fort, »Eure Majestät wissen, daß ich von Norderney her mit dem Herrn von Friesen und einigen sächsischen Herren durch die großdeutschen Bestrebungen bekannt bin, – man hat mir erzählt, daß gewisse finanzielle Verhältnisse es dem Herrn von Beust sehr wünschenswerth, ja nothwendig machen, unter allen Umständen Minister zu bleiben, und da nun die liberalen Wellen ziemlich hoch gehen, so –«
»Ich verstehe,« sagte der König, »es wird also im Ganzen wenig von dort zu erwarten sein?«
»Wenig Praktisches,« sagte Graf Decken, »viel Worte, der König ist ängstlich und vorsichtig, namentlich wo die Geldfrage in Betracht kommt, und Herr von Beust blickt mit einem Auge nach Wien, mit dem andern nach den Turnern und Schützen und hätte er ein drittes, so würde er auch noch nach Berlin sehen, wenn ihm Herr von Bismarck nur einmal den Gefallen thäte, sich in einen Depeschenwechsel mit ihm einzulassen.«
Der König schwieg.
»Von Dresden,« fuhr Graf Decken fort, »ging ich nach München, ich fand dort Knesebeck, Eurer Majestät Gesandten, der sogleich vollkommen begriff, um was es sich handelte, er ist Militair und hat militairischen Geist, er erfaßte den Gedanken, den ich ihm entwickelte, mit Lebhaftigkeit und führte mich sogleich überall ein, aber –«
»Aber?« fragte der König den Kopf erhebend, mit Spannung.
»Aber weder bei dem König Maximilian, noch bei Herrn von Schrenck fand ich das geringste eingehende Verständniß. Der König ist eine weiche schwankende, aus absolutistischen Instinkten und constitutionellen Doctrinen wunderbar gemischte Natur – er hat außerdem ein merkwürdiges specifisch baierisches Nationalgefühl, das ihm jede Organisation der deutschen Wehrkraft zu deutschen Gesamtzwecken überflüssig erscheinen läßt. Er hält das hat er mir nicht deutlich und direct gesagt, aber ich habe es doch klar genug aus seinen Worten entnommen, er hält Baiern allein für berufen, die vermittelnde Stellung zwischen Oesterreich und Preußen einzunehmen und scheint den übrigen deutschen Staaten keine andere Aufgabe zuzuschreiben, als sich politisch und besonders militärisch möglichst eng an Baiern anzuschließen. – Herr von Schrenck theilt diesen specifisch baierischen Standpunkt und ist mehr Büreaukrat als Staatsmann.«
»Der König Maximilian,« sagte Georg V., »hat in der Geschichte seines Hauses und in der Rolle, welche Baiern in Deutschland spielte, schon zur Zeit seiner welfischen Herzöge,« fügte er seufzend hinzu, »eine gewisse Berechtigung zu einer solchen Auffassung der Verhältnisse, und um so mehr, als die Stelle, welche Hannover, obwohl an Ausdehnung kleiner, doch durch seine geographische Lage in Deutschland einzunehmen berufen ist, so lange leer blieb, da meine Vorfahren, mit der Regierung des großen Weltreichs beschäftigt, wohl die materiellen Interessen ihres Stammlandes mit liebevoller Sorge pflegten, aber doch nicht daran denken konnten, seine politische Stellung in Deutschland auf die gebührende Höhe zu heben.«
Er richtete das Auge einen Moment sinnend zu Boden.
»Hannover hat die Küste des freien Meeres,« fuhr er, wie seinen Gedanken folgend, fort »und das wiegt schwerer als eine Anzahl von Quadratmeilen und Einwohnern, – Hannover ist norddeutsch und hat durch die Verwandtschaft der Bewohner und durch die Traditionen meines Hauses einige Beziehungen zu Preußen und den Hohenzollern, während uns zugleich die Geschichte auf die enge Verbindung mit Oesterreich und dem Hause Habsburg hinweist. Hier liegt unsere Aufgabe und ich danke Gott, daß er sie mich erkennen läßt, möge er mir die Kraft geben, sie ihrer Erfüllung näher zu bringen, damit, wenn es mir nicht vergönnt sein sollte, wenigstens meine Nachfolger den Platz einnehmen, welcher Hannover in Deutschland gebührt. – – Und Herr von der Pfordten?« fragte er abbrechend.
»Herr von der Pfordten, Majestät,« sagte Graf Decken, »den ich in Frankfurt später sah, hat mir sehr ausführlich seine Idee von der Trias entwickelt, diese Trias aber war wieder politisch und parlamentarisch, und vor Allem war es wieder Baiern allein, welches den Mittelpunkt der Trias bilden sollte, er unterschied sich in seiner Auffassung von dem Herrn von Beust nur dadurch, daß dieser einen allgemeinen parlamentarischen Urbrei einzurühren mir sehr geneigt schien, während Herr von der Pfordten eine Gruppirung der deutschen Mittelstaaten um Baiern, allerdings ebenfalls mit etwas parlamentarischem Kitt verbunden aufbauen möchte. Könnte man doch diesen Herren etwas von dem Geiste Bismarcks einflößen,« rief er, die spitzen Enden seines Schnurrbarts streichend, »er weiß, daß große Dinge in der Geschichte nur mit Blut und Eisen gemacht werden, sie aber wollen mit dem lauwarmen Wasser der constitutionellen Phrase die Schäden der Welt heilen.«
»Von München ging ich nach Stuttgart,« fuhr der Graf fort, »und ich war dort in der That erbaut und erhoben durch die fürstliche Erscheinung Seiner Majestät des Königs vom Württemberg.«
»Ein vortrefflicher Herr,« rief der König, »der sehr bestimmt weiß, was er will.«
»Ja, Majestät,« sagte Graf Decken ein wenig zögernd, »nur steht der König leider mit seinen Ansichten zu fest auf dem Boden der Vergangenheit, – wie das so häufig auch den klarsten Geistern im hohen Alter begegnet.«
»Ja,« sprach der König, »das ist die verhängnißvollste Schwäche der menschlichen Natur, – in der Jugend leben wir in der Zukunft, – im Alter in der Erinnerung, – wie wenig Zeit bleibt uns, um die Gegenwart mit ihren Forderungen und Lebensbedingungen frisch und klar zu erfassen! Und doch müssen die Könige vor Allen in ihrer Zeit leben und ihre Zeit verstehen!«
Er seufzte und fuhr leicht mit der Hand über die Augen.
»Der König begriff,« fuhr Graf Decken fort, »vollkommen den Gedanken, den ich ihm entwickelte, er verstand die hohe Bedeutung einer militairischen Einigung der mitteldeutschen Streitkräfte und bedauerte, daß eine solche nicht schon längst hergestellt sei zu den Zeiten der Ruhe und Ordnung, – gleichwie damals Preußen und Oesterreich den Vertrag geschlossen hatten, nichts ohne vorheriges Einverständniß an den Bund zu bringen, – so hätten,« meinte der König, »auch die übrigen deutschen Staaten sich unter einander stets vorher über ihre Abstimmungen verständigen sollen und als geschlossene Gruppe imponirend den Großmächten zur Seite treten, statt sich getrennt zum Object ihres Kampfes um den größeren Einfluß zu machen.«
»Bei diesen Ansichten mußte aber Seine Württembergische Majestät unsere Idee mit besonderer Bereitwilligkeit aufnehmen!« sagte der König.
»Und doch,« erwiderte Graf Decken, »wies der König dieselbe fast ganz zurück.«
Georg V. richtete den Kopf hoch empor und horchte gespannt.
»Seine Majestät,« fuhr der Graf fort, »sagte mir, daß er es für hoch bedenklich und gefährlich halte, auch für die beste und richtigste Idee in diesem Augenblick an der Verfassung des deutschen Bundes oder auch nur an den Institutionen zu rühren. Die Geister seien – und zwar auf unerklärliche Weise durch die große Mitschuld Oesterreichs, das völlig seine alten Traditionen verlassen habe – angefüllt mit dem Zündstoff der Reformidee, und sobald man nur in einem einzigen Punkte die Hand anlege zur Aenderung des bestehenden Zustandes, so würden jene Ideen in hoch gefährlicher Weise hervorbrechen – den vernünftigen und praktischen Gedanken verändern und mit den modernen Theorieen durchtränken, so daß er schließlich seine ursprüngliche Form ganz verlieren werde, – da leider – wie der König befürchtete, – die Regierungen nicht mehr die Kraft haben würden, ihren Plan und ihre Gedanken fest zu halten. Deshalb war seine Majestät der Ansicht, daß man gegenwärtig gar nichts thun dürfe, – man solle ruhig die Fluth der Reformideen verlaufen lassen und fest an dem Bestehenden halten, – denn wenn einmal der deutsche Bund in Auflösung geriethe, so sei nichts mehr fest und sicher in Deutschland und Alles würde dem Chaos zutreiben.«
»Es liegt viel Wahres in der Auffassung der Königs,« sagte Georg V. ernst und nachdenklich.
»Haben Sie den Kronprinzen gesehen?« fragte er dann, – »und die Kronprinzessin Olga, – eine Prinzessin von hohem Geist und festem Charakter.«
»Majestät,« sagte Graf Decken, »ich habe mich den kronprinzlichen Herrschaften gegenüber sehr zurückgehalten, – wenn ich ganz offen sein soll, scheinen mir gewisse Verhältnisse obzuwalten, die mir die größte Vorsicht – namentlich bei Mittheilung und Erörterung politischer Ideen auflegen mußten. Eure Majestät wissen, daß häufig auf dem Thron, auch bei den besten Familienverhältnissen eine gewisse Eifersucht auf die alleinige Autorität besteht.«
»Ich verstehe, – ich verstehe,« sagte der König, »das ist eine für das monarchische Princip sehr bedauerliche Erscheinung, durch welche die so nothwendige Continuität der Regierungen oft schwer erschüttert wird.«
»Ich hoffte,« fuhr Graf Decken fort, »daß ich in Wien ein um so klareres Verständniß für den Gedanken der militairischen Trias finden würde, –die ja ihrer Natur nach für Oesterreich nur günstig sein kann, da man doch nicht voraussetzen durfte, daß Oesterreich jemals die Selbstständigkeit der deutschen Bundesstaaten antasten werde, – ich hoffte, daß es mir gelingen würde, den Einfluß Oesterreichs auf die Höfe von Dresden, München und Stuttgart zu gewinnen, um dieselben zu größerer Autorität anzuspornen, – allein ich fand leider ganz das Gegentheil.«
»Mein Gott, mein Gott,« rief der König – »wo sind die alten österreichischen Staatsmänner geblieben?«
»Das fragte ich mich auch, Majestät,« sagte Graf Decken, »denn ich fand nirgends jene klare und scharfe Auffassung der Verhältnisse, welche in früherer Zeit die österreichische Staatskanzlei auszeichnete und selbst von ihren erbittertsten Gegnern anerkannt werden mußte. Ich habe Eurer Majestät bereits mitgetheilt, daß bei aller Gnade und Freundlichkeit, mit welcher der Kaiser mich empfing und anhörte, doch eine gewisse Verstimmung mir vorhanden zu sein schien, über deren Grund ich mir ebenfalls erlaubt habe, meine Voraussetzungen Eurer Majestät mitzutheilen.«
»Ich weiß –ich weiß,« rief der König, »ich hoffe, daß das bald verschwinden wird, – ich danke Ihnen übrigens noch besonders für Ihre Mittheilung, – Sie fanden also nicht die gehoffete eingehende Aufnahme Ihres Vortrages bei dem Kaiser?« fragte er abbrechend.
»Der Kaiser,« erwiderte Graf Decken, »verhielt sich in dieser Beziehung vollständig constitutionell ablehnend – was ja formell auch ganz richtig ist, aber sachlich mir sehr wenig Vertrauen einflößte, denn trotz aller constitutionellen Formen ist doch ein sehr absolutistischer Kern in der österreichischen Regierung –«
»Das ist ja auch gar nicht anders möglich,« rief der König, »wie sollen denn so verschiedene Elemente anders zusammengehalten werden, als durch die verbindende Kraft des monarchischen Willens.«
»Graf Rechberg,« fuhr Graf Decken fort, »mit dem ich sodann sprach, ist eine unendlich zurückhaltende Natur, ich konnte von ihm irgend eine Ansicht herausholen, er hörte – und hörte sehr aufmerksam, – doch hatte ich die bestimmte Empfindung, daß er meinen Gedanken nicht günstig sei, ja, daß er bereits auf dem Boden einer festgestellten Meinung über eine Modification der deutschen Bundes-Verfassung stehe.«
»Das ist ja nicht möglich,« rief der König, »wenn Oesterreich am Deutschen Bunde rühren wollte, das wäre ja fast Selbstmord, denn wenn das Bundes-Gebäude einmal ins Stürzen geräth, so müssen ja die Trümmer verderblich über Oesterreich herrollen.«
»Und doch, Majestät, habe ich die gewisse Ueberzeugung in mir, daß man in Wien über etwas brütet, ja daß man schon fertig mit seiner Ansicht und seinem Plan ist. Was mir das zurückhaltende Schweigen des Grafen Rechberg nicht sagte, das sagte mir die breite Redseligkeit des Herrn von Meysenburg, der ganz im Sinne der Herren von Beust und von der Pfordten über die Bundesreform sprach. In dem Kopfe dieses spiritus familiaris der Staatskanzlei schien sich mir ein wundersames mixtum compositum gebildet zu haben, aus liberal-parlamentarischen Reformgedanken, vermischt mit der Neigung, die alte Kaiserherrlichkeit des Hauses Habsburg wieder aufzurichten, das alles mit einer ultramontan-katholischen Sauce übergossen, in summa ein Gericht, an welchem Deutschland starke Unverdaulichkeit davontragen könnte!«
Der König lächelte. Dann blickte er ernst vor sich nieder. »Und da sollte wirklich schon ein fester Plan vorliegen?« fragte er »ich kann es kaum glauben – Stockhausen würde doch etwas davon erfahren haben.«
»Herr von Stockhausen, Majestät,« sagte Graf Decken, »ist so tief durchdrungen von der Unfehlbarkeit der Staatskanzlei, daß er sich vielleicht nicht die Mühe geben mochte, etwas zu erforschen, das man ihm nicht mittheilt – und man schien mir sehr geheimnißvoll in Wien zu sein.«
»Es ist mir hoch interessant, was Sie mir da sagen,« sprach der König nach einer Pause, »ich werde ernstlich darüber nachdenken, um für alle Fälle mit meinen Gedanken im Klaren zu sein. Wenn Oesterreich wirklich die Bundesreformfrage in Fluß bringen sollte,« fügte er kopfschüttelnd hinzu, »das wäre ja ganz im Preußischen Interesse gehandelt; Preußen könnte ja doch in der That nichts Besseres erwarten, als daß ihm die Bahn geöffnet würde, ohne daß es das Odium auf sich zu nehmen hätte, die alte Rechtsgrundlage zu zerstören – nein, nein es ist nicht möglich!«
»Ich wünschte,« sagte Graf Decken, »daß ich die Ansicht Eurer Majestät zu theilen im Stand wäre, aber nach meinen Eindrücken an Ort und Stelle kann ich es nicht.«
Ein Schlag ertönte an der Thür.
Der Geheime Cabinetsrath trat ein.
»Ein Schreiben aus Hannover« sagte er, »bringt so eben eine traurige Nachricht, die ich Eurer Majestät sogleich mittheilen zu müssen glaubte.«
»Nun,« rief der König, »was ist geschehen?«
»Der General Halkett ist gestorben, Majestät,« erwiderte der Geheime Cabinetsrath.
Der König neigte das Haupt und blieb eine Zeit lang schweigend stehen.
»Da ist wieder eine edle Seele heimgegangen,« sagte er dann, »ein ritterliches und braves Herz hat aufgehört zu schlagen, und ich habe einen treuen Diener verloren; immer mehr lichte sich die Reihen der Kämpfer aus jenen großen Tagen unserer Väter! Schreiben Sie sogleich nach Hannover an Brandis,« fuhr er fort, »daß der General mit den Ehren eines Feldmarschalls bestattet werden soll und daß ich selbst kommen werde, um ihm die letzte Ehre zu erweisen.«
Der Kammerdiener trat ein.
»Ein Telegramm für Eure Majestät.«
Der König ergriff das Telegramm, riß schnell den Umschlag ab und reichte es dem Geheimen Cabinetsrath.
»Lesen Sie!«
Der Cabinetsrath durchflog den Inhalt, seine Lippen zitterten, fast ängstlich blickte er zum König auf. »Majestät,« sprach er, »es scheint, daß der heutige Tag Eurer Majestät nur schmerzliche Nachrichten bringen soll. Das Telegramm kommt –«
»Aus Berlin?« rief der König rasch mit zitternder Stimme.
»Zu Befehl, Majestät,« erwiderte der Cabinetsrath, »und es bringt die Nachricht, daß gestern Abends 6 Uhr Seine Königliche Hoheit der Prinz Friedrich von Preußen sanft entschlafen ist.«
»Mein Bruder ist todt!« sagte der König leise und bedeckte die Augen mit der Hand.
Dann faltete er die Hände und bewegte eine Zeit lang die Lippen.
Graf Decken und der Cabinetsrath standen schweigend zur Seite.
»Bringen Sie der Königin die Nachricht, lieber Lex,« sagte der König dann mit ruhiger Fassung, »und bereiten Sie die Verfügungen an Malortie wegen der Trauer vor. – Auf Wiedersehen, Graf Decken,« fügte er mit sanftem Lächeln hinzu; »wir sprechen noch über Ihre Mittheilungen, jetzt, meine Herren will ich allein bleiben.« Er grüßte mit leicht geneigtem Haupt und setzte sich in seinen Stuhl.
Graf Decken und der geheime Cabinetsrath verließen das Zimmer.
Der König saß lange schweigend und stützte den Kopf in die Hand.
»Halkett todt,« sagte er in dumpfen Tone, »der Kämpfer von Waterloo, der Cambronne vor der Front der alten Garde des großen Napoleon gefangen nahm, jene Verkörperung der großen Zeit des Kampfes für die Heiligkeit des Rechts – mein Bruder Friedrich todt,« fuhr er mit tief wehmüthigem Klang der Stimme fort, »auch ein Streiter in dem großen Befreiungskampf – er, der Sohn meiner Mutter – der Sohn der Schwester der Königin Louise, er, die lebendige Erinnerung an alle die heiligen Traditionen, welche die Häuser der Welfen und Hohenzollern mit einander verbinden, die Erinnerung an Friedrich Wilhelm III., den vortrefflichen alten Herrn – todt – todt – sie sinkt dahin, die alte Zeit, und das gerade, als mir Decken berichtet von der Zerfahrenheit der Zustände in Deutschland, von der Verblendung Oesterreichs, das mit eigener Hand die Brandfackel in das kunstvolle Gebäude der deutschen Bundeseinigkeit werfen will! Sind das Zeichen der göttlichen Vorsehung, welche eine neue Zeit heraufführen will über den Gräbern der Vergangenheit? Eine neue Zeit in blutigem Morgenroth – denn Blut wird vergossen werden in Strömen, wenn einmal Alles zusammenbricht – und in all dem gährenden Wirrwarr,« rief er laut, »in all den durcheinanderstreitenden Elementen kein Mann, kein einziger großer und starker Geist, als nur der Eine – der Eine allein, der kalt und ruhig zusieht, wie sie geschäftig die Bollwerke des alten Rechts zerstören!«
»Mein Gott, mein Gott,« rief er, »soll es wahr werden in Deutschland, das alte Wort: »Quos Deus vult perdere prius dementat?«
Er ließ den Kopf auf die Brust herabfallen und versank in tiefes Nachdenken.
Zum offenen Fenster herein wehten die duftigen Sommerlüftchen und von den alten Bergwäldern des Harzes rauschte es in leisem Lufthauch herüber zu den ragenden Trümmern der Kaiserburg, in der einst der große Städtebegründer nachsann im tiefen Gemüth und klugen Sinn über des deutschen Reiches Macht und Herrlichkeit.
Zweites Capitel.
Der Kaiser Napoleon III. saß in früher Morgenstunde in seinem Cabinet im Schlosse der Tuilerien. Vor ihm lagen auf seinem Schreibtisch eine große Anzahl eingegangener Berichte, welche sein Cabinets-Chef Mocquard nach den Materien geordnet und ihm zur Durchsicht unterbreitet hatte.
Wie der Kaiser so da saß, in seinen Fauteuil zurückgelehnt, so daß man die etwas stark gewordene Figur und das Embonpoint, welches seinem früher so schlanken und geschmeidigen Wuchs die anmuthige Eleganz genommen, weniger bemerken konnte – lag auf seiner ganzen Erscheinung noch der Schimmer eines letzten Hauchs der Jugend. Sein dunkelblondes Haar war sorgfältig geordnet, und nur erst ganz unmerklich mit Grau untermischt.
Sein dichter Schnurrbart war an den Enden in zwei gerade Spitzen gedreht und ein langer nach unten hin breit auslaufender Knebelbart bedeckte sein Kinn, das ein wenig kurz und zurücktretend nicht jene stolze und unbeugsame Willenskraft verrieth, welche in der Gesichtsbildung des ersten Kaisers so besonders bemerkbar hervortrat. Seine in starker Wölbung heraustretende Stirne erschien im Verhältniß zu ihrer Höhe ein wenig schmal. Unter den dichten Augenbrauen, zwischen denen sich wie gewohnheitsmäßig kleine Falten bildeten, blickten seine Augen von unbestimmbarer Farbe und einem stets wechselnden Ausdrucke hervor. Es war eine besondere Eigenthümlichkeit dieser merkwürdigen Augen, daß sie bald sich unter den herabsinkenden Lidern, wie hinter verhüllendem Schleier verbargen, bald langsam sich öffnend oder in plötzlichem Aufblick groß hervortretend eine Fülle von Licht und Gluth ausstrahlten, welchen man einen Augenblick vorher kaum hätte in diesem so ruhig gleichgültigen und fast trägen Blick erwarten sollen. Ebenso wechselnd erschien dann auch die Farbe dieser Augen. Vom trüben und matten Grau ging sie plötzlich in einen tiefdunklen Ton über und ein leuchtender Phosphorglanz schimmerte aus den erweiterten Pupillen hervor.
Die Gesichtszüge des Kaisers waren weich bis zur Schlaffheit. Es lag in denselben ein tiefer, sinnender Ernst, ein Ausdruck von fast schwermüthiger Resignation – oft eine krankhafte, müde Erschöpfung und Abspannung. Doch waren diese Züge in wunderbarer Beweglichkeit, eines jeden Ausdrucks fähig, den der Kaiser auf ihnen erscheinen lassen wollte, wen er sich in Gesellschaft befand. Immer aber lag in seinem Gesicht der verbindliche Ausdruck einer liebenswürdigen und herzlichen Höflichkeit, jener Höflichkeit, welche die Franzosen so treffend politesse du coeur nennen, und welche Alles, auch die unangenehmsten Dinge so zu sagen weiß, daß niemals eine Verletzung persönlicher Gefühle stattfindet.
Der Kaiser trug einen leichten Morgenanzug von dunklem Stoff und rauchte eine jener großen dunkelbraunen Havanna-Cigarren, welche eigens für ihn aus den feinsten Deckblättern angefertigt wurden. Neben ihm auf einem kleinen Tisch stand ein einfaches Kaffee-Geschirr von Silber und aus einer Tasse von Sêvresporzellan duftete ein überaus starker Extrakt der reinsten Moccabohne.
Hier in der Einsamkeit seines Cabinets hatte der Kaiser jeden Zwang, jede sozusagen officielle Toilette seiner Gesichtszüge abgelegt. Seine Augen waren weit geöffnet und richteten sich mit träumerischem Ausdruck durch den offenen Fensterflügel nach den Baumwipfeln des Tuileriengartens hin; auf seinem Gesicht lag ein noch düsterer Ernst als gewöhnlich. Er hatte ein Papier, das er aufmerksam durchgelesen, wieder vor sich auf den Tisch gelegt und blies in großen Zügen die Rauchwolken aus seiner Cigarre empor, welchen in bläulichen Ringen dahinzogen und das Zimmer mit ihrem aromatischen Duft erfüllten.
»Ich habe eine mächtige Bresche gelegt in diese Verträge von 1815,« sagte er halb leise – »in diese Verträge, welche die Grundsätze der heiligen Allianz zur Basis des europäischen Völkerrechts machten und welche,« fuhr er mit halb zornigem, halb höhnischem Zusammenziehen der Lippen fort, »die napoleonische Dynastie für immer von dem Throne Frankreichs und von den durch ihren Gründer eroberten Rechten ausschließen.
»Oesterreich hat sich von jener östlichen Coalition, welche man die heilige Allianz nannte, und welche durch ihr Schwergewicht Europa beherrschte für immer getrennt – Rußland wird ihm seine Undankbarkeit nie vergessen – Italien ist regeneriert nach den Grundsätzen des neuen Völkerrechts, das an Stelle der Legitimität die Monarchie auf dem Willen des Volkes begründet, – aber noch steht ein mächtiges und gewaltiges Bollwerk jener alten Verträge da, welches wie eine starre Mauer sich an den Grenzen Frankreichs erhebt. Dieses Bollwerk, dessen Bau die Diplomatie des Wiener Congresses auf die Macht und den Einfluß Frankreichs gesetzt hat, wie einst die Berge Siciliens auf die Brust der niedergeworfenen Titanen gewälzt wurden, dies Bollwerk ist der Deutsche Bund; dieser Deutsche Bund, so schwerfällig und bewegungslos für die politische Initiative, aber von so gewaltiger Kraft in der Vertheidigung des bestehenden Rechts, weil er dieses vielgliedrige Deutschland vereinigt unter der Führung von zwei europäischen Großmächten und so eine Macht bildet, gegen welche kaum ein Kampf möglich ist. – So lange der deutsche Bund besteht,« fuhr er düster fort, »so lange besteht der festeste und innerste Kern dieser Verträge von 1815, welche meinem Thron die völkerrechtliche Grundlage nehmen und das Kaiserreich zu einem factischen Zustand machen, den die Mächte Europas annehmen, ohne ihn als sich ebenbürtig anzuerkennen.«
Er stand auf und ging langsam im Cabinet auf und nieder.
»Mein Oheim,« sprach er dann, vor dem geöffneten Fenster stehen bleibend und in tiefem Nachdenken hinaufblickend, »mein Oheim würde seinen Degen gezogen haben und mit gewaltigem Schlage dieses völkerrechtliche Gebäude zertrümmert haben, wie er es einst mit dem deutschen Reiche that, – aber das deutsche Reich war schwach und in sich verbröckelt, während dieser deutsche Bund sich bei einem Angriff von außen in gewaltiger und einiger Kraft erheben wird. –
»Mein Oheim wollte seine Dynastie zur ältesten in Europa machen, indem er die Throne zertrümmerte, aber selbst seine gewaltige Kraft zerschellte an diesem Werke, weil in ihm ein innerer Widerspruch lag. Er entfernte die Könige, aber er glaubte, seinen Thron auf derselben Basis der Legitimität aufbauen zu können, auf welche jene alten Dynastieen ihr Recht begründeten. Dadurch machte er sich zum Feinde Aller, er rief die europäische Coalition hervor, der er einsam gegenüberstand, nachdem er das Prinzip der Revolution verläugnet, das allein als übermächtiger Bundesgenosse ihm den Sieg in seinem Kampfe hätte sichern können. –
»Wie der einzelne Mensch,« sprach er weiter, indem er sich wieder in den Lehnstuhl vor seinem Schreibtisch niedersetzte, »aus seinen Fehlern lernen muß, so ist dies noch mehr die Pflicht der Dynastieen, welche die Zeit dazu haben, die dem Einzelnen so oft fehlt. Nicht die Throne zu zertrümmern, nicht die Dynastieen zu stürzen, ist die Aufgabe, die ich mir nach dem Studium der Geschichte meines Hauses zu stellen habe – mein Ziel muß es sein, allen Thronen in Europa dieselbe Rechtsbasis zu geben, auf welcher der meinige beruht, die Rechtsbasis des Volkswillens, der demokratischen Monarchie. Das aber ist nicht möglich, so lange die Macht dieses Deutschlands in seiner monarchischen Gliederung und in seiner nationalen Einigkeit in Europa dasteht. –
»Ich habe die Idee des europäischen Congresses mehrfach angeregt,« – sprach er nach einer Pause, indem er den Kopf langsam auf die Brust niedersinken ließ, »ich hoffte, an die Stelle der Wiener Congreß-Akte ein neues vertragsmäßiges Völkerrecht zu setzen, in welchem meine Schöpfungen ihren Platz finden würden. – – –
»Sie haben mit diesen Congreß verweigert, die stolzen Fürsten Europa's,« rief er, sich emporrichtend mit flammendem Blick, – »Weil sie trotz aller Freundlichkeit, mit der sie die vollendete Thatsache annahmen, trotz aller Dankbarkeit, welche sie wirklich für mich empfanden, weil ich die Revolution, die sie alle bedrohte, gebändigt habe, – weil sie trotz alle dem den Boden ihres legitimen Rechts nicht verlassen wollen, – weil sie mir nicht den völkerrechtlich gleich Platz in ihrer Reihe einräumen wollen.
»Nun,« fuhr er fort, indem er lächelnd über seinen Schnurrbart strich, – »sie haben den Boden der Negociation, den Boden des diplomatischen Conferenzsales nicht gewollt, so mögen sie es sich selbst zuschreiben, wenn ich die Dämonen entfessele. – Aber nicht ich werde es sein, der die Brandfackel in das Gebäude des alten Völkerrechts schleudert, – sie selbst sollen diesen Bau zerstören, auf den sie so stolz sind, – und in welchem sie mir den Platz nicht einräumen wollen.
»Der Augenblick ist günstig,« rief er abermals aufstehend, – »Rußland, das noch an seinen Wunden des Krimkrieges heilt, – ist von Neuem gebunden und an jedem Eingreifen in die Verhältnisse Europa's gehindert durch diese polnische Frage, welche wie ein offenes Geschwür all' seine Kräfte absorbiert.
»Der Ehrgeiz Oesterreichs ist mächtig aufgeregt durch die Reformbewegung, welche einen Theil des deutschen Volks, im Gegensatz zu den früheren Traditionen, seine Blicke nach Wien richten lassen wird. Der innere Conflikt, welcher dem preußischen Staatsleben scheinbar seine Kraft raubt, erregt in Wien die Hoffnung, die populären Sympathieen Deutschlands zu erhalten, und der Kaiser Franz Josef hat die größte Neigung, mit raschem Griff die Hand auszustrecken nach der alten Kaiserkrone seines Hauses.
»So wird daher mit stillem Lächeln Oesterreich die zerstörende Hand an das feste Gefüge des deutschen Bundes legen. Die Steine werden in's Rollen kommen, und wenn endlich der Conflikt sich zuspitzt, dann wird es diesmal nicht wie 1849 der russische Czar sein, welcher Halt gebietet, sondern ich, und leicht wird es mir werden, zwischen dem Zwiespalt der deutschen Großmächte die kleinen Könige und Fürsten des Bundes unter meiner Tutel zur Vertheidigung ihrer Selbstständigkeit zu vereinen.«
Sein Auge öffnete sich weit und träumenden Blickes schien er in die Bilder der Zukunft zu schauen.
Ein kurzer Schlag gegen die Thüre ertönte.
»Seine Exzellenz Herr Drouyn de Lhuys,« meldet der Kammerdiener.
Der Kaiser erhob sich rasch, sein Gesicht nahm den Ausdruck kalter, gleichmäßiger Ruhe an und mit leichter zustimmender Neigung des Kopfes trat er dem Minister der Auswärtigen Angelegenheiten entgegen.
Herr Drouyn de Lhuys war damals ein Mann in der Mitte der fünfziger Jahre. Die Haltung seiner großen vollen Gestalt war sicher und vornehm, aber ohne geschmeidige Eleganz. Sein dünn gewordenes Haar fiel in's Graue und war kurz geschnitten. Sein bartloses Gesicht von gesunder, frischer Farbe zeigte den Ausdruck ruhiger und selbstbewußter Würde, der Blick des ganz klaren, grauen Auges war durchdringend und kalt, aber von wohlwollender und verbindlicher Höflichkeit, – die ganze ruhige und vornehm einfache Erscheinung dieses Staatsmannes hätte kaum seine vielseitige Thätigkeit in so bewegten Phasen der Geschichte seines Landes errathen lassen, in welchen er stets seiner Ueberzeugung getreu gehandelt und lieber das Portefeuille aufgegeben hatte, als daß er sich zum Werkzeug einer Politik, die er nicht billigte, hätte gebrauchen lassen.
Der Kaiser hatte vor dem Eintritt seines Ministers seine Cigarre fortgelegt, und reichte demselben mit liebenswürdiger Verbindlichkeit die Hand.
Herr Drouyn de Lhuys setzte sich auf den Wink des Kaisers neben dessen Schreibtisch, und öffnete eine einfache schwarze Mappe, welche er in der Hand trug.
»Ich bringe Ew. Majestät zwei wichtige Nachrichten,« begann der Minister mit seiner sonoren, aber etwas leisen Stimme, – »zwei Nachrichten, welche nach verschiedenen Richtungen unsere Politik den erstrebten Zielen näher führen.«
Der Kaiser richtete seinen Blick erwartungsvoll auf den Sprechenden, neigte den Kopf etwas zur Seite und fuhr mit der Hand über seinen Schnurrbart.
»Soeben erhalte ich,« fuhr Drouyn de Lhuys fort, »von London die telegraphische Nachricht, daß der Zusammentritt der Notablen-Versammlung in Mexiko zur Beschlußfassung über die künftige Regierungsform des Landes gesichert ist. Die Versammlung wird aus zweihundertundfünfzig Mitgliedern bestehen, einschließlich der fünfunddreißig Mitglieder der junta superior de gobernio, welche der General Forey am 16. Juni ernannt hat und in dem Augenblick, in welchem ich die Ehre habe, zu Eurer Majestät zu sprechen, wird die feierliche Installation jener Versammlung bereits stattgefunden haben.«
Der Kaiser neigte mit zufriedenem Ausdruck den Kopf.
»Und sind wir dieser Versammlung vollkommen sicher?« fragte er dann.
»Vollkommen, Sire,« erwiderte Drouyn de Lhuys. – »Ich bin sogar in der Lage,« fuhr er fort, ein Blatt Papier aus der Mappe hervorziehend, »Eurer Majestät in bestimmter Fassung die Beschlüsse mitzutheilen, welche die Versammlung mit überwiegender Majorität votiren wird.«
Er verlas, während der Kaiser mit gespannter Aufmerksamkeit zuhörte, die folgenden Punkte:
»Die mexikanische Nation adoptirt als Regierungsform die constitutionelle erbliche Monarchie mit einem katholischen Fürsten, der den Titel »Kaiser von Mexiko« führen wird.
»Die Kaiserkrone von Mexiko soll dem Erzherzog Maximilian von Oesterreich angeboten werden, für sich und seine Deszendenten.
»Im Fall der Erzherzog den ihm dargebotenen Thron nicht annehmen sollte, wendet sich die mexikanische Nation an das Wohlwollen Seiner Majestät des Kaisers der Franzosen, um einen andern katholischen Fürsten zu bezeichnen, dem die Krone anzubieten sein würde.«
Er verneigte sich und legte schweigend das Blatt Papier auf den Tisch.
Der Kaiser wartete einen Augenblick und als Drouyn de Lhuys nicht weiter sprach, sagte er mit einem durchdringenden forschenden Blick auf das ernste Gesicht seines Ministers:
»Die Nachricht, welche Sie mir bringen, entspricht vollkommen meinen Wünschen und den Plänen unserer Politik, die Sie mit so geschickter Hand ihrer Vollendung entgegengeführt haben. Die Aufrichtung eines mexikanischen Kaiserreichs verstärkt das monarchische Prinzip auf dem Festlande der andern Hemisphäre, und da dieses Kaiserreich durch französische Waffen errichtet ist und unter französischem Schutze stehen wird, so gewinnt der Einfluß der lateinischen Racen, an deren Spitze Frankreich steht, eine mächtige Ausdehnung, welche für die Zukunft Folgen von unermeßlicher Bedeutung haben muß. – Nordamerika ist in seinem Wesen germanisch, protestantisch und republikanisch und steht in jeder Beziehung in feindlichem Gegensatz zu Frankreich. Wir haben also für unsere Politik, wir für unsere Handelsbeziehungen durch die Errichtung des mexikanischen Kaiserreichs einen großen und glücklichen Schritt gethan, der uns außerdem Oesterreich verbindet, indem ein Prinz des Hauses Habsburg zur Herrschaft in den alten transatlantischen Reichen seiner Vorfahren wiederberufen wird.
»Außerdem«, sagte er, sich ein wenig zu seinem Minister hinüberneigend, »werden Sie sich so wenig wie ich der Ueberzeugung verschließen, daß diese Combination den persönlichen Wünschen des Kaisers Franz Josef ganz besonders entsprechend ist. – Es ist schwer, für den hochstrebenden und thatendurstigen Geist des Erzherzogs Maximilian in Oesterreich eine passende Stelle zu finden, und bei den vielen Fähigkeiten des Erzherzogs, sowie bei seinen oft ausgesprochenen liberalen und reformatorischen Anschauungen kann es nicht fehlen, daß die Opposition bei jeder Unzufriedenheit mit der Regierung ihre Blicke auf den Bruder des Kaisers richtet und von ihm einen Einfluß erwartet, en er nicht ausüben kann oder der, wenn er es versuchen sollte, ihn geltend zu machen, nur zu schiefen Verhältnissen und bedenklichen Mißstimmungen führen könnte. Es ist nicht zweifelhaft, daß unter diesen Umständen der Kaiser Franz Josef nur innerlich erfreut sein kann, wenn sich der Thatkraft des Erzherzogs fern von den beengenden Verhältnissen des Heimatlandes ein großer und weiter Wirkungskreis öffnet.«
Drouyn de Lhuys neigte zustimmend den Kopf, ohne daß sein Gesicht einen Augenblick den Ausdruck einer ernsten, fast abwehrenden Zurückhaltung verlor.
»Sie scheinen, mein lieber Minister,« sagte der Kaiser nach einem abermaligen kurzen Stillschweigen mit fast unmuthigem Ton – »Sie scheinen trotz der so günstigen Resultate unserer Politik nicht zufrieden zu sein.«
Drouyn de Lhuys richtete seinen klaren Blick auf den Kaiser und sprach:
»Ich bin zufrieden, Sire, mit den erreichten Resultaten – allein es genügt nicht, sie erreicht zu haben, wir haben die weitere Aufgabe zu erfüllen, sie für die Zukunft zu sichern.«
Der Kaiser sah ihn erwartungsvoll an.
»Das Kaiserreich Mexiko, Sire,« fuhr Drouyn de Lhuys fort, »ist eine Schöpfung des augenblicklichen Waffenerfolges, der möglich wurde, weil Nordamerika durch den Kampf mit den Südstaaten sich außer Stande befand, seinen Einfluß geltend zu machen. Wäre dies möglich gewesen, – hätte Juarez einen Rückhalt an der vollen Kraft Nordamerika's gefunden, so möchte sicher unser Erfolg kein so schneller und leichter gewesen sein.«
»Ganz richtig,« sagte der Kaiser mit einem leichten Anflug von Ungeduld, – »die Sezession der Südstaaten hat aber auch von Anfang an ihren Platz in unseren Combinationen gehabt.«
»Wie aber die Errichtung des Kaiserreichs Mexiko,« fuhr Drouyn de Lhuys unbeirrt durch des Kaisers Einwurf fort, »eine Folge der Lähmung Nordamerika's ist, – so kann diese Staatsformation nur Bestand haben, so lange die Kraft Nordamerika's nicht wieder ersteht. Glauben Eure Majestät nicht, daß man in Washington ganz eben so gut wie hier in den Tuilerien die Bedeutung dieses mexikanischen Thrones versteht – glauben Eure Majestät nicht, daß man dort darin eine Kriegserklärung auf Tod und Leben erblickt?«
Der Kaiser schwieg und ließ langsam den Kopf auf die Brust sinken.
»Wenn man aber,« fuhr Drouyn de Lhuys immer in demselben ruhigen Ton fort, »die Bedeutung des Geschaffenen in Washington ebenso genau versteht als hier, so folgt daraus mit logischer Nothwendigkeit, daß man, sobald jemals Macht und Gelegenheit dazu sich wiederfindet, alle Kräfte aufbieten wird, um dasjenige wieder zu zerstören, was man im Augenblick der Ohnmacht hat entstehen lasse müssen.«
»Halten Sie es für möglich,« sagte der Kaiser, ohne aufzublicken, »daß eine solche Zeit kommen könne?
»Ich glaube nicht, daß der Kampf zwischen dem Süden und Norden der Vereinigten Staaten zu einem anderen Resultate führen könne, als zu einer dauernden Trennung derselben, in zwei gesonderte Gruppen, welche sich gegenseitig in eifersüchtiger Ueberwachung lähmen werden und von denen die südliche der Natur der Verhältnisse gemäß bald zum monarchischen Prinzip übergehen muß.«
»In politischen Combinationen, Sire,« sprach Drouyn de Lhuys ruhig weiter, »ist es bedenklich Möglichkeiten und Wünsche an die Stelle der sicheren Gewißheit zu setzen. Was Eure Majestät voraussetzen, ist möglich – vielleicht wahrscheinlich, indeß eine Garantie der Sicherheit dafür, vermag ich noch nicht zu erblicken. Eine solche kann nur geschaffen werden, wenn die Möglichkeit ausgeschlossen wird, daß der Norden über den Süden endlich Sieger bleibt und wenn die dauernde Trennung der beiden Hälften der bisherigen Union über alle Zweifel erhoben wird. Wollen Eure Majestät also die von mir im höchsten Maß anerkannten, und für die Zukunft so bedeutungsvollen Vortheile der mexikanischen Expedition und ihrer Resultate allen Wechselfällen gegenüber sicher stellen, so müssen Sie auf der Stelle fest und rückhaltslos für die Südstaaten Partei nehmen, mit denselben einen Vertrag abschließen und ihnen nöthigenfalls Truppen, Schiffe und Geld zur Verfügung stellen, denn – ich wiederhole es – das ganze Gebäude unserer transatlantischen Politik stürzt zusammen, wenn der Norden über den Süden Sieger bliebe, und wenn jemals die Union wieder zu ihrer alten Kraft erstarkte.«
Der Kaiser erhob sich und ging mehrere Male im Zimmer auf und nieder.
»Sie wissen,« sagte er dann, vor Drouyn de Lhuys stehen bleibend, der sich ebenfalls erhoben hatte, – »Sie wissen, daß England sich zurückzieht, – ich habe ja Palmerston darauf hinweisen lassen, daß es nothwendig sei, ernsthaft und energisch die Südstaaten zu unterstützen, – der alte feine Spieler zieht sich zurück, – seine Politik ist es, Zerstörung und Verwirrung in allen Theilen der Welt anzurichten, damit England seinen Vortheil dabei verfolgen kann, – niemals aber will er etwas Definitives schaffen, – Garantieen für die Ruhe der Zukunft herstellen. – Und Spanien,« fuhr er achselzuckend fort, »zieht sich ebenfalls von den Consequenzen der Londoner Convention von 1861 zurück, – dieser Prim hatte gehofft, sich zum Dictator und Kaiser von Mexiko erheben zu können – er sieht seine feinen Pläne vereitelt, – daher läßt er die ganze Sache im Stich. Soll ich nun ganz allein auf mich und Frankreich die ungeheure Last und das Odium einer solchen directen Intervention in die inneren Angelegenheiten der Vereinigten Staaten laden? – Ganz entgegen dem Prinzip, das ich stets gekannt und befolgt habe?«
»Wenn Eure Majestät nicht glauben, dies thun zu können, so wäre es vielleicht besser, daß wir uns ebenfalls ganz aus der Sache herauszögen, – es ist dies nicht unmöglich – Juarez hat durch seinen Minister Doblado eine Schrift aufsetzen lassen, in welcher er sich zu allen Opfern und zu jeder verlangten Genugthuung bereit erklärt und die Erfüllung aller Verpflichtungen zu garantiren verspricht. Es ist also noch die Möglichkeit, durch die Annahme seiner Vorschläge ehrenvoll aus der Sache herauszukommen und die ewige Feindschaft Nord-Amerika's zu vermeiden.«
Die Augen des Kaisers öffneten sich weit, seine Blicke funkelten.