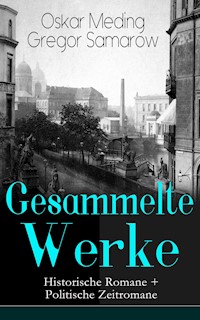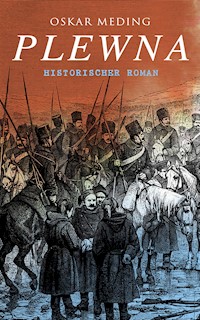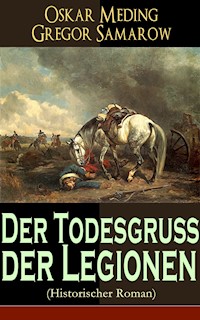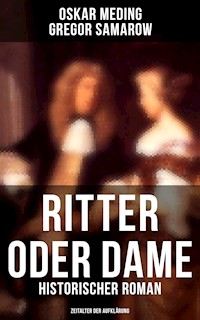
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Anthologie "Ritter oder Dame" versammelt historische Romane, die im Zeitalter der Aufklärung angesiedelt sind und durch die Autoren Oskar Meding und Gregor Samarow eine besondere literarische Tiefe erhalten. Diese Sammlung zeichnet sich durch eine Vielfalt an narrativen Techniken und stilistischen Ansätzen aus, die das europäische 18. Jahrhundert lebendig werden lassen. Von höfischen Intrigen bis zu philosophischen Debatten, die Werke beleuchten die Dynamiken eines sich wandelnden Kontinents und reflektieren die sozialen, politischen und intellektuellen Strömungen dieser Ära. Besonders hervorzuheben ist die Fähigkeit der Autoren, durch detaillierte Charakterstudien und komplexe Handlungsstränge sowohl Unterhaltung als auch tiefere Einsichten zu bieten. Oskar Meding und Gregor Samarow, beides Pseudonyme unter denen der deutsche Schriftsteller und Diplomat Meding schrieb, waren maßgeblich daran beteiligt, das Genre des historischen Romans in Deutschland zu prägen. Ihre Werke sind nicht nur literarisch wertvoll, sondern bieten auch eine Perspektive auf die politischen und sozialen Umbrüche ihrer Zeit. In dieser Anthologie werden die literarischen Errungenschaften und das kulturelle Gedächtnis dieser Epoche aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und bieten dem modernen Leser ein spannendes Panorama der Aufklärung. "Ritter oder Dame" ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für Geschichte, Kultur und Literatur des 18. Jahrhunderts interessieren. Diese Sammlung bietet eine exzellente Möglichkeit, die vielschichtigen Perspektiven und den Reichtum an Themen und Stilen zu erkunden, die das literarische Erbe der Aufklärung prägen. Leser werden ermutigt, sich auf diese erkenntnisreichen Geschichten einzulassen und durch sie ein tieferes Verständnis für die historischen und kulturellen Kontexte zu gewinnen, die unsere heutige Welt formen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ritter oder Dame
(Historischer Roman - Zeitalter der Aufklärung)
Books
Inhaltsverzeichnis
Erstes Kapitel.
Es war gegen das Ende der fünfziger Jahre im vorigen Jahrhundert, zur Zeit der Regierung Seiner allerchristlichsten Majestät Ludwig XV., welcher in seiner glänzenden hoffnungsvollen Jugend vom Volke den Namen des Vielgeliebten erhalten hatte, den er nun offiziell fortführte, obwohl das Volk selbst ihn weder mit den Lippen noch mit dem Herzen seinem Könige mehr gab, der sich so weit von den Wegen seiner ersten Regierungszeit entfernt hatte und in apathischer Gleichgültigkeit die Staatsgeschäfte meist gehen ließ, wie sie eben wollten und konnten. Und sie gingen im Ganzen damals noch nicht so schlecht, als zu einer spätern Epoche, welche die Revolution und den Untergang des von Ludwig XIV. so stolz und mächtig aufgerichteten Königthums vorbereitete. Damals hatte noch nicht die launenhafte Courtisane, welche man Gräfin von Dubarry nannte, die Krone Frankreichs durch den Schmutz der tiefsten Erniedrigung gezogen, so daß ihr später weder der edle, rechtliche Sinn Ludwig XVI., noch der stolze und kühne Geist der österreichischen Kaiserstochter Marie Antoinette wieder Glanz verleihen konnte, — damals lag die Regierung noch in den Händen der Marquise von Pompadour und ihres geistvollen und muthigen Freundes, des Herzogs von Choiseuil-Amboise, Grafen von Stainville, der als Minister-Staatssekretär die auswärtigen Angelegenheiten leitete und bald darauf auch das Kriegsdepartement übernahm, um die tiefe Verwahrlosung und Zerrüttung in den Armeen und Flotten Frankreichs mit kräftiger Hand zu bessern. Die Marquise von Pompadour war im Allgemeinen weit besser, als das Bild von ihr, welches die Geschichte als stereotyp aufgenommen hat; zwar war sie ein Weib mit weiblichen Launen und Schwächen; — die Stellung, welche sie als maîtresse en titre des Königs einnahm, verletzte das öffentliche Gefühl und brachte sie in ein schiefes Verhältniß, das oft durch Gereiztheit und Erbitterung sie zu falschen Schritten führte, — doch hatte sie bei alledem den hohen Wunsch, Frankreich, dessen König sie beherrschte, groß und mächtig zu sehen, und sie täuschte sich auch, namentlich seit Choiseuil ihren von Natur klaren und fein verständnißvollen Geist leitete, nicht in den Mitteln, welche zu diesem Zweck führten. Sie suchte Verständigung mit den freieren Elementen des nationalen Geistes und hoffte eine Zeitlang die geistige Bewegung, welche damals bereits begann, vom Thron aus lenken zu können, doch war ihre Stellung eine zu unklare und unsichere, und die ganze Zerrüttung der öffentlichen Autoritäten bereits eine zu große und tief eingefressene, als daß sie oder Choiseuil gründlich hätten bessern können, und das viele Gute, das geschah, wurde schnell wieder fortgeschwemmt, als es später der Dubarry gelang, Choiseuil zu stürzen und alle Bande des Rechts und der Ordnung im öffentlichen Leben zu zerstören.
Der ganze Glanz des Königthums, das die Sonne zu seinem Sinnbild genommen, ergoß sich über Versailles, diesen feenhaften Sitz monarchischer Allgewalt, diese Welt von goldenen Sälen und schimmernden Galerieen, in denen Alles, was reich, groß und erhaben war im großen, reichen und stolzen Frankreich, zusammenströmte, um den Strahlenkranz zu bilden des königlichen Sonnengestirns, zu dessen mehr oder minder matten Abbildern sich alle Höfe Europas machten. Der große Adel, dessen Vorfahren in trotziger Selbstständigkeit sich erhoben hatten gegen Ludwig XIII., den gewaltigen und furchtbaren Richelieu und den geschmeidig-tückischen Mazarin, dieser hohe Adel, der vor dem Schaffot nicht erbebt war, das der große Kardinal für einen Montmorency errichten ließ, er war gezähmt durch den Festrausch, welcher die Luft von Versailles erfüllte. Wie bunte Libellen flatterten im Glanz des Thrones die Träger der großen Namen des Landes, welche einst die wirklichen Pairs der Könige sich dünkten, und bettelten um die Gunst eines Blickes, eines gnädigen Wortes, einer Einladung nach Marly oder eines Platzes in den Karrossen des Königs, und die Wenigen, die sich von diesem Treiben des Hofes fern hielten und schauderten vor dem Wahlspruch der Höflinge: ›apres nous le déluge‹, — sie saßen einsam und vergessen auf ihren Schlössern in den Provinzen, ohne einen Platz finden zu können in der Verwaltung des Staates und in der Führung der Armeen, — für das Königthum existirte eben nichts, was nicht vor seinen Augen erschien in dem von der übrigen Welt hermetisch abgeschlossenen Lichtkreis von Versailles, und jene bespöttelten und verachteten Edelleute der Provinz erschienen erst wieder, als es galt, sich auf der Schwelle ihres bedrohten Königs zerstückeln zu lassen oder mit dem Rufe ›Vive le roi!‹ ihr Haupt dem Fallbeil der Guillotine darzubieten.
Die Bürger von Paris aber waren nicht gezähmt und verzaubert durch die Wunderwelt des Hofes von Versailles, die ihnen verschlossen blieb und von der sie nur zuweilen einen vorübergehenden Glanzblick sahen, wenn der König in feierlichem Auszug nach der Notredame kam, um vor dem Altar der hohen Schutzheiligen Frankreichs seine Andacht zu verrichten, oder wenn die glänzenden Equipagen der Großen mit den rücksichtslos Platz machenden Vorreitern durch die Straßen jagten, weil die Herren und Damen des Hofes sich in ihren Hotels in Paris ausruhen oder in ihren petites maisons die Fäden reizender kleiner Abenteuer verfolgen wollten.
Das Volk von Paris, welches nicht vergessen hatte, daß einst seine Könige in seiner Mitte lebten, sich zuweilen mit ihm zankend, zuweilen ihm schmeichelnd, immer aber seinen Wünschen und seinen Launen Rechnung tragend, — dieses so empfindliche und empfängliche Volk von Paris rächte sich für seine Zurückstellung in den Schatten auf jede Weise und bei jeder Gelegenheit. Zwar frondirte es nicht mehr mit der Muskete auf der Schulter und dem Degen in der Hand, dazu fehlten ihm die Führer, die rebellischen Prinzen wie Beaufort und Conti, und die konspirirenden Damen wie die Herzogin von Chevreuse und Mademoiselle von Mont-Zensier, — aber es jauchzte allen Denen zu, welche die Kämpfe der Fronde mit den Waffen des Rechtes und des Geistes fortsetzten, es umgab mit der Fülle der Popularität die Parlamente, welche gegen die Registrirung der königlichen Verordnungen eine oft begründete, oft auch unbegründete Opposition erhoben, und die Philosophen, welche ihre scharfen Kritiken gegen die staatlichen und gesellschaftlichen Zustände richteten, und es sang mit unermüdlicher Ausdauer alle die hämischen und boshaften, aber immer witzigen Couplets, welche täglich neu gegen den Hof und alle hervorragenden Persönlichkeiten desselben auftauchten, welche selbst den König nicht schonten und ihren Stachel gegen die Marquise und den Herzog von Choiseuil richteten, obgleich diese die Freunde und Gönner der Philosophen waren.
In dieser Zeit der allgemeinen Unruhe, Gährung und Erregung, welche noch keinen bestimmten Zweck und kein deutlich vorgestecktes Ziel hatte, wohnte in einem der hochgiebeligen alten Häuser der Rue des Saints Pères, welche von den Kais nach den alten Stadttheilen hinführt, in denen die mächtigen, mit fürstlicher Raumverschwendung erbauten Hotels der großen Adelsgeschlechter sich an einander reihen, ein junger Mann in einfachen und bescheidenen Verhältnissen, fast unbekannt allen Nachbarn und selbst den Mitbewohnern des Hauses, das einem reichen Seidenhändler gehörte, der im Erdgeschoß seine Kaufgewölbe hatte und den weiten ersten Stock bewohnte.
Dieser junge Mann, der drei Zimmer des zweiten Stockwerks gemiethet hatte und von der alten Frau des Concierge bedient wurde, die ihm auch von einem Garkoch in der Nähe seine bescheidenen Mahlzeiten herbeiholte, war der Chevalier Charles Geneviève d'Éon de Beaumont, der einzige Sohn eines nicht begüterten Edelmannes aus einer Seitenlinie der alten und berühmten Familie von Beaumont, der zu Tonnère in Burgund gelebt hatte und einige Jahre vorher gestorben war. Der Chevalier stand nun ziemlich allein in der Welt und besaß von näheren Verwandten nur noch eine Cousine, Fräulein Louise von Beaumont, ein armes, seit etwa einem Jahre ebenfalls verwaistes Mädchen, das bei einer ziemlich entfernten Verwandten, der Herzogin von Guéménee, die in Versailles lebte, Aufnahme gefunden hatte. Der junge Mann, welcher von Jugend auf durch fleißiges Studium sich umfassende Kenntnisse in den Staats- und Rechtswissenschaften erworben hatte, machte sein kleines Vermögen flüssig und begab sich nach Paris, um dort sein Glück zu versuchen, da es seiner feurigen Seele und seinem hochstrebenden Geiste zuwider war, in der Verborgenheit der Provinz von seinem dürftigen Einkommen ein dunkles Dasein zu führen. Er war seit etwa drei Jahren in der großen Hauptstadt und beschäftigte sich als Parlamentsadvokat, aber die Klienten und die Sporteln waren nur spärlich gekommen und langsam und allmälig, wie von einer vollen Baumkrone abwelkende Blätter, waren seine Hoffnungen und Illusionen zu Boden gesunken. Es war so schwer für den unbekannten und mittellosen jungen Mann, sich durch das vielverschlungene Labyrinth der vielen in der großen Hauptstadt sich durchkreuzenden Interessen einen Weg zu bahnen, und nach langer erfolgloser Arbeit hatte sich eine tiefe, schwermüthige und bittere Gemüthsstimmung des armen kleinen Chevalier bemächtigt.
Denn klein war er — und das war ein Unglück mehr für ihn, wenigstens glaubte er seiner unscheinbaren Gestalt, die fast eine Naturmerkwürdigkeit war, einen großen Theil von dem Mißerfolg seines ehrgeizigen Strebens zuschreiben zu sollen — vielleicht mit Unrecht, aber eine vom Unglück niedergebeugte Seele sucht ja fast immer in selbstquälerischer Erfindung allerlei Gründe für die Ungunst des Glücks. Der Chevalier d'Éon war von schlanker, ebenmäßiger und anmuthiger Gestalt, aber diese Gestalt war so klein und zierlich und dabei von so entschieden weiblichen Formen, daß Jeder, der ihn nicht kannte, ihn für ein Kind oder eine verkleidete Frau halten mußte. Sein Gesicht war von regelmäßiger Schönheit mit dunklen, sinnenden Augen und feinen, geistvollen Zügen, dabei aber, seiner Körperbildung entsprechend, so weich und weiblich und, obgleich er sechsundzwanzig Jahre alt war, so ohne jede Spur von Bartwuchs oder männlicher Entwicklung, seine wohllautende Stimme hatte einen so entschieden weiblichen Altton, daß er überall spöttischem Hohn oder mitleidigem Bedauern begegnete, und Diejenigen, welche gegen die Schärfe seines Geistes und seiner Dialektik nicht aufkommen konnten, rächten sich dafür durch beißende Bemerkungen über seine körperliche Unvollkommenheit.
Er hatte sich fast von allem Verkehr mit der Welt entmuthigt zurückgezogen, auch das Suchen nach gerichtlicher Praxis fast aufgegeben, da die meisten Parteien bei der Führung ihrer Prozesse zu den großen, kräftigen Männern mehr Vertrauen hatten, als zu dem kleinen, anscheinend noch so jugendlich unreifen Chevalier, und er füllte seine unfreiwillige Muße mit Ausarbeitungen über manche schwebenden Fragen des Rechts und der Politik aus, welche er als Broschüren erscheinen ließ, ohne auch auf diesem Wege besondere Beachtung zu erzielen, da seine Arbeiten zu ernst waren und ihnen jener Ton witzig-spottender Kritik der Regierung und des Hofes fehlte, welcher damals zur Mode gehörte und allein das Interesse des Publikums zu wecken und zu fesseln vermochte.
Der einzige Ort, an dem er verkehrte und wo er seit länger als einem Jahre fast alle seine Abende zubrachte, war das Haus des Grafen von Rochefort, eines alten, kränklichen, aber hochgebildeten und geistvollen Herrn, der mit dem Vater des Chevalier vor langen Jahren in freundlichen Beziehungen gestanden hatte und an der Unterhaltung des jungen, unterrichteten, klar und scharf denkenden Mannes großes Gefallen fand. Der Graf von Rochefort hatte sich in seinem späten Alter mit einem jungen, wunderschönen, aber ganz armen Fräulein verheirathet, welche ihm die Stellung und den Namen, die er ihr gegeben, durch kindliche Ergebenheit und treue Pflege vergalt, obgleich ihr lebenslustiger, frischer Sinn oft schmerzlich den Druck des einsamen Lebens an der Seite des kränklichen, hinfälligen Greises empfand. Der Chevalier brachte dem Grafen die Neuigkeiten des Tages, er las ihm die aufsehenerregenden Couplets, die politischen und philosophischen Broschüren vor; der lebhafte Geist der schönen Gräfin gab sich mit immer lebhafterem Vergnügen dieser einzigen Unterhaltung hin, welche ihr geboten wurde, und die Abende, welche der auf ein bewegtes Leben am Hof und in der Diplomatie zurückblickende alte Graf, die schöne, mit allen natürlichen Gaben des Geistes ausgestattete Frau und der fein empfindende, kenntnißreiche und fast gelehrte junge Mann mit einander zubrachten, wurden Jedem von ihnen zu einer immer neu sprudelnden Quelle wechselvollen Vergnügens. Zwischen dem Chevalier und der Gräfin bildete sich dabei ein Verhältniß zarten und reinen Minnedienstes aus, wie er in den vergangenen Zeiten altritterlich romantischer Galanterie vorgekommen, aber aus der damaligen Welt längst verschwunden war. Der feurige, von der übrigen Welt beinahe ganz abgeschlossene Chevalier konnte unmöglich täglich mit der so reizenden jungen Frau zusammensein, ihre dunklen, von innerer Glut leuchtenden Augen, während er vorlas oder sprach, auf sich gerichtet sehen, ohne daß sein ganzes, von zurückgedrängter Sehnsucht nach Ehre, Anerkennung und Lebensgenuß schwellendes Herz sich ihr hingab, und die einsame junge Frau, welche diese zarte Liebe wohl bemerkte, belohnte die innige Ergebenheit und die zugleich so ehrerbietige Zurückhaltung des jungen Mannes mit manchem Blick voll süßer Theilnahme und manchem kaum fühlbaren Händedruck, der aber, so flüchtig er auch immer sein mochte, stets den Chevalier mit Entzücken erfüllte. Diese so huldvoll aufgenommene Liebe zu der schönen Gräfin Rochefort war das einzige Glück, welches diese Zeit einsamen, stillen Lebens ihm bot, und sein hohes, glühendes Streben, das überall so niederschlagende Zurückweisung fand, konzentrirte sich mehr und mehr auf diese Liebe. Endlich war auch dieser kleine Lichtkreis verdunkelt, — der alte Graf Rochefort war fast plötzlich gestorben, — der Chevalier hatte in ernster Betrübniß über den Tod dieses wirklich teilnehmenden Freundes der jungen Wittwe beigestanden, die Beisetzung der Leiche ihres Gemahls zu besorgen, — eine stille Hoffnung erfüllte ihn, als er Diejenige frei sah, der er sein Herz hingegeben, aber er wagte in seinem feinen ritterlichen Gefühl dieser Hoffnung kaum durch Blicke in den ersten Tagen nach dem Todesfall Ausdruck zu geben, mehr als je aber erfüllte ihn die Sehnsucht, eine Stellung zu erringen, um die stillen Träume seiner verschwiegenen Hoffnungen endlich zur Wahrheit machen zu können. Die Gräfin hatte von ihrem Gemahl ein bedeutendes Vermögen geerbt, wenn auch die Hauptbesitzungen seiner Familie an entfernte Lehenserben fielen, — um so weniger mochte der stolze Sinn des Chevalier jetzt, da das äußere Hinderniß zwischen ihnen gefallen war, irgend eine Andeutung über seine Hoffnungen machen, bevor es ihm nicht gelungen war, für sich selbst eine unabhängige und sichere Stellung zu erringen. Er hatte sich nach dem Begräbniß des alten Grafen von der schönen Wittwe verabschiedet, da er es nicht ziemlich fand, seine Besuche vor Verlauf einiger Zeit fortzusetzen. Die Gräfin reichte ihm mit feuchten Blicken die Hand.
»Ich verstehe Ihre Entfernung, Chevalier,« sagte sie mit innigem Ton, der dem jungen Mann tief in die Seele drang, — »aber ich bitte Sie, mich nicht zu lange allein zu lassen, — ich werde sehr einsam sein,« fügte sie mit einem schweren Seufzer hinzu.
Fortgerissen von seinem Gefühl, sank der Chevalier vor der reizenden Frau in die Kniee nieder, drückte in glühendem Kusse seine Lippen auf ihre weiße Hand und rief:
»Wenn ich mein Herz hörte, Gräfin, so verließe ich Sie keinen Augenblick, — seien Sie gewiß, daß ich bald wiederkehre und daß mein heiligstes Streben sein wird, dann vor Ihnen so zu erscheinen, daß ich Alles sagen darf, was jetzt in meiner Brust verschlossen ruht.«
»Ich erwarte Sie,« hauchte die Gräfin.
Glühenden Herzens und glühenden Kopfes eilte der Chevalier davon, um sich mit tausend Plänen zu beschäftigen, wie er das schon fast im Mißmuth aufgegebene Ziel einer festen und angesehenen Stellung im Staatsdienst oder am Hof erreichen könne.
Einige Zeit verging in unruhvollen Arbeiten, in vergeblichen Besuchen und Absendung von Bittschriften, — da endlich schien das Glück, das so lange dem armen jungen Manne hartnäckig sein Gesicht verhüllt hatte, sich mit einem freundlichen Blick ihm zuzuwenden. Er erhielt ganz unerwartet an einem schönen Frühlingstag, etwa vier Wochen nach dem Tode des Grafen Rochefort, zu dessen Wittwe er, niedergedrückt und entmuthigt von der Erfolglosigkeit aller seiner Schritte, noch immer nicht wieder zurückzukehren gewagt hatte, den Befehl, sich nach dem Hotel Choiseuil zu begeben, wo der Minister ihn empfangen wolle, der allmächtig Frankreichs Geschicke lenkte und, wie er zuweilen that, von Versailles nach Paris gekommen war, um sich den Parisern zu zeigen, einige Audienzen zu ertheilen und seine Popularität ein wenig aufzufrischen. Denn der Herzog besaß diese von den Fürsten und Ministern oft so vergeblich gesuchte oder so ungeschickt verscherzte mächtige Waffe der Popularität, trotzdem er oft genug mit der öffentlichen Meinung, dieser damals zuerst sich aufrichtenden Gewalt, in Widerspruch trat und dieselbe ziemlich stolz und hochmüthig brüskirte. Er focht scharfe Kämpfe mit den Parlamenten aus und wurde dafür oft in beißenden Spottversen und scharfen Kritiken angegriffen, aber die anmaßenden und eitlen Herren von der Robe waren eigentlich durchaus nicht beliebt im Volk und fanden nur den Beifall, der jede Opposition gegen die Macht begleitet, der Herzog aber hatte mehrere und bedeutende Anrechte an die dauernde Gunst der pariser Bürgerschaft. Zunächst hatte er seine Gemahlin, die Tochter des reichen Bankiers Crozat, aus dieser Bürgerschaft gewählt und führte mit derselben eine überaus glückliche und musterhafte Ehe. Wenn ihm diese Heirath auch ein unermeßliches Vermögen eingebracht hatte, so fühlten sich die guten pariser Bürger doch stolz und geehrt, daß ein Mitglied des höchsten Adels und ein Günstling des Hofes in jener Zeit der Vorurtheile und Sittenlosigkeit mit einer Tochter der Bourgeoisie ein glückliches und vorwurfsfreies häusliches Leben führte. Der Herzog war ferner Grandseigneur im weitesten Sinne des Wortes, — er streute das Gold mit vollen Händen in fürstlicher Weise aus und endlich war er der erklärte Feind der Jesuiten, auf welche sich damals der heftigste Zorn der Pariser konzentrirte, weil schon in mehreren Fällen der Orden sich der Jurisdiktion der Parlamente und selbst der Bischöfe offen widersetzt hatte und nur dem Urtheil seines Generals sich unterwerfen wollte, und weil der Einfluß des dem Orden zugehörigen Beichtvaters des Königs bisher noch immer ein ernstes Vorgehen gegen die übermüthigen Patres, die sich über weltliches und kirchliches Gesetz stellten, verhindert hatte.
Von fieberhafter Aufregung zitternd, begab sich der Chevalier nach dem Hotel Choiseuil, in dessen weitem Hofe die Equipagen des Herzogs angespannt standen, während die Vorreiter ihre prachtvollen Blutpferde auf und ab führten. Der Chevalier ging klopfenden Herzens durch die Wolke von Lakaien, welche die Treppen und Vorplätze anfüllten und den bescheiden gekleideten jungen Mann mit der unscheinbaren Kindergestalt gar nicht beachteten oder mit einer fast mitleidigen Verwunderung anblickten, und fand endlich das Vorzimmer des Herzogs. Er nannte dem Huissier seinen Namen und wurde sogleich, einer Menge glänzender Kavaliere voraus, in das Kabinet des Ministers geführt.
Der Herzog von Choiseuil, damals in der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre stehend, war ein hoch, schlank und kräftig gewachsener Mann. Er trug einen Anzug von dunkelblauem Sammet, nur mit einer leichten, feinen Silberstickerei besetzt, darüber das blaue Band und den Stern des Ordens vom heiligen Geist mit der abwärts fliegenden Taube auf der Brust. Sein Gesicht hatte fast zu kräftige Züge, doch gaben ihm dieselben ein um so männlicheres Aussehen, seine großen Augen unter schön geschwungenen Brauen blickten stolz von oben herab und die auf die hochgewölbte Stirn herabfallenden weißen Locken der gepuderten Perrücke ließen das außerordentlich vornehme Gesicht noch jugendlicher erscheinen, als es vielleicht unter natürlich dunklem Haar der Fall gewesen wäre. Der Chevalier, welcher etwas schüchtern, aber mit edlem, freiem Anstand in das kleine, mit Deckengemälden und reichen Vergoldungen ausgeschmückte Gemach trat, verneigte sich tief vor dem Minister, den er noch nie in der Nähe gesehen hatte und dessen männliche und hocharistokratische Erscheinung ihm imponirte.
Der Herzog blickte den eintretenden jungen Mann mit seinen großen durchdringenden Augen an, denen man ansah, daß sie nur selten sich zu senken gewohnt waren. Er schien betroffen von dieser so schmächtigen, zarten Gestalt und diesem Kindergesicht, und während der Chevalier, ihn grüßend, tief das Haupt herabbeugte, spielte ein flüchtiges Lächeln gutmüthigen Spottes um seine Lippen, das jedoch die Selbstbeherrschung des feinen Weltmannes schon wieder hatte verschwinden lassen, als der junge Mann sein Haupt wieder erhob und den allmächtigen Minister erwartungsvoll ansah.
»Ich habe die letzten Broschüren gelesen, mein Herr,« sagte der Herzog mit seiner vollen, sonoren Stimme, »in denen Sie einige gerade jetzt zur Erörterung stehende Rechtsfragen und auch die Stellung Frankreichs in der europäischen Politik und den übrigen Mächten gegenüber behandeln, und ich mache Ihnen mein Kompliment über die Schärfe Ihres Urtheils und Ihre gediegenen Kenntnisse.«
Die Freude, welche der kleine Chevalier bei dieser ersten Anerkennung seiner Arbeiten aus dem Munde des gebietenden Staatsmannes empfand, ließ das Blut in seine Wangen steigen und verwirrte seine Gedanken, so daß er, der sonst seiner Rede so mächtig war und seine Worte so wohl zu setzen verstand, sich nur hoch erröthend verneigte und stammelte: »Der Herr Herzog ist zu gütig —«
»Außer jener Schärfe des Urtheils und jenen umfassenden Kenntnissen,« fuhr der Herzog fort, »welche ich auch bei einem Gegner achten würde, bin ich aber bei dem Durchblättern Ihrer Broschüren durch die große Uebereinstimmung betroffen worden, welche zwischen Ihren Ideen und den meinigen stattfindet, — Sie plaidiren für ein festes Bündniß mit Oesterreich und auch ich halte dasselbe für das sicherste Mittel, den Einfluß Frankreichs in Europa zu erhalten — leider müßte ich eigentlich sagen: wieder zu gewinnen.«
»Ja, Herr Herzog,« rief der Chevalier ganz glücklich, »ich bin durchdrungen von der Nothwendigkeit dieses Bündnisses, das so vielfach angefeindet wird, — denn —«
»Ich kenne Ihre Ansichten aus Ihren Broschüren,« fiel der Herzog ein, indem er den Chevalier mit der Rücksichtslosigkeit des an das Herrschen und Befehlen gewöhnten großen Herrn unterbrach, zugleich aber das Verletzende dieser Unterbrechung durch seinen verbindlichen Ton und seine artige Handbewegung abschwächte, — »und ich wünsche, da Sie meine Ueberzeugungen theilen und dieselben so vortrefflich zu begründen verstehen, Ihre Kraft und Ihr Talent für den Dienst der Regierung zu nützen. Ich werde Sie Seiner Majestät vorstellen und Ihnen eine Ihren Fähigkeiten entsprechende Anstellung geben. In einigen Tagen werden Sie Nachricht von mir erhalten, dann kommen Sie nach Versailles und melden Sie sich zuvor bei der Frau Marquise von Pompadour, der ich von Ihnen gesprochen und die ebenfalls die Karriere eines so hoffnungsvollen jungen Mannes unterstützen wird.«
Der Herzog neigte leicht den Kopf, zum Zeichen, daß für den Augenblick die Audienz beendet sei; schwindelnd, keines Wortes mächtig, verbeugte sich der Chevalier und schritt leuchtenden Blickes und stolz erhobenen Hauptes durch die Lakaien auf den Vestibüles, welche jetzt den jungen Mann, der aus den innern Gemächern kam und vom Herzog empfangen war, ehrerbietig grüßten.
Mit pochenden Schläfen, betäubt von so viel lichtem Glück nach so langer, trüber Zeit, ging er auf der Straße weiter, und bald nachher fuhr der Herzog, der nach Versailles zurückkehrte, in offener Kalesche an ihm vorüber und erwiederte seinen ehrfurchtsvollen Gruß durch einen freundlich vertraulichen Handwink, so daß die den Cortège des Ministers anstaunenden Vorübergehenden ganz scheu und verwundert diesen knabenhaften jungen Menschen in der schwarzen Tracht der Advokaten ansahen, den der stolze Choiseuil durch einen so freundschaftlich herablassenden Gruß auszeichnete.
Als der Chevalier sich von dem ersten Taumel der Freude erholt hatte, eilte er zur Gräfin Rochefort, — jetzt, da der Schutz des ersten Ministers ihm eine glänzende Zukunft eröffnete, durfte er vor ihr erscheinen, er durfte sie einen Blick in sein Herz thun lassen und er sann auf seinem Wege über die Worte nach, durch welche er am zartesten ihr seine sehnsüchtigen Hoffnungen aussprechen wollte.
Aber zu seinem Schrecken sagte ihm der Concierge des Hotels, daß die Gräfin schon seit zwei Wochen nicht mehr in Paris sei, — sie habe einen Brief aus Versailles erhalten, dann habe sie ihre Juwelen und ihre Garderobe einpacken lassen und sei nach Versailles gefahren, und ihre zurückkehrende Dienerschaft habe den Befehl gebracht, die Zimmer zu schließen, da die Gräfin vorläufig am Hofe bleiben werde.
Traurig und niedergeschlagen vernahm der Chevalier diese Nachricht. — Bald aber richtete er sich freudig wieder auf, — er sollte ja auch an den Hof, dieß glänzende Ziel der Wünsche aller Edelleute, die eine Carrière, Ansehen und Vermögen suchten, — dort würde er sie sehen, — sie würde ihn erblicken auf der ersten der Stufen, welche zu den Höhen des Glücks führten, und die Träume seiner Liebe würden zugleich mit denjenigen seines Ehrgeizes Erfüllung finden.
Noch eine Woche hatte er zu warten, — er durchforschte eifrig noch einmal alle politischen Fragen, die er in seinen Broschüren behandelt hatte, und wollte ungeduldig schon verzagen in der auftauchenden Furcht, daß der Herzog ihn vergessen haben könne, als er endlich ein Billet von dem Sekretär des Ministers erhielt, welches ihm befahl, am nächsten Tage sich in Versailles bei der Frau Marquise von Pompadour und dann bei dem Herzog zu melden, der ihn dem Könige bei dem Empfange vor der Messe vorstellen wolle.
Schon am frühen Morgen des entscheidenden Tages stand der bestellte Miethwagen mit einem Lohnlakai vor dem alten Hause in der Rue des Saints Pères und der Chevalier legte die letzte Hand an seine Toilette unter dem Beistand seiner alten Aufwärterin, welche ganz stolz dem ganzen Hause verkündet hatte, daß der junge Mann, dessen sorgenvolle Miene sie oft mit theilnehmendem Kummer erfüllt hatte, nach Versailles an den Hof fahre.
Der Chevalier sah reizend aus in dem zierlich eleganten Anzug von schwarzer Seide mit den duftig gepuderten Locken und dem kleinen, an der schlanken Hüfte sich wiegenden Degen, — aber als er vor den Spiegel trat und einen letzten prüfenden Blick in denselben warf, — als er diese kleine so ganz mädchenhafte Gestalt, dieses weiche Kindergesicht sah, da seufzte er tief auf, — er fürchtete, auch dort auf der neuen Bahn, die er betrat, unter den glänzenden Kavalieren des Hofes dem mitleidigen oder boshaften Spott zu begegnen, der ihm bisher sein Leben und Streben verbittert hatte.
Doch es war nicht Zeit, darüber nachzudenken, muthig mußte er vorwärts in die neue Welt, die sich vor ihm öffnete, — noch einmal drückte er der alten Aufwärterin, die ihn mit bewundernder Zufriedenheit betrachtete, die Hand und eilte dann schnell die Treppe hinab, um, angestaunt von den neugierig gaffenden Ladendienern, in den Wagen zu steigen und in seiner einfachen Equipage den verhängnißvollen Weg nach Versailles einzuschlagen, wo sich neben den lichten Höhen des Ruhmes und der Größe auch die schauerlichen, finsteren Abgründe der Bastille öffneten, wie im alten Rom neben dem Kapitol die Abhänge des tarpejischen Felsens sich mahnend dem kühnen Ehrgeiz zeigten.
Zweites Kapitel.
Während der kleine Chevalier in wechselndem Hoffen und Bangen sich für die über seine ganze Zukunft entscheidende Stunde vorbereitete, gingen in jener eigentümlichen Welt von Versailles, deren auf der Oberfläche so helles und lächelndes Bild so viel gährende Leidenschaften und so viel Haß und Neid bedeckte, die zahllosen großen und kleinen Intriguen dieser, aus so großen Namen und meist so kleinen Persönlichkeiten zusammengesetzten Gesellschaft ihren Lauf. Vor Allem waren es zwei große Parteien, welche sich im heftigen Kampf einander gegenüberstanden: die Partei des Herzogs von Choiseuil und der Marquise von Pompadour, zu welcher alle Diejenigen gehörten, welche Wünsche hegten, die von der Macht der Regierung befriedigt werden konnten, alle jungen und lebenslustigen Kavaliere und alle jungen und schönen Damen, — und sodann die Partei der Jesuiten, der sogenannten Frommen, welche in dem Dauphin ihre Stütze fanden, zu welcher alle Diejenigen gehörten, denen die Regierung die Erfüllung ihrer Wünsche versagt hatte, und welcher sich vorzugsweise alle alten frommen Damen anschlossen, denen die Versuchung zu reizenden Verirrungen vom strengen Tugendpfade nicht mehr nahe trat. Diese Partei, zu welcher der Pater Linière vom Orden der Gesellschaft Jesu, der Beichtvater des Königs, als hervorragendes Mitglied zählte, ließ überall laut ihre frommen Verwünschungen gegen die Marquise von Pompadour erschallen und that alles Mögliche, um dem Könige Furcht vor dem Urtheil der Menschen und vor den Strafen des Himmels einzuflößen. Es gelang dieser Partei zwar niemals, die Stellung der klugen, stets aufmerksamen und durch die öffentliche und ihre Privatpolizei gut bedienten Marquise zu erschüttern, ebensowenig wie diejenige des Herzogs von Choiseuil, andererseits waren diese beiden Verbündeten aber auch nicht im Stande, den Einfluß des Paters Linière auf die leicht zu abergläubischer Furcht erregbare Natur des Königs zu brechen, und so trat oft in den öffentlichen Angelegenheiten, in welchen die Interessen der beiden Parteien sich gegenüberstanden, ein Stillstand ein, da keine der andern weichen wollte und keine die andere überwinden konnte, worüber dann die öffentliche Meinung in Broschüren und Quatrains bitter spottete, während der König sich in tiefes Schweigen hüllte, diese große Waffe, mit welcher er Alles, was ihn zu einer unangenehmen und peinlichen Entschließung drängte, von sich abzuhalten pflegte. So war auch jetzt wieder der Kampf sehr lebhaft; der Herzog von Choiseuil wollte ein erneutes festes Bündniß mit Oesterreich abschließen, — die Marquise, welche anfänglich schwankend gewesen, war durch die sarkastischen Bemerkungen Friedrich's des Großen und durch einen Brief, in welchem die stolze Maria Theresia sie »meine Cousine« nannte, mit Entschiedenheit den politischen Ueberzeugungen des Ministers beigetreten, aber der König schwieg und war zu keinem Entschluß zu bewegen. Obgleich die fromme Partei und insbesondere die Patres vom Orden der Gesellschaft Jesu stets die guten Freunde des wiener Hofes waren, so konnte dieß Zögern des Königs doch nur in dem Einfluß des Pater Linière seinen Grund haben, und die Marquise sowohl als Choiseuil gaben sich vergebliche Mühe, diesen Einfluß zu überwinden, für dessen Anwendung gegen die Wünsche des wiener Kabinets sie keinen andern Grund auffinden konnten, als den Wunsch, die Stellung des Ministers durch das Scheitern eines von ihm offen aufgestellten Planes, das ihn vor den europäischen Mächten kompromittiren mußte, zu untergraben.
Die Verhältnisse am Hofe waren daher in dem Augenblick, in welchem der Chevalier dort erscheinen sollte, sehr gespannt, die Anhänger der Marquise und des Herzogs begannen unruhig zu werden, und der alte Habitué des Hofes, der Herzog von Richelieu, der klassische Repräsentant jener Zeit der Frivolität und der Intrigue, welche noch von einer leichten Vergoldung chevaleresker Form überzogen war, dieser merkwürdige Mann, über den das Alter keine Macht zu haben schien, der zugleich Kammerherr und Marschall, zugleich bis zur Tollkühnheit tapferer Soldat und bis zur Selbsterniedrigung geschmeidiger Höfling war, — selbst er, der sonst mit jeder Partei kokettirte, um mit jeder die Früchte des Sieges theilen zu können, — begann seit Kurzem, sich ziemlich geflissentlich von der Marquise fernzuhalten.
Zu dem Kreise der bittersten Feindinnen der Marquise und demgemäß des Herzogs von Choiseuil und der Regierung gehörte die Herzogin von Guéménée, jene alte Tante, bei welcher die Cousine des Chevalier d'Éon, das Fräulein Louise von Beaumont, Aufnahme gefunden. Die Herzogin, von welcher alte Kenner des Hofes und seiner Geschichten behaupten wollten, daß sie in ihrer freilich lange verblichenen Jugend ebenso galant als schön gewesen sei, war jetzt ein Muster strenger Frömmigkeit, die Freundin des Paters Linière und die regelmäßige Besucherin aller Messen und aller Andachtsübungen, in welchen sie so viele Verwünschungen auf das Haupt der verhaßten Marquise, mit ihren Gebeten untermischt, dem Himmel übergab, daß wenn nur die Hälfte derselben Erhörung gefunden, die Marquise längst von feurigem Schwefelregen hätte vernichtet sein müssen.
Die Herzogin hatte sich fast ganz vom Hofe zurückgezogen, obgleich sie sich nicht hatte entschließen können, Versailles, diesen Mittelpunkt aller Interessen und aller Intriguen, zu verlassen; ihr großes Hotel, früher der Sammelplatz einer ausgelassen fröhlichen Gesellschaft, lag jetzt still da und seine Thüren öffneten sich nur den frommen Patres, alten Damen, welche die Gesinnung und den Groll der Herzogin theilten, und alt gewordenen Abbés, welche die boshafte Medisance, die dort den Gegenstand der Konversation bildete, mit einigen welken Blüten abgestandener Galanterie ausschmückten.
Das junge Fräulein von Beaumont war recht unglücklich in diesem großen glänzenden Hotel und in dieser einförmigen Gesellschaft, deren Unterhaltungen so wenig Reiz für ein siebenzehnjähriges Mädchen boten. Sie hatte ihre Jugend verlebt in dem kleinen und bescheidenen, aber reizend gelegenen Schlößchen an den sonnigen Ufern der Garonne, in Freiheit und kindlicher Lust, — auch ihr Vater war fromm gewesen und hatte sie früh schon mit noch stammelnden Lippen ihr Gebet sprechen gelehrt, wenn die Abendglocken herübertönten von der Kapelle auf dem nahen Hügel, — aber wie anders waren jene Gebete gewesen, als diejenigen, die sie hier bei ihrer Tante hörte, — hier schnürte sich ihre Brust eng und angstvoll zusammen und die Worte des Gebets, die ihre Lippen sprechen sollten, fielen matt zur Erde.
Fräulein Louise von Beaumont war eine schlanke, zierliche Gestalt, mit weichen, anmuthigen Bewegungen, ihr feines Gesicht erinnerte an eine Miniaturmalerei auf Elfenbein, während die großen Augen, welche unter den langen seidenen Wimpern hervorblickten, den schwärmerischen Ausblick italienischer Madonnenköpfe mit einem leichten Anflug jener hervorlauschenden Schalkhaftigkeit vereinigten, welche aus so vielen taubensanften Frauenaugen blickt und den englischen Dichter zu dem Wort veranlaßte: ›Every woman has a rake at heart‹, und ihre wunderbar schönen und reichen dunkelbraunen Haare waren, als fürchte sie die Schönheit dieses herrlichen Schmuckes zu verhüllen, nur leicht mit Puder überstäubt.
Dieß so schöne und lieblich anmuthige Mädchen saß an dem Morgen, an welchem der Chevalier seine Fahrt nach Versailles unternahm, allein in dem Salon der Herzogin von Guéménée mit einer Tapisseriearbeit beschäftigt, die sie von Zeit zu Zeit träumend in ihren Schooß sinken ließ, während ihre Lippen sich in leisem Selbstgespräch bewegten und ihre Augen bald in kindlichem Trotz, bald in schwermüthigem Sinnen sich nach den an den Deckensimsen angebrachten, von Rosenguirlanden umschlungenen Liebesgöttern emporrichteten.
Da erhob sich die seidene Portiere vor der Thür, welche in die großen Empfangszimmer führte, und ein junger Mann blickte vorsichtig spähend in das Zimmer hinein. Dieser junge Mann, der, von dem schweren faltigen Vorhang, den er mit der einen Hand leicht und graziös emporhielt, umrahmt, wie ein reizendes Genrebild dastand, mochte höchstens einundzwanzig bis zweiundzwanzig Jahre zählen. Er trug die elegante und kleidsame Uniform des Elitekorps der grauen Musketiere des Königs, den Degen mit dem goldenen Gefäß an der Seite, die weißen, tadellos anschließenden Stulphandschuhe an den feinen, schlanken Händen, den Hut mit der weißen Feder unter dem Arm. Sein Gesicht mit dem schwarzen Flaum aus der keck aufgeworfenen Oberlippe vereinigte in seinen weichen Zügen und in seinen glänzenden Augen die Schüchternheit des Knaben mit dem Muthwillen des Pagen und der Kühnheit des Soldaten, seine ganze Erscheinung war übergossen von dem Reiz der Jugend und dem eigentümlichen Zauber einer vornehmen Rasse, welche durch Erziehung und Leben auf den Höhen der Gesellschaft zu voller Entwickelung gebracht ist.
Der junge Mann, welcher so spähend in das Zimmer blickte und in glücklicher Freude aufjauchzen zu wollen schien, als er die schöne Louise erblickte, war der Chevalier Gaston von Aurigny, Fähndrich bei den grauen Musketieren, diesem vornehmen Korps der maison militairs des Königs, welche damals noch bestand und welche später, trotz des Rathes Friedrich's des Großen, Ludwig XVI. auflöste, um sich den Linientruppen und Nationalgarden anzuvertrauen, die ihn an die Revolution überlieferten. Gaston war ein armer jüngerer Sohn einer alten und berühmten Familie aus der Heimat des Fräuleins von Beaumont, mit der er als Kind gespielt hatte. Sein Haus stand mit demjenigen der Herzogin von Guéménée in traditionellen Beziehungen und auf Grund derselben war er von der alten Dame in ihre kleinen Zirkel gezogen worden. Der lebenslustige junge Offizier wäre wohl kaum oft in diesen für ihn so fremdartigen und seiner Natur so wenig sympathischen Kreis gekommen, wenn er nicht seine Jugendfreundin hier wiedergefunden, und wenn nicht sehr bald das schöne Fräulein von Beaumont für ihn einen unwiderstehlichen Anziehungspunkt gebildet hätte. Er wußte sich geschickt und geschmeidig bei der Herzogin zu insinuiren, welche sein häufiges Erscheinen in ihrem Hause für ein anerkennenswerthes Zeichen frommer und würdiger Gesinnung aufnahm, die sie dem schönen, von allen Verführungen des Hofes umgebenen Offizier um so höher anrechnete, und so fanden die jungen Leute vielfache, von Gaston eifrig gesuchte und von Louise nicht vermiedene Gelegenheiten sich zu sehen und unbelauscht zu sprechen und sich dabei über die Gefühle ihrer Herzen, die einander entgegenflogen, zu verständigen.
Nachdem also der vorsichtig in das Zimmer hineinblickende Musketier sich überzeugt hatte, daß das junge Mädchen allein sei, trat er, rasch die Portière hinter sich zurückfallen lassend, einige Schritte vor und rief:
»Louise — meine theure Louise — Sie sind allein, — o welches Glück!«
Louise war bei dem Geräusch seines sporenklirrenden Schrittes und bei dem Ton seiner Stimme aufgesprungen und streckte ihm mit einem reizenden Lächeln beide Hände entgegen.
»Gaston,« sagte sie verwirrt und überrascht, — »Sie hier? — jetzt?«
»Ich habe keinen Dienst,« erwiederte der junge Mann, indem er die Spitzen ihrer schlanken Finger küßte, »und bin gekommen, um Sie wenigstens flüchtig zu sehen, — mein glücklicher Stern läßt mich Sie allein finden und schenkt uns einen süßen Augenblick, um zu plaudern, — wozu wir so selten leider Gelegenheit finden.«
»Die Herzogin wird nicht lange mehr fortbleiben,« sagte Louise, indem sie erröthend ihre Hände zurückzog, welche er nicht wieder von seinen Lippen lassen zu wollen schien, — »die Zeit der Messe ist fast vorbei — und wenn sie Sie hier findet, so könnte sie böse werden; — ich bin zur Strafe zu Hause gelassen, weil ich heute in der ersten Frühmesse nicht andächtig genug war, — weil ich zu oft nach einem gewissen Pfeiler hinsah, neben welchem ein gewisser junger Musketier kniete —«
Sie schlug nach einem schnellen, schalkhaften Blick stockend die Augen nieder.
»O,« rief Gaston entzückt, — »dann bin ich ja mitschuldig an Ihrem Vergehen und muß auch Ihre Strafe theilen, — die Einsamkeit ist zu Zweien weit weniger langweilig, als wenn man sie allein ertragen muß.«
Er führte sie zu ihrem Sessel zurück, zog ein Tabouret heran und setzte sich zu ihren Füßen.
»Ich werde suchen,« sagte er, ihre nur leicht widerstrebende Hand wieder an seine Lippen führend, »Sie recht oft schuldig zu machen, um recht oft diese Strafe mit Ihnen theilen zu können.«
»Sie scherzen, Gaston,« sagte Louise, »und ich bin doch so traurig, — wenn meine Tante je bemerkte, daß wir uns lieben, sie würde Ihre Besuche nicht mehr empfangen! Sie ist Ihnen jetzt freundlich gewogen, weil Sie ihr empfohlen sind, weil Sie ihr kleine Anekdoten erzählen, und weil sie Sie zur wahren Frömmigkeit nach ihrem Muster zu bekehren hofft, — aber wenn sie etwas merkte, — sie, die es für ein Verbrechen erklärt, wenn ich einen jungen Herrn nur ansehe, — und dann —« fügte sie zögernd hinzu.
»Und dann? — — was und dann?« fragte Gaston, ihre Hand liebkosend.
»Ach,« sagte Louise stockend und scheu im Zimmer umherblickend, — »ich habe immer nicht begriffen, warum die Tante so durchaus darauf besteht, mich in ein Kloster zu schicken, — ich habe geglaubt, sie strebte nur nach dem Verdienst, dem Himmel eine Seele zu retten, — aber —«
»Nun? — aber —?« fragte Gaston, aufmerksam und gespannt in das Gesicht des schönen Mädchens blickend.