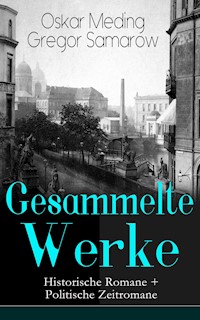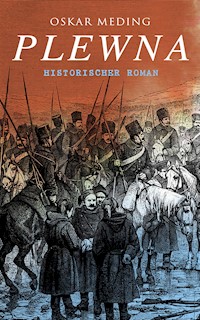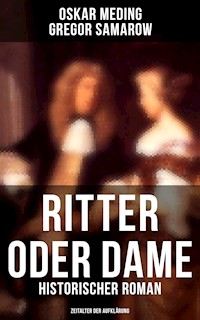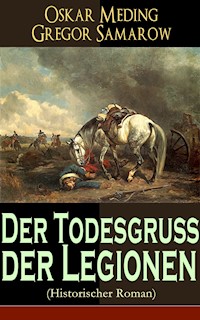Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Oskar Medings 'Kreuz und Schwert' ist ein faszinierendes historisches Werk, das die Geschichte des Kreuzzugs von 1096 aus einem neuen Blickwinkel betrachtet. Medings literarischer Stil ist geprägt von detaillierten Beschreibungen, die dem Leser eine lebendige Vorstellung von den Ereignissen dieser Zeit vermitteln. Das Buch hebt sich von anderen historischen Werken durch seine tiefgründige Analyse der politischen und religiösen Motivationen der Kreuzfahrer ab, was es zu einem wichtigen Beitrag zur historischen Forschung macht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1031
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kreuz und Schwert
Inhaltsverzeichnis
Erstes Kapitel
Die sinkende Sonne eines Spätsommertages des Jahres 1869 sendete ihre schrägen Strahlen über die einfache und gleichmäßige, aber üppig frische Landschaft, welche in der Nähe von Düsseldorf den breit und ruhig dahinfließenden Rheinstrom einfaßt. Dieser stolze deutsche Strom, in dessen Wellen die Sage rauscht, der bis in die Tiefen seiner grünen Fluten hinein belebt ist von den sinnigen Mären vergangener Heldenzeiten, der die Lebensader bildet der waffen- und sangesfreudigen Geschichte Deutschlands, – der gleicht hier im flachen Lande nicht mehr jenem wunderbaren, die Seele mit geheimnisvoller Poesie anmutenden Bilde, das er weiter hinauf bietet, wo er sich Bahn bricht durch starre Felsen – an den verfallenen Burgen vorbei, – das Rauschen seiner Wasser vermischend mit den sinnbetörenden Liedern der Loreley und dem mitternächtigen Schmerzensseufzer des grausamen Bischofs Hatto. Dort oben ist er der Jüngling voll Kampfesmut, voll tiefer Liebesglut, wie der goldene Wein, den die Sonne an seinen Ufern reift – hier ist er zum klaren, ruhigen Mann geworden, der in gesättigter Kraft nach überwundenen Lebenskämpfen den Segen einer fruchtbaren Tätigkeit um sich verbreitet.
Nicht Felsen und Burgen rahmen ihn hier ein – breite, grüne Wiesen und reiche Fruchtfelder dehnen sich weithin an seinen Ufern aus, hohe Gruppen uralter Riesenbäume ragen in einiger Entfernung daraus hervor, und zwischen den Schatten ihrer Wipfel schimmern die Dächer der großen Schlösser und der dazu gehörigen Wirtschaftsgebäude, der reichen Besitztümer des landsässigen Adels, der hier seit Jahrhunderten auf seinen Erbsitzen lebt und noch immer mehr oder weniger von dem Unabhängigkeits- und Selbständigkeitsgefühl der alten Reichsritterschaft erfüllt ist. In der Nähe der Ufer ziehen sich die mächtigen Deiche hin, welche, bis nach Holland herab, den Lauf des gewaltigen Stromes regeln und die von ihm befruchteten Felder vor der vernichtenden Gewalt seiner übermächtig anschwellenden Hochwasser schützen.
Auf dem Wege, welcher neben den Deichen her durch die Wiesen und Fruchtfelder führte, ritten zwei junge Offiziere in der grünen Husarenuniform. Beide mochten höchstens zwanzig bis einundzwanzig Jahre alt sein – trotz dieses gleichen Alters und der gleichen Uniform aber war ihre ganze Erscheinung von auffallender Verschiedenheit.
Der eine saß bequem auf seinem schönen Grauschimmel, seine Gestalt zeigte trotz seiner Jugend eine gewisse Anlage zu Fülle und Korpulenz, sein frisches Gesicht strahlte von einer sorglosen Heiterkeit, sein Mund mit den vollen, roten Lippen schien wie von innerer fröhlicher Laune bewegt zu lächeln, und die großen hellblauen Augen blickten so glücklich und vergnügt über die Wiesen, die Felder und die Bäume hin, als schienen sie zu fragen, ob es wohl etwas Schöneres und Besseres geben könnte, als diese reiche, blühende Landschaft am Ufer des königlichen Stromes. Seine grüne Mütze mit dem roten, weiß eingefaßten Streif saß etwas gebogen auf seinem Kopf und ließ das blonde, gelockte Haar hervordringen, das so lang gehalten war, als es die dienstliche Vorschrift nur irgend erlaubte.
Dieser junge Offizier, von dessen Antlitz das Morgenlicht eines sorgenfreien, glücklichen Lebens widerstrahlte, war Graf Xaver von Spangendorf, der Sohn und Majoratserbe eines der reichsten und vornehmsten Grundbesitzer der Gegend. Seine Familie saß seit unvordenklichen Zeiten auf dem von waldähnlichem Parke umgebenen Schlosse Rensenheim, dessen weitausgedehnte Nebengebäude bereits hinter einer bis hart an den Weg vorspringenden Schonung sichtbar wurden, während das Herrenhaus selbst noch hinter den hochragenden Baumwipfeln des Parkes sich verbarg.
Neben ihm ritt sein Freund und Regimentskamerad, der Leutnant von Rothenstein, der Abkömmling einer alten schlesischen Familie, der mit dem jungen Spangendorf fast gleichzeitig in das sonst beinahe ausschließlich aus den Söhnen des rheinischen Grundadels gebildete Offizierkorps des Regiments eingetreten war.
Obgleich die Züge seines länglichen, bleichen Gesichts noch die ganze Weichheit der Jugend besaßen, lag doch in demselben ein gewisser Ausdruck von sinnender, wehmütiger Trauer, gemischt mit einer fast starren und verschlossenen, eigenmütigen Willenskraft, – der feine, scharf gezeichnete Mund mit dem eben hervorkeimenden schwarzen Bart auf der Oberlippe schien sich nur selten zu heiterem Lächeln öffnen zu können; aus den tief dunklen Augen blickte es hervor wie verborgenes Feuer, wie geheimnisvoll zurückgezogenes inneres Leben, und die feinen Flügel der schlanken griechischen Nase öffneten sich zuweilen weit, als suche eine innere Glut in scharfem Atemzuge einen Ausgang.
Der Leutnant von Rothenstein saß in eleganter, fester und sicherer Haltung auf seinem schwarzen Pferde, seine Uniform schloß sich eng um die schlanke und magere Gestalt, ernst blickte er über den Kopf seines Pferdes auf die Straße hin, die sich immer mehr vom Rheinstrom ab zu den Hofgebäuden von Rensenheim hinwendete.
»Es ist wahrhaftig ein guter Gedanke gewesen,« rief der junge Graf Spangendorf, indem er seine kleine zierliche Reitpeitsche mit dem großen silbernen Knopf durch die Luft pfeifen ließ, was sein Pferd zu einem kurzen, unruhigen Satze veranlaßte, – »ein guter Gedanke, aus der heißen, staubigen Stadt herauszureiten nach dem schönen, kühlen Rensenheim – vor morgen Mittag haben wir nicht nötig zurück zu sein, wir können uns herrlich ausruhen und stärken in dem schattigen Park und in den dunkeln kühlen Zimmern – um dann wieder«, fügte er tief aufseufzend hinzu, »auf dem sonnenglühenden Exerzierplatz diese Tölpel von Rekruten das Reiten zu lehren.«
»Ja«, sagte der Leutnant von Rothenstein, – »es ist eine wohltätige Erholung – und für dich ist es ein ganz besonderes Glück, daß deine Heimat so nahe bei der Garnison liegt und dir Gelegenheit gibt, auch den kleinsten Urlaub so schön zu benützen – ich muß dir noch ganz besonders dankbar sein, daß du mich so freundlich in deine Familie eingeführt –«
»Du weißt,« rief der Graf Spangendorf, ungeduldig mit der Hand winkend, »welche Freude du mir und allen den Meinigen machst, wenn du zu uns hinauskommst – also laß uns keine Höflichkeitsredensarten machen –«
Er brach einen Augenblick ab und sah mit leuchtenden Blicken nach den hohen Bäumen des Parkes hinüber, zwischen denen jetzt ein breites, lang ausgedehntes Schieferdach und zwei nicht hohe, ebenfalls mit Schiefer gedeckte Kuppeltürme erschienen.
»Siehst du, alter Freund,« sagte er dann, mit seiner Reitpeitsche nach dem im Sonnenschein glänzenden Dach hindeutend, – »siehst du – wenn ich so mein altes väterliches Haus und die alten Bäume und das alles wiedersehe, was mich so von Jugend auf umgeben hat, dann wird es mir jedesmal leicht und frei, so wohl ums Herz, als ob ich ein liebes Menschengesicht erblicke, – es ist, als ob diese Erde mich anziehe, als ob ich auf ihr fester stände und sanfter ruhte als anderswo, – als ob die Luft hier sich leichter und freier atmete, als ob diese Sonne heller schiene! – Das ist recht kindisch,« – sagte er dann lächelnd, fast verlegen, »du wirst das töricht finden, du, der du schon ein großes Stück von der Welt gesehen hast, – und es ist auch beinahe lächerlich, dies Hangen an der Scholle – dies Heimweh, – da ich doch eigentlich noch nie von der Heimat wirklich entfernt war, – selbst als ich ein Jahr in Bonn studierte, war ich in jeden Ferien zu Hause – und jetzt bin ich ja wieder so nahe bei den Meinigen –«
»Ich finde dein Gefühl wahrlich nicht töricht,« fiel Herr von Rothenstein ein, indem er seine Blicke mit träumerischem Ausdruck auf dem immer mehr hervortretenden Schieferdach ruhen ließ, »ich kann dasselbe vollständig würdigen, – empfinde ich doch selbst Ähnliches, nur,« – sagte er seufzend, – »was bei dir Freude und Glück über den Besitz einer Heimat ist, in welcher dein Leben wurzelt, das ist bei mir tiefe, schmerzliche, ungestillte Sehnsucht.«
Mit einem Blick voll herzlicher Teilnahme sah der Graf Spangendorf seinen Freund an.
»Du hast doch«, sagte er ein wenig zögernd, »deine Heimat in Schlesien – du hast dort ein altes Familiengut, – es muß schön sein, nach dem, was du mir davon erzählt hast, – ein Schloß – Forsten mit großer Jagd, – die uns hier fehlt –«
»O ja, – ich habe das alles,« erwiderte Herr von Rothenstein, – »und es ist schön – es ist ein reicher Besitz und vortrefflich verwaltet von meinem Vormund, der mir jetzt schon vor meiner Großjährigkeit den Ertrag meines Vermögens zur freien Disposition überläßt, – aber«, rief er mit halb schmerzvoll wehmütigem, halb bitterem Ton, – »ist das eine Heimat – eine Heimat, wie du sie hast, wie sie dich grüßt mit tausend lieben Erinnerungen! – Meine Eltern starben«, fuhr er finster fort, »als ich noch keine zwei Jahre alt war, ehe noch mein Blick die Kraft hatte, ihr Bild in meine Seele zu tragen und dort zu bewahren zu heiliger Erinnerung, – mein Vormund, ein alter, unverheirateter Vetter meines Vaters, – ein braver, ein ehrenwerter Mann, dem ich stets Dank schulde, sorgte auf das Vortrefflichste für meine Erziehung, – ich wurde einem Professor in Pension gegeben, ich lebte in dessen Familie, man war freundlich gegen mich, man erzog mich mit Sorgfalt, – fast verzog man mich, – aber ich war der Fremde unter diesen Menschen, die sich einander angehörten durch die Bande der Familie, – eine Mauer von Eis umgab mich, durch die ich mich nicht herausarbeiten konnte, – ich war allein, immer allein! Und wenn ich dann zuweilen auf mein väterliches Gut kam mit meinem Vormund, – dann begrüßten mich die Beamten und Eingesessenen mit Ehrerbietung als ihren künftigen Herrn, – aber es fehlte das lebendige Liebesband, das mich mit der Heimat verknüpfte. Diese Gärten, diese Wälder, diese Wiesen waren mir fremd, – keine Erinnerung an kindliche Spiele, an Verwandte und Freunde trat mir entgegen. Die Zimmer des alten Schlosses waren erfüllt von dumpfem, schwülem Modergeruch, der die leicht empfänglichen kindlichen Sinne schaurig berührte, – waren sie doch eben erst kurz vor unserer Ankunft geöffnet, – man zeigte mir zwei große Bilder in breiten Goldrahmen, von denen man die verhüllende Florbedeckung abgenommen, und sagte mir, daß das mein Vater und meine Mutter sei; – ich sah eine schöne, sanftblickende Dame im weißen Seidengewand mit dunkeln Augen, – einen kräftigen hohen Mann in der ritterschaftlichen Uniform, aber ich suchte vergebens für diese Bilder einen Platz in meiner Erinnerung, – diese Augen, die da so vornehm ruhig aus den schimmernden Rahmen auf mich herabsahen, hatten niemals im Leben den warmen Strahl der Liebe auf mich gesendet, – trauriger als je kehrte ich zurück in die Familie meines Erziehers mit dem bitteren Gefühl im Herzen, daß das Haus meiner Vorfahren mir fremd sei, wie die Bilder meiner Eltern! – Darum habe ich auch meine heimatliche Provinz verlassen und bin in unser Regiment eingetreten, um all jenen schmerzlichen Eindrücken zu entfliehen.«
Die Pferde gingen im langsamen Schritt vorwärts, – das sonst verschlossen zurückhaltende Gesicht des jungen Offiziers zuckte und zitterte in lebhafter Bewegung, – es war, als ob ein tief im Innern verborgenes leidenschaftliches Gefühl in plötzlicher Aufwallung einen Ausdruck gefunden.
Die so gutmütigen heiteren Augen des jungen Grafen von Spangendorf ruhten halb erstaunt, halb voll tiefen Mitleids auf seinem Freunde, – er öffnete einige Male den Mund, als wolle er sprechen, ein Wort der Teilnahme und des Trostes sagen, – aber er fand nicht das Wort, das seine Teilnahme so ausgedrückt hätte, wie er sie fühlte, – und schweigend blickte er vor sich nieder, während der Leutnant von Rothenstein mit mächtiger Anstrengung die Lippen aufeinander preßte, um seiner tiefen Erregung Herr zu werden.
»Du siehst also,« sagte er tief aufatmend, indem er sich fester im Sattel aufrichtete und einen Tränentropfen zerdrückte, der zwischen seinen Wimpern hervorquoll, – »du siehst, daß ich dein Glück, deine Freude an der Heimat vollständig würdigen und verstehen kann, da ja doch mein ganzes Wesen erfüllt ist von der Sehnsucht nach diesem Glück, das der Himmel mir versagte.«
»Armer Freund,« rief der Graf Spangendorf mit treuherzigem Ton, indem er sich in rascher Bewegung zu seinem Kameraden hinüberneigte und ihm die Hand hinstreckte, – »das alles ist traurig, recht traurig – aber – vergiß das Vergangene, jetzt hast du gute Kameraden und einen treuen Freund, und die Zukunft wird dir ersetzen, was du entbehrt hast, – wenn du einst deine eigene Familie gründest, dann wird dein altes Haus sich wieder beleben und dir zur lieben Heimat werden, und du wirst deinen Kindern,« fügte er leicht lächelnd hinzu, »schaffen, was du dir in deiner Jugend ersehnt hast. Bis dahin,« – sagte er dann heiterer, aber mit dem Klange warmen und tiefen Gefühls, – »bis dahin sollst du meine Familie und meine Heimat als die deinige ansehen – ich hoffe, bei uns wirst du dich nicht fremd fühlen!«
Herr von Rothenstein drückte innig die Hand des jungen Grafen, – ein warmer Blick dankte ihm für seine herzlichen Worte, – dann richtete sich sein Auge langsam auf das glänzende Dach des Schlosses Rensenheim, – es blitzte darin auf wie eine freudig hoffnungsvolle Frage und mit etwas unsicherer Stimme sprach er: »Verzeih', daß ich da meine alten traurigen Erinnerungen vor dir berührt habe, – wenn ich sie irgendwo vergessen kann, so ist es bei dir – und im Kreise der Deinen« – fügte er leise hinzu – immer den Blick auf das Schloß gerichtet, das bei der Wendung des Weges mit seinen weit ausgedehnten Flügeln aus den Bäumen hervortrat.
Das Pferd des Grafen Spangendorf, das den gewohnten Weg genau kannte und die Vortrefflichkeit des Stalles von Rensenheim zu würdigen wußte, setzte sich in Trab – der Graf hielt es nicht zurück, Herr von Rothenstein folgte, und in wenig Augenblicken hatten beide die Wirtschaftsgebäude und die Wohnhäuser der Gutsbeamten erreicht.
Eine breite Allee von uralten Lindenbäumen führte nach dem Schlosse hin, der rasche Trab ihrer vortrefflichen Pferde brachte die jungen Husarenoffiziere schnell an das große Eisengitter, welches den inneren Hof des Schlosses von den übrigen Baulichkeiten trennte und dessen große Torflügel von geschmiedetem Eisen weit offen standen.
Das Schloß selbst zeigte keinen eigentlichen Baustil. Es war ein schwerer, massiver, zweistockiger Bau mit hohem Schieferdach – zwei lange Flügel schlossen den Hof nach der Gitterseite hin ab, – der Hauptbau hatte eine große, von einem steinernen Vorsprung überdachte Tür, zu welcher man einige breite Granitstufen hinaufstieg, die Fenster des Mittelhauses waren groß und hoch, grüne Jalousien schützten sie vor den Sonnenstrahlen, man bemerkte, wo diese nicht geschlossen waren, hinter den Spiegelscheiben schwere Vorhänge und hie und da eine große Vase oder eine Marmorstatue. An den Fenstern der Seitenflügel sah man überall leichte, schneeweiße Vorhänge, – hier waren die Fremdenzimmer des gastlichen Hauses, das oft bei großen Familienfesten mehr Gäste aufnahm, als irgendein großes Hotel nur zu beherbergen imstande gewesen wäre.
Als der Hufschlag der Pferde der beiden Offiziere auf dem Pflaster des Hofes erschallte, eilten aus den am Ende der Seitenflügel befindlichen Stallräumen mehrere Reitknechte in Stalljacken herbei, um den Herren die Pferde abzunehmen, während ein Diener in einfacher, dunkelblauer, mit kleinen Goldschnüren eingefaßter Livrée ehrerbietig dem Sohne des Hauses und seinem Freunde entgegentrat, die, bekannt mit der sorgfältigen Genauigkeit und Pünktlichkeit des Stalldienstes, ihre Tiere den Dienern überließen.
»Die Herrschaften sind im Garten,« sagte der Diener, indem er sich in der militärischen Haltung, welche dem früheren Soldaten stets eigentümlich bleibt, neben der Tür aufstellte.
»Ist Besuch da?« fragte der Graf Spangendorf, während er mit seinem Freunde unter das Portal trat.
»Nur ein Herr von der Regierung, der die Deiche besehen hat«, erwiderte der Diener, und die beiden Offiziere traten in eine hohe und weite, mit Granitfliesen ausgelegte Halle. An den mit altem Holzgetäfel bedeckten Wänden sah man mächtige Geweihe und schöne Rehkronen, alte Waffen und Trinkhörner, einen großen Eichentisch, auf dessen Mitte in eine Kupferplatte das alte, einfache Stammwappen der reichsritterschaftlichen Familie derer von Spangendorf, noch ohne die von den Königen von Preußen verliehene Grafenkrone, eingegraben war.
Die beiden jungen Leute durchschritten sporenklingenden Trittes die kühle Halle und traten durch die dem Eingange gegenüberliegende Tür in einen großen Gartensaal, dessen bis zum Fußboden herabreichende Fenster sowie die große Glastür in der Mitte weit offen standen, und der mit seinen weißen, von feinen Goldarabesken durchzogenen Tapeten, seinen großen Blumentischen und seiner von zahlreichen Kanapees, Causeuses und Fauteuils aller Art gebildeten Einrichtung ein Bild vornehmer Eleganz und behaglichen Komforts zugleich darbot.
Vor diesem Salon und in dessen ganzer Breite dehnte sich ein mächtiger, auf steinernem Fundamente ruhender Altan aus mit kunstvoll gearbeitetem eisernem Geländer und mit Orangen- und Lorbeerbäumen in großen Kübeln von Eichenholz besetzt. Wieder in der ganzen Breite dieses Altans führten mehrere Stufen in den Garten hinab. Ein weiter Platz, mit feinem gelbem Kiessande bedeckt, aus welchem sich einzelne Blumenparterres erhoben, erstreckte sich an der ganzen Front des Hauses her. Dann begannen die hohen Bäume und schlossen den ganzen Rundblick ein, bis auf eine Lichtung dem Hause gerade gegenüber, in welcher man über einen schönen englischen Rasen hin weite Wiesenflächen erblickte und in deren Hintergrunde der blinkende Wasserspiegel des Rheins erschien.
Auf dem großen freien Platz, etwa dreißig Schritte seitwärts vom Hause, stand eine mächtige uralte Linde, weit um sich her kühlen Schatten verbreitend, – unter derselben ein eiserner Tisch und ebensolche Gartenstühle.
Hier war die Familie versammelt. Auf dem mit einem weißen Tuch bedeckten Tisch stand in einem, mit großen Eisstücken bedeckten Untersatz eine silberne Bowle, gefüllt mit leichtem, duftigem Moselwein, dessen Aroma durch Schnitten frischer Aprikosen erhöht war.
Der Graf von Spangendorf, der Vater des jungen Offiziers, saß an der einen Seite des Tisches bequem in den weit ausgeschweiften Gartenstuhl zurückgelehnt. Er war ein Mann von fünf- bis sechsundvierzig Jahren, stark und voll, doch von jener gesunden, behäbigen Korpulenz, welche die Leichtigkeit und Elastizität der Bewegungen nicht hemmt und der freien Zirkulation des Blutes kein Hindernis bietet. Das volle rote Gesicht des Grafen mit dem leicht aufgekräuselten, rötlichblonden Schnurrbart und dem langen, herabhängenden, vollen Backenbart zeigte eine entschiedene Ähnlichkeit mit seinem Sohne, doch lag auf seiner hoch hinauf kahlen Stirn und in seinen sinnend und ernst blickenden Augen nicht mehr jene fröhliche, glückliche Heiterkeit, welche aus den Zügen des jungen Offiziers strahlte.
Er trug einen leichten Sommeranzug von weißem Leinen, und sein breitrandiger Strohhut lag neben ihm auf dem Boden. Ihm zur Seite saß ein Herr im schwarzen Überrock, von schlanker Gestalt und ruhiger, gerader Haltung, dessen kräftiges und gesundes Gesicht mit starkem, dunkelblondem Schnurrbart eine gewisse ernste Zurückhaltung zeigte.
Es war der Regierungsrat Rast, ein früherer Beamter des Königreichs Hannover, welcher als königlicher Kommissarius die Deichbauten besichtigt hatte und bei der Durchreise durch die Besitzungen des Grafen Spangendorf von diesem, der gastlichen Gewohnheit des Hauses und der traditionellen Deferenz gegen alle Repräsentanten der königlichen Regierung gemäß, zu Tisch eingeladen war.
Dem Grafen gegenüber saß seine Gemahlin, die Tochter einer alten Adelsfamilie des Münsterlandes, eine hohe, schlanke Dame mit edlen, scharfen Gesichtszügen, welche in ihrer Jugend sehr schön gewesen sein mußten, aber jetzt einen gewissen strengen und harten Ausdruck angenommen hatten, der nur durch den sanften, fast schwärmerischen Ausdruck ihrer großen, noch immer glänzenden dunkeln Augen gemildert wurde.
Neben ihr saßen zwei junge Damen im Alter von siebzehn bis achtzehn Jahren, beide schön und elegant, aber sehr verschieden in ihrer Erscheinung.
Die Gräfin Gabriele, die Tochter des Hauses, welche zur Rechten ihrer Mutter saß, war eine schlanke, ätherische Erscheinung, ihr länglich ovales Gesicht mit dem kleinen, fast traurig und schwermütig zusammengezogenen Munde, den großen dunkelblauen, meist niedergeschlagenen und durch außerordentlich lange dichte Wimpern verhüllten Augen, mit der weißen, von aschblondem dichtem Haar umgebenen Stirn zeigte keine Ähnlichkeit weder mit den Zügen ihrer Mutter noch mit denen ihres Vaters. Wohl aber hätte man in diesem wunderbar ansprechenden Gesicht, in diesem Augenaufschlag voll inniger, tief verborgener Empfindung den Ausdruck und die Linien eines Madonnenbildes von einem alten italienischen Meister wiederfinden können, das in dem Wohnzimmer der Gräfin hing, und vor welchem ein kleiner, mit schwarzem Sammet überzogener Betschemel bewies, daß die fromme Dame oft hier ihre andächtigen Gebete zu dem Bilde der Mutter Gottes empor zu senden pflegte.
Die Gräfin Gabriele trug ein einfaches Kleid von weißem Piqué; ein goldenes Kreuz, das an einem schwarzen Bande von ihrem Halse herabhing, war der einzige Schmuck, den man an ihr bemerkte; keine Blume, kein Band zierte die einfachen Flechten ihres schönen Haares, ihre ganze Erscheinung erinnerte fast an eine Novize eines geistlichen Ordens.
Auf der anderen Seite der Gräfin saß ihre Nichte, Fräulein Josephine von Altheim-Ödenberg, die Tochter ihres früh verwitweten Bruders, welche dieser, der viel auf Reisen war und nur selten auf seinen Gütern lebte, der Erziehung seiner Schwester anvertraut hatte. Fräulein Josephine war eine blühende Erscheinung von dem gesunden und kräftigen, doch dabei vornehmen, distinguierten Typus der alten westfälischen Familien. Ihr frisches Gesicht mit dem kastanienbraunen Haar, den glänzenden, feurigen Augen und den vollen Lippen zeigte fröhliche Lebenslust und scharfen Verstand.
Ein leichtes Sommerkleid von weißem Musselin mit feiner Spitzengarnitur umschloß ihre kräftige, volle Gestalt, ein rosenrotes Band war um ihren Hals geschlungen und hing in langen Enden von ihrem Nacken herab, und eine frische Rose schmückte ihr mit einer gewissen koketten Eleganz frisiertes Haar.
Die Damen waren mit weiblichen Arbeiten beschäftigt und schienen keinen zu großen Reichtum an Unterhaltungsstoff zu besitzen, denn nur selten wechselten sie einige Worte miteinander, während der Graf Spangendorf und der Regierungsrat Rast in lebhafter Unterhaltung miteinander begriffen waren.
In einiger Entfernung von dieser Gruppe, im Schatten der den freien Platz begrenzenden Bäume, ging der Hauskaplan des Grafen, der Pater Dominikus Haug, langsam auf und nieder, in einem kleinen schwarzen Buche lesend.
Der Pater Dominikus, welcher schon mehrere Jahre als Hauskaplan auf dem Schlosse zu Rensenheim lebte, war ein Mann von etwa achtundzwanzig Jahren. Seine Gestalt war schlank und kräftig, seine Bewegungen ruhig, würdevoll und bescheiden zugleich. Sein unbedeckter Kopf, dessen ganz kurz geschnittenes schwarzes Haar die kleine Tonsur deutlich hervortreten ließ, war von eigentümlichem, charakteristischem Ausdruck. Die breite und hochgewölbte Stirn zeigte klare und freie Intelligenz, auf seinen scharf markierten Zügen lag eine stille und sanfte Ruhe, ein Zug aszetischer Zurückhaltung umgab die feinen Linien des Mundes. Seine großen dunklen Augen von unbestimmbarer Farbe blickten, wenn er sie aufschlug, scharf forschend und durchdringend auf denjenigen, mit welchem er sprach, und trotz seiner bescheidenen Haltung, trotz seiner sanften und weichen Stimme schienen diese Augen das Recht der Herrschaft über Geist und Gemüt desjenigen, auf den sie sich richteten, in Anspruch zu nehmen. Es schien, als ob eine magnetische Kraft von ihnen ausströmte, deren Einfluß sich selten jemand entziehen konnte, der sich mit dem demütigen und meist schweigsamen Kaplan längere Zeit unterhielt.
Der Pater trug den einfachen, bis zum Hals hinauf zugeknöpften Rock der Weltgeistlichen. Er schien sich ausschließlich mit seiner Lektüre zu beschäftigen, und nur von Zeit zu Zeit warf er einen schnellen Blick nach der Gesellschaft unter dem alten Lindenbaum hinüber.
Als die beiden Offiziere die Stufen des Altans hinabstiegen, erhob sich der Graf Spangendorf und ging seinem Sohn und dessen Freund mit freiem, vornehmem Anstand einige Schritte entgegen.
Der junge Graf eilte auf seine Mutter zu, küßte derselben herzlich und ehrerbietig die Hand und sagte dann:
»Ich habe bis morgen mittag Urlaub, und mein Freund Rothenstein hat die Freundlichkeit gehabt, mich hierher zu begleiten und uns Gesellschaft zu leisten.«
»Herr von Rothenstein ist sehr freundlich,« sagte die Gräfin, den Gruß des jungen Offiziers erwidernd, der dann die herzlich dargebotene Hand des Grafen ergriff, – »Herr von Rothenstein ist sehr freundlich, wenn er unsere ländliche Einsamkeit teilen will, wir können den Herren hier wenig Anregendes bieten, um sie für die Entbehrungen der Genüsse der Stadt zu entschädigen.«
Graf Spangendorf stellte den Freund seines Sohnes und den Regierungsrat einander vor, – die jungen Damen hatten den Besuch nur durch eine stumme Verbeugung begrüßt, und der junge Graf füllte zwei Kelche mit dem eiskühlen, duftigen Getränk aus der Bowle und reichte einen derselben seinem Freunde, während er selbst den anderen mit durstigem Zuge leerte.
Der Pater Haug war herangetreten und hatte den Sohn des Hauses ehrerbietig, aber zugleich mit priesterlicher Würde begrüßt, dann hatte er sich kalt und ernst gegen Herrn von Rothenstein verneigt und sich darauf wieder in den Schatten der Bäume zurückgezogen, die Lektüre in seinem schwarzen Buch fortsetzend.
»Die Sonne sinkt und es wird kühl,« rief der junge Graf Spangendorf, »es wäre schön, einen Gang durch den Park zu machen. So oft ich hier bin, drängt es mich, meine alten Spielplätze wiederzusehen und ein wenig alte Jugenderinnerungen wachzurufen,« fügte er mit einem heiteren, schalkhaften Blick auf seine Cousine hinzu, »jene alten Erinnerungen, in welchen meine kleine Freundin Josephine eine so bedeutende Rolle spielt, teils in friedlicher Eintracht, teils in heftigem Streit und Zank.«
»Zu dem ich niemals die Veranlassung gegeben habe,« rief Fräulein von Altheim, indem sie ihre lebhaften, klaren Augen mit herausforderndem Ausdruck auf ihn richtete, – »und in welchem ich jedenfalls immer recht hatte. Übrigens ist es nicht hübsch,« fuhr sie fort, »die alten Erinnerungen an Streit und Zank festzuhalten: solche Erinnerungen der Vergangenheit üben ihren schlechten Einfluß auch auf die Gegenwart aus.«
»Nun, damit hat es keine Gefahr,« rief der junge Graf Spangendorf, »jetzt ist meine Erziehung vollendet, meine liebe Cousine hat mich so gut dressiert, daß ich nicht mehr wagen würde, zu widersprechen, geschweige denn mich mit ihr zu streiten.«
Fräulein Josephine zuckte leicht mit den Achseln, doch zeigte ein unmerkliches Lächeln ihres Mundes, daß sie sich völlig der Wahrheit dessen bewußt war, was ihr Vetter sagte, und daß sie allerdings keinen Widerspruch von seiner Seite zu erfahren gewohnt sei.
»So laßt uns ein wenig durch den Park und nach den Wiesen herabgehen,« sagte Graf Xaver, »ich möchte meinem Freund dort in der Freiheit das wunderschöne Füllen zeigen, das ich mir aufziehe, noch bevor es in den Stall zurückgebracht wird; ich glaube, ihr habt jetzt genug an den langweiligen Stickereien gearbeitet. – Begleitest du uns, Mama?«
»Ich habe noch einige Anordnungen im Hause zu treffen,« sagte die Gräfin, – »bleibt aber nicht zu lange aus, ich erwarte euch pünktlich zum Abendessen.«
»Ich glaube, wir bleiben hier im kühlen Schatten dieses Baumes und an der Quelle dieses nützlichen Getränks,« sagte der Graf Spangendorf gegen den Regierungsrat gewendet, »und überlassen der unruhigen Jugend das Durchstreifen des Parkes, wenn Sie damit einverstanden sind,« fügte er mit höflich verbindlicher Wendung hinzu.
Der Regierungsrat verneigte sich zustimmend.
Die jungen Damen standen auf, Fräulein Gabriele legte langsam und fast zögernd die kleine Kelchdecke von rotem Sammet aus der Hand, in welche sie mit feinen Goldfäden ein aus einem Herzen hervorwachsendes Kreuz stickte, und warf in raschem Augenaufschlag einen Blick von eigentümlichem, fast demütigem Ausdruck nach dem Pater Haug hinüber, dessen Augen, während er fortwährend mit gleichmäßigen ruhigen Schritten auf und ab ging, streng und starr mit einem faszinierenden Schimmer auf sie gerichtet waren.
Rasch füllte Graf Xaver noch einmal die Gläser und leerte das seinige mit einer leichten galanten Verbeugung gegen seine Cousine, – dann schritten die beiden Offiziere mit den jungen Damen über den weiten freien Platz hin und verschwanden bald in einem der dunklen Laubgänge, welche aus der Tiefe des Parks nach dem Schlosse hin führten.
Die Gräfin hatte sich in das Haus zurückgezogen. Graf Spangendorf und der Regierungsrat Rast blieben unter dem Baume sitzen.
»Ich habe mich gewundert,« sagte der Regierungsrat, – »obgleich ich von der preußischen Verwaltung eine sehr vortreffliche Meinung hatte, – über die wirklich ausgezeichneten Einrichtungen des hiesigen Deichwesens. Es hat mir besonderes Vergnügen gemacht, zu sehen, wie vortrefflich hier die Interessen der Uferbewohner gewahrt sind, indem man zugleich eine möglichst gerechte und wenig drückende Verteilung der Lasten hergestellt hat.«
»Sie finden also,« sagte der Graf Spangendorf mit leichtem Lächeln, »die preußische Verwaltung besser als diejenige in dem früheren Hannover? Da weichen Sie eigentlich von den Ansichten in sehr maßgebenden Kreisen ab. Man hat mir erzählt,« fuhr er fort, »daß dort oben die Ansicht ausgesprochen worden sei, es müsse in Hannover durchgehends das preußische Verwaltungssystem eingeführt werden, um bei den Bewohnern das durch die unveränderte Fortdauer der alten Zustände erzeugte und genährte Gefühl der fremden Okkupation verschwinden zu lassen. Es sei aber an sehr maßgebender Stelle bemerkt worden, daß dies untunlich sei, weil die hannöverische Verwaltung besser sei als die preußische.«
Der Regierungsrat zuckte mit den Achseln.
»Ich möchte weder nach der einen noch nach der anderen Richtung ein unbedingtes Urteil abgeben«, sagte er. »Die hannöverische Verwaltung hat mehr Elemente des Selfgovernments, obgleich diese in der letzten Zeit auch sehr beschränkt worden waren, die preußische hat mehr bureaukratische Ordnung, Präzision und Pünktlichkeit. Jedes System hat seine Vorzüge und seine Nachteile; am besten wäre es, wenn man beide miteinander vereinigen könnte, wie das ja auch beabsichtigt werden soll in der neuen Kreisordnung, welche man, wie ich höre, projektiert.«
»Ich habe auch davon gehört,« sagte Graf Spangendorf, »daß man an etwas Derartiges denkt, doch noch immer nicht recht damit vorwärts kommen will. Eine Änderung des Bestehenden würde auch in den alten Provinzen sehr böses Blut machen und viele Hindernisse finden – und vielleicht nicht nur bei den großen Gutsbesitzern, sondern ebenso auch bei der übrigen Bevölkerung. Solche Verhältnisse müssen mit äußerster Vorsicht angefaßt oder mit einem einzigen kühnen Schlage vollkommen von Grund aus umgestaltet werden. So ist es hier bei uns geschehen, und verhältnismäßig hat man sich sehr schnell in die neue Ordnung gefunden, und ich muß Ihnen sagen, daß die Stellung und der Einfluß des wirklich großen und gefestigten Grundbesitzes durch unsere Gesetzgebung nach dem Code Napoléon nicht verschlechtert sind. Es kommt in allem weit weniger darauf an, nach welchem System und welchem Gesetzparagraphen man die Provinzen verwaltet, als darauf, daß der geschlossene Grundbesitz in festen Händen bleibt. Wo dies der Fall ist, wird sein Einfluß unter allen Gesetzgebungen und unter allen Verwaltungssystemen derselbe bleiben.«
Er schwieg einen Augenblick.
»Sie haben ja in Ihrem Lande«, sagte er dann, »auch tiefe und schwere Veränderungen erlitten, und noch immer zuckt die dadurch erzeugte Bewegung durch das Volk. Diese Bewegung wird aber, wie ich glaube, auch bei Ihnen nicht lange dauern, denn in Hannover ist ja der Grundbesitz und Ackerbau das bestimmende Element des Volkslebens, und wo das der Fall ist, bestimmt sich die öffentliche Meinung auf die Dauer niemals nach politischen Sympathien oder Antipathien, sondern immer nur nach dem Bestreben, das Land, den Grund und Boden selbst auch den neuen Verhältnissen am besten und vorteilhaftesten anzupassen.«
»Eine Generation wird doch noch vorübergehen,« sagte der Regierungsrat Rast, »bevor die Hannoveraner wirklich und ohne Rückhalt sich als Preußen fühlen werden. Ich darf dies um so ungescheuter aussprechen,« fuhr er fort, »da Sie mich hier als preußischen Beamten vor sich sehen, also bei mir jedenfalls keine Feindseligkeit oder Voreingenommenheit gegen die neuen Zustände voraussetzen können. Aber ich muß Ihnen aufrichtig sagen, daß die Erinnerung an unser früheres Königshaus tief und voll schmerzlicher Bewegung in mir lebt und daß ich erst langsam und allmählich mich mit meinen Gefühlen in den neuen Verhältnissen zurechtfinden kann.«
»Wir haben ja Ähnliches erlebt,« sagte der Graf Spangendorf, »lange Zeit wurde ja auch hier die preußische Herrschaft als eine fremde gefühlt, und charakteristisch ist es, daß noch heute, wo das längst vorüber ist, von der ganzen Bevölkerung die Soldaten einfach die ›Preußen‹ genannt werden. Es ist das eine aus der früheren Zeit überkommene Bezeichnung, die heute durchaus nicht mehr den Begriff des Fremden und Feindlichen hat, die aber doch deutlich beweist, wie man zur Zeit ihrer Entstehung gedacht und empfunden hat. Was hier geschehen ist, wird sich in Hannover wiederholen, und um so schneller und sicherer, je fester, klarer und deutlicher Preußen seiner Politik eine deutschnationale Basis gibt. Ich gehöre ein wenig«, sagte er lächelnd, »noch den Gesinnungen und Anschauungen der alten Reichsritterschaft an, und ich muß Ihnen sagen, daß, so aufrichtig ich meinem preußischen König ergeben bin, doch der Krieg mit Österreich und das gänzliche Verschwinden dieses alten Kaiserstaats aus der deutschen Geschichte mich schmerzlich berührt hat, – der Gedanke des Reichs hat für uns hier etwas zauberisch Verlockendes, und wenn Preußen die Reichsfahne zu entrollen und die alte Krone der deutschen Kaiser auf das Haupt seines Königs zu setzen in die Lage käme, so würde meine und aller mir Gleichgesinnten freudige Begeisterung einer solchen Zukunft gehören.«
»Das ist auch das Gefühl,« sagte der Regierungsrat lebhaft, »welches uns alle in Hannover beseelt, die wir eine Versöhnung der Vergangenheit mit der Zukunft anstreben. Die einfach preußische Eroberung wird noch lange antipathischen Widerstand in den Gesinnungen des Volks finden, aber die Wiederherstellung eines großen, mächtigen Deutschlands würde mit einem Male den Geistern eine andere, neue Richtung geben, die Gemüter versöhnen und alles zum guten Ende führen.«
»Nach meiner Überzeugung wird es ja dazu kommen,« sagte der Graf, indem er ernst nach dem im Abendsonnenschein schimmernden Rhein hinüberblickte, »unsere Nachbarn dort jenseits des Stroms trachten ja mehr und mehr danach, daß dieses diplomatische Spiel und Widerspiel, welches seit 1866 zwischen dem Kaiser Napoleon und dem Grafen Bismarck geführt wird, endlich zu einer kriegerischen Entscheidung gedrängt werde, und wenn Deutschland in diesem Kriege siegreich sein sollte, wie ich sicher glaube und hoffe, dann wird, dann muß ja das alte Reich wieder erstehen und die alte nationale Kaiserherrlichkeit sich wieder erheben. Dann«, fuhr er fort, »wird der Deutsche Kaiser alle die Herzen willig sich unterwerfen, welche heute noch dem Könige von Preußen Widerstand leisten.
»Auch ich«, sagte der Regierungsrat, »glaube an eine solche Zukunft, und ich wünsche und erhoffe sie auch im Interesse meines speziellen Vaterlandes Hannover. Wieviel schöner freilich«, fügte er mit leichtem Seufzer hinzu, »würde eine solche Zukunft sich gestalten, wenn jene unglückselige Spaltung des Glaubens und der Kirche unser deutsches Vaterland nicht in zwei Hälften teilte! Selbst für die kaiserliche Macht würde es schwer sein, die volle nationale Einigkeit herzustellen, solange nicht die ganze Nation im Glauben und im Gewissen einig ist.«
Ein wenig erstaunt blickte ihn der Graf an.
»Sie beklagen«, sagte er in verwundertem Ton, »die Folgen der Reformation?«
»Ich bin Katholik, Herr Graf«, sagte der Regierungsrat, »wie Sie, und als solcher sehe ich die Reformation für ein großes nationales Unglück an, vielleicht deshalb, weil die Kirche es damals nicht verstand, selbst im freien Entgegenkommen Mißbräuche abzustellen, weil sie es nicht verstand, die Bewegung der Geister zu fassen und zu leiten, und weil sie so vielleicht selbst die Schuld trug, daß diese Bewegung, statt zu einer Reformation zu führen, eine Sezession schuf.«
Der Graf blickte in sinnendem Ernst vor sich nieder.
»Sie sind Katholik,« sagte er, »ich freue mich herzlich, in Ihnen einen Glaubensgenossen zu begrüßen, und kann mich Ihnen gegenüber also freier aussprechen, als ich es sonst tue, da man uns ja, wie Sie auch wissen werden, so leicht besondere Anschauungen und Ansichten unterzuschieben geneigt ist. Aber gerade als Katholik«, fuhr er fort, »kann ich für das Wohl unserer heiligen Kirche eine Vereinigung Deutschlands in einem neuen Reiche nur als ein günstiges Ereignis betrachten.«
»Viele meiner Glaubensgenossen in Hannover«, sagte der Regierungsrat, »denken anders. Ich persönlich halte mich von jeder Vermischung politischer und religiöser Fragen geflissentlich fern. Indessen es wird Ihnen vielleicht bekannt geworden sein, Herr Graf, daß unsere Kirche in Hannover eine ganz besonders günstige und selbständige Stellung hatte, daß ihr dort viele Rechte zustanden, welche sie in Preußen nicht mehr besitzt, und es ist vielleicht nicht unnatürlich, daß unsere Glaubensgenossen dort befürchten, nach der Einverleibung in Preußen auch diese Selbständigkeit ihrer Kirche allmählich einzubüßen.«
»Diese Befürchtung«, erwiderte der Graf, »würde sich am wenigsten realisieren, wenn Deutschland wirklich zu einem einigen Reich sich gestaltete, und wenn die so ganz katholischen Gebiete Süddeutschlands sich als ein berechtigter und mächtiger Faktor in dem Gesamtleben der Nation geltend machten. Die Könige von Preußen konnten protestantische Fürsten sein, für den Deutschen Kaiser ist dies unmöglich, und wenn er persönlich protestantischen Glaubens ist, so wird er die katholische Kirche in Deutschland um so mehr in ihrem Recht und in ihrer Selbständigkeit zu schützen Veranlassung haben, – um so mehr, wenn mit der Wiedererhebung des Reichs auch unter den deutschen Bischöfen der Geist der nationalen Selbständigkeit, der sie im Mittelalter der römischen Herrschaft gegenüber erfüllte, wiedererstehen sollte, was, wie ich glaube, eine natürliche und folgerichtige Erscheinung sein müßte.«
»Sie halten eine Kirche für möglich,« fragte der Regierungsrat befremdet, »welche sich auf nationaler Basis von Rom loslösen würde, wie dies in Frankreich mehrfach, aber vergeblich versucht worden ist?«
Der Graf lächelte.
»Sie verstehen mich falsch,« sagte er, »ich bin ein eifriger Anhänger der einen und unteilbaren römischen Kirche. Als bester Beweis dafür möge Ihnen dienen, daß mein zweiter Sohn, der einzige jüngere Bruder des Offiziers, den Sie soeben hier gesehen, mit meiner Erlaubnis in den Dienst des Heiligen Vaters eingetreten ist, um dessen Recht und dessen Unabhängigkeit nötigenfalls mit seinem Leben zu verteidigen, – aber«, fuhr er fort, »so sehr ich die Unteilbarkeit und Einheit der Kirche in allen Glaubenssätzen und allen rein geistlichen Fragen für notwendig halte, so glaube ich doch, daß in ihrer äußeren Organisation und namentlich in ihren Beziehungen zur Staatsregierung die Kirche in großen Ländern ihre Eigenart und Selbständigkeit, – ich sage es geradezu, ihre Unabhängigkeit von der römischen Kurie erstreben und bewahren muß, wie das ja zum Beispiel in Ungarn und in den morgenländischen Diözesen der Fall ist. Dadurch werden alle Konflikte mit der Staatsgewalt vermieden, welche in einer national selbständigen Kirche niemals einen Gegner oder eine Gefahr erblicken kann, und deren Mißtrauen nur dadurch erzeugt und genährt wird, daß sie in der ganzen Organisation, Verwaltung und Herrschaft der Kirche sich immer der Hand Roms gegenüber befindet, das heißt, der Hand einer Macht, welche außerhalb ihrer Macht und Rechtssphäre liegt. In den geteilten Ländern Deutschlands«, fuhr er fort, »konnte eine solche Selbständigkeit der Kirche nicht erwachsen, nicht bestehen, in dem geeinigten Deutschland wird dies möglich sein, und wenn man in Rom klug und geschickt ist, und wirklich das Heil der Kirche vor Augen hat, so wird man von dort aus selbst die Hand dazu bieten.«
»Es liegt viel Wahres in ihrer Bemerkung, Herr Graf,« sagte der Regierungsrat, welcher mit hoher Aufmerksamkeit zugehört hatte, »und ich wünschte, daß diese Gedanken auch in meiner besonderen Heimat sich geltend machten; freilich wird das wohl erst möglich sein, wenn wirklich eine deutsche nationale Einheit geschaffen ist. Jetzt steht man dort noch zu sehr auf dem partikularistischen Standpunkt, von welchem aus, wie ich schon bemerkte, man in Preußen wesentlich die protestantische Macht erblickt, der gegenüber man sich eines gewissen Mißtrauens nicht erwehren kann.«
»Sie haben dort einen sehr eifrigen und geistvollen Vertreter der katholischen Interessen,« sagte Graf Spangendorf, »Ihren früheren Minister Windthorst, ich habe ihn in Berlin kennen gelernt, auch einige Male in der Kammer sprechen hören, und bin wirklich erstaunt gewesen, welch eine Fülle von Geist und scharfer Schlagfertigkeit diese anfangs so unscheinbare Persönlichkeit zu entwickeln vermag. Er scheint seine politische Tätigkeit mehr und mehr aufzugeben und sich wesentlich dem Dienst und der Verteidigung der katholischen Kirche zu widmen.«
»Vielleicht,« sagte der Regierungsrat mit einem eigentümlichen Lächeln, »weil – ihm die politische Tätigkeit verschlossen ist. Ich kenne ihn persönlich nur wenig, – aber man hat mir erzählt, daß er sehr geneigt gewesen sein solle, an leitender Stelle die Hinüberführung der hannöverischen Justizverwaltung in die neuen Verhältnisse zu übernehmen, und daß er sehr peinlich durch die Ernennung Leonhardts, seines früheren Generalsekretärs, zum preußischen Justizminister berührt worden sei. Untätigkeit ist dieser reich und vielseitig begabten und strebenden Natur unmöglich, und auf dem kirchlichen Gebiet findet er das Feld wieder, das ihm in der Politik verschlossen ist.«
»Ich habe ihn nur flüchtig kennen gelernt,« sagte der Graf, das Gespräch abbrechend, »und jedenfalls ist es mir erfreulich gewesen, daß die Interessen unserer Kirche einen so geistvollen und beredten Verteidiger gefunden haben. Doch wenn es Ihnen recht ist,« sagte er aufstehend, »so lassen Sie uns ein wenig durch den Park gehen und unseren jungen Leuten folgen. Ich habe das Abendessen etwas früher bestellt, damit Sie noch die vollkommen bequeme Zeit zur Rückkehr nach Düsseldorf haben, aber uns bleibt immerhin noch eine halbe Stunde, um wenigstens einige Punkte des Parks anzusehen, auf die ich ein wenig stolz bin.«
Der Regierungsrat verneigte sich zustimmend.
Der Graf reichte ihm aus seinem Etui eine Zigarre, und beide Herren schritten schweigend dem Schatten des Parks zu, jeder in seine Gedanken über das eben geführte Gespräch vertieft, welches keiner von beiden für den Augenblick wieder aufzunehmen Neigung und Veranlassung fand.
Der Kaplan hatte sich, fortwährend in seinem Buche lesend, während des letzten Gespräches dem Grafen und dem Regierungsrat unbemerkbar etwas mehr und mehr genähert. Als die beiden Herren im Schatten der Bäume verschwunden waren, warf er über den Rand seines Buches hin, das er keinen Augenblick aus der Sehweite herabsinken ließ, denselben einen stechenden Blick nach.
»Das sind ja tief verwerfliche Ansichten,« sagte er vor sich hin, »die ich da soeben gehört habe, um so verwerflicher für einen Vertreter des altkatholischen Adels im Gebiet des Rheinlandes. Ich habe früher niemals Ähnliches vom Grafen aussprechen hören und habe ihn stets für einen strenggläubigen Sohn der Kirche gehalten, aber freilich das Gift der Zeit dringt überall hin und diese Gedanken der nationalen Selbständigkeit dem Heiligen Stuhl gegenüber sind das gefährlichste, das bedenklichste Gift, um so gefährlicher, als ähnliche Gedanken sogar an den Bischofssitzen auftauchen und Platz gewinnen. Ich muß darüber berichten und auch meinerseits darauf aufmerksam machen, welche Gefahr hier droht. Und auch dieser fremde Offizier, der in der letzten Zeit so oft hierherkommt, bringt mir Gefahr, seine Gegenwart droht mir diese junge Seele, die mir gehört und die ich dem Schoß der Kirche zuführen will, zu entreißen.«
Er warf einen wie in vulkanischem Feuer glühenden Blick nach dem Schatten des Parks hinüber.
»Aber«, flüsterte er dann aus seinen zusammengepreßten Lippen hervor, »was mir gehört, soll man mir nicht entreißen, eine Seele, die mein ist, ein Herz, das ich in meinen Händen halte, soll keinem anderen sich zuwenden.«
Er war einen Augenblick stehen geblieben, warf einen schnellen forschenden Blick nach den Fenstern des Schlosses hinauf, schloß dann sein Buch und ging mit langsamen, würdevollen, abgemessenen Schritten in das Haus.
Die beiden Offiziere mit der Gräfin Gabriele und ihrer Cousine waren durch einen langen, breiten Gang, von den Zweigen hoher Lindenbäume überdacht, bis zu einem runden Platz gekommen, der rings von Rosenhecken eingefaßt war und auf der einen Seite einen weiten Blick nach dem Rhein hin gewährte; auf der anderen Seite dieses Platzes stand, von weißen und roten Rosenstöcken umgeben, auf hohem Piedestal ein kleiner Amor von Marmor, der eben einen Pfeil aus seinem Köcher zieht, um ihn auf den Bogen zu legen.
»Hier muß man sich in acht nehmen,« rief Graf Xaver, »wenn dieser kleine heidnische Gott da oben seinen Pfeil auf uns abschießt, so ist es um uns geschehen, und wir müssen ewig in den Fesseln der Dame bleiben, auf welche gerade in dem Augenblick unser Blick gerichtet ist, wenn er nicht vielleicht«, fügte er mit einem lächelnden Seitenblick auf seine Cousine hinzu, »die große Freundlichkeit hat, auf die Dame zu zielen, statt auf uns – dann ist die Sache umgekehrt.«
»Das kann gar nicht vorkommen,« sagte Fräulein Josephine spöttisch, »die Herzen der Damen sind gegen solche Geschosse geschützt, ich wenigstens fürchte mich vor dem Pfeil nicht und würde ruhig abwarten, wohin der kleine Gott zielen möchte.«
Graf Xaver hatte einen Rosenzweig gepflückt, und unbemerkt an seine Cousine herantretend, berührte er ganz leicht mit einem Dorn dieses Zweiges die nur durch leichten Tüll verhüllte Schulter der jungen Dame.
Fräulein Josephine zuckte zusammen und stieß einen leichten Schrei aus.
»Siehst du,« sagte ihr Vetter, »man muß den Teufel nicht an die Wand malen. Und dieser Amor ist ja ein kleiner Teufel, dich hat er für deine Vermessenheit schon getroffen. Wenn du mich jetzt ansiehst, so wird es sehr gefährlich werden.«
»Wie unartig,« sagte Fräulein Josephine, »wie ungalant!« Und schmollend wandte sie sich ab, ohne die Augen zu ihrem Vetter aufzuschlagen.
»Du sollst mich jetzt ansehen,« rief dieser, »um die Macht des kleinen Gottes, den du verhöhnt hast, zu fühlen, oder sein Pfeil trifft dich noch einmal.«
Er erhob drohend den Rosenzweig gegen die Schulter seiner Cousine. Diese bog sich zur Seite und eilte davon in der Richtung des Weges, welcher nach der Rheinaussicht hinführte.
Graf Xaver verfolgte sie mit dem Rosenzweig in der Hand, bis sie in einiger Entfernung plötzlich stehen blieb und drohend und abwehrend ihm ihre Hände entgegenstreckte. Da hielt er an, man sah ihn die Dornen von seinem Zweig brechen und dann seiner Cousine die Rose reichen, welche sie zögernd annahm und an ihre Brust steckte. Die beiden jungen Leute beeilten sich jedoch nicht, nachdem dies geschehen, wieder zurückzukehren, sondern blieben auf dem Platz, den sie erreicht, stehen, in einem Gespräch, das augenscheinlich ernster und auch inniger und verständnisvoller war als ihre bisherigen Neckereien.
Herr von Rothenstein stand allein unter dem Bilde des Liebesgottes, während die Gestalten des Grafen Xaver und des Fräulein Josephine in der Ferne von dem Hintergrunde des abendroten Himmels wie eine reizende Staffage des schönen Landschaftsbildes sich abhoben.
Eine tiefe Bewegung zuckte auf dem Gesicht des Leutnant von Rothenstein, während Fräulein Gabriele ernst und ruhig mit niedergeschlagenen Augen dastand und kaum den eigentümlichen Reiz dieser vom Abendgold verklärten Natur zu bemerken schien.
»Wie schön ist es hier bei Ihnen, Komtesse,« sagte Herr von Rothenstein, »und wie heimisch und lieb mutet mich das alles hier an, mich, der ich bisher stets allein im Leben war, und der ich den Reiz der Heimat entbehrte, welche mit dem Schimmer ihrer Erinnerung unser ganzes Leben vergoldet! Wie glücklich sind Sie und Ihr Bruder in dieser so schönen Heimat!«
»Sie haben mir erzählt,« sagte Gräfin Gabriele, »daß Sie allein, ohne Eltern und Verwandte aufgewachsen sind. Das ist recht traurig,« fuhr sie fort, indem sie das große, leuchtende Auge einen Augenblick zu ihm aufschlug, »recht traurig, und gewiß ist es ein großes Glück, eine Heimat zu haben, und eine so schöne Heimat wie diese. Es ist wahr,« fuhr sie leise fort, »man kann auch in der Heimat allein sein, unsere Seele hat ja doch nur eine wahre Heimat, in der sie zu vollem Glück gelangen kann, – und diese Heimat ist nicht auf Erden.«
Erstaunt, fast erschrocken sah Herr von Rothenstein das junge Mädchen an, welches die letzten Worte in einem Ton gesprochen hatte, der weder zu ihrem Alter noch zu der heiteren, schönen und lichten Umgebung paßte, in der sie sich befanden.
»Mein Gott, Komtesse,« rief er wie scherzend, indem jedoch ein Klang von Unruhe und Besorgnis in seiner Stimme lag, »jene ewige Heimat der menschlichen Seele liegt uns, liegt Ihnen besonders doch noch unendlich fern, Ihnen, der die Erde allen Reiz bietet, den sie besitzt, Ihnen, die Sie die Aufgabe haben, glücklich zu werden und«, fügte er mit etwas leiserer, inniger Stimme zu, »glücklich zu machen.«
»Der Mensch steht in jedem Alter«, erwiderte Fräulein Gabriele ernst und fast düster, »unmittelbar vor den Pforten seiner ewigen Heimat, in jedem Augenblick können sich dieselben öffnen, und wir müssen bereit sein, die Schwelle zu überschreiten, welche uns von allen irdischen Gütern, von allem flüchtigen irdischen Glück trennt.«
»Ich verstehe es nicht,« rief Herr von Rothenstein, »wie Sie solche traurige, düstere Gedanken in sich tragen können, hier an den Ufern des schönen Rheins, wo alles fröhliche Lust und heiteres Leben atmet, wo die Lieder der Minnesänger einst erklangen, wo uns der poetische Hauch der Sagen der Vorzeit umweht. Ich trage oft auch«, fuhr er fort, »düstere Gedanken in mir, aber wenn ich hier geboren wäre, wenn ich hier aufgewachsen wäre im lieben Heimatkreis,« sagte er, während der dunkelglühende Abendhimmel sich in seinen Augen widerspiegelte, »dann würde mein Herz ebenso voll von Glück, von Poesie, von Liebe und Freude sein, wie es das Ihres Bruders und wie es auch das Ihrige sein sollte. Ich habe immer eine so tiefe Sympathie gehabt«, sprach er immer lebhafter weiter, »für diese wunderbaren Sagengestalten des Rheins, in denen allen die heldenmütige Tapferkeit und die ritterliche Minne lebt. Ich habe mich begeistert, als ich noch fern von den grünen Fluten dieses herrlichen Stromes lebte, an den Heldengestalten der Nibelungen, an den lieblichen Märchen von Nixen und Elfen und an der unzerstörbaren Treue des Ritters von Toggenburg, der in allen Kämpfen, allen Fernen das Bild seiner Geliebten unzerstörbar im Herzen trägt.«
Er hatte immer wärmer, immer inniger gesprochen, seine sonst kalten und abgeschlossenen Züge waren von tiefem Gefühl durchleuchtet, seine Blicke ruhten mit weichem Strahl auf der zarten Gestalt des jungen Mädchens.
Gräfin Gabriele hatte ihre Augen zu ihm aufgeschlagen. Der leise Hauch einer kaum sichtbaren Röte erschien auf ihrem bleichen Gesicht und es schien, als ob das Feuer seiner Augen auch in ihren Blicken eine sanfte Wärme erzeugte. Bei seinen letzten Worten flog es wie ein leichtes Zittern durch ihre Gestalt, langsam schlug sie die Augen nieder, und indem sie die Spitzen ihrer zarten Finger aneinanderlegte, sagte sie leise, wie den durch seine Worte angeregten Gedanken folgend, vor sich hin:
»Ritter, treue Schwesterliebe Widmet Euch dies Herz, Fordert keine andre Liebe, Denn es macht mir Schmerz.«
Herr von Rothenstein zuckte zusammen, auch er schlug die Augen nieder, und wie schmerzliche Trauer zuckte es um seinen Mund bei diesem durch seine Erwähnung der alten Sage so natürlichen Zitate.
Einige Augenblicke standen beide schweigend nebeneinander.
Endlich sagte Herr von Rothenstein in ruhigem und heiterem Ton, indem er auf den Grafen Xaver und seine Cousine deutete, welche langsam und in lebhafter Unterhaltung wieder auf den runden Platz zugeschritten kamen:
»Sehen Sie, Komtesse, Ihr Bruder und Ihre Cousine führen nicht so ernste Gespräche als wir – sie haben der Rose den verletzenden Dorn genommen, und Fräulein von Altheim trägt die schöne, glückbringende Blüte an ihrer Brust, – mein Leben«, fuhr er nach kurzem Zögern, wie einem schnellen Entschluß folgend, fort, »hat wenig Blüten bisher gehabt.. Wollen Sie nicht auch mir eine von diesen Rosen schenken zur Erinnerung an diese Stunde, die mit ihrem schönen Blick auf diese lichte, liebliche Natur mir wie ein goldener Erinnerungspunkt unvergeßlich sein wird.«
Gräfin Gabriele schlug langsam die Augen auf, sah ihn einen Augenblick wie fragend an, dann wandte sie sich zu dem Rosenstock, welcher die kleine Statue umgab, und streckte vorsichtig, die Dornen vermeidend, ihre Hand nach den Blüten aus.
Mit glückstrahlendem Blick folgte Herr von Rothenstein ihrer Bewegung.
Das junge Mädchen wandte sich wieder um und reichte die Blumen, die sie gepflückt, dem Leutnant hin.
»Dank, tausend Dank«, rief dieser mit zitternder Stimme, indem er fortwährend in ihre Augen blickte, – dann nahm er die Blume und hob sie langsam zu seinen Lippen empor. Aber plötzlich wurden seine Blicke starr und düster, ein Zug tiefbitteren Schmerzes erschien auf seinem Gesicht – es war eine weiße Rose, die sie gepflückt und ihm gegeben hatte.
Gräfin Gabriele stand bleich und zitternd vor ihm, sie hatte den Ausdruck seines Gesichtes gesehen und machte eine Bewegung, als ob sie sich abwenden wolle, als ob sie fürchte, daß er das, was in seinen Zügen geschrieben stand, in Worten aussprechen möchte.
Graf Xaver und seine Cousine waren herangekommen. Zugleich hörte man von dem Weg zum Schlosse her die Stimmen des Grafen und des Regierungsrats, welche nach einigen Augenblicken aus dem Schatten der Allee hervortraten.
Die Unterhaltung wurde allgemein und alle kehrten gemeinschaftlich nach dem Schlosse zurück, denn die Stunde des Abendessens war herangekommen.
Herr von Rothenstein hatte die weiße Rose in seine Uniform gesteckt und ging schweigend neben der Gräfin Gabriele her, nur durch gelegentliche allgemeine und zerstreute Bemerkungen an der Unterhaltung teilnehmend.
Zweites Kapitel
König Georg V. war im Sommer 1869 wieder nach Gmunden gezogen und bewohnte dort wie im vorhergehenden Jahre die Villa Thun auf der Höhe vor der Stadt.
Der König saß in seinem Arbeitszimmer neben dem großen Speisesaal im Erdgeschoß der Villa. Die Fenster waren geöffnet und ließen die würzige Luft der hohen Waldungen mit dem frischen Hauch des Sees in das Zimmer dringen, dessen Wand einige von den früheren Bewohnern dort aufgehängte so schlechte Bilder verunzierten, daß der König, wenn er sie je hätte sehen können, gewiß sofort ihre Entfernung würde befohlen haben.
Vor dem Könige saß der Geheime Kabinettsrat, der in den letzten Jahren, wenn möglich, noch etwas kleiner, noch etwas trockener und noch etwas mürrischer geworden zu sein schien, beschäftigt, ein Paket Papiere, aus welchen er dem Könige soeben vorgelesen hatte, mit einem roten Band wieder zusammenzubinden.
Der König hatte einen Augenblick nachdenkend den Kopf sinken lassen, dann wandte er sein Gesicht mit dem so lebhaft bewegten geistigen Ausdruck nach der Seite des Kabinettsrats hin und sagte:
»Wie schwer ist es doch, den Ereignissen in dieser politischen Welt zu folgen, sie richtig zu würdigen und aus ihnen die Gestaltung der Zukunft zu kombinieren! Sie haben mir die Berichte aus Paris vorgelesen, und fast möchte ich sagen, daß ich durch dieselben noch unsicherer, noch unklarer geworden bin als vorher. Meding schreibt mir, daß der Ausbruch des Krieges wie das Schwert des Damokles an einem dünnen Faden über der politischen Welt hängt, daß dieser Faden immer dünner und schwächer wird und daß, trotz dem inneren Widerstreben des Kaisers, mit mathemetischer Gewißheit der Ausbruch urplötzlich, unvorbereitet und überraschend erfolgen werde in einem, wenn auch nicht ganz genau vorher zu bestimmenden, so doch gewiß nicht mehr sehr fernen Augenblick. Der Graf Breda dagegen«, fuhr er fort, »versichert, daß der Kaiser nie etwas unternehmen werde, daß seine Macht vollständig unterwühlt sei, und daß die Orleans die Erben dieser Macht und der Aufgaben sein würden, welche das Kaiserreich ungelöst gelassen habe. Nach dieser Richtung hin müsse man also Fäden und Verbindungen anknüpfen, denn dort seien die Führer der Aktion der Zukunft, welche dem Kampf für mein Recht Raum und Gelegenheit würden bieten müssen. Wie schwer ist es, bei so verschiedenen und von beiden Seiten mit Bestimmtheit ausgesprochenen Auffassungen die wahre Lage der Dinge zu erkennen!«
»Diese Verschiedenheit der Auffassung scheint mir natürlich, Majestät,« sagte der Geheime Kabinettsrat mit seiner dünnen scharfen Stimme, »denn die beiden Herren sehen aus ganz verschiedenen Kreisen heraus die Verhältnisse in Paris an. Der Graf Breda lebt wesentlich unter den, dem Kaiser und Kaiserreich feindlichen Elementen, während der Regierungsrat Meding vorzugsweise mit der Regierung und der diplomatischen Welt in Beziehung steht. Jedenfalls ist es gut, von allen Seiten informiert zu sein.«
Der König schüttelte den Kopf.
»Das verwirrt aber,« sagte er, – »was ich um so mehr beklage, als es gerade in meiner Lage das Wichtigste ist, genau und wirklich wahr unterrichtet zu sein über das, was vorgeht. Ich bedaure eigentlich,« sagte er nach einem augenblicklichen Schweigen, »daß ich mich, vom Grafen Platen veranlaßt, mit diesem Grafen Breda eingelassen habe. Der Kronprinz war so eingenommen von ihm, der Graf Breda hatte ihm Wunderdinge von seinen persönlichen Relationen in Paris erzählt, die sich doch nun auf sehr enge und beschränkte Kreise reduziert haben – und dann sollten seine Dienste so wohlfeil sein,« fügte er mit leichtem Sarkasmus hinzu, »und davon spüre ich auch nichts, denn ich habe durch Elster nicht ganz unerhebliche Summen für ihn anweisen lassen. Freilich«, fuhr er fort, »dieser Punkt kommt jetzt, Gott sei Dank, weniger in Betracht, da ja die vortrefflichen Geschäfte der Wiener Bank meine finanzielle Lage so unendlich verbessert haben, und ich, wenn die Sache weiter so günstig verläuft, bald in die Lage kommen werde, ohne alle Rücksicht und Einschränkung die ganze große Macht der Geldmittel für meine Rechte in die Wagschale werfen zu können. Nicht wahr, die Aktien der Wiener Bank stehen jetzt hoch? Über Zweihundert?«
»Zweihundertundfünfundsiebzig, Majestät«, erwiderte der Geheime Kabinettsrat kurz und trocken.
»Es ist doch eine ganz vortreffliche Idee gewesen,« sagte der König, indem er rasch die Hände aneinanderrieb, »dieses große Geldinstitut zu gründen und damit die wesentlichste und wichtigste Macht, welche heute die Welt regiert, mir dienstbar zu machen. Wer hätte«, fuhr er dann fort, »in diesem unscheinbaren und bescheidenen Elster ein solches Finanzgenie gesucht! – So bringen immer außergewöhnliche Zeiten außergewöhnliche Menschen hervor, und wenn ich wieder in mein Reich zurückkehre, so wird es mir ein großer Gewinn sein, solche Begabung in der Zeit der Not und des Exils erkannt zu haben. Dieser Elster, der einen so großen Teil seines Lebens in der untergeordneten Tätigkeit des subalternen Bureaudienstes zugebracht hat, entpuppt sich da plötzlich als eine finanzielle Kapazität ersten Ranges, welche von den Matadoren der Wiener Börse als eine Autorität betrachtet wird, und welche man mir schon abwendig zu machen sucht, denn er hat mir vor kurzem geschrieben, daß die neugegründete Forstbank ihm bedeutende Offerten gemacht habe, wenn er in ihren Verwaltungsrat eintreten wolle, was er aber abgelehnt habe, um meinem Dienst seine ganze Kraft zu erhalten.«
Der Geheime Kabinettsrat schwieg. Ein eigentümliches skeptisches Lächeln spielte um seinen kleinen, faltig zusammengepreßten Mund.
Der König sah dies Lächeln nicht, aber er schien betroffen durch das Stillschweigen seines langjährigen, vertrauten Sekretärs, von dem er eine zustimmende Antwort erwartet haben mochte.
»Sie teilen meine Ansicht über die Nützlichkeit der Wiener Bank nicht, mein lieber Lex,« sagte er dann im Ton zögernder Frage, »Sie sind noch nicht von Ihrem Vorurteil gegen dieses Institut zurückgekommen?«
»Eure Majestät«, sagte der Geheime Kabinettsrat, »haben die Sache lange und eingehend geprüft, Sie haben dieselbe beschlossen und ins Leben gerufen. Was würden jene retrospektiven Bedenken und Gründe helfen? Ich habe ja seinerzeit meine Ansichten Eurer Majestät aufrichtig und einfach ausgesprochen, und da Allerhöchstdieselben mich fragen, muß ich Ihnen gestehen, daß ich auch heute noch mich von meinem tiefen Mißtrauen gegen alle solche Bank- und Kreditinstitute nicht freimachen kann, deren Basis ja doch nur auf imaginärem Wert beruht. Für den Augenblick sind allerdings bedeutende Erfolge erzielt, aber es wird immer wesentlich Glückssache sein, ob dieselben für die Zukunft erhalten werden können und dauernde Resultate liefern. Das Glück aber, Majestät, beruht auf Zufall, und es erfüllt mich mit einiger Besorgnis, einen so großen Teil des ohnehin schon beschränkten königlichen Vermögens den Chancen des Zufalls preisgegeben zu sehen.«
Der König lachte.
»Wissen Sie, lieber Lex,« sagte er, »daß es ein wahres Glück, eine segensreiche Fügung der Vorsehung ist, daß ich Sie gefunden habe?«
»Ein Glück für mich jedenfalls, Majestät,« sagte der Geheime Kabinettsrat, sich verneigend, im Ton aufrichtigster Überzeugung, »denn wie hätte ich einen glücklicheren Beruf finden können, als einem so edlen und gnädigen Herrn meine geringen und bescheidenen Kräfte zu widmen!«
»Ich meine«, sagte der König, »nicht Sie, sondern mich. Für mich ist es ein Glück daß ich Sie gefunden habe, und abgesehen von Ihrer Treue und Hingebung, welche Sie mir stets in so unermüdlicher Weise bewiesen haben, ergänzen sich unsere Naturen auf wunderbare Weise. Ich bin geneigt zu raschen Entschlüssen, zu Illusionen und zu kühnen Handlungen, zu raschem Vertrauen in das Schicksal und in die Menschen. Sie sind das lebendige Korrelativ für meine Eigenschaften mit Ihrem unzerstörbaren Mißtrauen, mit Ihrer stets vorsichtigen Bedenklichkeit, mit Ihrer logischen und scharfen Erwägung aller Hindernisse und Gegengründe, – ich muß wirklich der Vorsehung danken, daß sie mich Sie hat finden lassen, und ich bitte Gott, Sie mir lange zu erhalten«, fügte er mit innigherzlichem Ton hinzu, indem der Ausdruck eines tiefen Gefühls sein Gesicht erleuchtete.
Er reichte dem Kabinettsrat seine Hand hin, welche dieser, sich auf dieselbe herabbeugend, mit seinen Lippen berührte.
»Haben Sie noch etwas?« fragte er nach einer augenblicklichen Pause.
Der Geheime Kabinettsrat zog einen zusammengefalteten Bogen aus der Tasche seines Rockes hervor und sagte mit einer gewissen leichten Ironie in seinem Ton:
»Graf Platen, Majestät, berichtet über eine Unterredung, die er mit dem Grafen Beust gehabt habe.«
»Nun?« fragte der König gespannt.
»Graf Platen will aus dieser Unterredung wahrgenommen haben, daß Herr von Beust unzufrieden mit Eurer Majestät Vertretung in Paris sei, und daß er es für zweckmäßig halte, wenn Eure Majestät dort Ihre offizielle und quasi persönliche Repräsentation ganz aufhören ließen, da dieselbe zu sehr die Aufmerksamkeit Ihrer Gegner auf sich zöge und dadurch Ihren Interessen mehr schadete als nützte, da es ja doch viel zweckmäßiger sei, alles, was dort geschehe, mit der Stille des tiefsten Geheimnisses zu umgeben.«
Der König stützte den Kopf in die Hand und versank einige Sekunden in schweigendes Nachdenken.
»Sollte der Reichskanzler«, sagte er dann leise, wie zu sich selber sprechend, »wirklich mit dem Grafen Platen eingehend über meine Angelegenheiten und die Zukunft meiner Sache gesprochen haben? Freilich«, fuhr er dann in demselben Ton fort, »in der Staatskanzlei würde man es vielleicht lieber sehen, wenn meine Entschlüsse und Handlungen nur von dort aus inspiriert würden, wenn ich nur den Staatsrat Klindworth allein hörte und meine eigenen, mir wirklich ergebenen Diener von mir entfernte.«
Er dachte abermals schweigend nach.