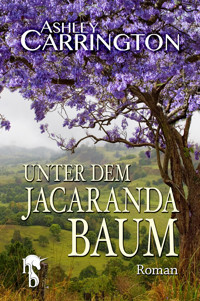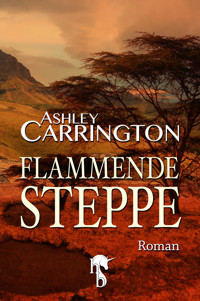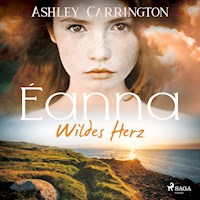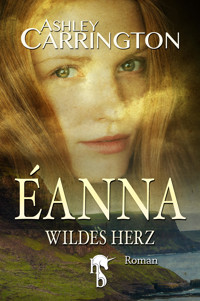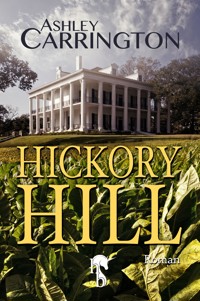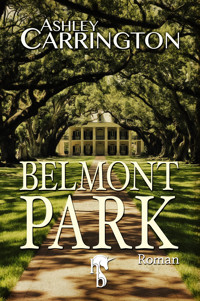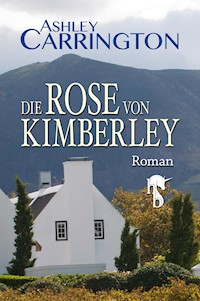
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Südafrika am Ende des 19. Jahrhunderts: Die 19jährige Rose Brandon macht sich aus ihrer wohlbehüteten Heimat in England auf ins südafrikanische Kimberley, um dort ihrem verwitweten Vater nach einem Herzanfall zur Seite zu stehen. Doch bevor sie in der Diamantstadt ankommt, lernt sie auf ihrer Reise den charmanten und gut aussehenden Richald Hamilton kennen, zu dem sie sich schnell hingezogen fühlt. Ihr Vater merkt, dass es mit ihm bald zu Ende gehen wird und hat indessen ganz andere Pläne: Um seine Tochter in guten Händen zu wissen, möchte er Rose mit Lawrence Gladstone, seinem jungen Geschäftspartner verheiraten. Rose muss sich zwischen beiden Männern entscheiden, und die Zeit läuft ihr davon, denn ihrem Vater geht es immer schlechter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Ashley Carrington
Die Rose von Kimberley
Roman
For Axel and Linda May love and devotion be the guiding star in your life.
Wenn ich die Sprache der Menschen und Engel redete, hätte die Liebe aber nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte; wenn ich alle Glaubenskraft besäße und damit Berge versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts … Jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe – diese drei; doch am größten unter ihnen ist die Liebe.
Das Hohelied der Liebe
1. Korinther
1
Was für ein Land! Welch eine fremde, erschreckende Welt, in die der rußspeiende, monoton dahinratternde Zug sie seit zwei Tagen und Nächten immer tiefer hineinführte, über weite Strecken hinweg mit zermürbender Langsamkeit, doch unaufhaltsam. Und hier in dieser staubigen, hitzeflirrenden Öde sollte es eine regelrechte Stadt geben, die Kimberley hieß und sich prahlend auch Diamond City nannte?
Rosemarie Brandon erschien das Ziel ihrer Reise an diesem hochsommerlichen Januarmorgen noch unwirklicher als vor drei Tagen, als sie und Emily Mitford im Hafen von Kapstadt von Bord des britischen Postdampfers HMS Bristol Blossom gegangen waren und ihren Fuß auf den afrikanischen Kontinent gesetzt hatten. Denn wohin ihr Auge auch blickte, die sonnendurchglühte Halbwüste der Großen Karroo erstreckte sich von Horizont zu Horizont wie ein zu Dreck erstarrter Ozean. Nichts als rotbraune, steinige Erde mit ein wenig spärlicher Vegetation. Hier und da gab es Flecken mit verdorrtem Gras, niedriges Dornengestrüpp und gelegentlich einen Kameldornbaum oder eine einsame Schirmakazie. Und über dieser trostlosen, scheinbar menschenleeren Halbwüste spannte sich ein Himmel, der so grenzenlos hoch und weit und von einer solch intensiven Bläue war, dass es sie erschreckte. So als hätte die Welt an diesem öden Ort ihr schützendes Dach verloren und schaute direkt in die Ewigkeit. All das wäre selbst ohne die gnadenlose Sonne schon mehr als genug gewesen, um eine bislang wohlbehütete junge Frau aus dem fernen England aus ihrem auch so schon wenig gefestigten inneren Gleichgewicht zu bringen, war sie doch an die lieblichen Landschaften Somersets mit seinen dichten Wäldern, fruchtbaren Feldern und Äckern und seinen wogenden, grasbedeckten Hügelketten gewöhnt. Achtzehn Jahre und viereinhalb Monate hatte sie sich, bis auf eine Sommerreise nach Brighton, nicht weiter als fünfzig Meilen von ihrem Elternhaus entfernt und in all dieser Zeit auch nur eine Natur gekannt, deren unterschiedliche Gesichter im Verlauf der Jahreszeiten im Großen und Ganzen von Sanftmut und Harmonie geprägt waren. Doch in diesem rauen, kargen Land besaßen die ihr so vertrauten Erscheinungen und Abläufe der Natur offenbar keine Gültigkeit mehr. Sogar die Jahreszeiten standen hier auf dem Kopf. Statt Winter herrschte jetzt Hochsommer, und im Juli, August, wenn in England die Kornfelder kurz vor der Erntezeit waren und die Erde der Äcker warm und voller Kartoffeln, kehrte in diesen südlichen Breiten der Winter ein. Doch einen richtigen Winter mit Schnee und eisigen Temperaturen über Wochen hinweg sollte es in dieser nördlichen Region der Kapkolonie noch nicht einmal geben, wie sie erfahren hatte, sondern nur eine Periode milderen Sommerwetters. Angesichts der mörderischen Hitze, unter der sie während der letzten Tage gelitten hatte, seit sie die liebliche Kapregion verlassen hatten, wunderte sie das gar nicht. Sie hatte den beklemmenden Eindruck, als herrschte hier allein eine ihr völlig unbekannte, unbarmherzige Sonne, die mit einer geradezu mörderischen Kraft vom Himmel brannte, als wollte sie jedes Gewächs und jede Kreatur versengen und auszehren, die sich ihr ins Licht zu stellen wagten.
Rosemarie Brandon erinnerte sich an ihre Albträume, die sie letzte Nacht heimgesucht hatten, und mit einem wachsenden Gefühl der Beklommenheit blickte sie durch das mit Staub und Ruß besprenkelte Zugfenster hinaus in die endlose Weite der Großen Karroo. Dabei hielten ihre Hände die kühlen, grünen Jadeperlen ihres Rosenkranzes umschlossen, der in ihrem Schoß lag. Ihr war, als wären ihr einzig Emily Mitford und dieser kostbare Rosenkranz, der ihrer Mutter gehört hatte, in dieser bestürzend fremden und sonnenverbrannten Welt als Stütze geblieben.
Wieso hatte das Schicksal sie ausgerechnet an diesen fernen, ungastlichen Ort führen müssen? Was hatte sie in Afrika, im südlichsten Zipfel des schwarzen Kontinents, in der Kapkolonie zu suchen? Und dann auch noch in einer angeblichen Stadt, die da draußen irgendwo im glutheißen Nirgendwo der Halbwüste lag?
Sie seufzte unwillkürlich, kannte sie die Antwort auf diese Fragen doch nur zu gut. Und im selben Augenblick schämte sie sich ihres inneren Aufbegehrens. Denn der Grund, warum sie diese beschwerliche Reise unternommen hatte, war gewichtig genug, dass er sie notfalls auch bis ans Ende der Welt geführt hätte.
»Es dauert nicht mehr lange. Gleich bin ich fertig, Rosemarie«, sagte Emily Mitford hinter ihr, die ihr Seufzen auf sich und ihre Arbeit bezogen hatte. »Schneller ging es aber nun wirklich nicht. Ein viersträngiger Zopf will sorgfältig geflochten sein, wenn er etwas hermachen soll.«
»Ach, deshalb habe ich nicht geseufzt, Emily«, erwiderte Rosemarie ihrer Zofe, während der Zug einer jener lang gezogenen Kurven folgte, die den Schienenstrang in der Karroo ganz selten einmal von seiner ansonsten schnurgeraden Bahn brachten. Sie erhaschte einen Blick auf die Lokomotive, die schmutziggraue Qualmwolken ausstieß, sowie auf die beiden Kohlentender und die vorderen Waggons der zweiten und dritten Klasse, wo die weniger zahlungskräftigen Passagiere mit ihrem teilweise sperrigen Gepäck die Reise auf harten Holzbänken ertragen mussten.
»Du sorgst dich um deinen Vater, nicht wahr?«
»Ja«, antwortete Rosemarie Brandon, obwohl es das nicht allein war, was sie bedrückte. Natürlich quälte sie die Sorge um ihren Vater, seit das Telegramm von Onkel Rupert Thorndike aus Kimberley vor nicht einmal vier Wochen bei ihnen in Bath eingetroffen war und sie zu einem überstürzten Reiseantritt gezwungen hatte.
»Das verstehe ich nur zu gut. Aber mittlerweile sollte begründete Zuversicht an die Stelle der Sorge treten. Hat Mister Lawrence Farrington uns denn in Kapstadt nicht mit hoffnungsvollen Nachrichten begrüßt, mein Kind?«, erinnerte Emily Mitford sie, um sie aufzumuntern. »Es war wirklich sehr freundlich von ihm, sich der nicht eben geringen Mühe zu unterziehen, aus Kimberley anzureisen, uns in Kapstadt in Empfang zu nehmen und uns auf dieser Zugfahrt zu begleiten. Und wie er sagte, hat sich dein Vater mittlerweile doch schon recht gut von dem Schlaganfall erholt. Sollten wir dafür nicht von Herzen dankbar sein?«
»O ja. Und das bin ich auch. Dem Himmel sei Dank, dass es Dad wieder besser geht!« Rosemarie hob das silberne Kreuz des Rosenkranzes schnell an ihre Lippen. Nur zu gut waren ihr die schrecklich langen Wochen der Überfahrt noch in Erinnerung, eine Zeit der Sorge und der quälenden Ungewissheit, ob ihr Vater überhaupt noch am Leben sei oder ob vielleicht nicht schon längst ein Grab in Kimberley auf sie wartete, auf dessen Stein der Name ihres Vaters gemeißelt stand. Und dann die befreiende Nachricht in Kapstadt an der Gangway, dass ihr Vater sich erholt habe und sich auf dem Weg der Besserung befinde. Sie hatte vor dem fremden Mann nicht in Tränen ausbrechen wollen, doch ihr Wille war nicht so stark gewesen wie ihr Gefühl der Erlösung und Dankbarkeit, dass ihre Gebete erhört worden waren.
»Aber?«, fragte Emily Mitford, während ihre Finger geschickt das kunstvolle Flechtwerk mit Rosemarie Brandons kastanienbrauner Haarflut fortsetzten. »Oder habe ich mir dein stummes Aber nur eingebildet?«
»Ach, Emily«, sagte Rosemarie und lächelte unwillkürlich. »Habe ich dir jemals etwas vormachen können?«
Emily Mitford schmunzelte. »Nun, häufig genug hast du es versucht. Aber allzu fruchtbar sind deine Bemühungen, mir Sand in die Augen zu streuen, nie gewesen, wie einfallsreich du oftmals auch warst.«
»Hätte ich eine Zwillingsschwester gehabt, sie hätte mich kaum besser kennen können, als du es tust, Emily«, räumte Rosemarie mit einer Mischung aus Wehmut und tiefer Zuneigung ein.
»Daran hege ich nicht den geringsten Zweifel«, stimmte Emily ihr sanft zu. Sie war gleich am Tag nach Rosemaries Geburt, die für ihre Mutter eine schwere gewesen war, ins Haus der Brandons gekommen, ein schüchternes Mädchen von sechzehn Jahren, pausbäckig, mit breiten Hüften und unerfahren, aber voll guten Willens und mit viel Liebe, sehnsüchtig darauf wartend, dass irgendjemand Anspruch darauf erhob und die schmerzliche Leere in ihrem Herzen füllte, die sechzehn Jahre in einem Waisenhaus hinterlassen hatten. Und genau das hatte Rosemarie getan. Wie ein Schwamm hatte sie ihre Liebe aufgesogen und ihr damit, ohne es selbst zu ahnen, das größte Geschenk ihres Lebens gemacht.
Zwölf Jahre war sie ihr Kindermädchen und ihre Vertraute gewesen, ja fast so etwas wie eine Schwester. Denn der Mutter ihres Zöglings war es nach der ersten lebensbedrohlichen Niederkunft nicht mehr möglich gewesen, weiteren Kindern das Leben und ihrer geliebten Tochter Geschwister zu schenken. Auch hatte ihre kränkelnde, schwermütige Natur sie oft und lange gezwungen, das Bett zu hüten. Und dann hatte sie, Emily, den Haushalt der Brandons am Stadtrand von Bath verlassen, um als Ehefrau des Zimmermanns George Mitford eine eigene Familie zu gründen. George und ihr waren jedoch nur zwei glückliche Jahre vergönnt gewesen. Ein tragischer Unfall auf einem hohen Baugerüst hatte sie an einem stürmischen Herbsttag zur kinderlosen Witwe gemacht und sie jäh ihres Traums vom eigenen Familienglück beraubt. Anderthalb Jahre später war Rosemaries Mutter gestorben und Charles Brandon, der viel beschäftigte Vater, hatte sie gebeten, wieder zu ihnen zurückzukehren und seiner Tochter nun als Zofe und freundschaftliche Gesellschafterin zu Diensten zu sein. Sie hatte nicht eine Sekunde überlegen müssen, um zu wissen, wie sie sich entscheiden sollte. Ebenso wie sie nun Jahre später auch nicht einen Wimpernschlag lang unsicher gewesen war, ob sie die Strapazen und Gefahren auf sich nehmen und Rosemarie auf ihrer Reise nach Kimberley begleiten sollte. »Also, was bedrückt dich heute Morgen?«
»Dieses Land bedrückt mich«, gestand Rosemarie. »Diese … erschreckende Leere und dazu diese grelle Sonne.«
Emily Mitford seufzte nun selbst. »Ja, das kann ich dir unschwer nachfühlen. Um sich an solch eine karge Landschaft und eine derartige Hitze zu gewöhnen, bedarf es gewiss einer langen Zeit.«
Rosemarie wollte den Kopf schütteln, besann sich aber rechtzeitig darauf, dass ihr Zopf noch nicht fertig geflochten war. »Nicht in tausend Jahren würde ich mich daran gewöhnen, Emily! Und es ist mir ein Rätsel, wieso Onkel Rupert sich ausgerechnet in dieser staubigen Wildnis niedergelassen hat – und warum Dad keinen besseren Ort gefunden hat, um sich an einer Firma zu beteiligen. Warum nur hier, Emily?«
»Vermutlich weil dieses Land ebenso reich an Diamanten ist wie arm an Wasser, grünem Gras und schattigen Wäldern«, antwortete Emily nüchtern. »Und für einen weitschauenden Geschäftsmann wie deinen Vater, der im Edelsteingewerbe tätig ist, dürfte das Grund genug sein. So, das hätten wir.« Sie schloss das Ende des Zopfs mit einer Klemmspange aus Elfenbein, die einen kunstvoll geschnitzten Schmetterling darstellte.
»Geld kann nie Grund genug sein, für gar nichts!«, widersprach Rosemarie kategorisch und stellte mit Bedrückung fest, wie schnell die Sonne an Kraft gewann. Die Luft war schon jetzt warm und stickig in ihrem engen Abteil. Dabei war es doch noch früh am Morgen. Mit Schaudern dachte sie an die vielen heißen Stunden, die sie bis zu ihrem Eintreffen in Kimberley noch im Zug aushalten mussten. Was hätte sie jetzt für einen kühlen englischen Wintertag gegeben.
»Das gilt nur dann, wenn man genug davon hat«, entgegnete Emily mit gutmütigem Spott und griff zur Kleiderbürste.
»Es wird heute wieder ein schrecklich heißer Tag werden«, befürchtete Rosemarie, während sie darauf wartete, dass Emily ihr auch das letzte Härchen von den Schultern gebürstet hatte.
»Anzunehmen«, sagte Emily trocken.
»Ich hasse es, wenn ich überall feucht von Schweiß bin und das Gefühl habe, der Puder verläuft mir auf dem Gesicht!«, beklagte sie sich.
»Eine Lady wie du schwitzt nicht, wie heiß es auch sein mag, sie transpiriert bestenfalls«, korrigierte Emily sie mit tadelnder Stimme, doch ihre Augen lachten dabei. »Und dein Puder kann gar nicht verschmieren, weil wir nämlich bis auf ein paar Tupfer auf ihn verzichten werden. Eine junge Frau mit deinem Teint ist zudem auf dieses Hilfsmittel nicht angewiesen.«
»Mir soll es heute recht sein«, seufzte Rosemarie und empfand einen Moment lang Dankbarkeit, dass ihre schlanke Figur sie davon befreite, sich in ein enges Korsett zu schnüren. Sie kannte in Bath viele junge Frauen, die sich dieser Tortur noch immer unterzogen. Glücklicherweise gehörte Emily nicht zu jenen viktorianischen Frauen, die darauf beharrten, dass ein Korsett ebenso eisernes Gebot der Mode wie der Schicklichkeit sei. »Aber diese Hitze …«
Emily ließ sie nicht ausreden, sondern fiel ihr energisch ins Wort: »Wir werden ertragen, was kommt, und wir werden es genauso überstehen, wie die stürmische Überfahrt und die Tage der Zugfahrt, die schon hinter uns liegen. Sag dir, dass wir das Schlimmste geschafft haben und der Rest nicht mehr der Rede wert ist.« Sie gab ihr einen Klaps auf die Schulter. »So, und jetzt dreh dich um, und lass dich anschauen, Rosemarie.«
Ein Anflug von Gereiztheit überkam Rosemarie, während sie von dem primitiven Holzschemel aufstand, den Mister Farrington besorgt und ihr stolz wie ein prächtiges Möbelstück präsentiert hatte, und sich zu ihrer Zofe umdrehte. Wie konnte Emily bloß so gelassen sein und alles, was das Leben an bitteren Schlägen und Prüfungen brachte, mit stoischem Gleichmut hinnehmen, ohne dabei doch ihr warmherzig frohes Wesen zu verlieren? Gut, Emily besaß einen starken Glauben. Aber das allein konnte es nicht sein. Den hatte sie auch, doch ihr Glaube hinderte sie, Rosemarie Brandon, nicht daran, aufzubegehren und mit dem Schicksal zu hadern – und mit Gott. Sie fand, das sei ihr gutes Recht, wie es ja auch schon die Propheten des Alten Testaments getan hatten. Und wie waren Abraham, Mose, Jeremia und all die anderen Bibelväter mit Gott ins Gericht gegangen! Nun ja, selbst bei diesen Auserwählten hatten die Klagen und das Aufbegehren selten etwas genützt, wie sie nur zu gut wusste. Aber sie war sicher, dass sie sich dennoch um einiges besser gefühlt hatten, nachdem sie ihrem Zorn und Groll ordentlich Luft gemacht und Gott die Leviten gelesen hatten.
Doch was genau sollte sie Emily vorwerfen? Dass sie sich leichter und ohne tiefen Groll mit dem Unabänderlichen abfand? Dass sie in jeder Situation stets das Positive zu sehen und sich darauf zu konzentrieren versuchte? Dass sie Leben und Leiden ebenso als selbstverständliche Einheit ihres menschlichen Daseins akzeptierte wie Leben und Liebe, so wie die beiden Seiten ein und derselben Münze? Nein, sie wusste, dass ihr Ärger eigentlich ihr selbst galt, ihrer Unsicherheit und Ungeduld.
Deshalb meinte sie schließlich nur mürrisch: »Ich wünschte, du würdest endlich aufhören, Rosemarie zu mir zu sagen! Meine Freundinnen in Bath und sogar die Schwestern in der Konventsschule haben mich Rose genannt! Das gefällt mir viel besser. Rosemarie, das … das klingt so nach alter Jungfer.«
Emily Mitford begegnete den blitzenden bernsteinfarbenen Augen der jungen Frau, die ihre Freundin und zugleich doch auch ihre Herrin war, mit festem Blick. »Wenn deine Mutter gewünscht hätte, dass alle Welt dich Rose nennt, hätte sie dich sicherlich selbst so genannt. Doch sie hat dich auf den schönen Namen Rosemarie taufen lassen, und ich kann mich nicht entsinnen, dass sie dich auch nur ein einziges Mal nicht so gerufen hätte. Oder kannst du mit anderen Erinnerungen aufwarten?«
Nein, das konnte sie nicht. Und fast hätte Rosemarie wütend mit dem Fuß aufgestampft, der in geschnürten Stiefeletten aus feinstem schwarzem Leder steckte. »Warum musst du bloß immer recht behalten?«, grollte sie.
Die Zofe lächelte nachsichtig. »Weil ich mich gewöhnlich nicht in eine Diskussion über Dinge einlasse, die offensichtlicher Natur sind und keiner Auslegung bedürfen. Und was die alte Jungfer betrifft …«
Emily Mitford machte eine kurze Pause und musterte Rosemarie, die in einem maronenfarbenen Reisekostüm vor ihr stand, als hätte sie zum ersten Mal Gelegenheit, ihre Erscheinung bewusst in sich aufzunehmen. Nicht einmal der sehr konservative Schnitt der Kleidung vermochte die überaus reizvollen weiblichen Rundungen ihres Schützlings zu verbergen. Ihr Gesicht konnte man zwar nicht als bildhübsch bezeichnen, wenn man das derzeitige Schönheitsideal zum Maßstab nahm, was aber ihrer Überzeugung nach sowieso nur für die ganz Einfältigen im Geiste beiderlei Geschlechts von Belang war, es besaß jedoch zweifellos einen überaus ansprechend natürlichen, ja sogar apart zu nennenden Ausdruck, woran auch die wenigen Sommersprossen auf Nase und Wangen nichts änderten. Worauf ihr Schützling außerdem noch ganz besonders stolz sein konnte, das waren ihre makellose Haut, der bernsteinfarbene Glanz ihrer Augen und ihr prächtiges volles Haar, das den rotbraunen Ton polierter Kastanien besaß.
»… tja, also was die alte Jungfer betrifft«, fuhr sie schließlich mit einem Lachen in der Stimme fort, »würde nicht einmal der hässlichste Name der Welt, so es denn einen solchen gibt, dich auch nur einen Flohsprung weit dem Schicksal einer solchen näher bringen.«
»Ein Flohsprung! Du bist unmöglich, Emily!«, rief Rosemarie und ihre Verdrossenheit löste sich in einem belustigten Lachen auf.
In dem Moment klopfte es an der Tür.
»Ja, bitte?«, rief Emily, die in dem engen Abteil auf der Seite zum Gang stand.
»Miss Brandon? … Missis Mitford?« Es war die reservierte Stimme von Lawrence Farrington, die durch die Mahagonitür zu ihnen drang.
Emily warf Rosemarie einen fragenden Blick zu und öffnete dann auf ihr Nicken hin die Tür. »Einen guten Morgen, Mister Farrington«, grüßte sie ihn und Rosemarie zwang ein freundliches Lächeln auf ihre Lippen, als auch sie ihm einen guten Morgen wünschte.
Lawrence Farrington war zweifellos eine recht attraktive Erscheinung, wie selbst Rosemarie in Gedanken zugeben musste. Klare Linien und ebenso klare Augen von graublauer Farbe zeichneten sein Gesicht aus. Das leicht wellige schwarze Haar trug er nach hinten gekämmt, benutzte offenbar jedoch keine Pomade – oder aber so geschickt, dass weder ein künstlicher Glanz auf seinem Haar noch ein penetranter Geruch dies verriet. Wenn er lächelte, was höchst selten der Fall war, zeigte er makellose Zähne. Von Statur weder zu kräftig noch zu hager, bot er in seinem dreiteiligen taubengrauen Anzug und der dezenten, quer gestreiften Seidenkrawatte den Eindruck eines kultivierten und im Umgang überaus angenehmen Mannes. Bis man ihn dann näher kennengelernt hat!, fügte Rosemarie im Stillen hinzu. Dass er vor einem Monat seinen zweiunddreißigsten Geburtstag gefeiert hatte, wusste sie aus den Briefen ihres Vaters. Sie fand jedoch, dass er jünger aussah. Und sie fragte sich an diesem Morgen erneut, wieso ihr Vater ausgerechnet einen so unleidlichen jungen Mann wie Lawrence Farrington schon vor fünf Jahren zu seinem Partner gemacht hatte. Und wieso hieß die Firma der Diamantenhändler in Kimberley Farrington, Brandon & Nash statt Brandon, Farrington & Nash? Sie hatte sich bisher nie Gedanken darüber gemacht, weil sie bisher noch keinen von Vaters Geschäftspartnern aus der Kapkolonie kennengelernt und sich auch nicht dafür interessiert hatte. Doch seit ihrer Ankunft in Kapstadt, als Lawrence Farrington sie kühl begrüßt und ihr in denkbar knappster Form mitgeteilt hatte: »Ihr Vater lebt, Miss Brandon. Er befindet sich außer Lebensgefahr, und er vermochte mit mir zu reden, bevor ich abreiste. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Alles Weitere werden Sie von Doktor Talbot in Kimberley erfahren!«, ging ihr diese Frage nicht mehr aus dem Kopf.
»Einen guten Morgen, Missis Mitford … Guten Morgen, Miss Brandon«, erwiderte ihr Reisebegleiter mit steifer Förmlichkeit. Und sein verschlossenes Gesicht ließ einen eher glauben, dass ihm in Wirklichkeit nichts ferner lag, als ihnen einen guten Tag zu wünschen. »Ihr Tisch ist bereit. Wenn ich Sie also zum Frühstück in den Speisesalon bitten darf …«
»Sehr freundlich von Ihnen, Mister Farrington«, bedankte sich Emily mit einem Lächeln. »Geben Sie uns nur noch einen Moment.«
Lawrence Farrington blickte gleichgültig an ihnen vorbei und deutete eine knappe Verbeugung an. »Natürlich. Ich warte im Gang.« Damit wandte er sich abrupt um und entfernte sich, ohne eine Antwort abzuwarten.
Emily schloss die Tür und Rosemarie verzog das Gesicht, als hätte sie auf eine Zitrone gebissen. »Dieser Stiesel! Steifer und unnahbarer als er kann auch ein Gardesoldat vor dem Buckingham-Palast nicht sein. Ja, nicht einmal die päpstliche Vatikanwache.«
»Schau mich an, und halte deine lose Zunge im Zaum!«, wies Emily sie zurecht, die Puderdose in der Hand. »Mister Farrington mag nicht der zugänglichste und geselligste Mann in diesem Zug sein, aber er ist der Einzige, der sich unser angenommen hat und gewissenhaft dafür Sorge trägt, dass es uns an nichts mangelt.«
»In diesem elenden Bummelzug mangelt es uns an allen Ecken und Enden!«, widersprach Rosemarie verdrossen.
»Ich rede von Dingen, die zu arrangieren Mister Farrington nach menschlichem Ermessen fähig ist, wie etwa einen Tisch in dem ständig überfüllten Salonwagen oder Extrarationen Wasser und derartige Sachen«, hielt Emily ihr vor, um dann mit zurechtweisendem Spott fortzufahren: »Dagegen erwarte ich von ihm nicht, dass er uns einen eigenen Salonwagen herbeizaubert oder der Sonne gebietet, gefälligst weniger heiß vom Himmel zu brennen, wie du es offenbar tust.«
»Gut, er bemüht sich sehr«, räumte Rosemarie widerwillig ein. »Aber er macht es auf eine recht unangenehm unpersönliche Art, als ginge es nur darum, eine lästige Pflicht zu erfüllen.« In Gedanken führte sie ihre Klage noch fort: Und als wäre ich jemand, der die Krätze hätte und den man sich deshalb besser vom Leib hält.
»Ach nein!« Emily klappte den Deckel der Puderdose zu und stemmte die Hände in die Hüften. »Würdest du es denn als ein Vergnügen empfinden, innerhalb einer Woche diese Strecke zweimal mit dem Zug zurückzulegen, nachdem du doch schon eine Fahrt kaum zu überstehen glaubst?«
Rosemarie sah ihre Zofe verblüfft an und winkte dann resigniert ab. »Ich gebe es auf, Emily. Du hast gewonnen. Vergiss, womit ich dir mal wieder die Ohren vollgeklagt habe und lass uns zum Frühstück gehen.« Sie hatte schon die Hand auf der Türklinke, als sie es sich nicht verkneifen konnte, noch bissig hinzuzufügen: »Es wird sicherlich wieder ungenießbar sein, was aber ja ganz ausgezeichnet zu unserem reizenden Reisebegleiter passt!«
2
Das Frühstück konnte man in der Tat nur als ungenießbar bezeichnen, wie Emily ihr wenig später insgeheim recht geben musste. Serviert wurde bloß ein einziges Gericht, das sich Digger’s Delight nannte. Doch statt des verheißenen Frühstück-Entzückens gab es eine ausgesprochene Zumutung, wie die beiden Frauen fanden. Das teilweise noch glibberige Rührei schwamm in einer Pfütze von Hammelfett, die gerösteten Speckwürfel bestanden überwiegend aus zäher Schwarte, die Kartoffeln waren matschig und das Brot schmeckte wie ein Schwamm aus Teig. Zu allem Übel gab es keinen Tee mehr, sondern nur noch Kaffee, eine pechschwarze Brühe mit dem bitteren Geschmack von Blech und Mandelsäure.
Rosemarie stocherte in ihrem Essen herum und hatte Mühe, sich ihren Ekel nicht anmerken zu lassen, dass ihr Gegenüber, Lawrence Farrington, diesen in ihren Augen ungenießbaren Fraß ohne eine Spur von Widerwillen zu sich nahm.
Als er ihren Blick auf sich ruhen spürte, hielt er innen und schaute sie an. »Ihr Appetit scheint heute Morgen nicht sehr ausgeprägt zu sein, Miss Brandon«, sagte er in bedauerndem Ton. »Ich will doch nicht hoffen, dass Sie sich unwohl fühlen.«
Rosemarie konnte keinen Spott aus seiner Stimme heraushören und sein Gesicht war so kühl und verschlossen wie immer. Doch sie hätte schwören mögen, dass er sich hinter dieser Maske der Unnahbarkeit über sie lustig machte. »Das ist er in der Tat nicht«, erwiderte sie bissig. »Wer immer für dieses unsägliche Essen verantwortlich ist, er muss an Menschen mit einem ganz eigenen, um nicht zu sagen erstaunlich strapazierfähigen Geschmacksempfinden und Magen gedacht haben. Aber ich freue mich, dass es Ihnen wenigstens schmeckt, Mister Farrington.«
Lawrence Farrington verzog nicht eine Miene. »Von Schmecken kann buchstäblich nicht die Rede sein, verzichte ich doch bei dieser Art von Gerichten prinzipiell darauf, beim Essen durch die Nase zu atmen. Wie Sie sicherlich wissen, ist das Geschmacksempfinden dann so gut wie ausgeschaltet«, entgegnete er reserviert und als hätte er ihren bissigen Spott überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. »Bei den Mahlzeiten im Zug geht es generell weniger um persönlichen Geschmack als um reine Nahrungsaufnahme zur Erhaltung der Kräfte. Es sei denn, man begibt sich mit seinem eigenen Pullmanwagen samt persönlichem Koch auf Reisen.«
Emily Mitford lachte kurz auf. »Nahrungsaufnahme zur Erhaltung der Kräfte – das ist wirklich gut, Mister Farrington«, zeigte sie sich amüsiert.
»Sagten Sie nicht, wir werden heute am späten Nachmittag in Kimberley eintreffen? Nun, ich werde kaum von Auszehrung bedroht sein, wenn ich mich bis dahin mit trockenem Zwieback und Wasser zufriedengebe«, erklärte Rosemarie spitz.
So etwas wie die Andeutung eines Lächelns zeigte sich kurz auf dem Gesicht ihres Reisebegleiters. »Wenn man diese Strecke ausgerechnet in der Woche zweimal hinter sich bringt, in der es der Eisenbahndirektion einfach nicht gelingen will, die vakante Stelle des Zugkochs zufriedenstellend zu besetzen, dann ist es nicht ratsam, jedes Essen ausfallen zu lassen, das den eigenen Ansprüchen nicht gerecht wird«, erwiderte er sarkastisch. »Es sei denn, man besitzt die Konstitution eines Fakirs oder Bettelmönchs. Keines von beidem ist mir gegeben, wobei ich es dahingestellt sein lassen möchte, ob ich das bedauern soll oder nicht.« Touché, meine vorwitzige Rosemarie!, dachte Emily und warf ihr einen Seitenblick zu, der sie zu mehr Selbstbeherrschung und Höflichkeit ermahnte.
Rosemarie spürte, wie ihr das Blut heiß ins Gesicht schoss, und sie wünschte, sie hätte der Versuchung widerstanden, ihm diesen Stich zu versetzen, der sich nun wie eine Ohrfeige gegen sie selbst gewandt hatte. »Wir hätten eben ein paar Tage am Kap bleiben sollen«, lenkte sie schnell von ihrer unglücklichen Bemerkung ab. »Kapstadt hat einen angenehmen Eindruck auf mich gemacht, mit all den herrlichen Palmen und Parkanlagen und den imposanten Bergen rundherum. Und dazu das bunte, geschäftige Treiben. Auf diese Stadt kann die Kapkolonie gewiss stolz sein.«
»Mag sein, doch ich würde nicht einen halben Penny für diese lausige Stadt geben!«, lautete seine spontane und erstaunlich grobe Entgegnung.
»So? Und warum nicht?«, hakte Rosemarie sofort nach, da sie plötzlich das Gefühl hatte, einen Blick auf den Lawrence Farrington werfen zu können, der sich ihr bisher hinter einem Visier aus steifer Höflichkeit und Unnahbarkeit verborgen hatte.
»Weil Kapstadt eine Stadt der Pharisäer ist!«, stieß er mit bitterem Groll aus. »Eine äußerlich schön getünchte Maske, die Liebreiz und tausend Tugenden verspricht. Dabei ist ihr wahres Gesicht abstoßend hässlich, geprägt von Heuchelei, Hochmut und Skrupellosigkeit!«
Rosemarie und Emily waren von seiner Antwort, die ihnen nach den Tagen wortkarger Höflichkeit wie ein Gefühlsausbruch vorkam, gleichermaßen überrascht.
»Oh!«, machte Emily, sichtlich verwirrt, was sie davon halten sollte.
Und Rosemarie brannte das Gesicht, als stünde es in Flammen. War dieses Beispiel mit der schön getünchten Maske, hinter der sich ein abstoßendes Gesicht verbarg, vielleicht sogar auf sie gemünzt? Hegte er wohl eine tiefe Abneigung gegen ihre Person? Aber nein, das konnte nicht möglich sein. Auch wenn Lawrence Farrington zu den beiden Geschäftspartnern ihres Vaters in Kimberley gehörte, so waren sie einander doch völlig fremd. Und die wenigen Gelegenheiten, bei denen sie Höflichkeiten ausgetauscht hatten, konnten unmöglich irgendeine Art von starker Antipathie in ihm geweckt haben. Es sei denn, er nahm Frauen gegenüber prinzipiell eine abweisende Haltung ein …
Lawrence Farrington blickte in ihre verstörten Gesichter und wurde sich wohl bewusst, wie sehr er mit seiner heftigen Äußerung aus dem Rahmen gefallen war. Seine Gestalt straffte sich, als müsste er sich erst wieder unter Kontrolle bekommen. Dann sagte er mit der kühlen Höflichkeit, mit der sie schon so gut vertraut waren: »Selbstverständlich steht es Ihnen völlig frei, Kapstadt mit anderen Augen zu sehen. Jeder hat seine Vorlieben und Abneigungen. Mich jedenfalls hält nichts in Kapstadt. Zudem schien es mir nicht angebracht, kostbare Zeit am Kap zu vergeuden, da Sie es doch gewiss nicht erwarten können, in Kimberley einzutreffen und Ihren Vater zu sehen.«
Das war wieder eine versteckte, verbale Ohrfeige. Rosemarie schluckte ihren Zorn hinunter. Wieso gelang es ihm bloß immer, das Gespräch so zu drehen, dass sie als diejenige dastand, die etwas falsch gemacht hatte und Schuldgefühle haben musste?
»Natürlich, Mister Farrington!«, erwiderte sie mit mühsam beherrschter Stimme, während ihre Augen ihn aber wütend anfunkelten. »Wenn es nicht wegen meines Vaters unumgänglich wäre, hätte ich nicht einmal im Traum daran gedacht, meinen Fuß in ein in jeder Hinsicht ungastliches Land zu setzen, das von den Errungenschaften der Zivilisation offenbar nur Stückwerk übernommen hat und so viel Charme und Kultur besitzt wie … wie der schwarze Heizer da vorn auf dem Kohlentender.«
Zu ihrer beider Überraschung reagierte er mit einem Lächeln, das diesmal jedoch weit mehr war als nur die höfliche Andeutung eines solchen. »Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, Miss Brandon. Afrika, und ganz besonders die Kapkolonie, ist nicht für die breite Masse geschaffen. Man muss schon aus einem ganz besonderen Holz geschnitzt sein, um hier leben und die Großartigkeit des Landes gebührend schätzen und lieben zu können«, entgegnete er süffisant, schob sein Besteck auf dem Teller zusammen und legte seine Serviette daneben. »Und jetzt bitte ich Sie, mich zu entschuldigen. Ich darf Ihnen versichern, dass ich Ihre Ansichten für überaus interessant und aufschlussreich halte und diese anregende Unterhaltung zu schätzen weiß, aber es gibt leider noch andere Dinge, denen ich meine Zeit widmen muss. Ich rechne mit Ihrem großzügigen Verständnis. Wir werden später ja wieder das Vergnügen der gemeinsamen Gesellschaft haben.« Er erhob sich, ohne eine Erwiderung abzuwarten, und nickte ihnen zu. »Miss Brandon … Missis Mitford.« Damit entfernte er sich und hatte den dicht besetzten Speisewagen Augenblicke später in Richtung Salonwagen verlassen. Dort würde er sich vermutlich wieder stundenlang hinter einer Zeitung oder einem dicken Buch verschanzen.
»Hast du das gehört?«, rief Rosemarie empört und äffte ihn nach: »Nicht für die breite Masse geschaffen! Überaus interessante und aufschlussreiche Ansichten! Also diese Unverschämtheiten, die er uns da mit seinem falschen Lächeln ins Gesicht gespuckt hat! Von wegen Heuchler und Pharisäer in Kapstadt! Wenn einer ein Heuchler ist, dann doch wohl er! Seine letzten Bemerkungen grenzten fast schon an Beleidigung. Nein, sie waren eine!«
»Sie waren in der Tat recht doppeldeutig und nicht ohne eine gewisse sarkastische Schärfe, aber …«
»Genau das meine ich ja!«, erregte sich Rosemarie. »Diese süffisante Wortverdreherei und Frechheit …«
»Hast du mehr als einmal herausgefordert«, unterbrach Emily sie.
»Nun mach aber mal einen Punkt!«, protestierte Rosemarie ungehalten. »Ich lasse mich doch nicht von diesem selbstgerechten, blasierten Kerl wie eine dumme Gans aus der Provinz behandeln!«
»Wie man in den Wald ruft, so schallt es heraus.«
»Ach was!« Rosemarie fegte den Einwand ihrer Zofe mit einer gereizten Handbewegung hinweg. »Auch wenn ich mich nicht zu den Suffragetten und neuen Chartisten zähle, die für uns Frauen dieselben Rechte verlangen, die Männern zugebilligt werden, und die dafür auf die Straße gehen, so sympathisiere ich doch in vielem mit ihnen und lasse es mir nicht bieten, wenn mich jemand wie ein unmündiges Kind behandeln will. Zudem schuldet er mir, der Tochter des Mannes, der ihn zum Partner gemacht hat, doch zumindest einen gebührenden Respekt. Oder ist das vielleicht auch zu viel verlangt?«
An den Nachbartischen wandten sich mehrere Passagiere zu ihr um und bedachten sie mit interessierten, teils auch spöttischen Blicken.
»Du magst es nicht hören wollen, aber du hast wahrhaftig keinen Grund, dich so zu echauffieren und Mister Farrington etwas vorzuwerfen«, entgegnete Emily Mitford unbeugsam. »Immerhin hast du ihn ja wohl zuerst beleidigt.«
»So? Das ist mir aber neu!«
»Ja, als du die Kapkolonie, die ja bekanntlich seine Heimat ist, ein ungastliches Land mit nur einem Stückwerk an Zivilisation genannt und dann auch noch ihm persönlich und allen anderen Einwohnern den Charme und die Kultur eines Kohlenschauflers attestiert hast«, hielt Emily ihr vor. »Hättest du die Güte, mir zu verraten, was du damit bezweckst? Und ob du nach solch bitterbösen Bemerkungen etwa noch erwartest, dass er dir verzückt in die Augen blickt und dir für deine reizenden Worte überschwänglich dankt? Ich bitte dich, Rosemarie!«
Rosemarie konnte nicht umhin, einzugestehen, dass ihre Äußerungen kaum dazu angetan gewesen waren, Lawrence Farrington versöhnlich zu stimmen. »Er hat mich gereizt und dazu herausgefordert«, verteidigte sie sich mürrisch. »Und überhaupt soll er mir weder verzückt in die Augen blicken noch mich sonst wie mit Überschwang bedenken. Er soll mich gefälligst in Ruhe lassen!«
»Aber das war dir doch in den letzten Tagen auch nicht recht«, erinnerte Emily sie.
Rosemarie warf ihrer Zofe einen geplagten und um Nachsicht flehenden Blick zu. »Musst du denn immer so penetrant genau sein und alles auf die Goldwaage legen? Das Essen ist eine Katastrophe, mir ist entsetzlich heiß, und ich bin die endlose Zugfahrt durch dieses grässliche, elend öde Land leid!«
»Kurzum: Du willst zurück nach Bath«, folgerte Emily mit einem versteckten Schmunzeln.
»Ja! Und das lieber heute als morgen!«
»Tja, mein Kind, das geht leider nur auf dem Weg über Kimberley, egal, was der Allmächtige für deinen Vater und für uns vorgesehen hat.«
Rosemarie wusste erst nicht, was sie auf diese nüchterne Feststellung erwidern sollte, und blickte einen Moment mit finsterer Resignation drein. »Na, in der göttlichen Vorsehung muss es aber einen ganzen Haufen von freien Stellen geben. Denn dass Er so herzlos sein soll, diesen aufgeblasenen Farrington für mich vorgesehen zu haben, kann ich beim besten Willen nicht glauben«, murmelte sie schließlich, erhob sich mit einem energischen Ruck und zog das Schiebefenster in der Hoffnung auf kühlen Fahrtwind herunter. Doch statt von frischer Luft umweht zu werden, drang die Wärme wie die heiße Woge aus einem Backofen in den Waggon ein. Ihr flog Sandstaub in die Augen und Rußpartikel hinterließen hässliche Flecken auf den hellen Samtrevers ihrer Kostümjacke. Sie tupfe sich mit der Serviette die Tränen aus den Augen und den Schweiß von der Stirn.
Oh, wie sie dieses Land hasste!
3
Zur frühen Mittagsstunde saß Rosemarie mit Emily im hinteren Teil des Salonwagens, der ihrer Überzeugung nach diese Bezeichnung so wenig verdiente, wie sie Lawrence Farrington glattweg absprach, ein Gentleman zu sein. Sie hatte in England in Magazinen von den überaus bequemen und luxuriös eingerichteten Pullmanwagen gelesen, die in den Vereinigten Staaten sogar transkontinentale Eisenbahnreisen erträglich machten und seit geraumer Zeit auch in Europa und Afrika Einsatz fanden. Und so war sie denn in Kapstadt davon ausgegangen, dass im Kimberley-Zug die Waggons der ersten Klasse einen ähnlich komfortablen Standard bieten würden wie jene Pullmanwagen, von denen sie gelesen und Abbildungen gesehen hatte.
Wie groß war ihre Enttäuschung auf dem Bahnhof von Kapstadt gewesen, als Lawrence Farrington sie in den Zug geführt hatte. Ihr Schlafabteil hatte sich als stickige winzige Kammer mit durchgelegenen Betten entpuppt, die wie billige Feldpritschen aufgehängt waren. Der Speisewagen konnte samt seiner hastig zusammengestellten und offensichtlich völlig unfähigen Küchencrew nur als Katastrophe bezeichnet werden, und der Salonwagen bot den schäbigen Komfort, den man im heruntergekommenen Wartezimmer eines trunksüchtigen Arztes oder Rechtsanwalts fand, der längst das Vertrauen seiner Nachbarschaft verloren hat und nur noch von ahnungsloser Zufallskundschaft lebt.
Dennoch gab es keinen angenehmeren Aufenthaltsort im Zug als ebendiesen muffigen Salonwagen, trotz seiner abgescheuerten Sitzpolster, der verblichenen Vorhänge und der schadhaften Wandvertäfelung. Es war sozusagen das kleinste der zahlreichen Übel, mit denen sich die Passagiere auf dieser Fahrt herumschlagen mussten, denn hier hatte man längst alle Fenster weit aufgerissen. Es war mittlerweile so heiß geworden, dass niemand mehr etwas darauf gab, ob nun Sandstaub und Rußpartikel in den Waggon wehten und sich in Haar und Kleidung festsetzten. Die einzige Alternative wären Atemnot und Hitzschlag gewesen. So machte der warme Fahrtwind aus der vorher lebensbedrohlichen Tortur eine Qual, die man jedoch überstehen würde, wenn auch reichlich zerzaust, verschwitzt und eingestaubt.
Lustlos blätterte Rosemarie in einem Monate alten Modejournal, während Emily neben ihr in eine Handarbeit vertieft war, die ihre ganze Aufmerksamkeit forderte. Schließlich legte sie das Magazin mit einer ärgerlichen Bewegung weg und suchte nach einer besseren Ablenkung. Ihr Blick fiel dabei ausgerechnet auf Lawrence Farrington, der schräg vor ihr in der Mitte des Salons saß. Zwar hatte auch er sich mittlerweile seiner Anzugjacke entledigt, doch Weste und Krawatte saßen noch so perfekt wie am frühen Morgen. Und im Gegensatz zu den meisten Passagieren, die große, dunkle Schwitzflecken unter den Armen aufwiesen und sich mit dem Taschentuch immer wieder über ihr schweißglänzendes Gesicht fuhren, waren bei Lawrence Farrington keine Anzeichen übermäßiger Transpiration zu erkennen. Man musste schon sehr genau hinsehen, um auf seiner Stirn einen hauchdünnen Film feinster Schweißperlen zu entdecken. Von irgendwelchen hässlichen Schwitzflecken auf seiner Kleidung konnte bei ihm jedoch nicht die Rede sein. Er saß gänzlich entspannt da, war in ein Buch vertieft und schien von der brütenden Mittagshitze nicht im Mindesten berührt zu sein.
Rosemarie ärgerte sich darüber mehr als über alles andere, was sie ihm vorzuwerfen hatte, spürte sie doch nur zu deutlich, wie ihr der Schweiß den Rücken und zwischen den Brüsten hinunterrann. Sie hatte das entsetzliche Gefühl, dass die Kleidung förmlich an ihr klebte und sie nicht weit davon entfernt war, sich in Schweiß aufzulösen. Und dieses Ekel Farrington saß dort so ruhig und ohne schweißtriefendes Gesicht auf seinem Platz, als erfüllte milde Frühlingsluft den Waggon – und nicht die sommerliche Gluthitze der afrikanischen Halbwüste.
»Das ist einfach nicht fair!«, grollte sie.
»Was hast du gesagt?«, fragte Emily, ohne von ihrer Stickerei aufzusehen.
»Dass die dümmsten Bauern nur allzu häufig die dicksten Kartoffeln haben«, antwortete Rosemarie verdrossen.
Verständnislos hob Emily nun den Blick. »Kartoffeln? … Wie kommst du jetzt bloß auf Kartoffeln?«
Rosemarie ersparte sich den Versuch einer Erklärung und schüttelte nur den Kopf. Sogar für eine Unterhaltung war es ihr zu heiß. Sie schaute aus dem Fenster. Die Landschaft hatte sich nicht verändert, wenn man einmal davon absah, dass der tiefblaue Himmel einem blendend grellen Spiegel gewichen war. Noch immer dehnte sich die trostlose Weite des afrikanischen Buschlandes von Horizont zu Horizont. Die Gehöfte der überwiegend burischen Farmer, die gelegentlich in Sichtweite der Eisenbahnlinie auftauchten und für einige Minuten die Eintönigkeit unterbrachen, boten jedoch auch keine große Ablenkung. Zumeist handelte es sich bei den Farmhäusern und Nebengebäuden um plumpe, armselige Lehmhütten, sogenannte hartebeesthütten, die bestenfalls einen weißen Kalkanstrich trugen. Zu diesen Gehöften gehörten meist noch mehrere kraals aus Dornengestrüpp, wie die Buren ihre Viehgehege nannten, sowie ein Bretterturm mit einem Windrad über einem tiefen Brunnen und ein paar Rundhütten, die sich abseits des Farmhauses befanden. Diese strohgedeckten Lehmhütten waren die Unterkünfte der schwarzen Farmarbeiter und Viehhirten, die bei Buren wie Engländern nur Kaffern hießen.
Mehrmals hatte Rosemarie auch schwere Fuhrwerke gesehen, die von bis zu sechzehn schweren Ochsen mit mächtigem Gehörn gezogen wurden. Vom Zug aus hatte es immer so ausgeschaut, als bewegten sich die schwerfälligen Ochsengespanne überhaupt nicht von der Stelle. Allein die Staubfahne, die sie wie einen dreckigen Schleier hinter sich herzogen, hatte verraten, dass diese klobigen Gefährte mit ihren sechs, sieben, acht Joch Zugochsen offenbar doch vorankamen.
Zu dieser drückend heißen Mittagsstunde vermochte sie auf dem veld, wie die offene Weite des Buschlandes bei den Einheimischen hieß, jedoch weder das Windrad eines fernen Gehöftes noch ein einsames Ochsenfuhrwerk zu entdecken. Wie ausgestorben zog die Halbwüste an ihrem Fenster vorbei. Nichts als steinige Erde, Staub und kümmerliches Gestrüpp. Und dazu diese unerträgliche Hitze, als hätte jemand die Feuerluke eines gigantischen, glühend heißen Dampfkessels geöffnet!
Die Trostlosigkeit der Landschaft legte sich auf Rosemaries Gemüt. Sie wollte so gern tapfer und stark sein und sich nicht über ihr Schicksal beklagen, das sie derart abrupt aus ihrer vertrauten und beruhigend überschaubaren Welt in Bath gerissen hatte. Aber es kostete so schrecklich viel Willenskraft, sich nicht gehenzulassen und nicht völlig vor ihren beklemmenden Gefühlen der eigenen Unzulänglichkeit und Überforderung zu kapitulieren. Ihr Vater hatte den Schlaganfall überstanden und befand sich außer Lebensgefahr, wie Lawrence Farrington ihr versichert hatte. Aber was hieß das schon? Was würde wirklich in Kimberley auf sie zukommen? Und hatte sie die Kraft, mit dem, was sie in den nächsten Tagen, Wochen, ja Monaten hier in der Fremde erwartete, fertig zu werden? Ihr war zum Weinen zumute, und dass es ihr gelang, die Tränen zurückzuhalten, empfand sie als die größte Leistung, zu der sie derzeit fähig war.
Sie flüchtete sich in Gedanken an ihre Freundinnen zu Hause und nahm sich vor, ihnen gleich am nächsten Tag zu schreiben. Jane würde wissen wollen, ob sie früh genug aus Afrika zurückkam, um bei ihrer Hochzeit im Mai Brautjungfer zu sein. Und Anne, der verträumten Abenteurerin, die Expeditionsberichte verschlang wie andere Mädchen Liebesromane, musste sie unbedingt mitteilen, dass sie keinen Grund hatte, sie um diese Reise zu beneiden. Ja, und vielleicht sollte sie auch ihren beharrlichen Verehrer Steve Oxley, den Sohn des örtlichen Apothekers, mit ein paar Zeilen bedenken. Genug, um sein Interesse an ihr nicht erkalten zu lassen. Aber doch zu wenig und zu unverbindlich, um sich zu verpflichten und ihm irgendwelche Vorrechte einzuräumen. Eine diffizile Aufgabe, die sich mit etwas Geschick jedoch bewältigen ließ. An Fanny Hayes musste sie natürlich auch schreiben. Ja, unbedingt! Zwar konnte von einer Freundschaft zwischen ihnen beiden keine Rede sein, kannte sie Fanny, eine ebenso zickige wie rachsüchtige Person, doch nur oberflächlich vom sonntäglichen Kirchbesuch her. Aber Fanny besaß einen hinreißend aussehenden Cousin namens Trevor Bailey, wie sie nach der Christmette auf dem verschneiten Kirchplatz zu ihrer freudigen Überraschung erfahren hatte. Und dieser attraktive Trevor Bailey, der ihr bei der leider allzu kurzen Vorstellung mehr als nur ein höfliches Lächeln geschenkt hatte, wie sie überzeugt war, hatte seit Jahresbeginn in der Bank von Fannys Vater eine verantwortungsvolle Stellung eingenommen und war zudem noch Junggeselle. Er wohnte für eine nicht näher benannte Übergangszeit im Haus seines Onkels, wie Emily der Köchin der Hayes hatte entlocken können. Fanny hatte noch zwei jüngere Schwestern, aber keinen Bruder, und deshalb bereitete ihr Vater, wie es hieß, nun seinen Neffen darauf vor, eines Tages seine Nachfolge anzutreten. Wenn sie also Fanny von ihren Erlebnissen in einem ausführlichen und vergnüglich zu lesenden Brief berichtete, vermochte sie bestimmt recht unverfänglich einen Absatz einzufügen, in dem sie sich nach ihrem Leben in Bath und dem ihres Cousins erkundigen würde, zumal er ja mit ihr unter einem Dach lebte. Ja, und dann hatte sie gute Chancen, dass Fanny, die ja sowieso nichts für sich behalten konnte, den Brief Trevor zu lesen gab. Wenn auch er ihr Schreiben amüsant genug fand, und wenn er ihr Interesse an seinem Leben richtig deutete und sie ihm nicht gleichgültig war, dann … ach, was konnte nicht alles geschehen.
Und so träumte sich Rosemarie weg aus dem heißen Salonwagen in die winterliche Heimat im fernen Bath, wo sie mit fast jedem Gesicht und jedem Haus in ihrer Nachbarschaft von Kindesbeinen an vertraut war und wo das aufregendste Abenteuer in ihrem Freundeskreis aus einem verstohlenen Kuss oder einem heimlich zugesteckten Liebesbrief bestand – und neuerdings aus der Verlobung und bevorstehenden Hochzeit von Jane Wilkens.
Eine ganze Weile träumte sie so vor sich hin. Dann veränderten sich das Rattern und das Schwanken der Waggons und auch das Stimmengewirr im Salonwagen erhielt auf einmal einen irgendwie freudig erregten, lebendigeren Klang.
Rosemarie fuhr aus ihren Tagträumen auf und stellte zu ihrer Verwunderung fest, dass sich der Zug mit spürbar verminderter Geschwindigkeit einem breiten Fluss näherte.
»Wir haben den Modder River erreicht. Jetzt sind es bloß noch gut zwanzig Meilen und drei weitere Stationen bis nach Kimberley«, hörte sie eine Stimme sagen, worauf eine andere mürrisch erwiderte: »Ja, zwanzig Meilen und drei Stationen zu viel!«
Nun schaute auch Emily auf. »Ah, ein Fluss!« Sie rief das mit solch einer Begeisterung aus, als wäre vor ihnen die breite Flussmündung des Avon bei Bristol mit seinen klaren, tiefen Fluten aufgetaucht.
»Der Modder River macht seinem Namen ja wirklich alle Ehre«, meinte Rosemarie etwas abfällig, als der Zug gemächlich über die Holzbrücke rumpelte, die hinüber auf das Nordufer führte. Unter ihnen floss der Modder auf einer Breite von nicht mehr als hundert Yards schlammbraun und träge dahin. Ein Ochsengespann zog ein Stück flussabwärts durch die Furt, und das Wasser reichte dem Fuhrwerk gerade mal bis an die Radnabe der kleineren Räder an der Vorderachse.
Aber dennoch erfreuten der Fluss und die Ufer auch Rosemaries Auge, zumal es auf beiden Seiten des Modder River einen wenn auch schmalen, so doch erfrischend grünen Streifen aus Gras, blühenden Büschen, Weiden, Akazien und etlichen Mimosenbäumen gab. Dieser Anblick bot einen angenehmen Kontrast zu der Trostlosigkeit des rotbraunen, ausgedörrten Buschlandes.
Am Nordufer lag die Modder River Station, um die sich eine bescheidene Siedlung mit knapp zwei Dutzend Hütten und Häusern gebildet hatte. Der Zug kam an einer langen Plattform, die ein Dach aus rostigem Wellblech trug, zum Stehen. Vorn bei der Lokomotive schwang der lange Arm des Wasserturms herum, und eine Gruppe schwarzer Arbeiter begann, von einer Rampe Kohle in den Tender zu schaufeln.
Alles drängte aus dem Zug, auch die Passagiere, für die hier noch nicht das Ende ihrer Eisenbahnfahrt gekommen war. Keiner konnte es erwarten, der Enge und staubigen Hitze der Waggons zu entrinnen und für die Dauer des Aufenthalts in den Schatten eines Baumes am Flussufer zu flüchten. Rosemarie und Emily machten da keine Ausnahme. Und wie glücklich waren sie, als sie hörten, dass in Smuts Canteen gegenüber der Bahnstation kalte Getränke ausgeschenkt wurden, die aus einem tiefen, feuchten Erdkeller kamen.
Sie labten sich an wunderbar kühler, belebender Limonenlimonade, von der sich jede zwei Glas gönnte und die ihre Lebensgeister wieder weckte. Anschließend begaben sie sich im Schutz ihrer Parasols in den Schatten einer mächtigen Weide am Ufer des Modder River. Sie setzten sich ins Gras, lehnten sich gegen den Stamm des alten Baumes und hätten dort am Fluss am liebsten bis in den späten Nachmittag hinein gesessen – mit gelegentlichen Besuchen von Smuts Canteen. Denn so konnte man die Hitze einigermaßen ertragen.
Ihnen war jedoch nicht mehr als eine halbe Stunde vergönnt. Dann rief der Lokführer die Passagiere mithilfe seiner Dampfsirene zum Zug zurück.
Rosemarie und Emily waren nicht die Einzigen, die sich mit einem Stoßseufzer von ihren schattigen Plätzen erhoben und sich widerwillig auf den Weg zur Bahnstation machten. Sie waren aber mit Sicherheit diejenigen, die sich von allen am meisten Zeit ließen. Lawrence Farrington stand schon mit dem Zugaufseher auf der Plattform des Waggons und hielt nach ihnen Ausschau, als sie endlich auf dem Bohlensteg der Station erschienen. Rosemarie hätte auf seinem Gesicht liebend gern einen Ausdruck von Ungeduld und Ärger entdeckt, doch diesen Gefallen tat er ihr nicht. Mit unbewegter Miene wartete er auf sie und streckte hilfreich die Hand aus, als sie ihre Parasols zusammenklappten und ihre Röcke rafften. Allein seine zusammengepressten Lippen gaben einen Hinweis auf die Missbilligung, die offen auszudrücken er sich nicht gestattete.
»Verbindlichsten Dank«, sagte Emily und bedachte ihn mit einem Lächeln, das von Herzen kam.
»Wir wüssten wirklich nicht, was wir ohne Ihre Hilfe täten, Mister Farrington«, fügte Rosemarie mit einem theatralischen Seufzer hinzu.
»Die Vorstellung, dies herauszufinden, entbehrt nicht eines gewissen Reizes, Miss Brandon«, erwiderte er überraschenderweise mit unverhohlenem Sarkasmus und begab sich in den Salonwagen.
»Musste das denn sein?«, raunte Emily vorwurfsvoll.
Rosemarie zuckte mit den Schultern. »Ich kann nichts dafür. Irgendwie reagiere ich allergisch auf ihn. Das ist so ähnlich wie mit Juckpulver oder wenn einem Pfeffer in die Nase dringt. Ob man nun will oder nicht, man muss dann einfach niesen. Da kann man gar nichts dagegen machen.«
»Mister Farrington ist weder Juckpulver noch Pfeffer. Und du tätest wirklich besser daran, dich nicht von dummen Vorurteilen, die du gegen ihn hegst, zu derlei ungebührlichen Äußerungen verleiten zu lassen. Denn mit dieser einen Bahnfahrt wird der Kontakt zwischen dir und ihm wohl sicher nicht sein Ende finden. In Kimberley wirst du ihm kaum aus dem Weg gehen können, ist er doch Geschäftspartner deines Vaters. Die Vernunft gebietet es daher schon, dass du dir den Umgang mit Mister Farrington selbst nicht noch schwerer machst, als er es leider jetzt schon ist.«
Emily Mitford bedachte sie mit einem strengen Blick und einmal mehr wünschte sie sich, nicht nur Zofe, Vertraute und in gewisser Weise Mutterersatz für Rosemarie zu sein, sondern auch die unangefochtene Autorität einer strengen Erzieherin zu besitzen. Doch wenn man miteinander so vertraut war und einander so nahestand wie Rosemarie und sie, dann überwog das freundschaftlich-schwesterliche Verhältnis. Und das ließ keinen Platz für harsche Anordnungen und Strafpredigten, sondern erlaubte allenfalls Appelle an ihre Vernunft und an ihre eigentlich sehr ausgeprägte Großherzigkeit.
»Ich werde darüber nachdenken«, versprach Rosemarie und es tat ihr leid, Emily so bedrückt zu sehen. Deshalb schenkte sie ihr ein entwaffnendes Lächeln, wusste sie doch ganz genau, wie sie ihre treue und so herzensgute Zofe und Gesellschafterin versöhnlich stimmen konnte.
»Tu das, meine Liebe«, sagte Emily nachdrücklich. »Nur ist es mit Nachdenken allein nicht getan.«
»Ich gelobe Besserung, Emily.«
»Gebe es Gott!«, seufzte die ältere Frau. »Und jetzt entschuldige mich bitte. Nach der vielen Limonade verlangt die Natur ihr Recht, und zwar ohne weiteren Aufschub.« Sprach’s und verschwand eiligst durch die Tür im Salonwagen.
Der Zugaufseher klappte die Pforte des hüfthohen Sicherheitsgitters zu, das den Perron des Waggons umschloss, und Rosemarie wollte ihrer Zofe schon ins Innere des Zugs folgen, als sie ihren Blick noch einmal über das Buschland jenseits der Siedlung schweifen ließ. Dabei zog eine Staubwolke am südwestlichen Horizont ihre Aufmerksamkeit auf sich. Sie stutzte, beschattete ihre Augen mit der flachen Hand, um in dem grellen Mittagslicht besser sehen zu können, und spähte angestrengt zu dieser Staubfahne hinüber.
»Sie gehen besser in den Wagen, Miss«, sagte der Zugaufseher zu ihr. »Ich gebe jetzt das Signal zur Abfahrt, und gleich darauf wird Big Molly«, er deutete nach vorn zur Lok, »mächtig viel Rauch ausspucken. Der Perron hier ist dann der denkbar ungemütlichste Ort, es sei denn, man ist versessen darauf, sich räuchern und einrußen zu lassen.«
»Ich weiß Ihre Besorgnis sehr zu schätzen«, erwiderte Rosemarie freundlich, »aber ich denke, Sie sollten unserem Lokführer besser noch nicht das Signal zur Abfahrt geben.«
Der Eisenbahner, der vom Alter her gut und gern ihr Vater hätte sein können, hob die grauen Augenbrauen. »Und weshalb nicht, Miss?«
»Mir scheint, da will noch jemand diesen Zug erreichen, Mister«, antwortete sie und deutete über die Blechdächer der Siedlung hinweg auf die Staubwolke, die schnell größer geworden war. »Das sieht mir nach drei Reitern aus.«
Der Zugaufseher blickte in die Richtung. »Donnerwetter, Sie müssen ja Augen wie ein Adler haben! Ich kann außer einer Staubwolke noch nichts Rechtes ausmachen«, brummte er und kratzte sich im Nacken unter dem Rand seiner Mütze.
»Es sind drei Reiter«, versicherte Rosemarie. »Zumindest kann ich drei Pferde erkennen. Und wer immer da im vollen Galopp über das veld gejagt kommt, wird bei dieser Hitze sich und seinen Pferden kaum eine solche Anstrengung abverlangen, nur um jemandem in der Siedlung einen Besuch abzustatten oder Einkäufe zu tätigen, die auch noch eine halbe Stunde länger warten können.«
»Hm, ja, Sie mögen recht haben. Niemand mit einem halbwegs gesunden Menschenverstand würde so unvernünftig sein«, räumte der Zugaufseher ein, um bissig einzuschränken: »Obwohl … in letzter Zeit scheinen eine Menge Leute ihren gesunden Menschenverstand verloren zu haben, ganz besonders in den Reihen der Politiker auf beiden Seiten der Grenze.« Er machte eine kurze Pause, kratzte sich erneut am Kopf und rang sich dann zu einem Entschluss durch. »Ich sage Ihnen, was ich tun werde. Henry, unser Lokführer, hat vorn ein Fernglas liegen, ein altes Armeeglas. Es hat einen Riss in der linken Linse, aber es tut noch seine Dienste. Ich werde rasch zu ihm laufen und ihm die Entscheidung überlassen, ob er noch zehn Minuten warten will oder nicht.«
Rosemarie lächelte. »Das ist eine gute Idee, aber wenn Sie möchten, wette ich mit Ihnen, dass es drei Reiter sind, die darauf hoffen, den Zug nicht zu verpassen«, sagte sie mit einem Augenzwinkern.
»Ich wette nicht mit jungen Damen, schon gar nicht mit solchen, die einem alten Mann mit ihren Adleraugen wenig Chancen lassen, die Wette zu gewinnen«, erwiderte er belustigt, tippte an seinen Mützenschirm und begab sich nach vorn zum Lokführer. Fünf Minuten später schwang er sich wieder zu ihr auf den Perron, das Gesicht zu einem breiten Grinsen verzogen. »Mein Riecher, dass Sie die Wette gewinnen würden, Miss, hat mich ebenso wenig getrogen wie Ihre Augen«, teilte er ihr mit. »Es sind in der Tat drei Reiter, die dort angeprescht kommen. Der gute Henry hat zwar geflucht wie ein Kesselflicker, wenn Sie mir diese Bemerkung erlauben, Miss, aber er wird warten.«
Auch Rosemarie wartete – und zwar auf der kleinen Außenplattform. Nach der langen eintönigen Fahrt und Ereignislosigkeit war ihr diese Ablenkung mehr als willkommen. Es gab etwas zu beobachten, und ihre Gedanken konnten sich eine Weile mit dem selbst gestellten Rätsel beschäftigen, wer diese drei Reiter wohl sein und woher sie kommen mochten.
Gute zehn Minuten später erreichte die kleine Reitergruppe die Modder River Station. Es handelte sich um drei Männer. Zwei von ihnen waren Schwarze, der eine ein junger Bursche, während der andere schon graue Haare zeigte, als er seinen Filzhut vom Kopf nahm und sich mit einem Tuch über Gesicht und Stirn wischte.
Obwohl Rosemarie in Bath nur gelegentlich ausritt und nicht allzu viel von Pferden verstand, sah doch auch sie auf den ersten Blick, dass es sich bei den drei Tieren um Prachtexemplare handelte. Die Pferde waren zwar nicht so hochbeinig und schlank in den Fesseln, wie Rosemarie sie von England her kannte, aber in ihren Adern floss zweifellos das Blut von Rassepferden. Trotz des gestreckten Galopps in dieser brutalen Hitze wiesen sie nur einen feuchten Schimmer auf den Flanken auf, jedoch keinen Schaum vor dem Maul.
»Erstklassige Burenpferde!«, sagte der Zugführer und schnalzte anerkennend mit der Zunge. »Diese Grobschädel können reiten wie der Teufel, das muss der Neid ihnen lassen, und die Kaffern, die von ihren Farmen kommen, stehen ihnen darin oft nicht nach. Und kein noch so reinrassiges Rennpferd, aus welchem erstklassigen europäischen Stall es auch stammen mag, kann es im veld mit Burenponys aufnehmen, mein Wort drauf, Miss.«
Während der Eisenbahner nun vom Perron stieg, beobachtete Rosemarie den Weißen, der kurz an die Spitze des Zugs geritten war, um dem Lokführer etwas zuzurufen. Nun kam er mit seinen beiden schwarzen Begleitern auf die Höhe der Waggons der ersten Klasse und sprang mit einer eleganten Bewegung, die den routinierten Reiter verriet, von seinem Pferd. Seine hochgewachsene, schlanke Gestalt steckte in Kakihosen und einem gleichfalls kakifarbenen Hemd, über dem er eine lederne, sandfarbene Weste trug. Auffallend war das lässig geknotete bunte Halstuch, das unter seinem offenstehenden Hemd zum Vorschein kam, und der speckige, breitkrempige Hut, der so typisch für die burischen Farmer war und dessen Schatten das Gesicht des Fremden verbarg.
Der Mann löste die Gurte, mit denen eine Reisetasche hinter dem Sattel seines Pferdes festgeschnürt war, und warf die Zügel dem grauhaarigen Schwarzen mit den Worten zu: »Reit mit den Pferden zu Martinus und versorge sie gut. Heute Abend bringst du sie dann nach Grootvlei zurück.«
»Ja, Mijnheer Hamilton!«, sagte der Schwarze.
Indessen hatte der Jüngere das andere Gepäck, das aus einer weiteren Reisetasche sowie einem Kleidersack aus grobem Drillich bestand, von seinem Pferd gebunden und die Zügel seines Reittiers ebenfalls dem Grauhaarigen überlassen. Er warf sich den Sack über die Schulter, nahm die Reisetasche und rief: »Wir können, baas!«
Dieser nickte ihm zu. »Gut, Cato. Wir haben den Zug auch lange genug aufgehalten. Sehen wir zu, dass wir hineinkommen!«
Der Schwarze namens Cato stieg in einen der vorderen Waggons, der allein den Schwarzen, den Kaffern, vorbehalten war, während der Zugaufseher ein paar Worte mit dem Mann in der Kakikleidung wechselte und dabei einmal mit dem Kopf zum Perron hindeutete.
Rosemarie konnte sich denken, was er dem Fremden erzählte, und sie gestattete sich ein kleines Lächeln. Das Wissen, dass sie für den längeren Aufenthalt und alles, was daraus folgte, verantwortlich war, bereitete ihr ein nicht geringes Vergnügen. So lächerlich unbedeutend ihr Eingreifen auch gewesen war, so erfuhr sie doch zum ersten Mal seit vielen Wochen wieder das erhebende Erlebnis, aus freiem Willen und nach eigenem Gutdünken etwas getan zu haben. Welch ein Unterschied zu dem bedrückenden Gefühl, ohnmächtiger Spielball eines ungnädigen Schicksals zu sein.
Mit derselben Eleganz, mit der sich der fremde Mann aus dem Sattel geschwungen hatte, erklomm er Augenblicke später den Perron. Er stellte die Reisetasche ab und nahm den Hut vom Kopf. Darunter kam ein üppiger blonder Haarschopf zum Vorschein, der ihm in sanften Locken bis über die Ohren reichte. Zudem hatte er ein ausnehmend gut geschnittenes Gesicht mit einer sinnlichen Mundpartie und die blauesten, ausdrucksstärksten Augen, die sie je gesehen hatte.
»Wie ich höre, habe ich es Ihnen und Ihrer scharfen Beobachtungsgabe zu verdanken, dass ich den Zug nicht verpasst habe«, sprach er sie mit einer ebenso männlichen wie wohlklingenden Stimme an. »Ich bin Ihnen überaus dankbar, Missis …« Leicht fragend hob er die perfekt geschwungenen Augenbrauen und neigte den Kopf dabei ein wenig, als fürchtete er, etwas Wichtiges überhört zu haben.
»Brandon … Miss Rosemarie Brandon.«
»Richard Hamilton«, stellte er sich vor. »Auch wenn Sie den Zug nicht für mich aufgehalten hätten, wäre es mir ein ausgesprochenes Vergnügen gewesen, Ihre reizende Bekanntschaft zu machen, Miss Brandon.«
Es war nicht der charmante Ton und das Kompliment als solches, was ihr gefiel, sondern wie er sie dabei ansah. Seine Augen zeigten unverhohlene Bewunderung, aber nicht auf jene kuhäugige und unterwürfige Art, mit der Steve Oxley sie stets anstarrte, als wollte er sich gleich vor ihre Füße werfen und sich ganz ihrer Gnade ausliefern. Dieser fremde Mann strahlte dabei viel mehr Selbstbewusstsein aus.
Sie lächelte, während er seine Tasche nahm und die Waggontür für sie aufhielt. »Für einen Buren, die man mir immer als ungehobelte Burschen geschildert hat, sprechen Sie unsere Sprache nicht nur ausgezeichnet, sondern Sie verstehen sich ebenfalls genauso gut auf die Kunst der charmanten Schmeichelei, Mister Hamilton.«
»Auch wenn ich unter der afrikanischen Sonne zur Welt gekommen bin, fließt doch so wenig burisches Blut in meinen Adern wie ich es bei Ihnen annehme, Miss Brandon«, erwiderte er amüsiert. »Und was die Buren ganz allgemein als Volk betrifft, so sind sie genauso ungehobelt wie unsere Bauern in Lancashire oder unsere Bergleute in Cornwall – oder so kultiviert wie unsere Landsleute, die man in den vornehmen Salons von London, Leeds und Bristol antrifft. Womit ich aber über die menschliche Qualität weder der einen noch der anderen ein Urteil gefällt haben möchte.«
»Oh, ich bitte um Entschuldigung für dieses Missverständnis«, sagte Rosemarie, errötend über ihren Fauxpas. »Wie gedankenlos von mir, Sie für einen Buren zu halten, nur weil der Zugaufseher Ihre Reitkünste gepriesen und diese als besondere Fähigkeit der Buren herausgestellt hat.«
»Wenn das so ist, bestehe ich darauf, Ihr Missverständnis als besonderes Kompliment zu nehmen, womit eine Entschuldigung gänzlich unnötig ist«, entgegnete er vergnügt und mit einer Konzilianz, die Rosemarie als ungemein einnehmend und erfrischend empfand – ganz besonders nach den grässlichen Tagen in Gesellschaft von Lawrence Farrington, dessen steife und oft genug geradezu abweisende kühle Art ihr doch sehr zugesetzt hatte.
»Dann bin ich beruhigt, Mister Hamilton.«
»Wie könnte ein Mann, der Augen im Kopf und Anstand im Leib hat, auch nur irgendetwas tun oder gar zulassen, was Sie womöglich beunruhigt?«
Bei jedem anderen hätte sie diese Schmeichelei als reichlich dick aufgetragen, ja sogar als ungehörig empfunden, kannten sie sich doch noch keine fünf Minuten. Dieser Fremde besaß jedoch eine bezaubernde Art, das, was bei anderen gekünstelt und übertrieben gewirkt hätte, ganz natürlich und dem Augenblick angepasst klingen zu lassen.