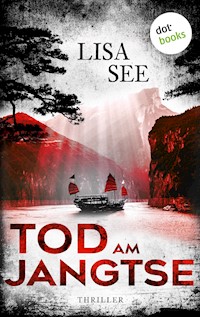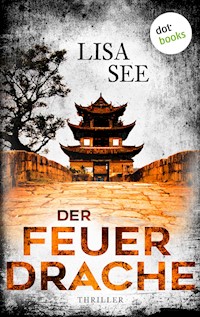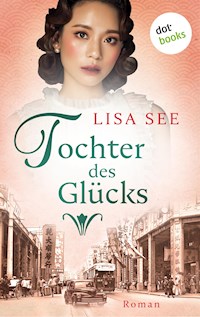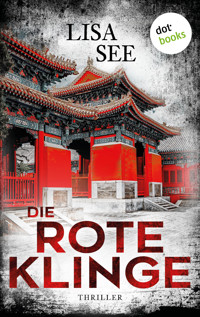
9,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Hochrangige Mordopfer und ein internationales Ermittlerteam: Der packende Thriller »Die rote Klinge« von Lisa See jetzt als eBook bei dotbooks. Wenn das zerbrechliche Gleichgewicht zwischen zwei Staaten ins Wanken gerät ... Als in Beijing der Sohn des amerikanischen Botschafters und vor der Küste Kaliforniens ein sogenannter »roter Prinz«, der zu den politischen Eliten Chinas gehört, ermordet aufgefunden werden, vermuten die Regierungen der Opfer einen Zusammenhang zwischen den Fällen. Der für ihre ungewöhnlichen Ermittlungsmethoden bekannten Inspektorin Liu Hulan und dem amerikanischen Staatsanwalt David Stark bleibt nicht viel Zeit, diesen Fall von internationaler Tragweite gemeinsam zu lösen – und so sehen sie sich bald einer brisanten Verschwörung von chinesischer Mafia, Regierungsmitgliedern und skrupellosen Wirtschaftsbossen gegenüber… »Die rote Klinge« wurde mit der »Notable Book«-Auszeichnung der New York Times und einem Platz auf der »Best Books List« der auf der Los Angeles Times ausgezeichnet – Publishers Weekly schrieb: »Komplex und spannend – dieser Debüt-Thriller ist herausragend! See kennt die subtilen und komplexen politischen und sozialen Unterschiede zwischen China und Amerika, lässt dies in die gut ausgearbeiteten Charaktere einfließen – und krönt das Ganze mit einer spannenden Handlung!« Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der fesselnde Thriller »Die rote Klinge« von Lisa See ist der erste Fall für ihr amerikanisch-chinesisches Ermittlerteam Liu Hulan und David Stark. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 590
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch:
Wenn das zerbrechliche Gleichgewicht zwischen zwei Staaten ins Wanken gerät ... Als in Beijing der Sohn des amerikanischen Botschafters und vor der Küste Kaliforniens ein sogenannter »roter Prinz«, der zu den politischen Eliten Chinas gehört, ermordet aufgefunden werden, vermuten die Regierungen der Opfer einen Zusammenhang zwischen den Fällen. Der für ihre ungewöhnlichen Ermittlungsmethoden bekannten Inspektorin Liu Hulan und dem amerikanischen Staatsanwalt David Stark bleibt nicht viel Zeit, diesen Fall von internationaler Tragweite gemeinsam zu lösen – und so sehen sie sich bald einer brisanten Verschwörung von chinesischer Mafia, Regierungsmitgliedern und skrupellosen Wirtschaftsbossen gegenüber…
»Die rote Klinge« wurde mit der »Notable Book«-Auszeichnung der New York Times und einem Platz auf der »Best Books List« der auf der Los Angeles Times ausgezeichnet – Publishers Weekly schrieb: »Komplex und spannend – dieser Debüt-Thriller ist herausragend! See kennt die subtilen und komplexen politischen und sozialen Unterschiede zwischen China und Amerika, lässt dies in die gut ausgearbeiteten Charaktere einfließen – und krönt das Ganze mit einer spannenden Handlung!«
Über die Autorin:
Lisa See entstammt einer chinesisch-amerikanischen Familie. Sie wurde in Paris geboren und wuchs in Los Angeles in Chinatown auf. Dreizehn Jahre lang arbeitete sie als Journalistin für Publishers Weekly. Später betreute sie als Kuratorin mehrere große Ausstellungen, die sich mit interkulturellen Beziehungen zwischen Amerika und China beschäftigen. Bereits ihr erstes Buch, eine Biographie ihrer Familie, war ein internationaler Bestseller und erhielt die »Notable Book«-Auszeichnung der New York Times. Dieselbe Auszeichnung bekam sie auch für ihren bald darauf folgenden ersten Thriller »Die rote Klinge«. Sie wurde als »National Woman of the Year« ausgezeichnet, erhielt den »Chinese American Museum’s History Makers Award« und den »Golden Spike Award« in Kalifornien. Mit ihrem Roman »Der Seidenfächer« gelang ihr ein Weltbestseller, der auch verfilmt wurde. Heute lebt sie in Los Angeles.
Lisa See veröffentlichte bei dotbooks bereits die historischen Romane »Der Seidenfächer« und »Eine himmlische Liebe«, außerdem »Töchter aus Shanghai« und »Tochter des Glücks« aus ihrer Reihe um »Die Frauen von Shanghai«.
Zudem erscheint bei dotbooks auch ihre Thrillerreihe um die Polizistin Liu Hulan und den Staatsanwalt David Stark mit den Bänden »Die rote Klinge«, »Der Feuerdrache« und »Tod am Jangtse«.
Die Website der Autorin: www.lisasee.com
***
eBook-Neuausgabe Dezember 2022
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1997 unter dem Originaltitel »Flower Net« bei Harper Collins, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1998 unter dem Titel »In einem Netz aus Lotusblumen« bei Droemer Knaur.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1997 by Lisa See
Translation rights arranged by The Sandra Dijkstra Literary Agency
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1998 bei Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-98690-424-1
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die rote Klinge« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Lisa See
Die rote Klinge
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Leonie von Reppert-Bismarck
dotbooks.
Für meinen Ehemann in Liebe
Kapitel 1
10. JanuarBeihai-Park
Wing Yun hielt die Hand seiner Enkelin fest umfaßt, während er sie mit langsamen, rhythmischen Gleitbewegungen über die gefrorene Weite des Beihai-Sees leitete, der unmittelbar vor den Mauern der Verbotenen Stadt lag. Am gegenüberliegenden Ufer sah Wing Yun die Junior-Eisschnelläufer von Peking ihr intensives Intervall-Training durchführen. Hinter der trainierenden Mannschaft lag, umgeben vom Dunst der Kohlerauchschwaden und in schwere, graue Wolken gehüllt, der Pavillon der Fünf Drachen und der Kleine Westliche Himmel. In der Nähe der Sportler, auf dem Spazierweg, der um den See führte, waren einige alte Leute mit Bambusbesen damit beschäftigt, die wenigen in der Nacht gefallenen Schneeflocken fortzufegen. Das feste, harte Eis unter den Kufen seiner alten Schlittschuhe und die Art, wie sich die Luft bei jedem Atemzug aufblähte und dampfte, ließen Wing Yun vermuten, daß es mindestens 15 °C kalt war und es an diesem Tag auch nicht wesentlich wärmer werden würde.
Wing blieb lieber auf dieser Seite des Sees unweit des Parkeingangs, wo sich die alte Runde Stadt an die ehemalige Festung schmiegte, die einst die Residenz des Mongolenherrschers Kublai Khan geschützt hatte. In unmittelbarer Nähe des Ufers und über eine Fußgängerbrücke erreichbar lag die Jade-Insel. Im Sommer schlenderte Wing Yun am liebsten über ihre überdachte Promenade und rastete in den Pavillons am Wegesrand. Wenn es nicht zu heiß oder zu schwül war, kletterte er dann auf den Hügel mit dem zwiebelförmigen Heiligtum im tibetischen Stil, das 1651 zu Ehren des ersten Besuchs des Dalai Lama erbaut worden war.
Wing Yun blieb mit seiner Enkelin in Hörweite der Lautsprecher. Über die gefrorene Ebene des Sees erklang altmodische Tanzmusik. Hier und da tanzten Paare Tango oder Walzer. Einige steckten kichernd die Köpfe zusammen, andere liefen händchenhaltend über das Eis. Ach, dachte Wing Yun bei diesem Anblick, wie sich die Dinge doch ändern. Als ich jung war, durfte niemand, aber wirklich niemand in der Öffentlichkeit Händchen halten. Selbst jetzt fragte er sich, was die Eltern dieser Paare wohl sagen würden, wenn sie sähen, wie dreist sich ihre Kinder vor ..., nun, vor so vielen Bürgern benehmen. Auf dem See tummelten sich lachend und miteinander scherzend zahlreiche Familien – Mama, Papa, Großeltern, Tanten, Onkel und unzählige Kinder. Sie gaben ein buntes Bild ab, eingemummelt in die altmodisch gefütterten, blauen Jacken oder in ihre farbenfrohen, westlichen Mäntel, Handschuhe und Muffs. Viele der kleineren Kinder, denen es noch schwerfiel, das Gleichgewicht zu halten, hielten sich an Holzstühlen auf Kufen fest. Strahlend ließen es sich die Großeltern gefallen, von ihren Enkeln auf solchen Stühlen umhergeschoben zu werden.
Wing Yun kannte viele der Schlittschuhläufer, obwohl auch heute, wie üblich, einige darunter waren, die sich zum ersten Mal auf das Eis wagten. So wären seine Enkelin und er beinahe von zwei unbekannten Soldaten umgefahren worden. Wing Yun verkniff sich eine Standpauke, als er merkte, daß die beiden vom Lande kamen, möglicherweise aus Südchina, und Schnee und Eis wahrscheinlich zum ersten Mal sahen.
Wing Yun und Mei Mei hatten in diesem Winter bereits viele Tage gemeinsam im Beihai-Park verbracht. Das Mädchen war ihm eine gute Gefährtin. Sie mochte die Stille und schien häufig genauso in ihre Gedankenwelt versunken zu sein wie er in die seine. Jetzt spürte er, wie ihre behandschuhten Finger in seiner Hand ungeduldig wurden. Sie wollte allein weiterlaufen, aber er zögerte noch, ihre Hand freizugeben.
»Sing mir ein Lied, Mei Mei«, sagte er. »Sing mir das Lied vom Eis.«
Sie schaute zu ihm auf. Ihr Schal war so hoch gebunden, daß er ihn herunterstreifen mußte, um ihre vor Kälte rosa angehauchten Wangen sehen zu können. Sie lächelte ihm zu und begann, ›Neun, neun‹ zu singen, ein Lied, das die neun Phasen des Winters aufzählte und vor den Gefahren dieser Jahreszeit warnte. Wing Yun kannte das Lied seit seiner Kindheit; jeder, der in Nordchina aufgewachsen war, kannte das Lied.
»Eins neun, zwei neun: Hände sind versteckt«, sang sie mit einer Stimme, die ebenso klar wie die Nachmittagsluft war. »Drei neun, vier neun: Das Eis ist fest. Fünf neun, sechs neun: die Weiden sind zu sehn. Sieben neun, es kracht das Eis, acht neun, die Schwalben sind zurück.«
Wing Yun fiel in die letzte Strophe mit ein. »Neun neun und ein ›neun‹ dazu, die Ochsen durchlaufen das Feld im Nu.«
Nachdem die letzten Töne in der eisigen Stille verklungen waren, fragte Wing Yun: »In welchem ›neun‹ sind wir jetzt, Mei Mei?«
»In drei neun, weil das Eis gut ist und wir darauf laufen können.«
»Richtig. Und was passiert bei sieben neun?«
»Großvater!« sagte sie empört. »Ich verspreche dir, daß ich dann nicht aufs Eis gehe. Das sage ich dir jedes Jahr.«
»Ich möchte doch nur, daß du auf dich aufpaßt«, erwiderte er.
»So, meinst du denn, daß du schon alleine laufen kannst?«
Ein schüchternes Lächeln umspielte ihre Lippen. Ihr Großvater sah, wie sie voller Erwartung tief Luft holte. Sie hielten an, und er gab ihre behandschuhte Hand frei. Ihre ersten Gleitschritte waren noch etwas wackelig, doch mit jeder Bewegung wurde sie sicherer.
»Geh nicht so weit in die Mitte«, rief er ihr nach, obwohl er wußte, daß das Eis zu dieser ›drei neun‹-Zeit im Januar auch dort fest war. Gehorsam verlangsamte seine Enkelin die Fahrt und nahm dann Kurs auf eine verlassene Ecke des Sees in Ufernähe. Während Wing Yun ihr folgte, bemerkte er, wie wenig zerkratzt das Eis an dieser Stelle war. Es ist schon merkwürdig, dachte er, wie sehr die Menschen zusammenhocken: Die Rennläufer auf der einen Seite des Sees, die einzelnen Familiengruppen in der Nähe des Haupteingangs und dazwischen niemand.
Kurz bevor Mei Mei die Uferböschung erreichte, verlor sie das Gleichgewicht. Mit wild rudernden Armen versuchte sie noch, ihre Balance wiederzugewinnen, bevor sie schließlich doch auf das Eis stürzte. Sie fiel hart. Wing Yun zögerte. Würde sie weinen? Das kleine Mädchen setzte sich auf, starrte vor sich auf das Eis und stimmte ein schrilles Geschrei an, das die romantische Walzermusik, die vertraulichen Unterhaltungen der jungen Liebespaare und die Scherze der Familien übertönte. Schnell glitt Wing Yun über das Eis zu seiner Enkelin. Als er bei ihr anlangte, hätte er selbst auch schreien mögen. Vor seiner Enkelin lag, eingeschlossen im Eis, ein Mann. Er starrte Wing Yun und Mei Mei aus offenen und blicklosen Augen an. Es war ein weißer Geist, ein fremder Teufel, ein Weißer.
Zwei Stunden später erschien Liu Hulan auf der Bildfläche. Seit der Entdeckung der Leiche hatte sich die Stimmung auf dem See dramatisch verändert. Sämtliche Schlittschuhläufer mußten das Eis verlassen und wurden in einem der Pavillons am Ufer als Zeugen festgehalten. Polizisten hatten das Areal rund um den Tatort abgeriegelt. Innerhalb dieses Kreises erblickte Hulan ein paar Männer in Zivil, von denen einige nach Spuren suchten, während andere mit einem Mann und einem kleinen Kind sprachen. Genau in der Mitte des Zirkels beugte sich ein Mann über eine dunkle Gestalt, die neben einem Eishaufen lag. So sah es zumindest aus. Liu Hulan seufzte, zog ihren Schal und den Kragen ihres lavendelfarbenen Daunenmantels höher und betrat das Eis.
Liu Hulan schien die Aufregung, die ihre Ankunft unter den Männern verursachte, nicht zu bemerken. Wenn diese Männer den Mut gehabt hätten, auszusprechen, was ihre Aufmerksamkeit so erregte, dann hätten sie womöglich gesagt, Liu Hulan sei zu gutaussehend für diese Art von Job; sie ziehe sich anders an als die meisten Frauen; sie sei eitel und verkehre nicht gerne mit den anderen. Mit diesen Antworten hätten die Männer erfolgreich vom brisanten Thema Sex abgelenkt und wären auf das sichere Thema politische Kritik umgeschwenkt, das sie so gut kannten.
Es wäre ein leichtes gewesen, Liu Hulan aufgrund ihrer äußeren Erscheinung zu kritisieren, wenn sie nicht solch ein Desinteresse für den westlichen Stil, wie er seit einigen Jahren in der Stadt en vogue war, an den Tag gelegt hätte. Sie zog es vor, sich im vorrevolutionären Stil zu kleiden: lange Röcke, die ihre schlanke Figur umschmeichelten, und cremefarbene, bestickte Seidenblusen in einem altmodischen chinesischen Schnitt. Im Winter trug sie Kaschmirpullover, die in Dörfern an der Grenze zur Mongolei hergestellt und in ruhigen Farben wie korallfarben, aquamarin und winterweiß gehalten wurden. Diese Farben brachten ihren Teint zur Geltung, der sämtliche von alters her überlieferten, poetischen Frauenbeschreibungen ins Gedächtnis rief: Ihre Haut leuchtete wie feines Porzellan, war so zart wie Rosenblüten und so weich wie Glückspfirsiche.
Liu Hulan hätte über solche Vergleiche gelacht. Sie machte sich nichts aus ihrer Schönheit. Sie schminkte sich nicht und ließ sich auch keine Dauerwelle in ihr schwarzes Haar machen, das ihr mit seinem einfachen, geraden Schnitt bis knapp über die Schultern ging. Wie ein seidiger Vorhang umrahmte es ihr Gesicht. Ein paar Strähnen standen allerdings immer wild ab, als stünden sie unter Strom. Schon häufiger hatten Männer das Bedürfnis verspürt, diese Strähnen mit der Hand zu glätten, doch keiner ihrer Kollegen hätte es jemals gewagt, Inspektor Liu Hulan auch nur zufällig zu berühren.
Als sie die abgesperrte Fläche erreichte, zeigte sie ihren Ausweis vom Ministerium für Öffentliche Sicherheit vor und wurde durchgelassen. Die wenigen Schritte, die sie noch vom Tatort trennten, nutzte sie, um sich für das zu wappnen, was sie gleich zu sehen bekäme. Obwohl sie seit elf Jahren für das Ministerium für Öffentliche Sicherheit tätig war, hatte sie sich immer noch nicht ganz an den Anblick von Toten gewöhnen können, besonders wenn sie eines gewaltsamen Todes gestorben waren.
Der Pathologe Fong blickte von der Leiche auf. »Noch ein Hübscher für Sie, Inspektor«, sagte er grinsend.
Das Opfer, ein junger, weißer Mann, war auf ein sauberes, weißes Laken gelegt worden. Die Arbeiter, denen die schauderhafte Aufgabe zugefallen war, den Körper aus dem Eis zu schlagen, waren behutsam vorgegangen. Die Leiche war nach wie vor in einen dünnen Eismantel gehüllt. Bis auf einen merkwürdig abgewinkelten Arm lag der Tote gerade und flach auf dem Eis. Seine Fingernägel waren dunkellila, Augen und Mund standen offen. Durch das Eis schien der ganze Körper rein und weiß, nur am Mund, in dem die Zähne wie ekelige schwarze Stümpfe hervorstanden, und um seine Nase herum war das Eis rosa gefärbt. Davon abgesehen konnte Liu Hulan keine äußeren Verletzungen erkennen.
»Haben Sie ihn bereits umgedreht?«
»Ja, was glauben Sie denn?« erwiderte Fong. »Ich mach das doch nicht zum ersten Mal! Natürlich habe ich ihn umgedreht. Ich kann nichts erkennen, aber das heißt nicht, daß ich nichts erkennen werde, wenn ich ihn erst einmal im Labor habe. Ich kann die Eisschicht hier nicht entfernen, ohne daß die Leiche Schaden nimmt. Deshalb werden wir einfach abwarten müssen. Wir lassen ihn auftauen, dann kann ich mehr sagen.«
»Aber was vermuten Sie?«
»Vielleicht war er betrunken. Vielleicht ist er in der Nacht vor dem großen Kälteeinbruch hierhergekommen, vielleicht ist er gestolpert und auf den Kopf gefallen. Ich sehe zwar keinerlei Hinweise darauf, aber möglich ist es.«
Liu Hulan ließ sich die geschilderte Szene durch den Kopf gehen, bevor sie meinte: »Er kommt mir ziemlich jung vor. Wenn er ins Wasser gefallen wäre oder durch das Eis eingebrochen wäre, hätte er dann nicht die Kraft gehabt, sich herauszuziehen?«
»Okay, Inspektor, Zeit für eine kleine Nachhilfestunde«, antwortete Pathologe Fong mit scharfer Stimme. Er hatte es noch nie gemocht, wenn sie sein Expertenwissen in Frage stellte. Er stand auf und starrte sie an. Er war einige Zentimeter kleiner als Liu Hulan, und auch das gefiel ihm nicht. »Nehmen wir einen Durchschnittsmenschen. Damit meine ich einen ausländischen Mann von durchschnittlicher Größe, also ungefähr ein Meter achtzig. Dieser Mann trägt Durchschnittskleidung. In unserem Fall trägt er, wie ich sehe, Jeans, ein Hemd und einen Pullover.«
»Und?«
»Unser Durchschnittsmensch hier, der normale Straßenkleidung trägt und sich bester Gesundheit erfreut, sollte es bis zu fünfzehn Minuten in minus zwei Grad kaltem Wasser aushalten können. Irgend etwas hat verhindert, daß er zum Ufer zurückgelangt ist.« »Sie tippen auf Alkohol?«
»Könnte sein. Könnte auch eine Überdosis sein.«
»Selbstmord?«
»Ich wüßte bessere Methoden«, sagte Fong und warf ihr noch ein Grinsen zu, bevor er sich wieder neben die Leiche hockte.
Liu Hulan beugte sich über das Opfer, um es genauer betrachten zu können. »Warum hat er Blut am Mund? Hat das etwas mit dem Erfrierungstod zu tun?«
»Nein, ich weiß nicht, was das verursacht hat. Vielleicht hat er sich auf die Zunge gebissen. Vielleicht hat er sich durch den Sturz die Nase gebrochen. Ich werde es Sie später wissen lassen.«
»Irritiert es Sie, daß er keinen Mantel trägt? Könnte er hierhergeschleppt und dann hier abgeladen worden sein?«
»An diesem Fall irritiert mich alles«, antwortete der Pathologe.
»Bevor Sie aber an Mord denken, sollten Sie die Ergebnisse der Autopsie abwarten.«
»Eine letzte Frage: Ist er es?«
»Seine Taschen konnte ich bisher nicht untersuchen, aber er sieht so aus wie auf den Fotos, die sie uns gegeben haben.« Mit dem Kinn deutete er zum Ufer. »Ich habe schon auf Sie gewartet. Ich denke, es wäre besser, wenn Sie sich darum kümmern.« Liu Hulan folgte seinem Blick und entdeckte ein weißes Paar auf einer schmiedeeisernen Bank.
»Oh, Scheiße.«
Fong schnaubte. »Überrascht Sie das?«
»Nein.« Liu Hulan seufzte. »Aber ich wünschte, ich wäre nicht diejenige, die es ihnen sagen muß.«
»Deshalb hat der Vizeminister ja Sie gesandt.«
»Das weiß ich, aber das heißt ja nicht, daß es mir auch gefallen muß.« Ihr fiel noch ein zu fragen: »Woher wußten sie es?«
»Ihr Sohn wird seit über einer Woche vermißt, und der Tote hat das richtige Alter und die richtige Hautfarbe. Der Vizeminister hat Sie erst angerufen, nachdem er ihnen einen Wagen geschickt hat.«
Hulan erkannte die politische Bedeutung dieser Mitteilung, legte Fong die Hand auf die Schulter und sagte: »Ich komme später im Labor vorbei. Und vielen Dank.«
Sie warf einen letzten Blick auf den leblosen Körper, dann schaute sie zum Ufer. Das weiße Paar würde sich noch einige Minuten gedulden müssen.
Wie immer, wenn sie einen Tatort verließ, entfernte sie sich langsam rückwärtsschreitend. Mit jedem Schritt weitete sich ihr Blickwinkel. Obwohl es schwierig gewesen war, die Leiche aus dem Eis zu hauen, hatten die Arbeiter die Eisreste sorgfältig zu einem sauberen Haufen aufgeschichtet, der nun neben dem flachen Grab lag. Und obwohl Dutzende von Leuten auf dem Eis gewesen waren, als die Leiche gefunden wurde, war das Eis so hart, daß es immer noch völlig glatt aussah, von zwei Schlittschuhspuren – einer tiefen Rille und einer leichten Kratzspur – einmal abgesehen. Hulan konnte keine Anzeichen eines Kampfes ausmachen, weder Blut noch sonstige Unebenheiten auf oder in dem Eis.
Sie wandte sich um und schritt nun eilig auf einen alten Mann und ein kleines Mädchen zu, die eng aneinandergeschmiegt auf dem Eis standen. Der alte Mann hatte seinen Arm schützend um die Schultern des Mädchens gelegt. Die beiden trugen immer noch ihre Schlittschuhe.
»Guten Tag, Onkel«, sagte Hulan und benutzte dabei den höflichen Ehrentitel.
»Wir haben nichts getan«, sagte der alte Mann. Hulan sah, wie er zitterte.
Sie wandte sich an einen der Polizisten. »Warum halten Sie den Mann hier fest? Warum haben Sie ihn nicht nach drinnen gebracht und ihm Tee angeboten?«
Der Polizist verzog verlegen das Gesicht. »Wir dachten ...«
»Sie haben falsch gedacht.«
Sie wandte ihre Aufmerksamkeit wieder dem Paar zu. Sie beugte sich hinunter, bis sie auf Augenhöhe mit dem kleinen Mädchen war. »Wie heißt du?«
»Mei Mei«, stieß das Mädchen zwischen klappernden Zähnen hervor.
»Und wer ist das?«
»Großvater Wing.«
Liu Hulan richtete sich wieder auf. »Großvater Wing, ni hao ma, wie geht es Ihnen?«
»Sie haben uns gesagt, sie würden uns festnehmen. Sie haben uns gesagt, wir würden ins Gefängnis kommen. Sie haben uns gesagt ...«
Liu Hulan warf dem Polizisten einen Blick zu, der ihn die Augen niederschlagen ließ. »Sie müssen meinen Kollegen ihre Übereifrigkeit verzeihen. Ich fürchte, sie waren sehr unhöflich zu Ihnen.«
»Wir haben nichts getan«, wiederholte der alte Mann.
»Natürlich nicht. Aber bitte, haben Sie keine Angst. Erzählen Sie mir einfach, was passiert ist.«
Als der alte Mann seine Geschichte beendet hatte, sagte sie: »Sie haben uns sehr geholfen, Großvater Wing. Nehmen Sie doch jetzt Ihre Enkelin, und gehen Sie mit ihr nach Hause.«
Die Erleichterung, die Liu Hulan in den Augen des alten Mannes sah, verriet ihr, welche Ängste er ausgestanden hatte. »Xie-xie, xie-xie«, dankte er ihr immer wieder. Dann nahm er die Hand seiner Enkelin und glitt langsam mit ihr davon.
Liu Hulan wandte sich an den Polizisten. »Sie! Sie begeben sich sofort zu dem Pavillon, in dem die anderen Schlittschuhläufer festgehalten werden. Sie werden umgehend freigelassen.«
»Aber ...«
»Es ist offensichtlich, daß diese Leute nichts mit dem Fall zu tun haben. Und noch etwas: Ich möchte, daß Sie vor Ihrem Vorgesetzten Selbstkritik üben. Und wenn Sie das getan haben, habe ich keine schlechte Lust, ihm zu sagen, daß ich nie wieder mit Ihnen arbeiten möchte.«
»Inspektor, ich ...«
»Verschwinden Sie.«
Während sie seinem davoneilenden Rücken nachsah, bedauerte sie es, daß sie so hart sein mußte, um ihre Position zu wahren und ihre Stellung im Ministerium zu sichern. Mao hatte zwar gesagt, daß die Frauen in China die Hälfte des Himmels tragen, doch in Wahrheit saßen in den Spitzenpositionen nur Männer.
Hulan ging langsam auf das Ufer zu und faßte das weiße Ehepaar ins Auge. Beide waren ungefähr Mitte Fünfzig. Die Frau trug einen Nerzmantel mit passendem Hut. Sie sah erschreckend bleich aus und hatte, wie Hulan selbst aus der Entfernung feststellen konnte, geweint. Der Mann war, wie die Zeitungen immer wieder berichteten, außergewöhnlich gutaussehend. Sein Gesicht war selbst mitten im Pekinger Winter braungebrannt. Sein kantiges Aussehen erinnerte an die Prärien und heißen, trockenen Winde seiner Heimat, in der er zunächst Farmer und dann Senator gewesen war.
»Guten Morgen, Herr Botschafter, Mrs. Watson. Ich bin Inspektor Liu Hulan«, sagte sie in nahezu akzentfreiem Englisch. Sie schüttelte beiden die Hand.
»Ist es unser Sohn? Ist es Billy?« fragte die Frau.
»Wir haben bislang noch keine Papiere gefunden, aber ich glaube, daß er es ist.«
»Ich will ihn sehen«, sagte Bill Watson.
»Natürlich«, stimmte ihm Liu Hulan zu. »Aber zunächst hätte ich ein paar Fragen.«
»Wir sind bereits bei Ihnen im Büro gewesen«, erwiderte der Botschafter. »Wir haben Ihnen alles gesagt, was wir wissen. Unser Sohn ist seit zehn Tagen verschwunden, und Sie haben nichts getan.«
Liu Hulan ignorierte den Botschafter und schaute Elizabeth Watson in die Augen. »Mrs. Watson, kann ich irgend etwas für Sie tun? Möchten Sie nicht lieber drinnen warten?« Als die Frau erneut in Tränen ausbrach, wandte sich ihr Mann ab und trat ans Ufer des Sees.
Hulan hielt Elizabeth Watsons Hand und beobachtete, wie diese um Fassung rang. Im Ton der Politikerfrau, die sie war, sagte Elizabeth Watson schließlich: »Ich bin sicher, Sie haben noch Pflichten zu erfüllen. Es geht schon wieder, meine Liebe, mir geht es wieder gut.«
Liu Hulan richtete sich auf und ging zu Mr. Watson. Schweigend standen sie Seite an Seite und blickten über die eisige, weite Fläche zu der Stelle, an der die Leiche gefunden worden war.
Ohne den Botschafter anzuschauen, brach Liu Hulan das Schweigen. »Bevor Sie das Opfer identifizieren, muß ich Ihnen ein paar Fragen stellen.«
»Ich weiß zwar nicht, was ich Ihnen noch sagen soll, aber bitte, nur zu.«
»Trank Ihr Sohn Alkohol?«
Der Botschafter erlaubte sich ein kurzes Auflachen. »Inspektor, Billy war Anfang Zwanzig. Was meinen Sie wohl? Natürlich trank er.«
»Verzeihen Sie, Herr Botschafter, aber ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Hatte Ihr Sohn ein Alkoholproblem?«
»Nein.«
»Hatten Sie jemals den Eindruck, er nehme Drogen?«
»Auf keinen Fall.«
»Sind Sie sich sicher?«
»Lassen Sie es mich so sagen, Inspektor. Der Präsident meines Landes hätte mich nicht mit dieser Aufgabe betraut, wenn wir in unserer Familie ein Drogenproblem hätten.«
So ist es gut, dachte Hulan. Werd du nur wütend, werd richtig wütend und erzähl mir die Wahrheit.
»War Billy niedergeschlagen?«
»Was wollen Sie damit sagen?«
»Ich frage mich, ob er hier glücklich war. Häufig fühlen sich die Mitglieder unserer ausländischen Gemeinden einsam und deprimiert, besonders die Ehepartner und Kinder derjenigen, die hierher versetzt worden sind.«
»Meine Frau und mein Sohn lieben China«, antwortete er mit lauter werdender Stimme. »Und jetzt möchte ich sehen, ob es sich bei dem Toten da draußen um Billy handelt.«
»Ich werde Sie hinführen, aber bevor wir dorthin gehen, möchte ich Ihnen erklären, wie es nun weitergeht. Unsere Vorgehensweise ist wahrscheinlich anders als das, woran Sie in Amerika gewöhnt sind.«
»Ich bin nicht daran gewöhnt, daß mein Sohn stirbt, Inspektor, weder in China noch in Amerika.«
»Bill«, protestierte seine Frau, die von hinten an sie herangetreten war, leise.
»Entschuldigen Sie. Bitte fahren Sie fort.«
»Der Tote wird ins Ministerium für Öffentliche Sicherheit gebracht.«
»Das kommt überhaupt nicht in Frage. Mrs. Watson und ich haben genug mitgemacht. Wir möchten unseren Sohn nach Hause mitnehmen, damit wir ihn dort beerdigen können. Und das möchten wir so schnell wie möglich tun.«
»Ich verstehe Ihren Wunsch, aber was den Tod Ihres Sohnes angeht, gibt es noch ein paar ungeklärte Fragen.«
»Da gibt es nichts ›Ungeklärtes‹. Mein Sohn hatte offensichtlich eine Art Unfall.«
»Woher wollen Sie das denn wissen, Sir? Wieso ...«, und dabei zögerte Hulan, »sind Sie sich so sicher, daß es sich bei dem Toten da draußen um Ihren Sohn handelt?«
»Ich versichere Ihnen, daß, wenn es mein Sohn ist, ich ihn mit nach Hause nehme, nach Montana, um ihn dort zu beerdigen.« »Ich bitte Sie abermals um Verzeihung, aber das wird in nächster Zeit nicht möglich sein. Wissen Sie, Sir, ich möchte wissen, warum dieser junge Mann – wenn er Ihr Sohn war – mitten im Winter ohne warme Kleidung draußen herumlief. Ich möchte wissen, warum er nicht einfach ans Ufer geschwommen ist. Wir müssen eine Autopsie durchführen und die wahre Todesursache feststellen.«
»Lassen Sie uns doch zunächst einmal feststellen, ob wir hier über meinen Sohn reden oder nicht«, sagte Watson und marschierte auf das Eis.
Als Liu Hulan und der Botschafter die abgeriegelte Zone erreichten, traten die Polizisten, die den Tatort abgesperrt hielten, beiseite und ließen die beiden durch. Fong stand auf und entfernte sich ein paar Schritte von dem Toten. Der Botschafter hielt inne, schaute auf die Leiche hinunter und nickte. »Es ist Billy«, brachte er schwer atmend hervor. Liu Hulan wartete. Schließlich sagte Watson: »Ich will meinen Sohn haben. Ich will ihn vollständig angezogen und unangetastet wiederhaben. Weder Sie noch irgendeiner Ihrer Abteilung faßt ihn an.«
»Herr Botschafter ...«
Er hob die Hand, gebot ihr zu schweigen und fuhr fort: »Ich will nichts von Ihrem bürokratischen Unsinn hören. Das hier war ein Unfall. Ihre Vorgesetzten und Sie werden es so handhaben.«
»Das kann ich nicht machen.«
»Sie haben so vorzugehen!«
»Herr Botschafter, ich weiß, wie schmerzhaft es für Sie sein muß, aber schauen Sie sich Ihren Sohn an. Irgend etwas ist hier passiert.«
Bill Watson wandte seinen Blick wieder der gefrorenen Gestalt seines toten Sohnes zu, sah seine offenen Augen, das Blut an seinem eisgefüllten Mund und seiner Nase. Dann schaute der Botschafter auf und betrachtete den See, die Gebäude aus einer anderen Zeit, die nackten Weiden. Liu Hulan fragte sich, ob er sich wohl das letzte Bild, das sein Sohn gesehen hatte, einprägen wolle. Schließlich wandte sich Bill Watson an die Gruppe.
»Es handelt sich hier um einen Unfall«, sagte er mit der wohltönenden, glatten Stimme eines erfahrenen Politikers.
»Woher wollen Sie das wissen, Sir? Wieso sind Sie sich dessen so sicher?«
Doch er wandte sich ab und ging wortlos zu seiner wartenden, bleichen Frau zurück.
Liu Hulan rief ihm nach. In der eisigen Stille klangen ihre Worte laut und unnachgiebig. »Ich werde es nicht dabei bewenden lassen, Sir. Ich werde herausfinden, was Ihrem Sohn zugestoßen ist, und dann können Sie ihn mit nach Hause nehmen.«
Kapitel 2
20. JanuarLos Angeles
Im konservativen Nadelstreifenanzug betrat Staatsanwalt David Stark die Eingangshalle und hielt dabei seinen Ausweis hoch, auch wenn ihn sämtliche Wachposten am Eingang vom Sehen her kannten. Nachdem er den Metalldetektor passiert hatte, nahm er den Aufzug in den zwölften Stock. Dort begrüßte er die Frau, die hinter der kugelsicheren Glasscheibe an der Rezeption saß, mit einem fröhlichen ›Guten Morgen, Lorraine‹. Die Frau schaute ihn ausdruckslos an und drückte auf den Summer, um ihn hereinzulassen. Eines Tages, dachte er, eines Tages werde ich ihr eine Reaktion entlocken.
Davids Büro, das erst vor kurzem hellgrau gestrichen und in dem für Regierungsbüros typischen sachlichen Stil eingerichtet worden war, ging nach Westen und hatte nach landläufiger Meinung eine großartige Aussicht. Normalerweise hieß das, meilenweit nichts als Smog zu sehen, aber an diesem Morgen leuchtete der Himmel in einem Tiffany-Blau, nachdem ihn einige Stürme, die in den letzten zwei Wochen über Los Angeles gefegt waren, saubergeschrubbt hatten. Von seinem Schreibtisch aus konnte David über Gebäude und Straßen hinweg das Meer sehen. Und rechts in der Ferne glitzerten die durch den letzten Sturm dorthin gezauberten jungfräulichen Schneekappen auf den Gipfeln der San-Gabriel-Berge.
In Davids Büro suchte man vergeblich nach den gerahmten Zeugnissen und Auszeichnungen, die die Büros mancher seiner Kollegen schmückten. Nur ein paar Fotos auf seinem Schreibtisch gaben Aufschluß über seine Karriere und sein Privatleben. Eines dieser Fotos zeigte ihn bei seiner Abschlußfeier mit seinen Eltern, auf einem anderen stand er auf den Stufen des Landesgerichtshofs und sprach mit der Presse, ein drittes war während seines letzten Jahres als Partner der Anwaltskanzlei Phillips, MacKenzie & Stout aufgenommen worden, und zwar während des jährlich stattfindenden Galaabends, den dieses Haus ausrichtete. Es zeigte David im Smoking neben seiner Frau bzw. seiner ehemaligen Frau, die ein tief ausgeschnittenes, burgunderrotes Kleid trug.
David begab sich sofort an die Arbeit. Er befand sich gerade zwischen zwei Fällen und nutzte die Zeit, um sich um liegengebliebene Post und unerledigte Anrufe zu kümmern. Er hatte die Verurteilung einer Gruppe von Männern bewirkt, die gefaßt worden war, als sie Heroin aus China in die USA schmuggeln wollte. Das FBI hatte 1 200 Kilo Heroin beschlagnahmt, das nun niemals auf den Markt gelangen würde. Daraufhin hatte David eine gute Presse bekommen, was sich natürlich positiv auf seine Karriere auswirken würde, für den Fall, daß er dem öffentlichen Dienst den Rücken kehren und sich wieder der privaten Juristerei zuwenden wollte. Der Wirbel um diesen Fall kam David gelegen, da sich daraus weitere wichtige Aufträge ergaben. Soweit war die Bilanz gut, wenn nicht sogar hervorragend. Dennoch barg das Urteil eine gewisse Enttäuschung für David.
Seit David bei der Generalstaatsanwaltschaft beschäftigt war, war er gegen Drogenschmuggel, Schiebereien und organisierte illegale Einwanderung gerichtlich vorgegangen. Er hatte sich wegen der zahlreichen Verurteilungen, die er gegen die chinesische organisierte Kriminalität erwirkt hatte, besonders gegen die Rising Phoenix, die mächtigste Bande in Südkalifornien, einen beachtlichen Ruf erworben. Doch bislang war es ihm nicht gelungen, einen führenden Kopf der Organisation mit irgendwelchen Verbrechen in Verbindung zu bringen.
Inzwischen hatte sich das Wesen der organisierten Kriminalität in den USA gewandelt. Das Justizministerium verfolgte zwar weiterhin die Mafia, doch moderne kriminelle Syndikate waren multikulturell. Einige Leute hielten Schwarze und Leute spanischer Herkunft – insbesondere Dominikaner – für die neuen ›Könige der organisierten Kriminalität‹. Andere konzentrierten sich auf die russische Mafia und die vietnamesischen Banden. Schließlich hatte das FBI Spezialeinheiten für jede dieser Gruppen ausgebildet, die diese unterwandern, aufstören und überführen sollten.
Keine dieser Banden war so etabliert und stellte eine solch große Bedrohung der USA dar wie die Triaden. In Amerika existierten diese chinesischen Banden, die von Kantonesen Tongs genannt werden, seit in Kalifornien Gold entdeckt worden war. Doch deren Bräuche, Blutsbrüderschaften und geheime Rituale hatten eine jahrhundertealte Tradition, ebenso die zahlreichen Organisationen, die zusammen mit der Diaspora der Chinesen weltweit gewachsen waren. Wie die Italiener, so verfügten auch die chinesischen Banden über ein weit verzweigtes internationales Netzwerk. Sie hatten unbegrenzten Zugang zu Heroin, das durch das Goldene Dreieck geschmuggelt wurde. Aus den Reihen der neuen Einwanderer rekrutierten sie immer neue Fußsoldaten, die die Drecksarbeit für sie verrichteten. Die Schautafeln, die an den Wänden von Davids Büro hingen, vermittelten ihm zumindest für Los Angeles einen Überblick über die diversen Betätigungsfelder der Banden. Er hatte zwar nicht genügend Beweise für eine Festnahme, doch einigen Grund zu der Annahme, daß die Rising Phoenix an Casinos, Wettbüros, Erpressung, Wucher, Prostitution, Kreditkarten- und Essensmarkenbetrug, illegaler Einwanderung und natürlich am Heroinschmuggel beteiligt war. All das galt als Zusatzgeschäft zu einer Reihe von legalen Unternehmen wie Restaurants, Motels und Kopierläden.
Gegen zwei Uhr wurde die Ruhe in Starks Büro durch die Ankunft von Jack Campbell und Noel Gardner gestört, die seit zwei Jahren zusammen mit David gegen die chinesischen Banden kämpften. Campbell, der ältere der beiden FBI-Agenten, war ein schlaksiger Schwarzer mit einigen verstreut auf Nase und Wangen sitzenden Sommersprossen. Sein Partner Gardner war gedrungen, muskulös und mindestens zwanzig Jahre jünger. Von Haus aus Buchhalter, war Noel bedächtig und genau und überließ das Reden zumeist dem etwas einnehmenderen Campbell.
»Der Sturm von letzter Nacht hat uns endlich die Chance gegeben, auf die wir gewartet haben«, sagte Campbell. »Die Peony ist in das Hoheitsgebiet der USA abgetrieben. Jetzt gehört sie uns, mein Freund.«
Der Frachter China Peony dümpelte nun schon seit einer Woche unmittelbar außerhalb der amerikanischen Hoheitsgewässer etwas über dreihundert Kilometer vor der kalifornischen Küste. Das FBI hatte das Schiff im Auge behalten, weil die Überwachungsbilder aus der Luft an Deck Hunderte von Chinesen gezeigt hatten. Nach einigen Erkundigungen in Chinatown hegte David Stark den Verdacht, daß diese Ladung illegaler Einwanderer auf das Konto der Rising Phoenix ging. Wieder hoffte David, daß ihm diesmal das bißchen Glück beschieden sei, das ihm bisher gefehlt hatte. Vielleicht würde er diesmal unter all den Leuten an Bord die eine Person finden, mit deren Hilfe er die Verbindung zur Führungsriege der Bande herstellen konnte.
»Die Küstenwache schickt einen Kutter los«, fuhr Campbell fort.
»Aber ich bin sicher, wir sind eher da, wenn wir den Helikopter nehmen. Was wir jetzt wissen wollen, ist ...«, Campbell warf seinem Partner einen Blick zu und lächelte, »möchtest du mitkommen?« Über eine Antwort mußte David nicht lange nachdenken.
David saß hinten im Helikopter, der von einem FBI-Agenten namens Jim geflogen wurde. Unter ihnen erstreckte sich das schäumende Meer. Über Kopfhörer vernahm David die Stimme des Piloten. »Wir stoßen gleich auf ziemliche Turbulenzen. Der Sturm ...« Der Rest des Satzes verlor sich in Knistern. Wenige Minuten später bewahrheiteten sich Jims Worte. Heftige Böen ließen den Helikopter erzittern und hin und her schaukeln. Über dem Horizont türmten sich hohe, schwarze Wolken auf. Die Nacht verhieß einen weiteren Sturm.
Eine Stunde später hatten die Turbulenzen derartig zugenommen, daß David sich allmählich in sein Büro zurückwünschte.
»Hey, Stark, guck mal. Da ist sie«, brüllte Campbells Stimme plötzlich über den Kopfhörer.
David schaute über Campbells Schulter und erblickte die China Peony, die mit einiger Schlagseite im aufgewühlten Meer schwamm. Als sich der Helikopter dem Schiff näherte, spürte David, wie sein Adrenalinspiegel anstieg. Ein Staatsanwalt nahm für gewöhnlich nicht an solchen Einsätzen teil, doch David hatte die Erfahrung gemacht, daß es nützlich war zu wissen, wie genau sich alles zugetragen hatte und wie die Leute reagierten, wenn sie auf frischer Tat erwischt wurden. Er hatte Campbell und Gardner schon verschiedene Male begleitet, war mit ihnen zu Textilfabriken in Chinatown, Bürohochhäusern in Beverly Hills und einigen Villen in Monterey Park gegangen. Die Agenten schienen ihn als aufgeweckten Beobachter zu schätzen und hofften, daß seine Anwesenheit in Situationen, in denen sich die Beschuldigten am verletzlichsten fühlten, sie eines Tages zur Führungsspitze der Triade führte.
Als die Rotoren langsamer wurden, zogen Campbell und Gardner ihre Waffen und sprangen an Deck der Peony. Nachdem alles ruhig blieb und kein Zeichen von Widerstand zu sehen war, bedeutete Campbell David, die Luft sei rein, worauf sich dieser den Agenten anschloß. Vorsichtig durchmaßen sie das Schiff, für den Fall, daß sie doch noch auf eine bewaffnete und angriffslustige Mannschaft trafen.
Auf dem Oberdeck drängten sich Hunderte von Chinesen zusammen. David sah, daß diese Möchtegern-Einwanderer – überwiegend Männer – ihr Essen über offenen Feuerstellen zubereitet hatten. Von den auf Kochstellen glimmenden Kohlen schlug ihm beißender Rauch entgegen. Einige Männer hockten zusammen und unterhielten sich aufgeregt. Andere lagen ausgestreckt auf dem dreckigen Deck und starrten teilnahmslos ins Leere. Den meisten Leuten schien es mittlerweile gleichgültig zu sein, was mit ihnen geschah. Nur wenige lächelten David erleichtert und dankbar an.
»Oh, Gott«, sagte Noel Gardner. »Die sehen aus, als hätten sie schon länger nichts gegessen oder getrunken.«
»Machen Sie den Kapitän ausfindig«, meinte David schroff zu dem jüngeren Agenten. Dieser nickte und verschwand. »Und Jack, du könntest vielleicht die Leute an Land wissen lassen, daß wir Duschmöglichkeiten, Nahrung, Getränke, Kleidung und Betten für die Leute hier brauchen werden. Das hier ist ein ziemlich großer Fisch, und wir werden in der Sache so diplomatisch wie möglich vorgehen müssen.« Schließlich kam ihm noch ein Gedanke. »Hat einer von euch Tabletten gegen Seekrankheit mitgebracht?«
»Ich nicht, aber ich frage den Piloten«, erwiderte Campbell.
David sah Campbell nach, wie dieser im Zickzack über das Deck davonstolperte. Dann ging er an die Reling geklammert weiter in Richtung Bug. Mit jeder Welle ging eine neue Erschütterung durch die Peony. Aus dem Schiffsrumpf drang das Ächzen von Metall herauf. David erkannte, daß das Schiff ziellos dahintrieb.
Von nun an, so hoffte er, würde dies ein Routinefall sein. Die Einwanderer würden nach Terminal Island in das Internierungslager der INS, der amerikanischen Immigrations- und Einbürgerungsbehörde, gebracht werden, wo man sie dann einem Verhör unterziehen würde. Durch Klatsch und Gerüchte würde sich unter den Einwanderern sehr schnell herumsprechen, was man sagen mußte, um in Amerika bleiben zu dürfen. Asyl wurde ihnen am ehesten gewährt, wenn sie behaupteten, an der Demonstration auf dem Platz des Himmlischen Friedens teilgenommen zu haben oder im Rahmen der Abtreibungs- und Sterilisationsgesetze in China verfolgt zu werden. Von den Hunderten von Chinesen, die David an Deck sah, würde nur eine Handvoll das Glück haben, Anspruch auf Asyl geltend machen zu können. Die anderen würden abgeschoben werden. Obwohl er für sie Mitleid empfand, vergaß er nicht, für wen er arbeitete.
David merkte, daß irgend etwas an seiner Hose zerrte. Er schaute hinab und entdeckte einen Mann in mittleren Jahren. »Amerika?« fragte der Mann mit starkem Akzent auf englisch. Der Wassermangel ließ seine Haut völlig schlaff von den Wangenknochen hängen. »Amerika?« wiederholte er seine Frage.
»Ja«, sagte David. »Ja, Sie sind da.« Dann fragte er den Mann:
»Sprechen Sie Englisch?«
»Ein wenig. Ich heiße Zhao.«
»Wie viele Leute befinden sich an Bord?«
»Fünfhundert, vielleicht auch mehr.«
David stieß einen kurzen Pfiff aus, bevor er weiterfragte: »Wie lange befinden Sie sich schon auf See?«
»Beinah drei Wochen«, antwortete der Mann.
»Wo ist die Mannschaft?«
»Mannschaft?«
»Die Leute, die auf dem Schiff arbeiten. Wo sind die?«
Der Chinese wandte seinen Blick ab. »Sie weg. Sie fahren weg letzte Nacht.«
»Das verstehe ich nicht«, sagte David. »Wie sind sie denn weggefahren? Und wo sind sie hin?«
»Der Sturm«, sagte Zhao. Er schaute auf das Meer. »Es war schlimm. Wir waren hier draußen. Wir machen uns fest an ...« Der Mann suchte vergeblich nach dem Wort und deutete schließlich auf die Reling. Dann schaute er Stark wieder an. »Viele weggespült worden. Mit eigenen Augen habe ich gesehen. Jie Fok, ein Farmer aus der Nähe von Guangzhou. Andere auch – ich weiß ihre Namen nicht.«
»Und die Mannschaft?«
»Sie brüllen. Sie sagen, das Schiff geht unter. Und dann kommt ein Boot. Wir glauben, es kommt, uns zu retten. Aber es ist klein. Der Kapitän und die anderen, sie gehen in Lebensboot.«
»Ein Rettungsboot?«
»Rettungsboot, ja. Sie gehen in Rettungsboot und lassen sich ins Meer. Sie haben eine Leine, an der sie sich zum anderen Boot ziehen können. Trotzdem sehe ich, wie auch ein paar von diesen Männern weggespült werden. Dann verschwindet das andere Boot. Einfach so.« Zhao hielt kurz inne. »Meinen Sie, wir gehen bald unter? Meinen Sie, es kommt jemand vor dem nächsten Sturm?«
»Wir schaffen das schon.«
Der Mann warf ihm einen scharfen Blick zu. »Jede Nacht kommt noch ein Sturm. Das Schiff sinkt langsam.«
David ignorierte seine Worte und fragte: »Bei wem haben Sie sich um einen Platz auf diesem Schiff beworben? Wie heißen die Mitglieder der Besatzung?«
Doch Zhao hatte sich bereits abgewandt und hörte nicht mehr zu. David richtete sich wieder auf und ging zurück zum Helikopter. Wie kann sich nur jemand solchen Gefahren aussetzen, fragte sich David. Und was für Menschen waren das, die aus solch einem Elend Profit schlagen konnten?
David kannte die Antworten. Diese Einwanderer – wie die meisten Einwanderer – wollten Freiheit. Heutzutage schien Freiheit ein Synonym für Geld zu sein. Die Männer und Frauen auf diesem Schiff wollten nach Amerika, um dort ihr Glück zu machen. Da die meisten Einwanderer über keinerlei Geld verfügten, heuerten sie bei den Triaden an. Die Überfahrt sowie Kost und Logis waren umsonst, und als Gegenleistung verpflichteten sie sich zu jahrelangem Dienst bei den Banden. Sie arbeiteten dann in Ausbeuterbetrieben, Restaurants, als Prostituierte und Drogenschmuggler. Erst wenn sie den vereinbarten Preis zurückgezahlt hatten, waren sie wirklich frei. Das Problem dabei war jedoch, daß es den Einwanderern nahezu unmöglich war, ihre vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen.
Das Motiv der Triaden war ebenfalls ein finanzielles. Auf einem Frachter von der Größe der China Peony konnten ungefähr 400 Personen bequem untergebracht werden. Auf dieser Reise war das Schiff mit über 500 Menschen beladen worden. Jeder von ihnen hatte sich zu einer Zahlung von durchschnittlich 20 000 Dollar verpflichten müssen, um in die USA zu gelangen. Einige wie Zhao hatten sich wahrscheinlich sogar bereit erklärt, 30 000 Dollar zurückzuzahlen für das Privileg, einen Platz an Deck, an der frischen Luft zu bekommen. Weniger glückliche Reisende hatten für 10 000 bis 12 000 Dollar auch mit einem engen Platz unter Deck vorliebgenommen. Zusammen ergab das einen Bruttoumsatz von ungefähr zehn Millionen.
Das Problem für die Vereinigten Staaten war, daß dieser Fang nur ein Tropfen auf den heißen Stein war. Laut Schätzungen der INS und des Außenministeriums gelangten mit jedem legalen Einwanderer zwei illegale ins Land. Jedes Jahr kamen so mindestens 100 000 Chinesen illegal über die Grenze. Dabei benutzten sie jedes nur erdenkliche Transportmittel: von Flugzeugen über Fischerboote bis hin zu solchen Frachtern.
Während David all diese Fakten überdachte, wurde er sich bewußt, daß ihn irgend etwas an der Situation der China Peony störte. Warum hatte die Rising Phoenix 10 Millionen Dollar im Stich gelassen?
Er war beinahe wieder am Helikopter angelangt, als er auf Gardner traf, der schrecklich grün im Gesicht aussah. »Ich weiß«, sagte David. »Die Mannschaft ist verschwunden. Hast du Campbell bereits Bescheid gesagt?«
»Ja, hab ich. Er setzt sich gerade über Radio mit dem Festland in Verbindung.«
»Ich muß mit ihm sprechen. Wir müssen die Leute hier von diesem Kahn schaffen.«
Die Männer und Frauen, die sich um den Helikopter drängten, wichen beiseite, als die beiden Weißen näher kamen. Campbell und der Pilot saßen bei geschlossener Tür im Helikopter, trugen ihre Kopfhörer und brüllten abwechselnd etwas ins Funkmikrophon oder machten sich hastig Notizen. Ab und zu sahen sie sich an und verzogen das Gesicht. Schließlich rieß sich Campbell verärgert den Kopfhörer vom Kopf und öffnete die Tür.
»Ich habe nur schlechte Neuigkeiten. Der Sturm nähert sich schneller, als die Wetterstation vorhergesagt hat. Wir können nicht abfliegen, weil wir es nicht vor dem Bastard bis zum Festland schaffen. Die Küstenwache wird nicht vor morgen früh hier eintreffen, denn die kehrt natürlich in den Hafen zurück! Tja, ich weiß ja nicht, was ihr für einen Eindruck habt, Jungs, aber ich glaube nicht, daß diese abgewrackte Sardinenbüchse die Nacht überlebt.«
Nach diesem letzten Satz mußte sich Gardner schnellsten über die Reling beugen und erst einmal reihern. Campbell lehnte sich zurück in den Helikopter, griff nach etwas und reichte David dann einige Tabletten. »Du wirst sie trocken runterschlucken müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, daß du etwas von dem Wasser an Bord trinken möchtest, wenn es überhaupt Wasser gibt.«
David nahm die Tabletten und schluckte sie hinunter. Campbell fuhr fort: »Sieht so aus, als sei Gardner erst mal außer Gefecht gesetzt. Also müssen wir drei sehen, wie wir die Sache schaukeln.« Auf Campbells dunklem Gesicht breitete sich ein Grinsen aus. Er hielt ein Stück Papier mit Notizen hoch. »Hier sind die Instruktionen, wie wir den Kahn über Wasser halten. Mal gucken, ob das funktioniert.«
Gegen sechs Uhr abends hatte sich Dunkelheit ausgebreitet, und die ersten Regentropfen klatschten aufs Deck. David und Jack Campbell hatten einige Leute gefunden, darunter auch Zhao, die ein wenig Englisch sprachen. Diese Männer wurden sogleich als Übersetzer eingesetzt. »Wir müssen jemanden finden, der etwas von Schiffen versteht«, erklärte ihnen Campbell. »Ob Segler, Fischer oder sonst etwas, ist egal. Hauptsache, ihr findet jemanden.« Wundersamerweise machten sie einen Elektriker und einen Mechaniker ausfindig. Diese beiden Männer, Wei und Lau, gingen unter Deck, um nachzuschauen, ob sie die Maschinen wieder in Gang bringen konnten. Das Ergebnis dieser Untersuchung bekamen Campbell und David umgehend zu hören. Das Schiff steckte in ernsten Schwierigkeiten; die Bilgen standen voller Wasser, und die Pumpen funktionierten nicht.
David kletterte erstmalig unter Deck, wo die Bedingungen um ein Vielfaches schlimmer waren als draußen an Deck. Die Luft war stickig, heiß, feucht und beißend. In dem riesigen Schiffskörper entdeckte David Dutzende von Leuten, die die Seekrankheit, der Mangel an Süßwasser und die mageren Rationen geschwächt hatten. Einige der Männer hatten sich an Ort und Stelle übergeben oder entleeren müssen. Die meisten Frauen waren so schwach, daß sie nicht stehen, geschweige denn an Deck gehen konnten, um nachzuschauen, was die Aufregung zu bedeuten hatte. Einige Leute schienen im Delirium zu sein, andere waren tief und fest eingeschlafen. Der Eindruck des Elends wurde durch die nahezu greifbare Angst, die diese dunklen Räume beherrschte, verstärkt. Diese Leute wußten, daß sie am Ende waren. Ihr Traum von einem neuen, besseren Leben in Amerika war ausgeträumt.
Wieder hatte David den Eindruck, als verberge sich unter der Oberfläche mehr, als es auf den ersten Blick den Anschein hatte. Diese Einwanderer – zumindest die Gesunden – schienen noch verängstigter zu sein als andere, die David bisher bei Festnahmen und Abschiebungen erlebt hatte. Vielleicht fürchteten sie die Rising Phoenix, die berüchtigt war für ihre blutigen Racheaktionen und besonders brutale Vergeltungsmaßnahmen. Dennoch gab auch das keinen Sinn, hatten die Schlepper doch selbst ihre kostbare Fracht im Stich gelassen. Vielleicht war diese Angst auf das drohende Sinken des Schiffes zurückzuführen. David verzog das Gesicht. Er selbst machte sich beinahe in die Hosen vor Angst.
Um das Schiff über Wasser zu halten, brauchte es die Hilfe aller. Während David weiter in die Tiefen des Schiffes vordrang, bemerkte er, daß sich einige der kräftigeren Männer – diejenigen, die die Überfahrt an Deck verbracht hatten – das nächstbeste Stück Stoff vor Nase und Mund gebunden und eine Kette vom ersten offenen Deck bis in die Tiefen des Rumpfes gebildet hatten. Diese Kette hievte langsam und mühselig Eimer für Eimer das Wasser aus den Bilgen an Deck und kippte es über Bord. Da er nicht wußte, was er sonst hätte tun sollen, reihte sich David kurzerhand in die Kette ein.
Als die See noch rauher wurde, wurden die Männer seekrank und übergaben sich an Ort und Stelle. Doch keiner verließ seinen Platz in der Kette. Einzig der Standortwechsel innerhalb der Kette brachte eine gewisse Erleichterung. Etwa alle zwanzig Minuten rückten diejenigen, die in den Bilgen gearbeitet hatten, zwanzig Schritte in Richtung frische Luft, während die, die an Deck gestanden hatten, hinunter geklettert kamen in das von Öl und Gott-weiß-was-sonst-noch verdreckte Wasser, das einfach nicht weniger wurde. Keiner sagte einen Ton. Die Männer arbeiteten grimmig und mit wild entschlossenen Gesichtern weiter.
Gelegentlich hörten sie das Stottern der Maschinen, die kurz ansprangen und dann wieder erstarben. Die Männer verdoppelten ihre Anstrengungen. Fünf Stunden später hatten sie einen Frachtraum geleert.
Dann zeigten die Männer David die anderen Frachträume. Unter Deck verlor David die Orientierung. Die Luft war verpestet durch Benzinabgase, menschliche Exkremente und von etwas, von dem David nur annehmen konnte, daß es tote Ratten waren. In der Dunkelheit verschwammen die Konturen, eiserne Stiegen schienen ins Nichts zu führen, Korridore wurden plötzlich zu Sackgassen. Er wurde von einer Gruppe von fünf oder sechs Leuten geführt, die mit ihm immer wieder irgendwelche Korridore entlanggingen, bis sie plötzlich eine laute, intensive Debatte anfingen. Die Männer brüllten einander mit ihren rauhen Stimmen an, fuchtelten wild mit den Armen vor Davids Nase herum und weigerten sich energisch, ihn weitergehen zu lassen. Schließlich ergriff dann Mr. Zhao das Wort: »Falscher Weg. Wir müssen den anderen Weg gehen.« Und dann kehrten sie um und gingen dorthin zurück, wo sie hergekommen waren. David hatte den Eindruck, sie gingen im Kreis, und doch hatten sie weitere fünf Frachträume gefunden, in denen das eiskalte Wasser bereits hüfthoch stand.
Gegen Mitternacht, während der Sturm die Peony beutelte, gaben die Motoren wieder ein kräftiges Stottern von sich und erwachten keuchend zu neuem Leben. Durch das Schiff ging ein Jubelschrei, der jedoch sehr bald wieder erstarb, denn es gab noch viel zu tun. Innerhalb von Minuten wurden die Pumpen in Gang gesetzt. Beim gleichmäßigen Dröhnen der Pumpen verließ David die Männer, mit denen er zusammengearbeitet hatte, um Campbell zu suchen. Er fand den FBI-Agenten im Maschinenraum. Der ältere Mann war verschwitzt und ölverschmiert, hatte aber weder seine Energie noch seinen Humor eingebüßt.
»Du siehst furchtbar aus«, sagte Campbell und lachte.
Zum ersten Mal schaute David an sich und seinem Anzug herunter. Irgendwann hatte er sein Jackett ausgezogen und es irgendwo liegengelassen. Sein Hemd war dreckig, ein Ärmel an der Schulternaht gerissen. Seine Hose war von dem übelriechenden Wasser durchnäßt und klebte ihm an den Beinen. Unwillkürlich mußte David ebenfalls grinsen, doch der unbeschwerte Augenblick verschwand so schnell, wie er gekommen war.
»Okay, hier der Lagebericht«, sagte Campbell. »Die Maschinen funktionieren wieder ...«
»Das habe ich auch gemerkt.«
»Wir haben die Pumpen wieder in Gang gebracht. Bringt das auch was? Konntest du das erkennen?«
»O ja, und zwar allemal mehr, als wenn wir die Arbeit per Hand weitermachen müßten.«
»Wei meint, wenn wir das Schiff mit der Nase in den Wind drehen, es auch so halten können und alles andere dicht machen, müßten wir durchkommen.«
David warf Wei einen Blick zu. Er war ein drahtiger, zahnloser, kleiner Mann, der ungefähr ein Meter sechzig maß. »Wenn er das sagt, dann machen wir das auch.«
»Wunderbar. Sorg dafür, daß alle unter Deck gehen und daß – wie man so schön sagt – alle Schotten dicht gemacht werden.« Auf den ersten Blick schien das eine einfache Aufgabe zu sein, doch es stellte sich sehr schnell heraus, daß es die schwierigste des Tages sein sollte. Viele der Einwanderer, darunter auch Mr. Zhao, der mittlerweile unter einer wasserdichten Plane an seinem angestammten Platz saß, weigerten sich, unter Deck zu gehen. »Kommen Sie, Mr. Zhao«, versuchte David ihn gegen den Sturm anbrüllend zu überreden. Der heftige, westliche Wind peitschte ihm den Regen ins Gesicht. »Ich brauche Ihre Hilfe. Wir müssen alle unter Deck gehen.«
»Ich bleib hier draußen die ganze Reise.«
»Wenn Sie draußen bleiben, kommen Sie um, so einfach ist das.« Er zeigte auf das Meer, dessen turmhohe Wellen das Schiff hin- und herwarfen. Ab und an hörte man die Schiffsschraube, wenn diese für einen Moment aus dem Wasser kam. »Sie werden noch über Bord gespült.«
»Ich habe es bis jetzt geschafft, jetzt werde ich es auch noch bis zum Ende schaffen.«
David ging in die Hocke. »Ich brauche Sie, Mr. Zhao. Ohne Ihre Hilfe kann ich die anderen nicht überreden. Wenn Sie mir jetzt helfen, verspreche ich Ihnen, daß ich Ihnen später helfe.«
Der Chinese überlegte. »Woher weiß ich, ob ein weißer Geist die Wahrheit sagt?«
David reichte ihm die Hand für einen verbindlichen Handschlag. »Ich lüge nie.«
Gegen vier Uhr morgens hatte die China Peony das Schlimmste überstanden. Campbell hatte sich per Radio mit dem Festland in Verbindung gesetzt und gemeldet, die Peony werde den Sturm überstehen und die Küstenwache solle ihren Arsch möglichst bald, bitte schön, herbewegen und den Kahn an Land schleppen.
Hier und da waren einige Männer in einen unruhigen, kurzen Schlaf gefallen. Andere standen in Gruppen zusammen, rauchten und unterhielten sich leise. Gardner, der immer noch seekrank war, lag in der Kajüte des Kapitäns. Campbell hatte seinen Kopf in die linke Armbeuge gelegt und war am langen Tisch im Mannschaftssalon eingeschlafen. Sein rechter Arm hing herunter und pendelte im Gleichtakt mit dem Rollen des Schiffes hin und her. David lag in der obersten Koje einer Kabine, die sich vier Mannschaftsmitglieder geteilt haben mußten. Er hatte seinen zerfetzten Anzug abgestreift und am Fußende der Koje zum Trocknen aufgehängt. Aus der Koje unter ihm ertönte leises Schnarchen. Der Pilot des Helikopters schlief in der oberen Koje gegenüber, doch er hatte sich zur Wand gedreht. David starrte an die Decke, an der eine Handvoll Postkarten angepinnt waren. Wer auch immer in dieser Koje geschlafen hatte, mußte schon seit geraumer Zeit auf See gewesen sein. Auf einer der Postkarten hatte sich ein zart aussehendes chinesisches Mädchen vor einem bunten Strauß Nelken in Pose geworfen. Die anderen zeigten den Hafen von Hongkong, eine neonbeleuchtete Straße in Tokio und die Golden Gate Bridge. Müde überlegte David, wo dieser Seemann jetzt wohl war. Ob er von den Wellen ins Meer gerissen worden war, als die Mannschaft das Schiff verlassen hatte? Oder befand er sich in Chinatown und sang gerade ein Lied in einer Karaoke-Bar?
David schloß die Augen und horchte auf das beruhigende Dröhnen der Maschinen. Solch einen Tag hatte er wahrhaftig noch nie erlebt.
In diesem Moment zwischen Schlafen und Wachen drängte sich etwas in Davids Bewußtsein: Was gab es in den Frachträumen, das man vor ihm zu verbergen versuchte? Er öffnete die Augen und flüsterte: »Jim, sind Sie wach?« Der Pilot rührte sich nicht. David kletterte aus seiner Koje, schlüpfte in seinen klammen, zerissenen Anzug, öffnete vorsichtig die schwere Tür und trat in den verlassenen Gang hinaus. Er wandte sich nach links und ging eine Treppe hinunter.
Als er auf einige schlafende Gestalten traf, wartete er einen Augenblick, doch sie rührten sich nicht. Er ging noch eine weitere Treppe hinunter und dann noch eine. Hier unten waren die Treppen wenig mehr als steile, eiserne Leitern. Die Luft war feucht und roch faulig, der Gang war nur spärlich beleuchtet. David schloß die Augen und versuchte sich zurückzuversetzen, sich die Orte zu vergegenwärtigen, an denen er einige Stunden zuvor gewesen war. An einer bestimmten Stelle hatten die Männer ihm immer wieder den Weg versperrt. Dort wollte er hin. Er kam an den Frachträumen vorbei, in denen sie alle so hart gearbeitet hatten, ging dann um eine Ecke und befand sich plötzlich in einem großen, verlassenen Raum, in dem in einer Ecke ein drei Meter hoher Eisentank stand. Diesen Raum kannte er, war er doch genau hier immer wieder in eine andere Richtung geführt worden. Er ging zu dem Tank und klopfte an die Wand. Es klang hohl, doch wenn der Tag ihn eines gelehrt hatte, dann war es, daß er keine Ahnung vom Meer oder von Schiffen hatte. Die Öffnung zu dem Tank hatte eine schäbige, grüne Farbe. Um die Scharniere und Schrauben herum breiteten sich Rostflecken aus. David versuchte, den runden Drehgriff zu bewegen. Er glitt leicht durch seine Hände und ließ sich problemlos ein-, zweimal drehen.
Ehe David sich versah, wurde er von einer mächtigen Kraft zurückgestoßen und zu Boden geworfen. Wasser überspülte ihn, breitete sich dann am Boden aus, bis nur noch ein paar Pfützen übrigblieben. Ein übler, fauliger Gestank machte sich in dem Raum breit. Neben David lag ein verwesender Fleischberg, ein menschlicher Körper, der unsagbar aufgedunsen war, dessen Augen und Zunge hervorquollen. Die Lippen waren zurückgezogen und gaben den Blick auf schwarze Zähne frei. Die Haut – oder was davon übrig war – war voller grünlich-schwarzer Algen. An dem verfaulenden Handgelenk glitzerte das auffällige Armband einer Rolex-Uhr.
David stieß sich angewidert ab und schlitterte über den glitschigen Boden. Als er an sich herabsah, erblickte er an seiner Brust etwas, das wie ein Handschuh aussah. Angeekelt versuchte er es abzuschütteln, aber es blieb an seinem Hemd kleben. Und plötzlich erkannte er, was es war. Von der Hand des Toten – oder war es eine Tote? – hatten sich Haut und Fingernägel gelöst. Mit wachsendem Entsetzen zwang sich David, noch einen Blick auf die Leiche zu werfen. An beiden Händen und Füßen war die Haut tatsächlich abgestreift, als handele es sich um Handschuhe und Socken.
Der Anblick genügte, damit David taumelnd auf die Füße kam. Er stolperte aus dem Frachtraum, polterte die schmale Stiege hinauf, ohne sich noch darum zu scheren, wieviel Lärm er verursachte, und stieß schließlich die letzte Tür auf, um an Deck zu gelangen. Immer noch goß es in Strömen, und das Schiff rollte schwer in der Dünung. David klammerte sich an die Reling und erbrach sich mehrmals.
Doch selbst während er sich erbrach, selbst während er sich nichts sehnlicher wünschte, als den widerlichen Glibber, der ihn soeben überspült hatte, von seinem Körper schrubben zu können, hatte ein anderer Teil seines Verstandes bereits fieberhaft zu überlegen begonnen. Und als er noch, den Kopf über die Reling gebeugt und bis auf die Knochen durchnäßt, zitternd an Deck stand, plante David bereits die nächsten Schritte. Es mußte eine Autopsie gemacht werden. Campbell mußte sich mit dem FBI, besser noch mit dem Außenministerium, in Verbindung setzen, damit die sich nach vermißten Personen in China erkundigten. Außerdem brauchte er zusätzliche Leute für die Verhöre auf Terminal Island. Denn zwei Dinge standen fest: Diese Uhr gehörte keinem normalen Einwanderer, und die Mehrzahl der Illegalen an Bord wußte um die Leiche.
Kapitel 3
21.–22. JanuarTerminal Island
Die folgenden zehn Stunden verschwammen in Davids Bewußtsein zu einem alptraumhaften Nebel. Undeutlich war ihm bewußt, daß er zurück zum Mannschaftsraum gestolpert war und dort Jack Campbell aufgeweckt hatte. Er wußte noch, wie ihn dieser beruhigt hatte, ehe er ihm erzählen konnte, was geschehen war. Daraufhin waren sie noch einmal in diesen grauenhaften Raum hinuntergestiegen. David hatte mitbekommen, daß Campbell den Frachtraum abriegelte, in dem die Leiche in ihrer Brühe schwamm. Auch erinnerte er sich, daß der Pilot aus einem Erste-Hilfe-Kasten eine Flasche Schnaps hervorgekramt hatte und wie ihm das scharfe braune Gebräu durch die Kehle geronnen war. Er hatte sich unbedingt umziehen und sich mit Salzwasser abwaschen wollen, doch Campbell ließ das nicht zu, weil er keine Beweise zerstören wollte.
Dann hatten sie gewartet. David erinnerte sich, wie er an Deck gesessen und den kalten, grauen Morgen am Himmel hatte heraufdämmern sehen. Immer noch prasselte der Regen auf das Deck, doch das Meer hatte sich beruhigt und wogte nunmehr gemächlich auf und ab. Endlich setzte sich Jim in seinen Helikopter und telefonierte mit dem Festland. Er kam mit der Nachricht zurück, daß die Küstenwache in ein paar Stunden bei ihnen sein würde, um das Schiff in den Hafen zu schleppen, und daß sie nun zurückfliegen könnten. Campbell wollte, daß David mitflog, doch dieser weigerte sich. Nachdem Jim und Noel Gardner abgeflogen waren, begannen Jack und David, die Einwanderer zu befragen. In der Nacht zuvor hatte David mit vielen dieser Männer Seite an Seite gearbeitet und um ihrer aller Überleben gekämpft. Doch an jenem Morgen weigerten sich die meisten, mit ihm zu sprechen, und keiner schaute ihm in die Augen. »Diese Leiche klebt an mir«, meinte David in einem Anfall von Frustration, doch nichts, was er tat, brachte die Leute zum Reden. Selbst Mr. Zhao wandte sich ab.
Als sie am Spätnachmittag den Hafen erreichten, ging plötzlich alles sehr schnell. Die Beamten der INS und der Küstenwache kamen an Bord und wandten sich über Megaphon auf kantonesisch und in Mandarin an die Einwanderer. Diese hoben ihre kleinen Bündel auf und trotteten die Gangway hinunter zu einem Gebäude, das wie eine riesige Lagerhalle aussah. David wurde in einen Krankenwagen verfrachtet und fortgefahren. Er sträubte sich hartnäckig und wiederholte immer wieder: »Ich muß dabei sein. Ich will zurück.« Schließlich stülpte ihm der Rettungshelfer eine Sauerstoffmaske über das Gesicht. Im Krankenhaus wurde er auf Schock und Wassermangel behandelt und erhielt eine Tetanusspritze. Unter Aufsicht eines FBI-Beamten von der Spurensicherung wurde David ausgezogen. Man packte seine Kleidung in Plastiktüten und beschriftete sie. Um zwei Uhr morgens wurde er in Krankenhauskleidung entlassen. David hatte sich noch nie so einsam gefühlt wie in dem Moment, als er sein leeres Haus betrat. Mühevoll gelang es ihm auszurechnen, daß er seit dreiundvierzig Stunden nicht geschlafen hatte. Er ging unter die Dusche, zog sich danach Jogginghosen und einen Pullover an und fiel in einen unruhigen Schlaf.