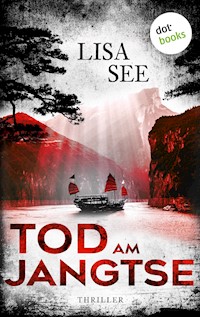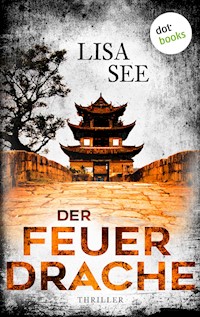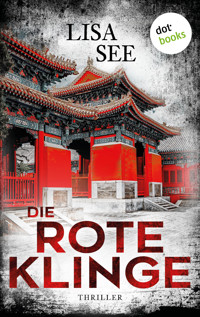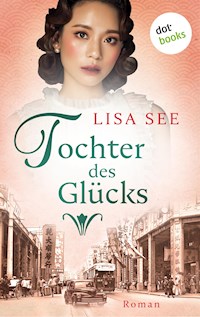
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Frauen von Shanghai
- Sprache: Deutsch
Wenn Mutter und Tochter vom Schicksal getrennt werden: Der historische Roman »Tochter des Glücks« von Lisa See jetzt als eBook bei dotbooks. Amerika, 1957. Sie ist in L.A. aufgewachsen – doch nun will die junge Joy unbedingt in die chinesische Heimat ihrer Eltern reisen, um ihren leiblichen Vater kennenzulernen: jenen geheimnisvollen Mann, den ihre Mutter Pearl und ihre Tante May einst beide liebten und der inzwischen zum angesehenen Propagandamaler avanciert ist. Vom ersten Moment an ist Joy fasziniert von diesem fremden Land … und geblendet von den Versprechungen, mit denen die kommunistische Republik lockt. Pearl dagegen ahnt, dass ihre Tochter sich in große Gefahr gebracht hat, und reist ihr voller Sorge nach. Als Mao die Grenzen abriegelt und die schwelende Not im Land zu eskalieren droht, sucht sie fieberhaft nach einem Weg, Joy nach Amerika zurückzuholen … »Wie immer schafft See eine fesselnde Atmosphäre … Ein weiterer Hit.« Publishers Weekly Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Tochter des Glücks« von Lisa See ist der zweite Band der großen Familiensaga »Die Frauen von Shanghai«. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 715
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch:
Amerika, 1957. Sie ist in L.A. aufgewachsen – doch nun will die junge Joy unbedingt in die chinesische Heimat ihrer Eltern reisen, um ihren leiblichen Vater kennenzulernen: jenen geheimnisvollen Mann, den ihre Mutter Pearl und ihre Tante May einst beide liebten und der inzwischen zum angesehenen Propagandamaler avanciert ist. Vom ersten Moment an ist Joy fasziniert von diesem fremden Land … und geblendet von den Versprechungen, mit denen die kommunistische Republik lockt. Pearl dagegen ahnt, dass ihre Tochter sich in große Gefahr gebracht hat, und reist ihr voller Sorge nach. Als Mao die Grenzen abriegelt und die schwelende Not im Land zu eskalieren droht, sucht sie fieberhaft nach einem Weg, Joy nach Amerika zurückzuholen …
»Wie immer schafft See eine fesselnde Atmosphäre … Ein weiterer Hit.« Publishers Weekly
Über die Autorin:
Lisa See entstammt einer chinesisch-amerikanischen Familie. Sie wurde in Paris geboren und wuchs in Los Angeles in Chinatown auf. Dreizehn Jahre lang arbeitete sie als Journalistin für Publishers Weekly. Später betreute sie als Kuratorin mehrere große Ausstellungen, die sich mit interkulturellen Beziehungen zwischen Amerika und China beschäftigen. Bereits ihr erstes Buch, eine Biographie ihrer Familie, war ein internationaler Bestseller und erhielt die »Notable Book«-Auszeichnung der New York Times. Dieselbe Auszeichnung bekam sie auch für ihren bald darauf folgenden ersten Thriller »Die rote Klinge«. Sie wurde als »National Woman of the Year« ausgezeichnet, erhielt den »Chinese American Museum’s History Makers Award« und den »Golden Spike Award« in Kalifornien. Mit ihrem Roman »Der Seidenfächer« gelang ihr ein Weltbestseller, der auch verfilmt wurde. Heute lebt sie in Los Angeles.
Die Website der Autorin: www.lisasee.com
Bei dotbooks veröffentlicht Lisa See den historischen Roman »Der Seidenfächer«, außerdem »Töchter aus Shanghai« und »Tochter des Glücks« aus ihrer Reihe um »Die Frauen von Shanghai«.
Zudem erscheint bei dotbooks auch ihre Thrillerreihe um die Polizistin Liu Hulan mit den Bänden »Die rote Klinge«, »Der Feuerdrache« und »Tod am Jangtse«.
***
eBook-Neuausgabe Juli 2022
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2011 unter dem Originaltitel »Dreams of Joy« bei Random House, New York.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2011 by Lisa See
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2013 beim C. Bertelsmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-232-2
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Tochter des Glücks« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Lisa See
Tochter des Glücks
Roman – Die Frauen von Shanghai 2
Aus dem Amerikanischen von Elke Link
dotbooks.
Für meinen Vater Richard See
Prolog
Der schrille Heulton einer Polizeisirene in der Ferne fährt mir durch alle Glieder. Grillen zirpen im Chor immer wieder dieselben Vorwürfe. Im Bett am anderen Ende der durch Fliegengitter abgeschirmten Veranda, die wir uns teilen, weint meine Tante leise vor sich hin – Nachwirkung des Elends und der Peinlichkeit der Geheimnisse, die sie und meine Mutter sich heute Abend im Streit an den Kopf geworfen haben. Meine Mutter kann ich nicht hören, ihr Zimmer ist zu weit weg. Diese Stille schmerzt. Ich klammere mich an die Laken, fixiere einen alten Riss an der Decke. Ich versuche verzweifelt, mich festzuhalten, aber seit dem Tod meines Vaters stehe ich an einem Abgrund, und nun habe ich das Gefühl, ich wäre über den Rand gestoßen worden und würde fallen.
Alles, was ich über meine Geburt, meine Eltern, meine Großeltern und mich selbst zu wissen glaubte, war eine Lüge. Eine dicke, fette Lüge. Die Frau, die ich für meine Mutter hielt, ist eigentlich meine Tante. Meine Tante ist in Wirklichkeit meine Mutter. Der Mann, den ich als meinen Vater liebte, war überhaupt nicht mit mir verwandt. Mein richtiger Vater ist ein Maler aus Shanghai, den meine Mutter und meine Tante vor meiner Geburt beide geliebt haben. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs – wie Tante May sagen würde. Aber ich wurde im Jahr des Tigers geboren und will mich daher nicht von den quälenden Schuldgefühlen wegen des Todes meines Vaters und des Schmerzes über all diese Eröffnungen überwältigen lassen. Ich umklammere die Laken fester, recke das Kinn vor und versuche, diesen Gefühlen mit meiner Tigerwildheit beizukommen. Es funktioniert nicht.
Ich würde gerne mit meiner Freundin Hazel sprechen, aber es ist mitten in der Nacht. Noch lieber wäre ich jetzt wieder an der Universität von Chicago, denn mein Freund Joe würde verstehen, was ich gerade durchmache. Ganz bestimmt.
Um zwei Uhr morgens schläft meine Tante schließlich ein, und im Haus scheint alles still zu sein. Ich stehe auf und gehe in den Flur zum Wäscheschrank mit meinen Sachen. Jetzt höre ich meine Mutter weinen, und es bricht mir das Herz. Sie hat nicht die geringste Ahnung, was ich vorhabe, und selbst wenn, würde sie mich aufhalten? Ich bin nicht ihre Tochter. Warum also sollte sie mich daran hindern? Rasch packe ich das Nötigste zusammen. Dort, wo ich hinwill, werde ich Geld brauchen, und der einzige Weg, an Geld zu kommen, wird noch mehr Schande und Schmach über mich bringen. Ich husche in die Küche, schaue unter das Spülbecken und ziehe die Kaffeedose mit den Ersparnissen meiner Mutter heraus. Damit wollte sie mir das College finanzieren. Dieses Geld steht für all ihre Hoffnungen und Träume für mich, aber ich bin nicht mehr dieser Mensch. Sie war immer vorsichtig, und ausnahmsweise bin ich einmal froh darüber. Ihre Angst vor Banken und den Amerikanern finanziert nun meine Flucht...
Ich suche Papier und einen Stift, setze mich an den Küchentisch und schreibe:
Mom, ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Ich verstehe dieses Land nicht mehr. Ich hasse es dafür, dass es Dad umgebracht hat. Ich weiß, dass du jetzt glaubst, ich sei verwirrt und dumm. Das kann schon sein, aber ich muss Antworten bekommen. Vielleicht ist China doch meine wahre Heimat ...
Ich schreibe weiter, dass ich meinen leiblichen Vater finden möchte und sie sich keine Sorgen um mich machen soll. Den zusammengefalteten Zettel bringe ich zur Veranda. Tante May rührt sich nicht, als ich den Zettel auf mein Kopfkissen lege. An der Haustür zögere ich. Mein behinderter Onkel liegt in seinem Zimmer im hinteren Teil des Hauses. Er hat mir nie etwas Böses getan. Ich sollte mich von ihm verabschieden, aber ich weiß schon, was er sagen wird: »Kommunisten taugen nichts. Sie werden dich umbringen.« So etwas will ich nicht hören, und ich will nicht, dass meine Mutter und meine Tante durch ihn auf mein Verschwinden aufmerksam werden.
Ich nehme meinen Koffer und trete hinaus in die Nacht. An der Ecke biege ich in die Alpine Street ein und gehe Richtung Union Station. Es ist der 23. August 1957. Ich möchte mir alles noch einmal genau einprägen, denn ich bezweifle, dass ich die Chinatown von Los Angeles jemals wiedersehen werde. Ich bin immer gerne in diesen Straßen herumgelaufen und kenne mich dort besser aus als sonst irgendwo auf der Welt. Hier kenne ich jeden, und jeder kennt mich. Die Häuser – es sind fast ausschließlich holzverschalte Bungalows – wurden chinafiziert, wie ich es nenne. Bambus wächst in den Gärten, auf den Veranden stehen Blumentöpfe mit Miniaturkumquatbäumen, und auf dem Boden liegen Holzbretter mit Reisresten für die Vögel. Nun sehe ich alles mit anderen Augen. Dafür genügten neun Monate im College – und die Ereignisse des heutigen Abends. In meinem ersten Studienjahr an der Universität von Chicago lernte ich viel und unternahm viel. Ich lernte Joe kennen und trat der Chinese Students Democratic Christian Association bei – dem Chinesischen Christlich-Demokratischen Studentenverband. Ich lernte alles über die Volksrepublik China und darüber, was der Vorsitzende Mao für das Land tut, und das alles läuft sämtlichen Vorstellungen meiner Familie zuwider. Was tat ich also, als ich im Juni nach Hause kam? Ich kritisierte meinen Vater und warf ihm vor, dass er immer noch den Eindruck erwecke, er komme »frisch vom Schiff«, und dass er in seinem Café so fette Gerichte koche und sich immer so dämliche Fernsehserien anschaue.
Diese Erinnerungen lösen einen Dialog in meinem Kopf aus, der seit seinem Tod in mir abläuft. Warum habe ich nicht bemerkt, was meine Eltern durchmachten? Ich wusste nicht, dass mein Vater illegal als Papiersohn in dieses Land gekommen war. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich meinen Dad niemals gebeten, dem FBI gegenüber zu gestehen – als hätte er nichts zu verbergen. Meine Mutter macht Tante May für das Geschehene verantwortlich, aber sie hat unrecht. Sogar Tante May glaubt, es war ihre Schuld. »Als der FBI-Agent nach Chinatown kam«, hatte sie mir erst vor ein paar Stunden auf der Veranda gestanden, »habe ich mit ihm über Sam gesprochen.« Aber Agent Sanders war der rechtliche Status meines Dads ziemlich egal, denn als Allererstes fragte er nach mir.
Die Schlinge aus Schuldgefühlen und Kummer zieht sich immer enger zusammen. Woher hätte ich wissen sollen, dass die Gruppe, der ich beigetreten war, für das FBI als Tarnung für kommunistische Umtriebe galt? Wir demonstrierten vor Läden, in denen keine Schwarzen arbeiten oder Mahlzeiten einnehmen durften. Wir redeten darüber, dass die Vereinigten Staaten während des Krieges amerikanische Bürger japanischer Abstammung interniert hatten. Wieso machte mich das zu einer Kommunistin? Doch in den Augen des FBI tat es das, und deshalb versprach dieser schreckliche Agent meinem Dad eine Amnestie, wenn er jeden verriet, den er für einen Kommunisten oder einen Sympathisanten hielt. Wäre ich diesem Studentenverband nicht beigetreten, so hätte das FBI nichts in der Hand gehabt, um meinen Vater zu drängen, Namen zu nennen – insbesondere meinen. Mein Dad hätte mich nie verraten, und so blieb ihm keine andere Wahl. Solange ich lebe, werde ich nie vergessen, wie meine Mutter die Beine meines Vaters umklammerte in dem vergeblichen Versuch, das Seil um seinen Hals zu entlasten, und ich werde mir selbst nie meine Rolle bei seinem Selbstmord verzeihen.
Teil 1
Der Tiger springt
Kapitel 1Joy
Life Savers
Ich biege in den Broadway ein, dann in den Sunset Boulevard. So komme ich an den Orten vorbei, die ich in Erinnerung behalten möchte. Die mexikanische Touristenattraktion in der Olvera Street ist geschlossen, aber die fröhlich-bunten Lichterketten werfen einen goldenen Schein auf die geschlossenen Souvenirstände. Rechts von mir liegt die Plaza, der Geburtsort der Stadt, mit dem schmiedeeisernen Musikpavillon. Gleich dahinter geht es in die Sanchez Alley. Dort wohnte meine Familie im ersten Stock des Garnier Building, als ich klein war, und mein Herz füllt sich mit Erinnerungen an meine Großmutter, wie sie mit mir auf der Plaza spielte, an meine Tante, die mir mexikanische Lutscher in der Olvera Street kaufte, an meine Mutter, die immer mit mir hier hindurchging, wenn sie mich nach Chinatown in die Schule brachte oder dort abholte. Das waren glückliche Jahre, und dennoch steckten sie so voller Geheimnisse, dass ich mich fragen muss, was in meinem Leben überhaupt echt war.
Die Palmen werfen perfekte Schatten auf die Fassade der Union Station vor mir. Der Uhrturm zeigt 2.47. Ich war gerade einmal ein Jahr alt, als der Bahnhof eröffnet wurde, daher war auch er ein fester Bestandteil in meinem Leben. Um diese Zeit fahren keine Autos oder Straßenbahnen, deshalb warte ich nicht, bis die Ampel umschaltet, sondern laufe einfach schnell über die Alameda Street. Ein einsames Taxi steht vor dem Bahnhof am Randstein. Drinnen im riesigen Wartesaal herrscht gähnende Leere, und meine Schritte hallen vom Marmor und den Fliesen wider. Ich schlüpfe in eine Telefonzelle und schließe die Tür. Über mir geht ein Licht an, und ich sehe mein Spiegelbild in der Glasscheibe.
Meine Mutter mahnte mich immer, mich nie wie ein Pfau zu benehmen. »Du willst doch nicht wie deine Tante werden«, schalt sie mich stets, wenn sie mich bei einem Blick in den Spiegel erwischte. Doch jetzt weiß ich: Sie wollte nicht, dass ich zu genau hinsah. Denn wenn ich jetzt hinsehe, und zwar richtig, erkenne ich, wie sehr ich Tante May ähnele. Meine Augenbrauen haben die Form von Weidenblättern, ich habe einen hellen Teint, meine Lippen sind voll, und mein Haar ist schwarz wie Onyx. Meine Familie hat immer darauf bestanden, dass ich es lang trage, und früher konnte ich sogar darauf sitzen. Aber Anfang dieses Jahres ging ich in einen Frisiersalon in Chicago. Ich wollte einen Kurzhaarschnitt wie den von Audrey Hepburn. Die Friseuse bezeichnete das als Pixie-Schnitt. Jetzt trage ich die Haare kurz wie ein Junge, und sie glänzen selbst hier im schwachen Licht der Telefonzelle.
Ich schütte meinen Münzgeldbeutel auf der Ablage aus, wähle Joes Nummer und warte darauf, dass die Telefonistin mir sagt, wie viel die ersten drei Minuten kosten werden. Ich stecke die Münzen in den Schlitz. Es klingelt. In Chicago ist es kurz vor fünf Uhr morgens, ich wecke ihn also auf.
»Hallo?« Er klingt verschlafen.
»Ich bin’s.« Ich bemühe mich, begeistert zu klingen. »Ich bin weggelaufen. Ich bin bereit, endlich zu tun, worüber wir bisher nur gesprochen haben.«
»Wie viel Uhr ist es?«
»Du musst aufstehen. Packen. Steig in ein Flugzeug nach San Francisco. Wir gehen nach China. Du hast gesagt, wir sollten Teil dessen sein, was dort passiert. Also los!«
Durch das Telefon höre ich, wie er sich umdreht und aufsetzt.
»Joy?«
»Ja, ja, ich bin’s. Wir gehen nach China!«
»China? Du meinst die Volksrepublik China? Herrgott, Joy, es ist mitten in der Nacht. Ist alles in Ordnung? Ist irgendwas passiert?«
»Du hast mich extra einen Reisepass beantragen lassen, damit wir zusammen hinfahren können.«
»Spinnst du?«
»Du hast gesagt, wenn wir nach China gehen, arbeiten wir auf den Feldern und singen Lieder«, fahre ich fort. »Wir machen Gymnastik im Park. Wir helfen, das Wohnviertel sauber zu halten, und teilen die Mahlzeiten mit den anderen. Wir wären nicht arm, und wir wären nicht reich. Wir wären alle gleich.«
»Joy...«
»Chinese zu sein und das auf den Schultern und im Herzen zu tragen, kann eine Last sein, aber auch ein Quell der Hoffnung und der Freude. Auch das hast du gesagt.«
»Klar haben wir darüber geredet, was gerade in China passiert, aber ich habe hier eine Zukunft – das Zahnmedizinstudium, die Praxis meines Vaters ... Ich hatte nie ernsthaft vor, wirklich hinzufahren.«
Als ich seinen spöttischen Tonfall höre, frage ich mich, worum es bei all den Treffen und dem ganzen Gerede eigentlich gegangen war. Waren die Gespräche über Gleichberechtigung, geteilten Wohlstand und die Vorzüge des Sozialismus gegenüber dem Kapitalismus nur ein Weg, um mir an die Wäsche zu gehen? (Nicht, dass ich ihn gelassen hätte.)
»Man würde mich umbringen, und dich genauso«, sagt er abschließend und verkündet damit dieselbe Propaganda wie Onkel Vern schon den ganzen Sommer.
»Aber es war doch deine Idee!«
»Hör mal, es ist mitten in der Nacht. Ruf mich morgen an. Nein, lieber nicht. Das ist zu teuer. Du bist doch in ein paar Wochen wieder hier. Dann können wir darüber reden.«
»Aber ...«
Die Leitung ist tot.
Ich will mich auf keinen Fall durch meine Wut und Enttäuschung über Joe von meinem Plan abbringen lassen. Meine Mom hat immer versucht, meine besten Charaktereigenschaften zu fördern. Wer im Jahr des Tigers geboren wird, ist romantisch und künstlerisch veranlagt, aber sie hat mich immer gewarnt, dass es auch in der Natur des Tigers liegt, voreilig und impulsiv zu handeln, mit einem großen Satz davonzuspringen, wenn die Umstände widrig sind. Meine Mutter hat sich bemüht, diese Eigenschaften in mir nicht zum Vorschein kommen zu lassen, doch der Drang, zu springen, ist überwältigend, und ich lasse mich nicht von diesem Rückschlag aufhalten. Ich bin entschlossen, meinen Vater zu finden, selbst wenn er in einem Land mit über 600 Millionen Einwohnern lebt.
Ich gehe wieder nach draußen. Das Taxi steht immer noch da. Der Fahrer schläft auf dem Vordersitz. Ich klopfe ans Fenster, mit einem Ruck wacht er auf.
»Bringen Sie mich zum Flughafen«, sage ich.
Dort angekommen, gehe ich direkt zum Schalter der Western Airlines, denn sie hatten immer so schöne Werbespots im Fernsehen. Nach Shanghai kann ich nur über Hongkong fliegen. Nach Hongkong komme ich nur von San Francisco aus. Ich kaufe mir ein Ticket für den ersten Abschnitt meiner Reise und buche den ersten Flug des Tages nach San Francisco. Es ist noch frühmorgens, als ich dort lande. Am Schalter von Pan Am erkundige ich mich nach dem Flug 001, der rund um die Welt geht, mit Zwischenlandungen in Honolulu, Tokio und Hongkong. Die Frau in der feschen Uniform sieht mich misstrauisch an, als ich ein einfaches Ticket nach Hongkong bar bezahle, aber nachdem ich ihr meinen Pass gegeben habe, bekomme ich das Ticket.
Bis zum Abflug muss ich noch ein paar Stunden warten. Ich suche eine Telefonzelle und rufe bei Hazel an. Ich habe nicht vor, ihr zu erzählen, wo ich hinfliege. Joe hat mich bereits im Stich gelassen, und ich fürchte, Hazels Reaktion wird noch schlimmer sein. Sie hat mich schon gewarnt, dass Rotchina ein schlimmes Land sei und so – die übliche negative Einstellung, die wir beide von unseren Familien so gut kennen.
Die jüngste der Yee-Schwestern nimmt ab und reicht mich an Hazel weiter.
»Ich möchte mich verabschieden«, sage ich. »Ich verlasse das Land.«
»Wie bitte?«, fragt Hazel.
»Ich muss weg.«
»Du verlässt das Land?«
Ich merke, dass Hazel mir nicht glaubt – denn keine von uns hat bisher weitere Reisen unternommen als Wochenendausflüge nach Big Bear und San Diego mit der Methodistenkirche und den Flug zum College –, aber später wird sie schon kapieren. Doch da werde ich bereits irgendwo über dem Pazifik sein. Dann gibt es kein Zurück mehr.
»Du warst immer eine gute Freundin«, sage ich zu ihr. Mir kommen die Tränen. »Du warst meine beste Freundin. Vergiss mich nicht.«
»Ich vergesse dich nicht.« Nach einer kurzen Pause fragt sie: »Hast du denn Lust, heute Nachmittag zu Bullock’s zu gehen? Ich würde gerne ein paar Sachen für Berkeley kaufen.«
»Du bist die Beste, Haz. Bye.«
Das Klicken des Hörers auf der Gabel klingt endgültig.
Als mein Flug aufgerufen wird, gehe ich an Bord und nehme meinen Platz ein. Ich taste nach dem Stoffbeutelchen, das ich um den Hals trage. Tante May hat es mir letzten Sommer geschenkt, bevor ich nach Chicago ging. Es enthält drei Sesamsamen, drei Mungobohnen und drei Kupfermünzen aus China. »Pearl und ich haben diese kleinen Säckchen von unserer Mutter bekommen, als wir aus Shanghai geflohen sind. Sie sollten uns beschützen«, erzählte sie mir gestern Nacht. »Ich habe dir meines am Tag deiner Geburt geschenkt. Als du noch ein Baby warst, wollte deine Mutter nicht, dass du es trägst, aber ich durfte es dir geben, als du aufs College gegangen bist. Ich freue mich, dass du es im vergangenen Jahr getragen hast.« Meine Tante ... Meine Mom ... Meine Augen füllen sich mit Tränen, aber ich dränge sie zurück, denn wenn ich anfange zu weinen, kann ich vielleicht nie wieder aufhören.
Doch wie konnte May mich aufgeben? Wie konnte mein leiblicher Vater mich gehen lassen? Und mein Vater Sam? Wusste er, dass ich nicht sein Kind war? May sagte, niemand wusste es sonst. Hätte er es gewusst, hätte er sich nicht umgebracht. Er wäre noch am Leben und könnte mich rauswerfen, weil ich ein respektloser, abscheulicher, arglistiger, Unruhe stiftender Bastard bin. Tja, jetzt bin ich ja draußen. Mom und meine Tante sind mittlerweile wahrscheinlich wach. Bestimmt sprechen sie immer noch nicht miteinander, aber sie werden sich allmählich fragen, wo ich bin. Ich bin froh, nicht dort zu sein und mich entscheiden zu müssen, welche Mutter ich lieben und zu welcher ich halten soll, trotz all ihrer hässlichen Geheimnisse, denn diese Entscheidung ist unmöglich. Schlimmer noch, es wird einen Moment geben, in dem sich alles beruhigt und meine Mom und meine Tante Frieden schließen – und sie werden alles noch einmal ganz genau unter die Lupe nehmen, wie immer –, und dann werden sie zwei und zwei zusammenzählen und daraufkommen, dass ich der wahre Grund für das bin, was mit meinem Vater Sam passiert ist, und nicht Tante May. Wie werden sie wohl reagieren, wenn sie allmählich begreifen, dass ich diejenige bin, an der das FBI interessiert war, dass ich diejenige bin, die Agent Sanders direkt zu uns nach Hause geführt und die ganze Katastrophe verursacht hat? Wenn das passiert, werden sie froh sein, dass ich weg bin. Vielleicht.
Ich lasse das Beutelchen los und wische mir die verschwitzten Hände am Rock ab. Ich bin verunsichert – wer wäre das nicht? –, doch ich darf mir jetzt keine Sorgen darüber machen, welche Auswirkungen mein Handeln auf meine Mom und meine Tante hat. Ich liebe sie beide, aber ich bin auch wütend auf sie und habe Angst davor, was sie vielleicht von mir denken – und für mich steht fest, dass ich immer »Tante« zu May sagen werde und Pearl für mich Mom bleiben wird. Sonst verwirrt mich das alles noch mehr als sowieso schon. Säße Hazel jetzt neben mir, würde sie sagen: »Ach, Joy, du bist so eine Chaotin.« Zum Glück ist sie nicht hier.
Eine Ewigkeit später landen wir in Hongkong. Ein paar Männer rollen eine Treppe ans Flugzeug, und ich gehe mit den anderen Passagieren von Bord. Von der Rollbahn steigen Hitzewellen auf, die Luft ist erstickend heiß, und die Luftfeuchtigkeit ist noch höher als bei meiner Abreise aus Chicago im Juni. Ich folge den anderen Passagieren in den Terminal und durch einen düsteren Gang in einen großen Raum, wo sich vor den Passkontrollen viele Schlangen gebildet haben. Als ich an der Reihe bin, fragt mich der Mann mit abgehacktem britischem Akzent: »Was ist Ihr endgültiges Reiseziel?«
»Shanghai in der Volksrepublik China«, antworte ich.
»Treten Sie auf die Seite!« Er telefoniert, und innerhalb von Minuten werde ich von zwei Wachen abgeholt. Sie bringen mich zum Gepäckbereich, wo ich meinen Koffer heraussuche, dann führen sie mich durch weitere finstere Korridore. Ich sehe keine anderen Passagiere, nur Männer in Uniform, die mich misstrauisch mustern.
»Wo gehen wir hin?«
Eine der Wachen beantwortet meine Frage durch unsanftes Zerren am Arm. Schließlich gelangen wir zu einer Doppeltür. Wir gehen hindurch und befinden uns wieder in der entsetzlichen Hitze. Ich werde hinten in einen fensterlosen Transporter geschoben, man sagt mir, ich soll still sein. Die Wachmänner steigen vorne ein, wir fahren los. Ich sehe überhaupt nichts. Ich verstehe nicht, was vor sich geht, und ich fürchte mich – ich bin starr vor Angst, um ehrlich zu sein. Mir bleibt nichts anderes, als mich festzuhalten, während der Transporter um scharfe Kurven und über holprige Straßen fährt. Nach einer halben Stunde hält er an. Die Wachmänner kommen zur Rückseite des Wagens. Sie unterhalten sich ein paar Minuten, während ich schwitzend im Inneren sitze und mir Sorgen mache. Schließlich werden die Türen geöffnet. Wir befinden uns an einem Kai, wo ein großes Schiff Fracht aufnimmt. Das Schiff fährt unter der Flagge der Volksrepublik China – fünf goldene Sterne auf einem roten Hintergrund. Derselbe unfreundliche Wachmann wie vorhin zerrt mich aus dem Wagen und auf den Landungssteg.
»Wir wollen nicht, dass ihr den Kommunismus hier verbreitet.« Er herrscht mich fast an, als er mir meinen Koffer reicht. »Machen Sie, dass Sie an Bord kommen, und steigen Sie bloß nicht aus, bevor Sie in China sind.«
Die beiden Wachmänner bleiben am Ende des Landungsstegs stehen, um sich zu vergewissern, dass ich auch an Bord gehe. Das alles ist eine Überraschung – eine verstörende Überraschung, die nichts Gutes verspricht. Am anderen Ende des Landungsstegs steht ein Matrose. Nein, so würde man wohl nicht sagen. Ich glaube, er ist ein Besatzungsmitglied. Er spricht schnell auf Mandarin mit mir, der offiziellen Sprache Chinas, eine Sprache, in deren reiner Form ich mich nicht ganz sicher fühle. Meine Mutter und meine Tante haben sich immer im Shanghaier Wu-Dialekt unterhalten – mein ganzes Leben lang. Ich glaube, ich beherrsche ihn gut, aber lange nicht so gut wie das Kantonesische, das üblicherweise in Chinatown gesprochen wurde. Mit meiner Familie habe ich immer ein bisschen Kantonesisch, ein bisschen Shanghaier Dialekt und ein bisschen Englisch gesprochen. Englisch werde ich von jetzt an wahrscheinlich gänzlich aufgeben.
»Könnten Sie das noch einmal sagen, und ein bisschen langsamer, wenn möglich?«, frage ich.
»Kehrst du ins Land deiner Vorfahren zurück?«
Ich nicke, ziemlich sicher, dass ich ihn richtig verstanden habe.
»Gut, willkommen! Ich zeige dir dein Quartier. Dann bringe ich dich zum Kapitän. Bei ihm zahlst du deine Fahrkarte.«
Ich drehe mich zu den beiden Wachmännern um, die immer noch am Kai stehen und mich beobachten. Ich winke ihnen, wie eine Idiotin. Dann folge ich dem Besatzungsmitglied. Als ich jünger war, spielte ich mit meiner Tante in vielen Filmen als Komparsin mit. Einmal hatte ich eine Rolle in einem Film über chinesische Waisenkinder, die während des Krieges mit einem Schiff aus China evakuiert wurden, aber hier ist es völlig anders als am Set. Alles ist rostig. Die Treppen sind schmal und steil. Die Gänge sind schwach beleuchtet. Wir liegen noch im Hafen, aber ich spüre das Wogen des Wassers unter den Füßen, was darauf schließen lässt, dass dieses Schiff nicht sonderlich seetüchtig ist. Man sagt mir, ich bekomme eine Einzelkabine, aber diesen klaustrophobisch engen Verschlag, in den ich geführt werde, könnte man sowieso nicht mit jemand anderem teilen. Draußen ist es heiß, hier drinnen womöglich noch heißer.
Später werde ich dem Kapitän vorgestellt. Seine Zähne haben Tabakflecken, seine Uniform ist mit Speiseresten und Öl verschmiert. Er sieht genau hin, als ich meine Geldbörse aufmache und meine Fahrkarte bezahle. Das Ganze ist ziemlich unheimlich.
Auf dem Rückweg zu meiner Kabine rufe ich mir in Erinnerung, dass ich das alles wollte. Weglaufen. Abenteuer. Meinen Vater suchen. Ein freudiges Wiedersehen. Auch wenn ich gerade erst herausgefunden habe, dass Z. G. Li mein Vater ist, hatte ich schon zuvor von ihm gehört. Er hat meine Mom und meine Tante immer gemalt, damals in Shanghai, als sie ihm Modell saßen. Die Plakate habe ich nie gesehen, aber einige seiner Illustrationen für China Reconstructs, eine Propagandazeitschrift, die mein Großvater im Tabakladen unter der Theke kaufte. Es war schon seltsam, die Gesichter meiner Mutter und meiner Tante auf dem Titelblatt einer Zeitschrift aus Rotchina zu sehen. Z. G. Li hatte sie aus dem Gedächtnis gemalt, und zwar sehr oft. Da hatte er seinen Namen schon in Li Zhi-ge geändert, wahrscheinlich gemäß den politischen Veränderungen in China, wie meine Mom meinte. Meine Tante hängte sich die Titelblätter mit seinen Illustrationen gerne an die Wand über ihrem Bett, deshalb glaube ich, ein bisschen über ihn als Maler zu wissen. Bestimmt wird Z. G. – oder wie auch immer ich ihn nennen soll – sehr überrascht sein und sich freuen, mich zu sehen. Diese Gedanken lindern vorübergehend meine Sorgen wegen der Sicherheit des Schiffs und wegen des merkwürdigen Kapitäns.
Sobald wir aus dem Hafen von Hongkong ausgelaufen sind, gehe ich in die Kombüse zum Essen. Wie sich herausstellt, sind hauptsächlich heimkehrende Überseechinesen auf dem Schiff. Jeden Tag verlässt ein anderes Boot Hongkong, erzählt man mir, und bringt Leute wie mich nach China. Zwanzig Passagiere – allesamt männliche Chinesen – aus Singapur, Australien, Frankreich und den Vereinigten Staaten wurden von anderen Flügen und Schiffen direkt zu diesem Boot gebracht. (Was glaubt man in Hongkong wohl, was passieren würde, wenn einer von uns über Nacht oder eine ganze Woche bliebe?) Während der Mahlzeit wird mir auf einmal komisch. Bevor das Dessert serviert wird, muss ich den Tisch verlassen, weil mir schlecht ist. Ich schaffe es kaum in meine Kabine. Der Geruch nach Öl und der Latrine, die Hitze, die emotionale und körperliche Anstrengung der letzten Tage setzen mir stark zu. Die nächsten drei Tage verbringe ich damit, Brühe und Tee möglichst bei mir zu behalten, zu schlafen, in der Hoffnung auf eine kühle Brise auf dem Deck zu sitzen und mich mit den anderen Passagieren zu unterhalten, die mir alle möglichen nutzlosen Ratschläge gegen die Seekrankheit geben.
Ich liege in meiner Koje, als in der vierten Nacht das Rollen des Schiffs endlich nachlässt. Wahrscheinlich befinden wir uns an der Mündung des Yangtze. Angeblich dauert es noch ein paar Stunden, bis wir in den Whangpoo einfahren und Shanghai erreichen. Kurz vor Sonnenaufgang stehe ich auf und ziehe mein Lieblingskleid an – ein weiß gefüttertes, hellblau getupftes Musselinkleid. Ich statte dem Kapitän einen Besuch ab, reiche ihm einen Brief, den er abschicken soll, wenn er nach Hongkong zurückkehrt, und frage ihn, ob er mir ein paar von meinen Dollars in chinesisches Geld wechseln kann. Ich gebe ihm fünf Zwanzigdollarscheine. Vierzig Dollar steckt er ein, dann gibt er mir chinesische yuan im Gegenwert von sechzig Dollar. Ich bin zu verblüfft, um Einwände zu erheben, aber in Anbetracht seines Verhaltens wird mir bewusst, dass ich keine Ahnung habe, was mich erwartet, wenn ich an Land gehe. Werde ich behandelt wie in Hongkong? Werden die Leute, denen ich begegne, einfach mein Geld nehmen wie der Kapitän? Oder wird etwas völlig anderes geschehen?
Meine Mutter sagte immer, China sei korrupt. Ich dachte, solche Dinge hätten sich mit der Machtübernahme der Kommunisten erledigt, aber offenbar nicht ganz. Was würde meine Mom tun, wenn sie hier wäre? Sie würde ihr Geld verstecken, wie zu Hause. Als ich wieder in der Kabine bin, nehme ich alles Geld, das ich ihr aus dem Versteck unter dem Spülbecken gestohlen habe, teile es in zwei Stapel, wickle den höheren Betrag in ein Taschentuch und stecke ihn an meiner Unterwäsche fest. Den Rest – 250 Dollar – schiebe ich in meinen Geldbeutel, zusammen mit dem neuen chinesischen Geld. Dann verlasse ich mit meinem Koffer die Kabine und gehe von Bord.
Es ist acht Uhr morgens, und die Luft ist dick, schwer und heiß wie Kartoffelsuppe. Mit den anderen Passagieren werde ich in einen stickigen Raum gedrängt, in dem Zigarettenrauch steht und es penetrant nach Essen riecht, das bei diesem Wetter zu lange ungekühlt herumstand. Die Wände sind in einem scheußlichen Erbsengrün gestrichen. Die Luft ist so feucht, dass die Fenster beschlagen. In Amerika würden die Leute ordentliche Schlangen bilden. Hier drängen sich meine Mitreisenden in einer pulsierenden Masse zu dem einen Abfertigungsschalter. Ich halte mich am Rand, denn nach meiner Erfahrung mit der Passkontrolle in Hongkong bin ich nervös. Es geht sehr langsam voran, immer wieder kommt es zu Verzögerungen, aus Gründen, die ich weder sehen noch erahnen kann. Es dauert drei Stunden, bis ich vor dem Schalter stehe.
Ein Inspektor in einer schlecht sitzenden graugrünen Uniform fragt: »Was ist der Grund für deinen Besuch, Genossin?«
Er spricht Shanghaier Dialekt. Darüber bin ich froh, dennoch sollte ich ihm wohl nicht die Wahrheit sagen – dass ich gekommen bin, um meinen Vater zu suchen, aber keine Ahnung habe, wo genau er sich aufhält oder wie ich ihn ausfindig machen soll.
»Ich möchte beim Aufbau der Volksrepublik China helfen«, antworte ich.
Er verlangt meine Papiere und bekommt große Augen, als er meinen amerikanischen Pass sieht. Er sieht mich an und dann wieder das Foto. »Du hast Glück, dass du dieses Jahr gekommen bist und nicht letztes. Der Vorsitzende Mao sagt, dass Überseechinesen keine Einreiseerlaubnis mehr beantragen müssen. Ich brauche nur einen Identitätsnachweis, und den hast du mir gegeben. Würdest du dich als staatenlos bezeichnen?«
»Als staatenlos?«
»Es ist illegal, als amerikanischer Staatsbürger durch China zu reisen«, sagt er. »Du bist also staatenlos?«
Ich bin neunzehn. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, eine uninformierte und unwissende Ausreißerin zu sein. Ich möchte nicht zugeben, dass ich nicht genau weiß, was staatenlos bedeutet.
»Ich bin nach China gekommen, um dem Aufruf an patriotische Chinesen aus den Vereinigten Staaten zu folgen, dem Volk zu helfen.« Ich sage auf, was ich in meiner Gruppe in Chicago gelernt habe. »Ich möchte der Menschheit einen Dienst erweisen und beim nationalen Aufbau helfen!«
»Na dann«, sagte der Inspektor.
Er lässt meinen Pass in eine Schublade fallen und verschließt sie. Das beunruhigt mich.
»Wann bekomme ich meinen Pass wieder?«
»Gar nicht.«
Ich bin nie auf die Idee gekommen, dass ich meine Rechte aufgeben würde, sollte ich China jemals wieder verlassen und in die Vereinigten Staaten zurückkehren wollen. Ich habe das Gefühl, hinter mir ist eine Tür zugefallen und verschlossen worden. Was soll ich später tun, wenn ich wegwill und den Schlüssel nicht habe? Die Gesichter meiner Mutter und meiner Tante blitzen vor mir auf, und all das Gefühlsdurcheinander und die Traurigkeit unserer letzten gemeinsamen Tage kommen an die Oberfläche. Ich werde nie zurückkehren. Niemals.
»Das persönliche Gepäck von Überseechinesen muss durchsucht werden«, verkündet der Inspektor und zeigt auf ein Schild, auf dem steht: BEVORZUGTE ZOLLABFERTIGUNG VON ÜBERSEECHINESEN. »Wir suchen nach Konterbande und versteckten Devisen.«
Ich öffne den Koffer, und er wühlt den Inhalt durch. Er konfisziert meine BHs, was man lustig finden könnte, wäre ich nicht so überrascht und ängstlich. Mein Pass und meine BHs?
Er sieht mich streng an. »Wäre die Aufseherin hier, würde sie dir auch den wegnehmen, den du gerade trägst. Reaktionäre Kleidung hat keinen Platz im Neuen China. Wirf das anstößige Stück so bald wie möglich weg.« Er macht meinen Koffer wieder zu. »So, und wie viel Geld hast du mitgebracht? Du wirst einer Arbeitseinheit zugeteilt, aber momentan können wir dich nicht einreisen lassen, außer du kannst dich selbst versorgen.«
Ich reiche ihm meinen Geldbeutel. Er nimmt die Hälfte meiner Dollars und steckt sie ein. Ich bin froh, dass ich den größten Teil des Geldes in der Unterwäsche habe. Dann mustert mich der Inspektor genau, besonders mein getupftes Musselinkleid, was vielleicht ein Fehler war, wie mir jetzt klar wird. Ich soll hierbleiben, bis jemand kommt. Als er geht, fürchte ich, dass sich nun wiederholt, was in Hongkong passiert ist, aber wo sollten sie mich diesmal hinschicken? Vielleicht hatten Joe und mein Onkel doch recht. Vielleicht wird mir wirklich etwas Schlimmes zustoßen. Schweiß läuft mir den Rücken hinunter.
Der Inspektor kehrt mit mehreren Männern zurück, die die gleichen tristen grünen Uniformen tragen. Sie lächeln begeistert. Sie nennen mich tong chi. Das bedeutet Genossin, aber gleichzeitig schwingt mit, dass man die gleiche Gesinnung, die gleichen Ziele, die gleichen Ambitionen hat. Ich fühle mich gleich viel besser. Siehst du, sage ich mir, du hättest dir gar keine Sorgen machen müssen. Sie nehmen mich in die Mitte und drängen sich zusammen, damit wir fotografiert werden können, die Erklärung für die Verzögerungen von vorhin. Danach zeigen sie mir eine Wand mit gerahmten Aufnahmen von Leuten, die, wie sie sagen, durch dieses Büro nach China eingereist sind. Hauptsächlich Männer, ein paar Frauen und auch ein paar Familien. Und nicht alle sind Chinesen. Auch Weiße sind darunter. Ich kann nicht sagen, woher sie kommen, allerdings sehen sie ihrer Kleidung nach zu urteilen nicht aus wie Amerikaner. Vielleicht stammen sie aus Polen, Ostdeutschland oder einem anderen Land im Ostblock. Bald wird auch das Bild von mir an der Wand hängen. Wie schön.
Dann fragen mich die Inspektoren, wo ich wohnen werde. Ich weiß nicht recht, was ich antworten soll. Sie bemerken meine Unsicherheit und werfen einander besorgte – argwöhnische – Blicke zu.
»Du musst uns sagen, wo du wohnen wirst, sonst dürfen wir dich hier nicht weglassen«, sagt der Oberinspektor.
Ich lege den Kopf schräg und sehe sie von unten an, was mich unschuldig und hilflos wirken lässt. Diesen Ausdruck habe ich vor Jahren bei Filmaufnahmen von meiner Tante gelernt.
»Ich suche meinen Vater«, vertraue ich ihnen an, in der Hoffnung, ihr Mitleid zu erregen. »Meine Mutter hat China vor meiner Geburt verlassen. Jetzt bin ich dahin zurückgekehrt, wo ich hingehöre.« Bisher habe ich nicht gelogen, doch ich brauche ihre Unterstützung. »Ich möchte bei meinem Vater leben und ihm helfen, das Land aufzubauen, aber meine Mutter wollte mir nicht sagen, wo ich ihn finde. Sie ist zu amerikanisch geworden.« Beim letzten Satz verziehe ich das Gesicht, als wäre es das Verabscheuenswerteste auf Erden.
»Was für eine Art von Arbeiter ist er?«, fragt der Inspektor.
»Er ist Kunstmaler.«
»Aha, gut«, sagt er. »Ein Kulturarbeiter.« Die Männer diskutieren rasch die Möglichkeiten durch. Dann sagt der Chefinspektor: »Geh zum Nationalen Chinesischen Kulturarbeiterverband. Ich glaube, jetzt heißt er nur noch Künstlerverband, Niederlassung Shanghai. Sie betreuen alle Kulturarbeiter. Sie werden genau wissen, wo man ihn finden kann.«
Er schreibt mir den Weg auf, zeichnet eine einfache Karte und erklärt mir, dass ich den Künstlerverband leicht zu Fuß erreichen kann. Die Männer wünschen mir Glück, dann verlasse ich den Abfertigungsbereich, trete hinaus auf den Bund und reihe mich in ein Meer von Menschen ein, die alle aussehen wie ich. Die Chinatown von Los Angeles war eine kleine Enklave, und an der Universität von Chicago gab es nicht viele Chinesen. Hier sind mehr Chinesen, als ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ein Hochgefühl erfasst mich.
Ich stehe auf einem Fußweg, der beinahe wie ein Park am Fluss entlangführt. Die Straße vor mir ist voll mit Fahrradfahrern. Es ist Mittagszeit, vielleicht machen deshalb gerade alle Pause, aber ich bin nicht sicher. Auf der anderen Straßenseite säumen hohe Gebäude – massiger, prächtiger und breiter als alles, was ich von Los Angeles gewohnt bin – den Bund und folgen der Biegung des Whangpoo. Als ich mich zurück zum Fluss wende, sehe ich chinesische Marineschiffe und Lastkähne jeder Form und Größe. Zahllose Sampans tanzen auf dem Wasser wie eine ganze Schar Wasserläufer. Dschunken mit gesetzten Segeln gleiten vorbei. Tausende Männer, wie es mir vorkommt – mit nacktem Oberkörper und leichten Baumwollhosen, die bis zu den Knien hochgerollt sind –, schleppen Baumwollbündel, mit Obst und Gemüse gefüllte Körbe und riesige Kisten zu den Booten hin oder an Land. Es ist ein einziges Kommen und Gehen.
Ich werfe einen Blick auf die Karte, um mich zu orientieren, nehme den Koffer wieder auf, bahne mir einen Weg durch die Menschenmenge zum Randstein und warte, dass die Fahrräder anhalten, um mich über die Straße zu lassen. Sie halten aber nicht an. Und es gibt keine Ampel. Unaufhörlich werde ich von dem unendlichen Strom der Fußgänger gestoßen und geschoben. Ich beobachte, wie sich andere mitten zwischen die Fahrräder hineinwagen und mutig die Straße überqueren. Als das nächste Mal jemand vom Randstein auf die Straße tritt, hefte ich mich ihm an die Fersen, in der Hoffnung, hinter ihm sicher zu sein.
Während ich die Nanking Road entlanggehe, stelle ich unwillkürlich Vergleiche zwischen Shanghai und Chinatown an, wo die meisten Leute aus Kanton in der Provinz Kwangtung im Süden Chinas stammten. Auch meine Familie kommt ursprünglich aus Kwangtung, aber meine Mutter und meine Tante wuchsen in Shanghai auf. Sie haben immer gesagt, in Shanghai sei das Essen süßer und die Kleidung modischer. Die Stadt sei aufregender – mit Clubs und Tanzlokalen, nächtlichen Spaziergängen am Bund entlang, und noch etwas: Es wurde gelacht. Als ich klein war, hörte ich meine Mutter nur selten lachen, aber sie erzählte immer davon, wie sie mit Tante May in ihrem Zimmer saß und kicherte, wie die beiden mit gut aussehenden jungen Männern Witze rissen und wie sie lachten, nur weil sie sich freuten, genau am richtigen Ort zu sein – im Paris Asiens –, und zwar genau zum richtigen Zeitpunkt, bevor die Japaner einmarschierten und meine Großmutter, Mutter und Tante fliehen mussten, um ihr Leben zu retten.
Was ich nun vor Augen habe, ist sicherlich nicht das Shanghai, von dem mir meine Mutter und meine Tante erzählten. Ich sehe keine schicken Frauen auf den Straßen, die in den Schaufenstern nach der neuesten Mode aus Paris oder Rom Ausschau halten. Ich sehe keine Ausländer, die sich benehmen, als gehörte alles ihnen. Überall sind nur Chinesen. Sie haben es alle eilig, und modisch ist nichts an ihnen. Die Frauen tragen Baumwollhosen und kurzärmelige Baumwollblusen oder einfache blaue Anzüge. Ein Stück weg vom Fluss sind die Männer besser gekleidet als die Hafenarbeiter. Sie tragen graue Anzüge – die mein Vater abschätzig als Mao-Anzüge bezeichnete. Niemand sieht zu dünn oder zu dick aus. Niemand sieht zu reich aus, und ich sehe keinen der Bettler oder Rikschafahrer, über die sich meine Mutter und Tante immer beklagten.
Es gibt nur ein Problem. Ich finde den Künstlerverband nicht. Shanghai besteht aus einem Gitterwerk von Straßen, und ich bin bald völlig verwirrt. Ich biege in Seitenwege und kleine Sträßchen ein. Ich lande in Höfen und Sackgassen. Ich frage nach dem Weg, aber die Leute drängen an mir vorbei oder glotzen mich an, weil ich hier fremd bin. Ich glaube, sie haben Angst, mit jemandem zu sprechen, der so fehl am Platz wirkt. Ich betrete ein paar Läden, um Hilfe zu bekommen, aber niemand hat jemals vom Künstlerverband gehört. Als ich ihnen meine Wegskizze zeige, schütteln sie den Kopf und schieben mich unfreundlich zur Tür hinaus.
Nachdem ich, wie es mir vorkommt, stundenlang abgewiesen, bewusst ignoriert oder von den vielen Menschen herumgeschubst wurde, stelle ich fest, dass ich mich völlig verlaufen habe. Außerdem habe ich richtigen Hunger, und mir ist schwummrig von der Hitze. Langsam bekomme ich Angst. Richtig Angst, denn ich bin in einer mir fremden Stadt, eine halbe Welt entfernt von allen, die mich kennen, und die Leute starren mich an, weil ich in meinem blöden getupften Kleid und den weißen Sandalen so fremdartig aussehe. Was mache ich hier?
Ich muss mich zusammenreißen. Unbedingt. Denk nach! Ich werde ein Hotel brauchen. Ich muss zum Bund zurückkehren und noch einmal von vorne anfangen. Aber zuerst brauche ich etwas zu essen und zu trinken.
Ich finde zurück zur Nanking Road, und bald komme ich zu einem riesigen Park, in dem ich einige Imbisswagen entdecke. Ich kaufe mir einen pikanten Kuchen, der mit Schweinehack und klein geschnittenem Blattgemüse gefüllt und in Wachspapier gewickelt ist. An einem anderen Wagen hole ich mir einen Tee in einer dicken Keramiktasse und setze mich damit auf eine Bank in der Nähe. Der Kuchen schmeckt köstlich. Der heiße Tee bringt mich mehr zum Schwitzen, als ich es sowieso schon tue, aber meine Mom hat immer behauptet, an einem heißen Tag würde eine Tasse Tee den Körper abkühlen. Es ist Spätnachmittag, doch die Hitze hat nicht nachgelassen. Noch immer ist es so feucht – ohne die Spur einer Brise –, dass ich gar nicht sagen kann, ob der Tee kühlt oder nicht. Trotzdem beleben mich das Essen und die Flüssigkeit.
In so einem Park war ich noch nie. Er ist ganz flach und scheint sich über mehrere Blocks zu ziehen. Ein Großteil davon ist gepflastert, er ist offenbar eher für Massenveranstaltungen als zum Spiel und zur Erholung gedacht. Dennoch sind hier viele Großmütter, die auf kleine Kinder aufpassen. Die Babys tragen sie auf dem Rücken, festgebunden mit einer Schlinge. Die Kleinkinder tapsen in Hosen herum, die im Schritt einen Schlitz haben. Ein kleines Mädchen hockt sich hin und pinkelt einfach auf den Boden! Ein paar ältere Kinder – keines ist älter als vier oder fünf – spielen mit Stöcken. Auf einer Bank mir gegenüber sitzt eine Großmutter. Ihre Enkeltochter ist ungefähr drei Jahre alt und wirklich niedlich. Die Haare sind in Kringeln hochgebunden und sprießen ihr wie kleine Pilze aus dem Kopf. Die Kleine sieht ständig zu mir her. Ich muss ihm wie ein Clown vorkommen. Ich winke. Sie versteckt den Kopf im Schoß ihrer Großmutter. Dann schaut sie wieder zu mir her, ich winke, und sie vergräbt wieder das Gesicht im Schoß der Großmutter. Wir wiederholen das ein paarmal, bis das kleine Mädchen mit den Fingern in meine Richtung zeigt.
Ich bringe die Keramiktasse dem Teeverkäufer zurück, und als ich wieder zur Bank komme, um meinen Koffer zu holen, verlässt das Mädchen den sicheren Bereich bei der Großmutter und nähert sich mir.
»Ni hao ma?«, frage ich. »Wie geht es dir?«
Das kleine Mädchen kichert und läuft zu seiner Großmutter. Ich sollte wirklich los, aber das Kind ist so reizend. Darüber hinaus gibt es mir das Gefühl, hierher zu gehören, wenn ich mit der Kleinen spiele, und die Zuversicht, dass alles gut wird. Sie deutet auf mich und flüstert ihrer Großmutter etwas zu. Die alte Frau öffnet eine Tasche, kramt darin herum und legt dann ihrer Enkelin etwas in die winzige Hand. Gleich darauf steht das kleine Mädchen mit ausgestrecktem Arm vor mir und bietet mir einen Krabbencracker an.
»Shie-shie.«
Die Kleine lächelt, als ich mich bedanke. Dann klettert sie neben mir auf die Bank, lässt die Beine baumeln und plappert über alles Mögliche. Ich dachte ja, ich würde den Shanghaier Dialekt recht gut beherrschen, aber ich verstehe sie lange nicht so gut, wie ich gehofft hatte. Schließlich kommt die Großmutter zu uns herüber.
»Du hast unsere Enttäuschung kennengelernt«, sagt sie. »Mein Mann und ich hoffen beim nächsten Mal auf einen Enkelsohn.«
Solche Sachen habe ich mein ganzes Leben lang gehört. Ich tätschle dem kleinen Mädchen das Knie, eine Geste der Solidarität.
»Du siehst nicht aus, als kämst du aus Shanghai«, fährt die alte Frau fort. »Bist du aus Peking?«
»Ich komme von weit her«, antworte ich, denn ich will nicht meine ganze Geschichte erzählen. »Ich bin hier, um meinen Vater zu suchen, aber ich habe mich verlaufen.«
»Wo musst du denn hin?«
Ich zeige ihr die Wegbeschreibung.
»Ich weiß, wo das ist«, sagt sie. »Wir können dich hinbringen, wenn du willst. Es liegt auf unserem Heimweg.«
»Dafür wäre ich sehr dankbar.«
Sie nimmt ihre Enkelin an die Hand, ich meinen Koffer.
Einige Minuten später stehen wir vor dem Gebäude des Künstlerverbandes. Ich bedanke mich bei der alten Frau. Ich durchsuche meine Handtasche, finde noch eine letzte Rolle Life Savers und schenke die Pfefferminzbonbons dem kleinen Mädchen. Die Kleine weiß nicht, was sie damit anfangen soll.
»Das sind Bonbons«, erkläre ich. »Genauso süß wie du.« Meine Tante hat das oft zu mir gesagt, und ein stechender Schmerz durchfährt mich bei der Erinnerung daran. Ich bin so weit gekommen, und immer noch sind meine Mutter und meine Tante bei mir.
Nachdem wir uns ausgiebig gegenseitig bedankt haben, wende ich mich ab und betrete das Gebäude. Ich hoffte auf eine Klimaanlage, aber im Foyer ist es genauso drückend heiß wie auf der Straße. Eine Frau mittleren Alters sitzt hinter einem Schreibtisch mitten im Raum. Sie lächelt und winkt mich zu sich.
»Ich suche einen Maler namens Li Zhi-ge«, sage ich.
Das Lächeln verschwindet aus dem Gesicht der Frau und verwandelt sich in einen finsteren Blick. »Zu spät. Die Besprechung ist fast vorbei.«
Ich sehe sie verblüfft an.
»Ich lasse dich aber nicht da rein«, blafft sie und deutet verärgert auf eine hohe Doppeltür.
»Heißt das, er ist da drinnen? Jetzt?«
»Natürlich ist er da drinnen.«
Meine Mutter würde es Schicksal nennen, dass ich meinen Vater so schnell gefunden habe, doch vielleicht ist es nur ein glücklicher Zufall. Was es auch sei, ich bin froh darüber, auch wenn es nur blindes Glück ist. Aber ich verstehe immer noch nicht, warum die Frau vom Empfang mich nicht hineinlassen will.
»Ich muss ihn sehen«, bitte ich sie.
In diesem Moment gehen die Türen auf, und eine Gruppe Menschen strömt heraus.
»Da ist er«, sagt die Empfangsdame verächtlich.
Sie deutet auf einen großen Mann mit einer Drahtgestellbrille. Seine Haare sind ziemlich lang und fallen ihm locker über die Stirn. Er hat auf jeden Fall das richtige Alter – etwa Mitte vierzig –, und er sieht auffallend gut aus. Er trägt einen Mao-Anzug, aber seiner unterscheidet sich von den anderen, die ich auf der Straße gesehen habe. Seiner ist elegant und gut geschnitten, der Stoff sieht fester aus. Mein Vater muss sehr berühmt und mächtig sein, denn die anderen folgen ihm dichtauf und drängen ihn quasi zur Straße hinaus.
Als sie das Gebäude verlassen, laufe ich ihnen rasch hinterher. Sobald sie auf dem Gehsteig sind, verlieren sich die anderen und vermischen sich mit dem Strom der Fußgänger. Z. G. bleibt einen Augenblick stehen und blickt zwischen den Häusern hindurch nach oben auf ein Stück weißen Himmel. Dann seufzt er, schüttelt die Hände, als wollte er eine Last abschütteln, und geht los. Ich folge ihm, immer noch mit dem schweren Koffer. Was würde wohl passieren, wenn ich zu ihm ginge und ihm eröffnete, dass ich seine Tochter bin? Ich kenne ihn nicht, dennoch spüre ich, dass jetzt gerade kein guter Moment ist. Ganz abgesehen davon habe ich viel zu große Angst. Irgendwann bleibt er an einer Kreuzung stehen, und ich stelle mich neben ihn. Er muss mich doch bemerken, so anders, wie ich aussehe – immerhin bin ich ja allen anderen auch aufgefallen –, aber er wirkt völlig in Gedanken versunken. Ich sollte etwas sagen. Hallo, du bist mein Vater. Es geht nicht. Er streift mich mit einem kurzen Blick, nimmt aber immer noch nichts wahr und überquert dann die Straße.
Er biegt in eine ruhigere Straße ein. Bürogebäude weichen Wohnungen und kleinen Läden. Er geht ein paar Straßen weiter, dann biegt er in einen Fußweg ein, der auf beiden Seiten gesäumt ist von hübschen zwei- und dreistöckigen Häusern im westlichen Stil. Ich bleibe an der Ecke stehen, um zu beobachten, wo er hinwill. An den ersten drei Häusern geht er vorbei, dann öffnet er ein Tor in einem niedrigen Lattenzaun, betritt einen Garten, steigt die Stufen zur Veranda hinauf und verschwindet durch den Eingang. Ich gehe ein paar Schritte weiter. In den Gärten sehe ich Rasenflächen, blühende Cymbidien, Kletterwein. An den Veranden lehnen Fahrräder, Wäsche hängt an Stangen, die aus den Fenstern herausragen. Die Häuser selbst sind hübsch – mit Ziegeldächern, nett bemalten Fassaden und schmiedeeisernem Gitterwerk mit Art-déco-Ornamenten vor den Fenstern, als Durchblick für die Türen und als Dekoration an den Dachvorsprüngen und um die Briefschlitze.
So haben Joe und meine Dozenten Rotchina nicht beschrieben. Ich habe kommunistische Zweckbauten erwartet oder sogar nur ein Wohn-Schlaf-Atelier. Doch mein Vater wohnt in einem eleganten Art-déco-Haus mit einem hübschen Garten. Was sagt das wohl über ihn aus?
Ich hole tief Luft, steige die Stufen hinauf und drücke auf die Klingel.
Kapitel 2Joy
Zwei länger werdende Schatten
Eine junge Frau öffnet die Tür. Sie trägt eine weite schwarze Hose und eine leichte blaue Tunika mit geflochtenen Knebelverschlüssen am Hals, quer über der Brust und unter dem Arm.
»Ja bitte?«, sagt sie.
Ist sie Z. G.s Tochter? Meine Halbschwester?
»Ich möchte zu Li Zhi-ge.«
»Worum geht es?« Ihre melodiöse Stimme klingt plötzlich irritiert, vielleicht ängstlich.
»Ich bin von weit her gekommen.« Ich hebe meinen Koffer etwas an. Abgesehen davon muss sie doch sehen, dass ich nicht aus der Gegend stamme. »Es geht um eine Privatangelegenheit, und es ist sehr wichtig, dass ich mit ihm spreche.«
Das Mädchen tritt zur Seite, und ich gehe ins Haus. Der Vorraum ist groß. Der lange Gang ist mit polierten Mahagonidielen ausgelegt. Rechts befindet sich ein Wohnzimmer mit Möbeln aus der Ming-Dynastie. Links liegt das Esszimmer, ähnlich eingerichtet. Da ich in Chinatown aufgewachsen bin, kann ich das Echte vom Nachgemachten unterscheiden, und was ich hier sehe, ist echt und von guter Qualität. Doch was da an der Wand hängt, erschüttert mich. Jedes einzelne der Plakate zeigt meine Mutter und meine Tante. Sie sind jung und strahlend, hübsch gekleidet und mit allen möglichen Aktivitäten beschäftigt – wollen in einen Pool springen, steigen aus einem Flugzeug und winken oder trinken Champagner bei einem Tanztee. Meine Mutter und meine Tante schwelgten oft in Erinnerungen an ihre Zeit als »Kalendermädchen«. Und nun sehe ich sie hier, gerahmt und ausgestellt wie in einem privaten Museum. Ich bin hin- und hergerissen, denn einerseits bin ich noch wütend auf sie, andererseits verleiht es mir Mut, ihre Gesichter zu sehen.
»Bitte«, sagt die junge Frau. Ich nehme Platz, und sie tappt leise aus dem Raum. Kurz darauf kommt eine andere junge Frau herein, in identischer Hose und Tunika. Ohne ein Wort schenkt sie mir eine Tasse Tee ein und zieht sich wieder zurück. Mein Vater hat Dienstmädchen! So habe ich mir sein Leben allerdings nicht vorgestellt.
»Was gibt es?«, fragt ein Mann.
Er ist es. Plötzlich zittere ich so sehr, dass ich Angst habe aufzustehen. Ich habe einen so weiten Weg zurückgelegt und so viele Verbindungen durchtrennt ...
»Ich würde gerne mit Ihnen sprechen.« Meine Stimme bebt. »Sind Sie beschäftigt?«
»Um ehrlich zu sein, ja«, antwortet er kurz angebunden. »Ich gehe aufs Land. Das musst du doch wissen, Genossin. Ich würde jetzt gerne in Ruhe packen. Ich habe noch viel zu erledigen ...«
»Sind Sie Li Zhi-ge?«
»Natürlich bin ich das!«
»Vor langer Zeit hatten Sie einen anderen Namen. Man nannte Sie Z. G. Li ...«
»Damals hatten viele Leute andere Namen. Zu der Zeit folgte ich dem Wind und nahm westliche Gepflogenheiten an. Ich habe meinen Fehler eingesehen. Ich habe mich mit der Zeit verändert und verändere mich immer noch.«
»Sind Sie derselbe Maler, der früher Kalendermädchen gemalt hat?«
Er sieht mich ungeduldig an und deutet auf die Wände. »Das siehst du doch. Auch diese Zeit bereue ich ...«
»Haben Sie jemals Pearl und May Chin gemalt?«
Er antwortet nicht – wieder hängt die Antwort an den Wänden –, aber sein Gesicht wird grau und seine Haltung schlaff. »Wenn du hier bist, um mich noch mehr zu bestrafen, kannst du dir die Mühe sparen, Genossin«, sagt er steif.
Wovon redet er da?
»Pearl Chin ist meine Tante«, fahre ich fort. »May Chin ist meine Mutter. Ich bin neunzehn Jahre alt.« Ich beobachte ihn genau, während ich spreche. Sein abwehrendes Grau wird zu einem geisterhaften Weiß. »Ich bin deine Tochter.«
Er lässt sich in den Sessel mir gegenüber fallen und starrt mich an. Kurz blickt er auf die Poster an der Wand hinter mir, dann sieht er wieder mich an.
»Das könnte jeder behaupten.«
»Aber aus welchem Grund?« erwidere ich schroff. »Sie haben mir den Namen Joy gegeben.« Ich sage »sie« und hoffe, er fragt nicht nach dem Grund. Ich bin nicht darauf vorbereitet, ihm alles gleich jetzt zu erzählen.
»Ich habe gehört, Pearl und May seien gestorben ...«
»Nein.«
Ich suche in meiner Handtasche nach meinem Geldbeutel und zeige ihm ein Foto, das Anfang dieses Sommers aufgenommen wurde, als wir zum ersten Mal in Disneyland waren. Meine Mutter und meine Tante fanden, wir müssten entsprechend gekleidet sein. Tante May trug ein Baumwollkleid mit einem Gürtel um die Taille, einem weiten Rock und einem Petticoat darunter. Mom trug einen Faltenrock und eine taillierte Hemdbluse. Beide waren vorher beim Friseur gewesen und hatten sich Seidenschals um den Kopf gebunden, um ihre Frisuren zu schützen. Zur Abrundung trugen sie Schuhe mit hohen Absätzen. Natürlich waren wir uns heftig darüber in die Haare geraten, was ich anziehen sollte. Wir hatten uns schließlich auf einen engen, knielangen Rock, eine ärmellose weiße Bluse und Ballerinas geeinigt. Mein Dad hat das Bild von uns drei vor der Peter-Pan-Bahn gemacht.
Meine Augen füllen sich mit Tränen. Ich blinzle sie weg. Z. G. betrachtet das Foto mit einem Ausdruck, den ich nicht deuten kann. Verlust? Liebe? Reue? Vielleicht begreift er einfach allmählich, dass ich ihm die Wahrheit gesagt habe.
»May.« Er zieht die eine Silbe ganz lang. Dann wird ihm bewusst, dass ich ihn ansehe, und er setzt sich gerade auf. »Und, wo sind sie? Warum sind sie nicht mit dir gekommen? Warum sollten sie dich alleine herschicken?«
Auch er spricht von ihnen im Plural, und ich werde ihn auf keinen Fall korrigieren.
»Sie sind in Los Angeles.« Damit es besser klingt, füge ich »Haolaiwu – Hollywood« hinzu.
Ihm scheint nicht aufzufallen, dass ich seine andere Frage gar nicht beantwortet habe, denn er sagt: »May wollte immer nach Haolaiwu.«
»Hast du sie in den Filmen gesehen? Sie spielt in vielen Filmen mit. Ich auch. Wir haben zusammen gearbeitet. Erst waren wir Komparsen, und dann ... Hast du uns gesehen?«
Er sieht mich an wie ein Wesen von einem anderen Stern.
»Joy, so heißt du, oder? Das hier« – er macht eine ausholende Armbewegung – »ist China. Wir sehen hier keine Hollywood-Filme.« Dann fragt er: »Wo kommst du her? Wie bist du hergekommen?«
»Entschuldigung, ich dachte, ich hätte dir das gesagt. Ich komme aus Los Angeles. Ich bin gekommen, um dich kennenzulernen und den revolutionären Kampf zu unterstützen!«
Er lässt den Kopf zurückfallen, als wollte er die Decke betrachten. Als er wieder mich ansieht, fragt er: »Was hast du getan? Bist du von Sinnen?«
»Was meinst du damit? Ich musste dich kennenlernen«, sage ich. »Willst du mich nicht?«
»Bis vor ein paar Minuten wusste ich noch nicht einmal, dass es dich gibt.«
Er wirft einen Blick über die Schulter in die Diele. Beim Anblick meines Koffers runzelt er die Stirn. »Was hast du vor? Dein Wu-Dialekt klingt nicht ganz richtig. Er ist einigermaßen passabel, aber die meisten Leute werden gleich merken, dass du nicht von hier bist. Selbst wenn du den Shanghaier Dialekt perfekt beherrschen würdest, mit deiner Frisur und deiner Kleidung siehst du immer noch so aus, als gehörtest du nicht hierher.«
Warum muss er das alles so negativ klingen lassen?
»Deine Mutter und deine Tante können unmöglich damit einverstanden gewesen sein, dass du herkommst«, fügt er hinzu. Er will mehr Informationen aus mir herauslocken, aber dazu bin ich immer noch nicht bereit.
»Eure Regierung hat Leute wie mich aufgerufen herzukommen.« Ich versuche die Begeisterung durchklingen zu lassen, die ich seit Monaten verspüre. »Ich möchte helfen, die Neue Gesellschaft aufzubauen.« Aber es ist, als hätte man den Deckel von einem Reistopf genommen. Der ganze Dampf ist zu schnell entwichen. Warum ist er nicht glücklicher, mich zu sehen? Warum hat er mich nicht umarmt oder geküsst? »Und ich bin da nicht die Einzige.«
»Du bist die Einzige, die ... die ...« Er schluckt. Ich warte darauf, dass er die Worte ausspricht, die ich hören muss. »Die meine Tochter ist.« Er verstummt und knetet sich das Kinn. Hin und wieder schaut er mich an, überlegt, denkt nach. Offenbar sucht er nach einer Lösung für ein schwieriges Problem, aber wo liegt das Problem? Er hat mich schon als seine Tochter anerkannt. Schließlich fragt er: »Bist du Künstlerin? Kannst du malen?«
Eine seltsame Frage. Als Künstlerin würde mich wohl niemand bezeichnen. Deshalb lüge ich. »Ja! Das wurde immer behauptet.«
»Erzähl mir von den vier Arten der Kunst.«
Soll das eine Prüfung sein? Ich beiße mir auf die Unterlippe, um meine Enttäuschung zu verbergen, und versuche mich zu erinnern, was ich in Chinatown gesehen habe. Zum chinesischen Neujahr gab es immer Kalender. Sogar Pearls Café hat einen Kalender machen lassen, den wir unseren treuesten Kunden geschenkt haben.
»Es gibt Neujahrskalender«, sage ich zögernd.
»Stimmt. Das ist eine von vier anerkannten Kunstformen. Sie sind für Bauern bestimmt – wie Volkskunst – und deshalb gut für die breiten Massen. Politische Porträts und Propagandaplakate würden ebenfalls in diese Kategorie fallen.«
Ich erinnere mich an etwas, das ich an der Universität von Chicago gelernt habe, und sage es auf: »Mao hat gesagt, die Kunst soll Arbeitern, Bauern und Soldaten dienen. Sie soll eng mit der revolutionären Praxis verbunden sein.«
»Du bist mit den vier Arten der Kunst noch nicht fertig. Was ist mit dem sozialistischen Realismus?«
Daran erinnere ich mich genau, vom College her. »Er gibt die echte Welt beinahe wissenschaftlich genau wieder, wie ein Spiegel: die Volksmassen, die einen Damm bauen, junge Frauen, die in einer Fabrik Stoff weben, Traktoren und Panzer, die Seite an Seite über eine Landstraße rollen und Arbeiter und Soldaten vereinen. So ähnlich wie das, was du für China Reconstructs gemacht hast. Meine Mutter und meine Tante« – ich spezifiziere weiterhin nicht, wer von beiden wer ist – »haben die Ausgaben mit deinen Bildern immer aufgehoben.«
»May hat sie gesehen?«
Wieder May. Er scheint mehr über sie wissen zu wollen als über mich.