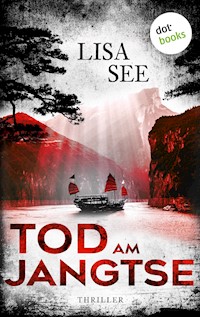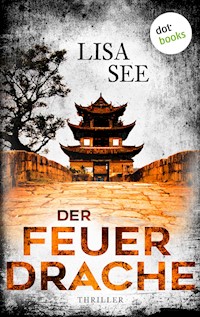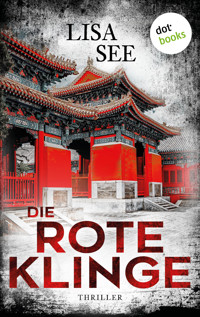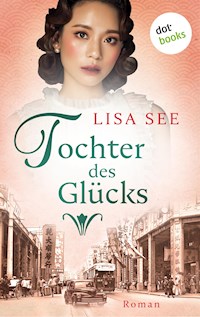6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Frauen von Shanghai
- Sprache: Deutsch
Zwei mutige Schwestern, die aus ihrer Heimat gerissen werden: Der historische Roman »Töchter aus Shanghai« von Lisa See jetzt als eBook bei dotbooks. Das ebenso glanzvolle wie gefährliche Shanghai im Jahre 1937: Als Töchter einer reichen Familie genießen Pearl und May ihr Leben in der glitzernden Metropole Chinas – bis sich alles auf einmal schlagartig ändert. Ihr Vater hat sein Vermögen verspielt und Schulden bei einem der gefährlichsten Männer Shanghais gemacht. Um ihn vor dessen Rache zu bewahren, sollen Pearl und May nun als Ehefrauen an zwei Brüder aus Amerika verkauft werden. Doch während die Schwestern verzweifelt nach einem Weg suchen, diesem Schicksal zu entgehen, greifen die Japaner Shanghai an. Ganz auf sich allein gestellt bleibt Pearl und May keine andere Wahl, als aus der in Schutt und Asche gelegten Stadt zu fliehen und die gefährliche Reise nach Los Angeles anzutreten … »Lisa See versteht es hervorragend, uns Lesende in die reiche Geschichte Chinas hineinzuziehen und ihren Erzählerinnen einzigartige Stimmen zu geben …« The Miami Herald Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Töchter aus Shanghai« von Lisa See ist der erste Band der großen Familiensaga »Die Frauen von Shanghai«. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 652
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch:
Das ebenso glanzvolle wie gefährliche Shanghai im Jahre 1937: Als Töchter einer reichen Familie genießen Pearl und May ihr Leben in der glitzernden Metropole Chinas – bis sich alles auf einmal schlagartig ändert. Ihr Vater hat sein Vermögen verspielt und Schulden bei einem der gefährlichsten Männer Shanghais gemacht. Um ihn vor dessen Rache zu bewahren, sollen Pearl und May nun als Ehefrauen an zwei Brüder aus Amerika verkauft werden. Doch während die Schwestern verzweifelt nach einem Weg suchen, diesem Schicksal zu entgehen, greifen die Japaner Shanghai an. Ganz auf sich allein gestellt bleibt Pearl und May keine andere Wahl, als aus der in Schutt und Asche gelegten Stadt zu fliehen und die gefährliche Reise nach Los Angeles anzutreten …
»Lisa See versteht es hervorragend, uns Lesende in die reiche Geschichte Chinas hineinzuziehen und ihren Erzählerinnen einzigartige Stimmen zu geben …« The Miami Herald
Über die Autorin:
Lisa See entstammt einer chinesisch-amerikanischen Familie. Sie wurde in Paris geboren und wuchs in Los Angeles in Chinatown auf. Dreizehn Jahre lang arbeitete sie als Journalistin für Publishers Weekly. Später betreute sie als Kuratorin mehrere große Ausstellungen, die sich mit interkulturellen Beziehungen zwischen Amerika und China beschäftigen. Bereits ihr erstes Buch, eine Biographie ihrer Familie, war ein internationaler Bestseller und erhielt die »Notable Book«-Auszeichnung der New York Times. Dieselbe Auszeichnung bekam sie auch für ihren bald darauf folgenden ersten Thriller »Die rote Klinge«. Sie wurde als »National Woman of the Year« ausgezeichnet, erhielt den »Chinese American Museum’s History Makers Award« und den »Golden Spike Award« in Kalifornien. Mit ihrem Roman »Der Seidenfächer« gelang ihr ein Weltbestseller, der auch verfilmt wurde. Heute lebt sie in Los Angeles.
Bei dotbooks veröffentlicht Lisa See den historischen Roman »Der Seidenfächer««, außerdem »Töchter aus Shanghai« und »Tochter des Glücks« aus ihrer Reihe um »Die Frauen von Shanghai«.
Zudem erscheint bei dotbooks auch ihre Thrillerreihe um die Polizistin Liu Hulan mit den Bänden »Die rote Klinge«, »Der Feuerdrache« und »Tod am Jangtse«.
Die Website der Autorin: https://www.lisasee.com/
***
eBook-Neuausgabe Juli 2022
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2009 unter dem Originaltitel »Shanghai Girls« bei Random House, New York.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2009 by Lisa See
First published by Random House, New York.
Translation rights arranged by The Sandra Dijkstra Literary Agency
Translation Copyright © 2009 by Elke Link and Andrea Fischer
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2009 beim C. Bertelsmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch The Dijkstra Literary Agency
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / Jenson / scis65 sowie Nankin Road, Shanghai, c. 1930s, unknown author
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-085-4
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Töchter aus Shanghai« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Lisa See
Töchter aus Shanghai
Roman - Die Frauen von Shanghai 1
Aus dem Amerikanischen von Elke Link und Andrea Fischer
dotbooks.
Für meine Cousine Leslee Long, meine Mitstreiterin im Bewahren der Erinnerung
Vorbemerkung der Autorin
»Töchter aus Shanghai« spielt in den Jahren zwischen 1937 und 1957. Der Leser wird in diesem Buch einige Ausdrücke finden, die wir heutzutage nicht mehr als politisch korrekt bezeichnen würden, aber in der damaligen Zeit waren sie gebräuchlich. Für die Umschrift der chinesischen Wörter – ob Mandarin, Kantonesisch oder aus dem Sze-Yup- beziehungsweise dem Wu-Dialekt – habe ich das Wade-Giles-System verwendet, wie es damals üblich war.
Zur Umrechnung: Vor November 1935 wurde in Shanghai mit Silberdollars gezahlt; nach 1935 gab es chinesische yuan. Die beiden Währungen entsprechen sich im Großen und Ganzen. Ich habe beschlossen, bei Dollar und Cent zu bleiben, weil sie immer noch im Umlauf waren und für den westlichen Leser vertrauter sind. Der Kupfer-Silber-Wechselkurs schwankte zwischen 300 und 330 Kupfermünzen für einen Silberdollar (oder yuan).
Erster Teil
Schicksal
Kapitel 1
Kalendermädchen
»Mit ihren roten Bäckchen sieht unsere Tochter aus wie eine südchinesische Bäuerin«, mäkelt mein Vater und ignoriert demonstrativ die Suppe, die vor ihm steht. »Kannst du nichts dagegen tun?«
Mama schaut Baba an, aber was soll sie schon sagen? Ich habe ein recht hübsches Gesicht – manche finden es sogar reizend –, doch es schimmert nicht wie die Perle, nach der ich benannt bin. Ich erröte leicht. Außerdem bin ich sehr sonnenempfindlich. Seit ich fünf bin, reibt mir meine Mutter Gesicht und Arme mit Perlencreme ein und mischt mir morgens zermahlene Perlen in den jook – den Reisbrei –, in der Hoffnung, das Weiß würde mir in die Haut eindringen. Alles vergebens. Jetzt glühen meine Wangen rot – genau das, was mein Vater nicht leiden kann. Ich sacke auf meinem Stuhl zusammen. In Babas Nähe werde ich immer klein, aber es wird noch schlimmer, wenn er den Blick von meiner Schwester abwendet und mich anschaut. Ich bin größer als mein Vater, das stört ihn sehr. Wir leben in Shanghai, wo das größte Auto, die größte Mauer oder das größte Gebäude eindeutig und unumstößlich verkündet, dass der Besitzer ein sehr bedeutender Mensch ist. Ich bin kein bedeutender Mensch.
»Sie hält sich für besonders schlau«, fährt Baba fort. Er trägt einen gut geschnittenen Anzug im westlichen Stil. Seine Haare haben nur wenige graue Strähnen. In letzter Zeit wirkte er häufig nervös. Aber heute Abend ist seine Stimmung noch düsterer als sonst. Vielleicht hat sein Lieblingspferd nicht gewonnen, oder die Würfel wollten nicht zu seinen Gunsten fallen. »Dabei ist sie alles, nur nicht klug.«
Das ist ein weiterer Kritikpunkt, den mein Vater gerne äußert. Er bezieht sich auf Konfuzius, bei dem es heißt: »Eine gebildete Frau ist eine wertlose Frau.« Man bezeichnet mich als Bücherwurm, was sogar im Jahr 1937 nicht als Kompliment gilt. Doch so schlau ich auch sein mag, ich weiß nicht, wie ich mich vor den Worten meines Vaters schützen soll.
Die meisten Familien essen an einem runden Tisch. So bilden sie einen Kreis, ein harmonisches Ganzes, ohne harte Kanten. Wir hingegen essen an einem eckigen Tisch aus Teakholz. Jeder von uns hat seinen festen Platz: neben May auf der einen Seite des Tisches mein Vater, gegenüber von ihr meine Mutter, damit Mays Anblick meine Eltern gleichermaßen erfreut. Tag um Tag, Jahr um Jahr ist jede Mahlzeit eine Erinnerung daran, dass ich nicht ihr Liebling bin und es auch nie sein werde.
Während mein Vater weiter an mir herummäkelt, schalte ich ab und tue so, als interessierte ich mich für unser Esszimmer. An der Wand zur Küche hängen normalerweise vier Bildrollen mit den vier Jahreszeiten. Heute wurden sie abgenommen, sodass nur noch dunkle Umrisse zu sehen sind. Das ist nicht das Einzige, was fehlt. Früher hatten wir einen Deckenventilator, aber letztes Jahr kam Baba auf die Idee, es wäre angenehmer, wenn wir uns beim Essen von den Dienern Luft zufächeln ließen. Sie sind heute Abend nicht da, und wir vergehen vor Hitze. Sonst wird der Raum von einem Art-Déco-Lüster und passenden Wandlampen aus gelbem und rosafarbenem Ätzglas erhellt. Auch die sind weg. Doch ich zerbreche mir nicht den Kopf darüber und gehe davon aus, dass die Bildrollen abgenommen wurden, damit sich die seidenen Ränder in dieser Feuchtigkeit nicht aufrollen, dass Baba den Dienern freigegeben hat, damit sie mit ihren Familien zu einer Hochzeit oder einer Geburtstagsfeier gehen können, und dass die Lampen vorübergehend entfernt wurden, weil sie geputzt werden müssen.
Koch – der weder Frau noch Kinder hat – trägt unsere Suppenschalen ab und serviert nun Garnelen mit Wasserkastanien, in Sojasauce geschmortes Schweinefleisch mit getrocknetem Gemüse und Bambussprossen, gedämpften Aal, ein Acht-Kostbarkeiten-Gemüsegericht sowie Reis, aber die Hitze dämpft meinen Hunger. Lieber wären mir ein gekühlter Ume-Pflaumensaft, kalte, süße Mungobohnensuppe mit Minze oder eine süße Mandelbrühe.
Als Mama sagt: »Der Korbmacher hat heute zu viel Geld verlangt«, entspanne ich mich. Ebenso absehbar wie die Kritik meines Vaters an mir ist die Tatsache, dass meine Mutter von ihren alltäglichen Problemchen berichtet. Sie sieht elegant aus, wie immer. Spangen aus Bernstein halten ihren Haarknoten im Nacken genau an der richtigen Stelle. Ihr Kleid, ein cheongsam aus mitternachtsblauer Seide mit halblangen Ärmeln, ist perfekt auf ihr Alter und ihren Stand zugeschnitten. Am Handgelenk trägt sie einen Armreif aus einem einzigen Stück hochwertiger Jade. Wenn er auf die Tischkante trifft, macht es ein beruhigendes, vertrautes Klack. Sie hat gebundene Füße und verhält sich in manchen Dingen ebenso altmodisch. Sie deutet unsere Träume, überlegt, ob es wohl ein gutes oder schlechtes Omen ist, wenn darin Wasser, Schuhe oder Zähne vorkommen. Sie glaubt an Astrologie. Sie rügt oder lobt May und mich für alle möglichen Dinge, nur weil wir im Jahr des Schafs beziehungsweise im Jahr des Drachen geboren wurden.
Mama führt ein glückliches Leben. Die arrangierte Ehe mit meinem Vater verläuft einigermaßen friedlich. Morgens liest sie buddhistische Sutras, lässt sich mit einer Rikscha zum Mittagessen bei Freundinnen fahren, spielt bis in den späten Nachmittag hinein Mah-Jongg und klagt mit Ehefrauen ähnlicher Stellung über das Wetter, phlegmatische Dienstboten oder über die Wirkungslosigkeit der neuesten Mittelchen gegen Schluckauf, Gicht oder Hämorrhoiden. Sie hätte eigentlich keinen Grund, missmutig zu sein, und doch sind all ihre Geschichten von leiser Verbitterung und ständiger Sorge durchtränkt. »Es gibt kein glückliches Ende«, sagt sie oft. Trotzdem ist sie eine schöne Frau, und ihr Liliengang ist so anmutig wie das Schwanken von jungem Bambus im Frühlingswind.
»Der faule Diener von nebenan hat den Nachttopf der Familie Tso überschwappen lassen, und jetzt stinkt es in der ganzen Straße nach Jauche«, sagt Mama. »Und dann Koch!« Sie gestattet sich ein missbilligendes Zischeln. »Die Garnelen, die uns Koch vorgesetzt hat, waren alt, und der Geruch hat mir völlig den Appetit verdorben.«
Wir widersprechen ihr nicht, aber dieser erstickende Gestank stammt nicht von einem umgekippten Nachttopf oder alten Garnelen, sondern von ihr. Da unsere Diener nicht da sind, um die Luft im Raum zu bewegen, steigt mir der Geruch der mit Blut und Eiter vollgesogenen Bandagen um Mamas gebundene Füße so in die Nase, dass ich würgen muss.
Mama klagt unablässig weiter, bis Baba sie unterbricht. »Ihr Mädchen könnt heute Abend nicht ausgehen. Ich muss mit euch reden.«
Dabei schaut er May an, die ihm ihr strahlendstes Lächeln schenkt. Wir sind keine schlechten Mädchen, aber wir haben Pläne für den Abend. Und dazu gehört bestimmt kein Vortrag von Baba, wie viel Wasser wir im Bad verschwenden oder dass wir nicht jedes Reiskörnchen in unseren Schalen aufessen. Normalerweise reagiert Baba auf Mays Charme, erwidert ihr Lächeln und vergisst, was er sagen wollte, doch diesmal blinzelt er nur ein paarmal und richtet seine schwarzen Augen auf mich. Wieder sacke ich auf meinem Stuhl zusammen. Manchmal glaube ich, dass ich meinen Eltern nur dann wahren kindlichen Respekt entgegenbringe, wenn ich mich vor meinem Vater klein mache. Ich betrachte mich als modernes Shanghaier Mädchen und mag nicht an diesen ganzen Unsinn vom bedingungslosen Gehorsam glauben, den man den Mädchen in der Vergangenheit eingebläut hat. Aber es ist nun einmal so: May – sosehr unsere Eltern sie auch anhimmeln – und ich sind nur Mädchen. Keine von uns wird den Familiennamen weitergeben, und keine von uns wird unsere Eltern später einmal als Ahnen verehren. Mit meiner Schwester und mir endet die Linie Chin. Als wir noch klein waren, hatten unsere Eltern wegen unseres geringen Werts kein Interesse daran, uns zu erziehen. Wir waren der Mühe und Anstrengung nicht wert. Später passierte dann etwas Merkwürdiges: Meine Eltern fanden plötzlich Gefallen an ihrer jüngeren Tochter – sie waren völlig vernarrt in sie. Dadurch konnten wir uns ein gewisses Maß an Freiheit bewahren, und es fiel meistens gar nicht auf, dass meine Schwester verwöhnt war oder wir manchmal jeglichen Respekt und unsere Pflicht vergaßen. Was andere vielleicht als respektlos und ungezogen betrachten würden, bezeichnen wir als modern und unabhängig.
»Nicht eine Kupfermünze bist du wert«, sagt Baba mit schneidender Stimme zu mir. »Ich weiß nicht, wie ich dir jemals ...«
»Ach, Ba, jetzt hör doch auf, an Pearl herumzunörgeln. Du kannst dich glücklich schätzen, so eine Tochter zu haben. Und ich noch viel mehr, weil sie meine Schwester ist.«
Alle Blicke richten sich auf May. So ist das mit ihr. Wenn sie spricht, muss man ihr einfach zuhören. Wenn sie im Raum ist, muss man sie einfach ansehen. Alle lieben sie – unsere Eltern, die Rikschajungen, die für meinen Vater arbeiten, die Missionare, die uns in der Schule unterrichtet haben, die Künstler, Revolutionäre und die Ausländer, die wir in den letzten Jahren kennengelernt haben.
»Wollt ihr gar nicht wissen, was ich heute gemacht habe?«, fragt May. Ihre Stimme klingt so leicht und luftig wie Vogelschwingen im Flug.
Damit verschwinde ich aus dem Gesichtskreis meiner Eltern. Ich bin zwar die ältere Schwester, aber in vielerlei Hinsicht kümmert sich May um mich.
»Erst hab ich mir im Metropol einen Film angeschaut, dann bin ich in die Avenue Joffre gegangen, um Schuhe zu kaufen«, fährt sie fort. »Von dort war es nicht weit zu Madame Garnets Laden im Cathay Hotel, wo ich mein neues Kleid abholen wollte.« May hört sich jetzt ein bisschen vorwurfsvoll an. »Sie hat gesagt, sie gibt es mir erst, wenn du vorbeikommst.«
»Kein Mädchen braucht jede Woche ein neues Kleid«, sagt Mama sanft. »Da könntest du dir ausnahmsweise ein Beispiel an deiner Schwester nehmen. Ein Drache braucht keine Rüschen, Spitze und Schleifchen. Für so etwas ist Pearl viel zu praktisch veranlagt.«
»Baba kann es sich aber leisten«, gibt May zurück.
Mein Vater presst die Lippen zusammen. Hat May etwas Falsches gesagt, oder will er mich gleich wieder kritisieren? Er öffnet den Mund, aber meine Schwester schneidet ihm das Wort ab.
»Wir haben jetzt den siebten Monat, und die Hitze ist schon unerträglich. Wann schickst du uns nach Kuling, Baba? Du willst doch nicht, dass Mama und ich krank werden, oder? Wenn der Sommer kommt, ist es in der Stadt nicht mehr auszuhalten. Um diese Jahreszeit sind wir in den Bergen viel glücklicher.«
May hat es taktvoll unterlassen, meinen Namen zu erwähnen. Von mir ist besser erst später die Rede. Aber eigentlich will sie mit ihrem ganzen Geplapper nur unsere Eltern ablenken. Meine Schwester sieht zu mir herüber, nickt beinahe unmerklich und steht schnell auf.
»Komm, Pearl! Machen wir uns fertig!«
Ich schiebe den Stuhl zurück und bin froh, dass mir die Kritik meines Vaters erspart wurde.
»Nein!« Baba schlägt mit der Faust auf den Tisch. Das Geschirr klappert. Mama fährt vor Schreck zusammen. Ich erstarre. Die Leute in unserer Straße bewundern meinen Vater für seinen Geschäftssinn. Er hat den Traum wahr gemacht, den jeder gebürtige Shanghaier hat, und auch jeder Shanghailänder – das sind die Ausländer, die aus der ganzen Welt hierhergekommen sind, um ihr Glück zu machen. Er hat mit nichts angefangen und aus sich und seiner Familie etwas gemacht. Vor meiner Geburt führte er ein Rikschaunternehmen in Kanton, nicht als Betreiber, sondern als Subunternehmer. Er mietete Rikschas für siebzig Cent pro Tag, vermietete sie dann an einen kleineren Subunternehmer für neunzig Cent weiter, der sie wiederum für einen Dollar am Tag an die Rikschafahrer verlieh. Nachdem Vater genügend Geld beisammenhatte, zog er mit uns nach Shanghai und gründete sein eigenes Rikschaunternehmen. »Günstigere Gelegenheiten«, betont er gerne – und mit ihm wahrscheinlich eine Million weitere Bewohner der Stadt. Baba hat uns nie erzählt, wie er so wohlhabend geworden ist oder wie er an diese Gelegenheiten gekommen ist, und ich habe nicht den Mut, ihn danach zu fragen. Man ist sich – sogar innerhalb der Familie – einig, besser nicht nach der Vergangenheit zu fragen, denn jeder ist nach Shanghai gekommen, um vor etwas zu fliehen oder etwas zu verbergen.
May ist das alles egal. Ich schaue sie an und weiß genau, was sie sagen will: Ich will mir nicht anhören, dass dir unsere Frisuren nicht gefallen. Ich will mir nicht anhören, dass wir die Arme nicht entblößen oder zu viel Bein zeigen sollen. Nein, wir wollen keine »normalen Vollzeitbeschäftigungen«. Du bist vielleicht mein Vater, aber trotz des ganzen Getöses, das du veranstaltest, bist du ein schwacher Mann, und ich will dir nicht zuhören. Stattdessen neigt sie nur den Kopf und blickt in einer Art auf meinen Vater herab, die ihn völlig hilflos macht. Diesen Trick beherrschte sie schon als Kleinkind und perfektionierte ihn im Laufe der Jahre. Ihre Unbekümmertheit, ihre Unbefangenheit lässt jeden dahinschmelzen. May verzieht den Mund zu einem kleinen Lächeln. Sie tätschelt Vater die Schulter, und sein Blick fällt auf ihre Fingernägel, die, genau wie meine, durch das mehrmalige Auftragen von Springkrautsaft rot gefärbt sind. Berührungen sind – sogar innerhalb der Familie – nicht gänzlich tabu, üblich sind sie jedoch keinesfalls. In einer guten, anständigen Familie gibt es keine Küsse, keine Umarmungen, keine liebevollen Klapse. May weiß also ganz genau, was sie tut, als sie unseren Vater berührt. Während ihn das noch sichtlich irritiert, saust sie schon davon, und ich laufe ihr rasch nach. Wir sind ein paar Schritte weit gekommen, da ruft Baba uns nach: »Bitte bleibt hier!«
Aber wie üblich lacht May einfach nur. »Wir arbeiten heute Nacht. Warte nicht auf uns.«
Ich steige hinter ihr die Treppe hinauf, und die Stimmen unserer Eltern begleiten uns wie ein misstönendes Lied. Mama singt die Melodie: »Eure Ehemänner tun mir jetzt schon leid. ›Ich brauche Schuhe.‹ ›Ich will ein neues Kleid.‹ ›Kaufst du uns Opernkarten?‹« Baba sorgt mit seiner tieferen Stimme für den Bass: »Kommt zurück! Bitte kommt zurück! Ich muss euch etwas sagen.« May ignoriert sie, und ich versuche es ebenfalls. Ich bewundere, wie sie die Ohren vor den Worten und der Beharrlichkeit unserer Eltern verschließen kann. Da ist sie ganz anders als ich, wie auch sonst in vielerlei Hinsicht.
Immer wenn es zwei Schwestern gibt – oder Geschwister jeglicher Zahl, ganz gleich welchen Geschlechts – werden Vergleiche angestellt. May und ich wurden im Dorf Yin Bo geboren, weniger als einen halben Tagesmarsch von Kanton entfernt. Wir sind nur drei Jahre auseinander, aber wir könnten unterschiedlicher nicht sein. Sie ist ein fröhlicher Typ; mir wird vorgeworfen, zu düster zu sein. May ist klein und hat bezaubernde Rundungen; ich bin groß und dünn. May, die gerade die Schule abgeschlossen hat, liest nichts außer den Klatschspalten; ich habe vor fünf Wochen den Abschluss am College gemacht.
Die erste Sprache, die ich lernte, war Sze Yup, der Dialekt, der in den Vier Bezirken der Kwangtung-Provinz gesprochen wird, aus der unsere Familie stammt. Seit meinem fünften Lebensjahr hatte ich amerikanische und britische Lehrer, daher ist mein Englisch so gut wie perfekt. Ich beherrsche vier Sprachen fließend – britisches Englisch, amerikanisches Englisch, den Sze-Yup-Dialekt (einen von vielen kantonesischen Dialekten) und den Wu-Dialekt (eine besondere Variante des Mandarin, die nur in Shanghai gesprochen wird). Ich lebe in einer internationalen Stadt, daher benutze ich die englischen Namen der chinesischen Städte und Gegenden wie Kanton, Chungking und Yunnan; ich verwende die kantonesische Bezeichnung cheongsam statt ch’i pao, wie es auf Mandarin heißt, für unsere chinesischen Kleider, ich sage britisch boot statt amerikanisch trunk, ich sage abwechselnd fan gwaytze – »ausländische Teufel« – auf Mandarin und lo fan – »weiße Geister« – auf Kantonesisch, wenn ich von Ausländern rede, und ich gebrauche das kantonesische Wort für »kleine Schwester« – moy moy –, statt auf Mandarin mei mei zu sagen, wenn ich von May spreche. Meine Schwester ist sprachlich völlig unbegabt. Wir sind nach Shanghai gezogen, als May noch ein Säugling war, und bis auf ein paar Bezeichnungen für bestimmte Gerichte und Zutaten hat sie nie Sze Yup gelernt. May kann nur Englisch und den Wu-Dialekt. Abgesehen von den üblichen dialektalen Eigenheiten haben Mandarin und Kantonesisch ungefähr so viel gemein wie Englisch und Deutsch – sie sind miteinander verwandt, aber wer die andere Sprache nicht gelernt hat, versteht sie nicht. Deshalb nutzen meine Eltern und ich manchmal Mays Unwissenheit aus und sprechen Sze Yup, um sie außen vor zu lassen.
Mama behauptet steif und fest, May und ich könnten uns nicht ändern, selbst wenn wir es versuchten. May ist angeblich so selbstzufrieden wie das Schaf, in dessen Jahr sie geboren wurde. Das Schaf ist das weiblichste aller Sternzeichen, sagt Mama. Es ist modebewusst, künstlerisch veranlagt und mitfühlend. Das Schaf braucht jemanden, der sich um es kümmert, damit es immer sicher sein kann, Nahrung, Obdach und Kleidung zu haben. Gleichzeitig ist das Schaf dafür bekannt, dass es andere mit seiner Zuneigung erstickt. Das Glück lächelt auf das Schaf herab, weil es so ein friedliches Wesen und ein gutes Herz hat, aber – und das ist laut Mama ein großes Aber – manchmal denkt das Schaf nur an sich selbst und seinen Vorteil.
In mir steckt das Streben und Trachten eines Drachen, das nie ganz befriedigt werden kann. »Es gibt keinen Ort, den du mit deinen großen Füßen nicht erreichen könntest«, sagt Mama oft zu mir. Doch der Drache, das mächtigste aller Sternzeichen, hat auch seine Schattenseiten. »Ein Drache ist loyal, fordernd, verantwortungsbewusst, er meistert das Schicksal«, hat Mama mir gesagt, »aber dir, meine Pearl, wird immer der Dampf, der dir aus dem Schlund steigt, den Blick vernebeln.«
Bin ich eifersüchtig auf meine Schwester? Wie soll ich auf sie eifersüchtig sein, wenn selbst ich sie anhimmle? Long – »Drache« – ist unser gemeinsamer Generationsname. Ich bin Perldrache und May ist Schöner Drache. Sie schreibt ihren Namen, wie es im Westen gebräuchlich ist, doch auf Mandarin ist mei eines der Wörter für schön, und genau das ist sie. Meine Pflicht als ihre ältere Schwester ist es, sie zu schützen, dafür zu sorgen, dass sie den richtigen Weg einschlägt, und sie nachsichtig zu behandeln, weil sie so kostbar für uns ist und in der Familie so geliebt wird. Manchmal bin ich trotzdem böse auf sie: zum Beispiel als sie, ohne mich zu fragen, einfach meine italienischen Stöckelschuhe aus pinkfarbener Seide anzog und im Regen ruinierte. Aber eines steht fest: Meine Schwester liebt mich. Ich bin ihre jie jie – ihre ältere Schwester. In der Hierarchie der chinesischen Familie werde ich immer und für alle Zeit über ihr stehen, selbst wenn mich meine Familie nicht so sehr liebt wie sie.
Als ich in unser Zimmer komme, hat sich May schon das Kleid ausgezogen, das nun als schlaffes Häuflein auf dem Boden liegt. Ich drücke die Tür hinter mir zu und schließe uns in unsere Mädchenwelt ein. Wir haben zwei identische Himmelbetten mit Baldachinen aus weißem, blau eingefasstem Leinen, bestickt mit einem Glyzinienmuster. In den meisten Schlafzimmern von Shanghai hängen Poster oder ein Kalender mit schönen Mädchen darauf, aber in unserem Zimmer gibt es mehrere davon. Wir sitzen Modell als Kalendermädchen, und für unser Zimmer haben wir uns unsere Lieblingsbilder ausgesucht: May in einer lindgrünen Seidenjacke auf einem Sofa, eine Hatamen-Zigarette in einer elfenbeinernen Zigarettenspitze in der Hand, ich sitze in einen Hermelin gehüllt, die Knie ans Kinn gezogen, in einem Säulengang vor einem mythischen See und preise Dr. Williams Pink Pills for Pale People an (wer wäre besser geeignet, solche Pillen zu verkaufen, als jemand, der von Natur aus einen rosigen Teint hat?), und schließlich ein Bild von uns beiden, wie wir zusammen in einem eleganten Boudoir sitzen, jede mit einem dicken kleinen Jungen auf dem Arm – dem Symbol für Wohlstand und Erfolg. Wir werben für Milchpulver, um zu zeigen, dass wir moderne Mütter sind, die für ihren modernen Nachwuchs die besten modernen Erfindungen verwenden.
Ich durchquere das Zimmer und gehe zu May an den Schrank. Erst jetzt beginnt eigentlich unser Tag. Heute Nacht sitzen wir für Z. G. Li Modell, den besten der Maler, die sich auf Mädchenkalender, -poster und -werbung spezialisiert haben. Die meisten Familien wären entsetzt, wenn ihre Töchter Künstlern Modell sitzen und häufig die ganze Nacht wegbleiben würden, und unsere Eltern waren das zunächst auch. Als wir dann aber anfingen, Geld nach Hause zu bringen, hatten sie nichts mehr dagegen. Baba nahm unseren Verdienst und investierte ihn. Er meinte, wenn wir dann unsere Ehemänner kennenlernen, uns verlieben und heiraten möchten, könnten wir mit unserem eigenen Geld bei denen einziehen.
Wir wählen cheongsams, die sich ergänzen, um Harmonie und Eleganz zu versinnbildlichen, gleichzeitig verbreiten wir eine Leichtigkeit und Frische, die allen Käufern unseres Produkts Frühjahrsglück verspricht. Ich wähle einen cheongsam aus pfirsichfarbener Seide mit roten Paspeln. Das Kleid ist so eng geschnitten, dass die Schneiderin den Schlitz an der Seite gewagt hoch gezogen hat, damit ich überhaupt laufen kann. Knebelverschlüsse aus dem roten Stoff der Paspeln halten das Kleid am Hals, über der Brust, unter der Achsel und an der rechten Seite. May entscheidet sich für einen cheongsam aus blassgelber Seide mit einem Muster aus feinen weißen Blüten, die in der Mitte rot sind. Ihre Paspeln und Knebelverschlüsse sind genauso tiefrot wie meine. Der steife Mandarinkragen ihres Kleides ist so hoch, dass er ihre Ohren berührt; kurze Ärmel betonen ihre schlanken Arme. Während sich May die Augenbrauen in Form junger Weidenblätter nachzieht – lang, dünn und glatt –, tupfe ich mir weißes Reispuder auf das Gesicht, um meine rosigen Wangen zu verbergen. Dann schlüpfen wir in rote Stöckelschuhe und tragen auch Lippenstift in einem passenden Rot auf.
Vor Kurzem haben wir uns die langen Haare abschneiden und eine Dauerwelle machen lassen. May zieht mir jetzt einen Mittelscheitel und steckt mir die Locken hinter den Ohren fest, wo sie wie Pfingstrosen mit schwarzen Blütenblättern prangen. Dann kämme ich ihr die Haare, sodass die Locken ihr Gesicht umrahmen. Anschließend ergänzen wir unser Erscheinungsbild noch mit rosa Kristallohrhängern, Jaderingen und Goldketten. Unsere Blicke treffen sich im Spiegel. Durch die Kalenderbilder an der Wand vervielfältigt sich unser Spiegelbild. Wir lassen diesen hübschen Anblick einen Moment lang auf uns wirken. Wir sind einundzwanzig und achtzehn Jahre alt. Wir sind jung, wir sind schön, und wir leben im Paris Asiens.
Wir trippeln wieder nach unten, rufen rasch Auf Wiedersehen und treten hinaus in die Nacht von Shanghai. Wir wohnen im Viertel Hongkew, gleich auf der anderen Seite des Soochow Creek. Es gehört nicht zur offiziellen Internationalen Siedlung, aber die liegt so nahe, dass wir uns vor möglichen ausländischen Invasoren geschützt glauben. Wir sind nicht furchtbar reich, doch ist das nicht stets eine Frage des Maßstabs? Nach britischen, amerikanischen oder japanischen Maßstäben kommen wir gerade so zurecht, aber für chinesische Verhältnisse besitzen wir ein Vermögen, auch wenn manche unserer Landsleute hier in der Stadt wohlhabender sind als viele Ausländer. Wir sind kaoteng Huajen – höherstehende Chinesen –, die der Religion des ch’ung yang anhängen: Wir verehren alles, was aus dem Ausland kommt, wir verwestlichen unsere Namen und lieben Kinofilme, Speck und Käse. Als Mitglied der bu-er-ch’iao-ya – der Bourgeoisie – ist unsere Familie so begütert, dass unsere sieben Dienstboten auf der Eingangstreppe nacheinander ihre Mahlzeiten zu sich nehmen können. So wissen vorüberkommende Rikschafahrer und Bettler, dass man regelmäßig zu essen bekommt und ein sicheres Dach über dem Kopf hat, wenn man für die Chins arbeitet.
Wir gehen bis zur Ecke und feilschen mit mehreren hemd- und schuhlosen Rikschajungen, bevor wir uns auf einen guten Preis einigen. Wir klettern in die Rikscha und setzen uns nebeneinander.
»Fahr uns zur Französischen Konzession«, weist May den Jungen an.
Seine Muskeln ziehen sich zusammen, als er die Rikscha mühsam in Bewegung setzt. Bald hat er einen angenehmen Rhythmus gefunden, und der Schwung der Rikscha nimmt ihm die Spannung von Schultern und Rücken. Er zieht uns wie ein Lasttier, aber ich fühle mich einfach frei. Wenn ich tagsüber einkaufe, Besuche mache oder Englisch unterrichte, benutze ich immer einen Sonnenschirm. Nachts muss ich mir jedoch keine Gedanken wegen meiner Haut machen. Ich sitze aufrecht und hole tief Luft. Ich werfe einen Blick zu May hinüber. Sie ist völlig unbekümmert und lässt ihren cheongsam so leichtsinnig im Wind flattern, dass er sich bis zum Oberschenkel öffnet. May ist kokett, und sie könnte ihre Qualitäten in keiner Stadt besser zur Geltung bringen als in Shanghai – ihr Lachen, ihre schöne Haut, ihren Charme bei der Konversation.
Wir überqueren den Soochow Creek auf einer Brücke und biegen dann nach rechts ab, fort vom Whangpoo mit seinem feuchten Dunst von Öl, Tang, Kohl und Abwasser. Ich liebe Shanghai. Shanghai ist anders als andere Städte in China. Statt Kacheln und geschweiften Dächern haben wir mo t’ein talou – magische hohe Häuser –, die bis in den Himmel ragen. Statt Mondtoren, Wandschirmen zur Abwehr von Geistern, kunstvollen Gitterfenstern und rot lackierten Säulen haben wir neoklassizistische Granithäuser, die mit Art-Déco-Schmiedearbeiten, geometrischen Mustern und Ätzglas verziert sind. Statt Bambushaine oder Weiden, die ihre langen Zweige in den Teich hängen lassen, bietet unsere Stadt europäische Villen mit sauberen Fassaden, eleganten Balkonen, in Reihen gepflanzten Zypressen und ordentlich gemähten Rasenflächen, gesäumt von makellos gepflegten Blumenbeeten. In der chinesischen Altstadt gibt es noch Tempel und Gärten, aber das restliche Shanghai kniet nieder vor den Göttern des Handels, des Wohlstands, der Industrie und der Sünde. In der Stadt stehen Lagerhäuser, wo Waren auf- und abgeladen werden, es gibt Hunde- und Pferderennbahnen, zahllose Filmpaläste und Clubs, in denen man tanzen, trinken und Sex haben kann. Shanghai ist die Heimat von Millionären und Bettlern, Gangstern und Spielern, Patrioten und Revolutionären, Künstlern und Warlords, und es ist die Heimat der Familie Chin.
Unser Fahrer zieht uns durch Gassen, die gerade breit genug sind für Fußgänger, Rikschas und Schubkarren mit Bänken für zahlende Passagiere. Dann biegen wir in die Bubbling Well Road ein. Er trabt den eleganten Boulevard entlang, ohne Furcht vor den schnurrenden Chevrolets, Daimler und Isotta-Fraschinis, die vorbeischießen. An einer Ampel flitzen Bettlerkinder auf die Straße, umrunden unsere Rikscha und zerren an unseren Kleidern. Jeder Häuserblock trägt den Geruch von Tod und Verfall, von Ingwer und gebratener Ente, von französischem Parfüm und Räucherstäbchen herüber. Die lauten Stimmen der hier geborenen Shanghaier, das ständige Klick-klick des Abakus und das Rattern der durch die Straßen rollenden Rikschas bilden die Hintergrundgeräusche, die mir sagen, dass hier unser Zuhause ist.
An der Grenze zwischen der Internationalen Siedlung und der Französischen Konzession hält der Rikschajunge an. Wir zahlen ihn, überqueren die Straße, weichen einem toten Baby aus, das auf dem Gehsteig liegen gelassen wurde, suchen uns einen Rikschafahrer mit einer Lizenz für die Französische Konzession und nennen ihm die Adresse von Z. G., eine Straße, die von der Avenue Lafayette abgeht.
Dieser Fahrer ist noch schmutziger und verschwitzter als der vorherige. Sein zerlumptes Hemd verbirgt kaum seinen Körper, der nur noch ein Gerüst mit hervortretenden Knochen ist. Er zögert, bevor er sich in die Avenue Joffre hineintraut. Der Name ist zwar französisch, aber die Straße ist der Lebensmittelpunkt der Weißrussen. Über den Läden hängen Schilder in kyrillischer Schrift. Wir atmen den Duft von frischem Brot und Kuchen aus den russischen Bäckereien ein. Aus den Clubs dringt schon Musik, es wird getanzt. Als wir uns der Wohnung von Z. G. nähern, ändert sich die Umgebung erneut. Wir kommen an der Seeking Happiness Lane vorbei, in der es mehr als 150 Bordelle gibt. Aus dieser Straße werden jedes Jahr viele von Shanghais »Berühmten Blumen« – die talentiertesten Prostituierten der Stadt – für die Titelseiten von Zeitschriften ausgewählt.
Unser Fahrer lässt uns aussteigen, wir zahlen. Während wir die wackeligen Stufen zum zweiten Stock des Mietshauses erklimmen, in dem Z. G. wohnt, fahre ich mit den Fingerspitzen durch die Locken, die ich mir hinter den Ohren festgesteckt habe, drücke die Lippen zusammen, um den Lippenstift besser zu verteilen, und richte meinen cheongsam, damit mir der seidene Schrägschnitt wieder perfekt über die Hüften fällt. Wenn Z. G. die Tür öffnet, bin ich jedes Mal aufs Neue überrascht, wie gut er aussieht: schmaler Körperbau, ein voller, ungebärdiger schwarzer Haarschopf, eine große, runde Nickelbrille, Blick und Gebaren so intensiv, dass sie von langen Nächten, einer Künstlernatur und politischer Inbrunst künden. Ich mag zwar groß sein, aber er überragt mich noch. Das gehört zu den vielen Dingen, die ich an ihm liebe.
»Was ihr da anhabt, ist perfekt«, freut er sich. »Kommt herein! Kommt herein!«
Wir wissen nie genau, was er für unsere Sitzung geplant hat. In letzter Zeit waren junge Frauen populär, die in einen Pool springen, Minigolf spielen oder einen Bogen spannen, um einen Pfeil in den Himmel zu schicken. Fit und gesund sein, das ist das Ideal. Wer ist am besten dafür geeignet, die Söhne Chinas aufzuziehen? Die Antwort: eine Frau, die Tennis spielen, Auto fahren und eine Zigarette rauchen kann und dennoch so offen, elegant und verführerisch aussieht wie möglich. Wird Z. G. uns bitten, so zu tun, als würden wir gleich zu einem nachmittäglichen Tanztee gehen? Oder wird er etwas völlig anderes im Sinn haben, für das wir in geliehene Kostüme schlüpfen müssen? Wird May zu Mulan werden, der großen Kriegerin, die wieder zum Leben erweckt wurde, um für Parrot-Wein zu werben? Werde ich als das Mädchen Du Liniang aus dem Theaterstück Der Päonienpavillon gemalt, um die Vorzüge von Lux-Toilettenseife anzupreisen?
Z. G. führt uns zu dem Bühnenbild, das er für heute aufgebaut hat: eine gemütliche Ecke mit einem Polstersessel, einem kunstvoll geschnitzten chinesischen Wandschirm und einem mit komplizierten Knotenmustern verzierten Tontopf, in dem ein paar blühende Pflaumenzweige die Illusion von freier Natur und Frische vermitteln.
»Heute verkaufen wir My-Dear-Zigaretten«, verkündet Z. G. »May, ich hätte gerne, dass du dich in den Sessel setzt.« Sobald sie sitzt, tritt er zurück und betrachtet sie kritisch. Ich liebe Z. G. dafür, wie behutsam und feinfühlig er mit meiner Schwester umgeht. Immerhin ist sie noch ziemlich jung, und die meisten wohlerzogenen Mädchen würden sich gar nicht auf so etwas einlassen. »Entspann dich ein bisschen«, weist er sie an, »als wärst du die ganze Nacht unterwegs gewesen und würdest deiner Freundin gleich ein Geheimnis anvertrauen.«
Nachdem er May entsprechend positioniert hat, ruft er mich herbei. Er legt mir die Hände auf die Hüften und dreht mich zurecht, bis ich auf der Rückenlehne von Mays Sessel hocke.
»Du hast so schöne lange Arme und Beine«, sagt er und zieht meinen Arm nach vorne, sodass ich mich mit der Hand abstützen muss, um mich über May zu halten. Er legt die Hand auf meine, spreizt meinen kleinen Finger ab. Einen Moment lässt er die Hand dort ruhen, dann weicht er zurück und betrachtet seine Komposition. Zufrieden gibt er uns nun Zigaretten. »Und jetzt beugst du dich zu May hin, Pearl, als hättest du dir gerade die Zigarette an ihrer angezündet.«
Ich tue, was er mir aufträgt. Er tritt ein letztes Mal nach vorne, um May eine Strähne von der Wange zu streichen und ihr das Kinn so zurechtzurücken, dass das Licht auf ihren Wangenknochen tanzt. Ich mag zwar diejenige sein, die Z. G. gerne malt und berührt – und das fühlt sich wirklich verboten an –, aber es ist Mays Gesicht, mit dem sich alles verkaufen lässt: von Zündhölzern bis hin zu Vergasern.
Z. G. tritt hinter seine Staffelei. Er hat es nicht gerne, wenn wir sprechen oder uns bewegen, während er malt, doch er unterhält uns, stellt das Grammophon an und plaudert über dieses und jenes.
»Sind wir hier, um Geld zu verdienen oder um uns zu amüsieren, Pearl?« Er wartet nicht auf meine Antwort. Er will keine. »Schadet das, was wir tun, unserem Ruf oder tut es ihm gut? Ich behaupte: weder noch. Wir machen etwas anderes. Shanghai ist das Zentrum von Schönheit und Modernität. Ein wohlhabender Chinese kann sich alles leisten, was er auf unseren Kalendern sieht. Wer weniger Geld hat, kann danach streben, diese Dinge eines Tages zu besitzen. Und die Armen? Die können nur davon träumen.«
»Lu Hsün ist da anderer Meinung«, sagt May.
Ich seufze ungeduldig. Jedermann bewundert Lu Hsün, den großen Schriftsteller, der letztes Jahr gestorben ist, aber das heißt noch lange nicht, dass May während unserer Sitzung über ihn reden sollte. Ich sage nichts dazu und halte die Pose.
»Er wollte ein modernes China«, fährt May fort. »Er wollte, dass wir uns von den lo fan und ihrem Einfluss befreien. Auch die Kalendermädchen hat er mit kritischen Augen gesehen.«
»Sicher, sicher«, antwortet Z. G. ruhig, aber ich bin überrascht, was meine Schwester alles weiß. Sie liest nicht, hat das noch nie getan. Offenbar will sie bei Z. G. Eindruck schinden, und es funktioniert. »Ich war an dem Abend dabei, als er diese Rede gehalten hat. Du hättest gelacht, May. Und du genauso, Pearl. Er hat einen Kalender hochgehalten, auf dem zufällig ihr beide abgebildet wart.«
»Welchen?«, frage ich nun doch.
»Ich habe das Bild nicht gemalt, aber ihr beide tanzt einen Tango darauf. Pearl, du hältst May im Arm, die sich nach hinten biegt. Es war sehr ...«
»Daran kann ich mich erinnern! Mama hat sich wahnsinnig aufgeregt, als sie es gesehen hat. Weißt du noch, Pearl?«
Und ob ich das weiß. Mama bekam den Kalender in dem Laden an der Nanking Road, wo sie immer Binden für den monatlichen Besuch der kleinen roten Schwester kauft. Sie weinte, tobte und brüllte, dass wir die Familie Chin beschämen würden, wenn wir so aussähen und uns so benähmen wie weißrussische Taxidancer. Wir versuchten zu erklären, dass die Kalender mit den Mädchen in Wirklichkeit Respekt gegenüber den Eltern und traditionelle Werte vermitteln. Sie werden zum chinesischen und zum westlichen Neujahr verschenkt, als Anreiz, als Werbung oder als kleine Aufmerksamkeit für besondere Kunden. Von den guten Häusern finden sie dann langsam ihren Weg zu den Straßenhändlern, die sie für ein paar Kupfermünzen an die Armen verkaufen. Wir haben Mama erzählt, ein Kalender sei das Wichtigste im Leben jedes Chinesen, obwohl wir das selbst nicht glaubten. Ob reich oder arm, die Menschen richten ihr Leben nach der Sonne, dem Mond und den Sternen aus, und in Shanghai dazu noch nach dem Wasserstand des Whangpoo. Sie weigern sich, ein Geschäft abzuschließen, den Termin für eine Hochzeit festzulegen oder ein Feld zu bepflanzen, ohne nach den Prinzipien des feng shui zu prüfen, ob der Zeitpunkt auch günstig ist. Diese Hinweise stehen bei den meisten Werbekalendern am Rand, daher dienen sie als Ratgeber für alles, was im kommenden Jahr Glück bringen mag, und was für Gefahren drohen könnten. Gleichzeitig sind sie ein preiswerter Wandschmuck für die ärmsten Häuser.
»Unsere Kalender verschönern den Leuten das Leben«, erklärte May. »Daher nennt man uns Kalendermädchen.« Aber Mama beruhigte sich erst, nachdem May sie darauf hingewiesen hatte, dass mit dem Bild für Lebertran geworben würde. »Wir halten die Kinder bei guter Gesundheit«, sagte May. »Du solltest stolz auf uns sein!«
Am Ende hängte Mama den Kalender in der Küche neben dem Telefon auf, um sich die wichtigen Nummern – die des Sojamilchverkäufers, des Elektrikers und die von Madame Garnet – sowie die Geburtsdaten aller unserer Dienstboten auf unsere entblößten, bleichen Arme und Beine zu schreiben. Nach diesem Vorfall überlegten wir es uns zweimal, welche Bilder wir mit nach Hause brachten, und hatten Sorge, welche sie wohl von einem der Händler in der Nachbarschaft geschenkt bekäme.
»Lu Hsün hat gesagt, solche Kalender sind verderbt und anstößig«, fährt May fort. Beim Sprechen bewegt sie die Lippen kaum, damit sie weiter lächeln kann. »Er hat gesagt, die Frauen, die dafür Modell sitzen, seien krank. Und dass diese Krankheit nicht von der Gesellschaft kommt ...«
»Sondern von den Malern«, beendet Z. G. den Satz für sie. »Er findet es dekadent, was wir tun, und behauptet, es würde die Revolution nicht voranbringen. Aber sag mir doch, kleine May, wie soll die Revolution ohne uns stattfinden? Antworte nicht! Sitz einfach da und sei still! Sonst brauchen wir noch die ganze Nacht.«
Ich bin dankbar für die Stille. In der Zeit vor der Republik wäre ich schon längst in einer rot lackierten Sänfte in das Haus meines Mannes gebracht worden. Mittlerweile hätte ich mehrere Kinder zur Welt gebracht, hoffentlich Söhne. Aber ich wurde 1916 geboren, im vierten Jahr der Republik. Das Füßebinden wurde verboten, und das Leben der Frauen änderte sich. Arrangierte Ehen werden nun in Shanghai als rückständig betrachtet. Alle wollen aus Liebe heiraten. Und bevor es so weit ist, glauben wir an die freie Liebe. Nicht, dass ich sie reichlich verschenkt hätte. Ich habe sie noch gar nicht verschenkt, aber ich würde es tun, wenn Z. G. mich darum bäte.
Er hat mich so hingesetzt, dass sich mein Gesicht im schrägen Winkel zu dem von May befindet, aber ich soll ihn dabei ansehen. Ich halte die Pose, schaue zu ihm hinüber und träume von unserer gemeinsamen Zukunft. Freie Liebe hin oder her – ich möchte, dass wir heiraten. Jede Nacht, in der Z. G. malt, muss ich an die prächtigen Feste denken, zu denen ich eingeladen war, und stelle mir die Hochzeit vor, die mein Vater für Z. G. und mich ausrichten wird.
Kurz vor zehn hören wir den Ruf des Wan-Tan-Suppenverkäufers: »Warme Suppe! Sie bringt euch ins Schwitzen! Kühlt die Haut, kühlt die Nacht!«
Z. G. lässt seinen Pinsel in der Luft verharren und tut so, als überlegte er, wo er als Nächstes Farbe auftragen soll. In Wirklichkeit ist er gespannt, wer von uns zuerst seine Pose aufgibt.
Als der Wan-Tan-Mann direkt unter dem Fenster steht, springt May auf und kreischt: »Ich halt’s nicht mehr aus!« Sie eilt zum Fenster und ruft unsere übliche Bestellung nach unten. Dann lässt sie eine Schüssel an einem Seil hinunter, das wir aus mehreren Seidenstrümpfen zusammengeknotet haben. Der Wan-Tan-Mann schickt uns eine Schüssel nach der anderen herauf, und wir essen voller Appetit. Danach nehmen wir wieder unsere Plätze ein und machen uns an die Arbeit.
Kurz nach Mitternacht legt Z. G. den Pinsel zur Seite. »Für heute sind wir fertig«, sagt er. »Ich arbeite bis zur nächsten Sitzung am Hintergrund weiter. Gehen wir!«
Während er in einen Nadelstreifenanzug schlüpft, sich die Krawatte bindet und den Filzhut aufsetzt, müssen May und ich uns erst einmal dehnen, weil wir ganz steif geworden sind. Wir frischen unser Make-up auf und kämmen uns die Haare. Und dann sind wir draußen auf der Straße, haken uns alle drei unter und laufen lachend die Straße entlang, auf der die Verkäufer ihre Leckereien anpreisen.
»Glühend heiße Ginkgonüsse! Alle schon geknackt! Riesengroß!«
»Schmorpflaumen mit Süßholzpulver! Eine Köstlichkeit! Nur zehn Kupfermünzen pro Packung!«
Fast an jeder Ecke stehen Wassermelonenverkäufer. Jeder hat einen eigenen, charakteristischen Ruf und verspricht die beste, süßeste, saftigste, kälteste Melone der ganzen Stadt. So verlockend sie auch sind, wir gehen an ihnen vorbei. Zu viele dieser Verkäufer versuchen ihre Melonen schwerer zu machen und spritzen ihnen Wasser aus dem Fluss oder aus den Bächen ein. Mit einem einzigen Biss kann man sich die Ruhr, Typhus oder Cholera holen.
Wir erreichen das »Casanova«, wo später Freunde zu uns stoßen werden. Man erkennt May und mich als Kalendermädchen, daher bekommen wir einen guten Tisch neben der Tanzfläche. Wir bestellen Champagner, und Z. G. fordert mich zum Tanzen auf. Ich mag es, wie er mich hält und herumwirbelt. Nach zwei Tänzen werfe ich einen Blick zu unserem Tisch hinüber, wo May alleine sitzt.
»Du solltest vielleicht auch mal meine Schwester auffordern«, sage ich.
»Wenn du das willst«, antwortet er.
Wir tanzen zurück an unseren Tisch. Z. G. nimmt May an der Hand. Das Orchester spielt ein langsames Stück. May legt ihm den Kopf an die Brust, als lauschte sie seinem Herzschlag. Z. G. führt May elegant zwischen den Tanzpaaren hindurch. Einmal treffen sich unsere Blicke, und er lächelt. Meine Gedanken sind so typisch für ein Mädchen: unsere Hochzeitsnacht, unser Eheleben, unsere gemeinsamen Kinder.
»Da bist du ja!« Jemand küsst mich auf die Wange. Als ich aufblicke, steht meine Schulfreundin Betsy Howell vor mir. »Wartest du schon lange?«
»Wir sind gerade erst gekommen. Setz dich doch! Wo ist der Kellner? Wir brauchen noch Champagner. Hast du schon gegessen?«
Betsy und ich sitzen eng nebeneinander, stoßen an und trinken unseren Champagner. Betsy ist Amerikanerin. Ihr Vater ist Mitarbeiter des Außenministeriums. Ich mag ihre Eltern, weil sie mich mögen und nicht versuchen, Betsy daran zu hindern, mit Chinesen zu verkehren, wie es so viele andere ausländische Eltern tun. Betsy und ich haben uns in der Missionsstelle der Methodisten kennengelernt, wo sie hingeschickt wurde, um den Heiden zu helfen, und ich, um die Umgangsformen des Westens zu lernen. Ob sie meine beste Freundin ist? Eigentlich nicht. Meine beste Freundin ist May. Betsy kommt erst an zweiter Stelle.
»Du siehst aber heute hübsch aus«, sage ich. »Was für ein schönes Kleid du anhast.«
»Na klar! Du hast mich doch beim Kauf beraten. Ich würde aussehen wie ein Trampel, wenn ich dich nicht hätte.«
Betsy ist ein bisschen pummelig und außerdem mit einer vernünftigen amerikanischen Mutter geschlagen, die sich mit Mode überhaupt nicht auskennt. Deshalb bin ich mit Betsy zu einer Schneiderin gegangen, die ihr ein paar anständige Sachen genäht hat. Heute trägt sie ein Etuikleid aus zinnoberrotem Satin mit einer Brillant-Saphir-Brosche über der linken Brust. Blonde Locken fallen ihr über die sommersprossigen Schultern.
»Schau doch mal, wie süß!« Betsy nickt zu Z. G. und May hinüber.
Wir sehen ihnen beim Tanzen zu, während wir über unsere Schulfreundinnen tratschen. Als das Stück zu Ende ist, kommen May und Z. G. zurück an den Tisch. Er hat Glück, heute Abend in Gesellschaft von drei Frauen zu sein, und er macht es genau richtig, tanzt nacheinander mit jeder von uns. Gegen ein Uhr kommt endlich Tommy Hu. May steigt die Röte in die Wangen, als sie ihn sieht. Mama hat mit seiner Mutter jahrelang Mah-Jongg gespielt, und sie haben immer darauf gehofft, dass es zwischen unseren Familien eines Tages eine Verbindung geben wird. Mama wird begeistert sein, wenn sie von diesem Treffen hört.
Um zwei Uhr morgens treten wir wieder hinaus auf die Straße. Es ist Juli, heiß und feucht. Alle sind noch wach, selbst Kinder und Greise. Es ist Zeit für einen Imbiss.
»Kommst du mit?«, frage ich Betsy.
»Ich weiß nicht. Wohin geht ihr?«
Alle schauen Z. G. an. Er nennt ein Café in der Französischen Konzession, das als Treffpunkt für Intellektuelle, Künstler und Kommunisten bekannt ist.
Betsy zögert nicht. »Dann los! Nehmen wir den Wagen meines Vaters.«
Das Shanghai, das ich liebe, ist eine Stadt, die im Fluss ist, wo sich die interessantesten Menschen treffen. Manchmal nimmt mich Betsy mit, und wir bestellen amerikanischen Kaffee, Toast und Butter; manchmal führe ich Betsy in irgendwelche Gassen, wo es hsiao ch’ih gibt – Leckereien wie in Blätter gewickelten Klebreis oder Kuchen aus Zimtblüten und Zucker. Betsy ist abenteuerlustig, wenn sie mit mir zusammen ist, und hat mich einmal sogar in die chinesische Altstadt begleitet, um billige Weihnachtsgeschenke einzukaufen. Ich scheue mich manchmal, in die Parks der Internationalen Siedlung zu gehen. Bis zu meinem zehnten Lebensjahr waren sie für Chinesen verboten, nur Kinderfrauen mit ausländischen Kindern oder Gärtner, die die Anlage pflegten, durften hinein. Aber mit Betsy zusammen, die schon ihr ganzes Leben lang in diese Parks gegangen ist, bin ich nie ängstlich oder nervös.
Das Café ist verraucht und düster, doch wir kommen uns in unseren schicken Kleidern nicht fehl am Platz vor. Wir gesellen uns zu einer Gruppe von Z. G.s Freunden. Tommy und May setzen sich ein wenig abseits, damit sie sich ungestört unterhalten und der hitzigen Diskussion darüber entziehen können, wem unsere Stadt »gehört« – den Briten, den Amerikanern, den Franzosen oder den Japanern? Wir sind den Ausländern zahlenmäßig weit überlegen, selbst in der Internationalen Siedlung, aber wir haben keine Rechte. May und ich machen uns gemeinhin keine Gedanken darüber, ob wir zum Beispiel vor Gericht gegen einen Ausländer aussagen dürfen oder ob sie uns in einen ihrer Clubs lassen, aber Betsy kommt aus einer anderen Welt.
»Bis zum Ende des Jahres«, sagt sie, und ihr Blick ist dabei klar und leidenschaftlich, »wird man von den Straßen der Internationalen Siedlung zwanzigtausend Leichen aufgesammelt haben. Jeden Tag steigen wir über diese Toten, aber ich kann keine Anzeichen dafür erkennen, dass irgendjemand von euch etwas dagegen unternimmt.«
Betsy glaubt, dass eine Veränderung der Lage dringend nötig ist. Die Frage ist, warum gibt sie sich dann mit May und mir ab, wenn wir so bewusst missachten, was um uns herum geschieht?
»Willst du wissen, ob wir unser Land lieben?«, fragt Z. G. »Es gibt doch zwei Arten von Liebe, nicht wahr? Ai kuo ist die Liebe, die wir für unser Land und unser Volk empfinden. Ai jen ist das, was ich vielleicht für meine Geliebte empfinde. Die eine Liebe ist patriotisch, die andere romantisch.« Er wirft mir einen kurzen Blick zu, und ich werde rot. »Können wir nicht beides haben?«
Gegen fünf Uhr verlassen wir das Café. Betsy winkt, steigt in den Wagen ihres Vaters und wird weggefahren. Wir sagen Z. G. und Tommy Gute Nacht – beziehungsweise Guten Morgen – und rufen eine Rikscha. An der Grenze zwischen der Französischen Konzession und der Internationalen Siedlung steigen wir wieder in eine andere Rikscha um, und dann rumpeln wir über die Pflastersteine den restlichen Weg nach Hause.
Die Stadt ist wie ein Ozean, sie schläft nie. Die Nacht weicht zurück, und jetzt setzt die Flut der morgendlichen Rituale und Rhythmen ein. Die Fäkaliensammler schieben ihre Karren durch die Gassen und rufen: »Leert eure Nachtöpfe aus! Hier kommt der Sammler!« Shanghai mag die erste Stadt gewesen sein, in der es Strom, Gas, Telefone und fließend Wasser gab, aber was die Kanalisation betrifft, sind wir rückständig. Die Bauern zahlen jedoch Höchstpreise für unsere Fäkalien, weil sie wegen unserer Ernährung so reichhaltig sind. Nach den Fäkaliensammlern werden die Frühstücksverkäufer mit ihren Waren kommen: Brei aus Hiobstränensamen, Aprikosenkernen und Lotuskernen, gedämpfte Reiskuchen mit Kartoffelrose und weißem Zucker, Eier, die sie in Teeblättern und fünf Gewürzen ziehen ließen.
Zu Hause angekommen, bezahlen wir den Rikschafahrer. Wir heben den Riegel des Tors zu unserem Haus an und gehen über den Weg zur Eingangstür. Die Feuchtigkeit der Nacht verstärkt den Duft der Blumen, der Büsche und der Bäume, und wir sind trunken von dem Jasmin, den Magnolien und den Zwergkiefern, die unser Gärtner züchtet. Wir steigen die Steinstufen hinauf und gehen unter einem geschnitzten hölzernen Gitter hindurch, das böse Geister abhält – ein Zugeständnis an Mamas Aberglauben. Unsere Absätze klappern laut auf dem Parkettboden im Eingang. In dem Salon links brennt Licht. Baba ist wach und wartet auf uns.
»Setzt euch und schweigt!« Er zeigt auf die Sitzbank ihm gegenüber.
Ich tue, was er sagt, falte die Hände im Schoß und kreuze die Beine in Höhe der Knöchel. Falls wir in Schwierigkeiten stecken, hilft es, sittsam zu schauen. Seine Nervosität der letzten Wochen hat sich in etwas Hartes, Unbewegliches verwandelt. Die Worte, die er nun sagt, verändern mein Leben für immer.
»Ich habe für euch beide Ehen arrangiert«, sagt er. »Die Zeremonie findet übermorgen statt.«
Kapitel 2
Männer vom goldenen Berg
»Sehr witzig!« May lacht zaghaft.
»Ich mache keine Witze«, sagt Baba. »Ich habe Ehen für euch arrangiert.«
Ich kann immer noch nicht ganz begreifen, was er da sagt. »Was ist denn los? Ist Mama krank?«
»Ich habe es dir gerade gesagt, Pearl. Ihr müsst zuhören und mir gehorchen. Ich bin der Vater, und ihr seid meine Töchter. So ist das nun einmal.«
Wenn ich ihm doch nur klarmachen könnte, wie absurd sich das anhört!
»Ohne mich!«, ruft May entrüstet.
Ich versuche es mit Argumenten. »Die Feudalherrschaft ist vorbei. Es ist nicht mehr so wie damals, als du und Mama geheiratet habt.«
»Deine Mutter und ich wurden im zweiten Jahr der Republik verheiratet«, sagt er missgelaunt, aber darauf kommt es jetzt nicht an.
»Trotzdem war eure Ehe arrangiert«, entgegne ich. »Hast du Anfragen von Heiratsvermittlerinnen beantwortet, die wissen wollten, wie gut wir stricken, nähen oder sticken können?« Ich höre mich zunehmend höhnisch an. »Und hast du mir für die Mitgift einen Nachttopf gekauft, der mit Drachen- und Phönix-Motiven bemalt ist, als Symbol für die Vollkommenheit meiner Ehe? Gibst du May einen Nachttopf voll roter Eier, als Botschaft für ihre Schwiegereltern, dass sie viele Söhne bekommen wird?«
»Du kannst sagen, was du willst.« Baba zuckt gleichgültig mit den Achseln. »Ihr heiratet.«
»Ohne mich!«, wiederholt May. Tränen konnte sie schon immer gut einsetzen, und die ersten fließen bereits. »Du kannst mich nicht zwingen.«
Als Baba sie ignoriert, wird mir klar, wie ernst die Lage ist. Er schaut mich an, als sähe er mich zum ersten Mal.
»Erzählt mir nicht, ihr hättet gedacht, ihr könntet aus Liebe heiraten.« Das hört sich merkwürdig grausam und triumphierend an. »Kein Mensch heiratet aus Liebe. Ich hab’s jedenfalls nicht getan.«
Jemand atmet scharf ein. Ich drehe mich um. Meine Mutter, noch in ihrer Schlafhose, steht in der Tür. Auf ihren gebundenen Füßen schwankt sie durchs Zimmer und sinkt auf einen geschnitzten Birnenholzstuhl. Sie verschränkt die Finger ineinander und richtet den Blick nach unten. Kurz darauf fallen ihr Tränen auf die gefalteten Hände. Keiner sagt etwas.
Ich setze mich so aufrecht wie möglich, damit ich auf meinen Vater hinabblicken kann, wie er es hasst. Dann nehme ich Mays Hand. Zusammen sind wir stark, und wir haben ja noch das Geld, das er für uns angelegt hat.
»Ich spreche für uns beide, wenn ich mit allem Respekt um das Geld bitte, das du für uns investiert hast.«
Mein Vater verzieht das Gesicht.
»Wir sind alt genug, um auf eigenen Füßen zu stehen«, fahre ich fort. »May und ich nehmen uns eine Wohnung. Wir werden uns eigenes Geld verdienen. Wir wollen unsere Zukunft selbst bestimmen.«
May nickt, während ich rede, und lächelt Baba an, aber sie sieht dabei nicht so hübsch aus wie sonst. Ihr Gesicht ist fleckig und geschwollen von den Tränen.
»Ich will nicht, dass ihr Mädchen ganz auf euch allein gestellt seid«, flüstert Mama, nachdem sie ihren Mut zusammengenommen hat.
»Dazu kommt es sowieso nicht«, sagt Baba. »Es ist kein Geld da – weder eures noch meines.«
Wieder tritt verblüfftes Schweigen ein. Meine Schwester und meine Mutter überlassen es mir zu fragen: »Was hast du gemacht?«
In seiner Verzweiflung schiebt Baba uns die Schuld für seine Probleme zu. »Eure Mutter macht Besuche und spielt mit ihren Freundinnen. Ihr beide werft das Geld zum Fenster raus. Keiner von euch sieht, was direkt vor eurer Nase passiert.«
Er hat recht. Erst gestern Abend habe ich noch gedacht, dass unser Haus irgendwie heruntergekommen wirkt. Ich habe mich gefragt, wo der Lüster sein mochte, die Wandlampen, der Deckenventilator und ...
»Wo sind unsere Dienstboten? Wo sind Pansy, Ah Fong und ...«
»Ich habe sie entlassen. Sie sind alle weg, bis auf den Gärtner und Koch.«
Die beiden konnte er natürlich nicht gehen lassen. Die Pflanzen im Garten würden rasch verdorren, und unsere Nachbarn würden merken, dass etwas nicht stimmt. Und Koch brauchen wir unbedingt. Mama kann nur die Aufsicht führen. May und ich können kein einziges Gericht kochen. Wir haben uns nie damit beschäftigt. Wir hätten nie gedacht, dass es eines Tages nötig wäre. Aber der Junge, Babas Hausdiener, die zwei Mädchen und die Küchenhilfe? Wie konnte Baba so vielen Leuten wehtun?
»Hast du alles verspielt? Gewinn es doch zurück, Herrgott noch mal«, fauche ich. »Sonst schaffst du das doch auch immer.«
Mein Vater mag in der Öffentlichkeit als wichtiger Mann gelten, aber in meinen Augen war er schon immer unnütz und schwach. Wie er mich jetzt anschaut ... ich kann in ihm lesen wie in einem offenen Buch.
»Wie schlimm ist es?« Ich bin wütend – ist das ein Wunder? –, aber langsam verspüre ich leises Mitgefühl für meinen Vater und, mehr noch, für meine Mutter. Was wird mit ihnen geschehen? Was wird aus uns allen werden?
Er senkt den Kopf. »Das Haus. Der Rikschabetrieb. Euer Geld. Meine geringen Ersparnisse. Alles ist weg.« Irgendwann blickt er zu mir auf, Hoffnungslosigkeit, Elend und Verzweiflung in den Augen.
»Es gibt kein glückliches Ende«, sagt Mama. Es scheint, als wären all ihre düsteren Vorhersagen letztendlich eingetroffen. »Gegen das Schicksal kann man nicht ankämpfen.«
Baba ignoriert Mama und appelliert an meinen Respekt gegenüber den Eltern und an meine Pflicht als älteste Tochter. »Willst du, dass deine Mutter auf der Straße betteln muss? Und was ist mit euch beiden? Als Kalendermädchen seid ihr schon nahe daran, Mädchen mit drei Löchern zu werden. Da stellt sich nur noch die Frage: Wird es ein einzelner Mann sein, der euch aushält, oder fallt ihr so tief wie die Huren, die in der Blood Alley nach ausländischen Seeleuten Ausschau halten? Was für eine Zukunft wollt ihr?«
Ich bin zwar gebildet, aber was kann ich schon? An drei Vormittagen die Woche gebe ich einem japanischen Hauptmann Englischunterricht. May und ich sitzen Malern Modell, aber unser Verdienst deckt noch nicht einmal ansatzweise die Kosten für unsere Kleider, Hüte, Handschuhe und Schuhe. Ich will nicht, dass jemand von uns betteln gehen muss. Und ganz sicher will ich nicht, dass May und ich Prostituierte werden. Egal, was passiert, ich muss meine Schwester beschützen.
»Was sind das denn für Ehemänner?«, frage ich. »Können wir sie vorher kennenlernen?«
May bekommt große Augen.
»Das ist gegen die Tradition«, sagt Baba.
»Ich heirate niemanden, den ich nicht vorher gesehen habe.« Ich schalte auf stur.
»Du glaubst ja wohl nicht, dass ich das mache«, sagt May, doch ihre Stimme verrät uns, dass sie innerlich bereits nachgegeben hat. Wir wirken und handeln zwar in vielerlei Hinsicht modern, aber wir können nicht aus unserer Haut: Wir sind gehorsame chinesische Töchter.
»Es sind Männer vom goldenen Berg«, sagt Baba. »Amerikaner. Sie sind nach China gekommen, um sich eine Braut zu suchen. Eigentlich sind das doch gute Nachrichten. Die Familie ihres Vaters stammt aus demselben Bezirk wie unsere. Wir sind so gut wie verwandt. Ihr müsst eure Ehemänner nicht nach Los Angeles begleiten. Amerika-Chinesen sind zufrieden, wenn ihre Ehefrauen in China bleiben und sich um ihre Eltern und Vorfahren kümmern, während sie selbst zu ihren blonden lo-fan-Geliebten nach Amerika zurückkehren können. Betrachtet es einfach nur als ein Geschäft, das unsere Familie retten wird. Aber wenn ihr beschließt, mit euren Männern zu gehen, dann werdet ihr ein schönes Haus haben, Dienstboten, die putzen und waschen, Amahs, die sich um eure Kinder kümmern. Ihr werdet in Haolaiwu leben – in Hollywood. Ich weiß doch, wie gerne ihr Mädchen Filme mögt. Es würde dir gefallen, May. Ganz sicher. Haolaiwu! Stell dir das vor!«
»Aber wir kennen sie doch gar nicht!«, schreit May ihn an.
»Ihren Vater schon«, antwortet Baba ruhig. »Ihr kennt den Alten Herrn Louie.«
May verzieht vor Abscheu den Mund. Den Mann haben wir in der Tat kennengelernt. Ich mochte Mamas altmodische Anreden noch nie, doch für May und mich war der drahtige Auslandschinese mit dem ernsten Gesicht trotzdem immer der Alte Herr Louie. Er lebt, wie Baba schon sagte, in Los Angeles, kommt jedoch etwa einmal im Jahr nach Shanghai und kümmert sich um seine hiesigen Geschäfte. Er besitzt eine Fabrik für Rattanmöbel und eine, in der billiges Porzellan für den Export hergestellt wird. Aber es ist mir egal, wie reich er ist. Mir hat nie gefallen, wie der Alte Herr Louie May und mich anschaut: wie eine Katze, die uns aufschlecken will. Dabei geht es mir nicht um mich. Ich kann das vertragen, doch May war erst sechzehn, als er das letzte Mal in der Stadt war. In seinem Alter – er muss damals mindestens Mitte sechzig gewesen sein –, hätte er sie nicht so mit den Augen verschlingen sollen. Baba hat nie auch nur ein Wort gesagt, sondern May nur gebeten, Tee nachzuschenken.
In dem Moment begreife ich es. »Hast du alles an den Alten Herrn Louie verloren?«
»Nicht ganz ...«
»An wen dann?«
»So was ist immer schwer zu sagen.« Baba trommelt mit den Fingern auf den Tisch und schaut weg. »Ich habe überall verloren, hier ein bisschen, da ein bisschen.«