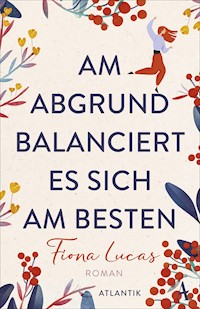13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Ein verschlossenes Zimmer, ein Haufen Erbstücke und vergessene Erinnerungen
Heather, Archivarin Anfang 30, versucht alles, um nicht so zu werden wie ihre Mutter: Ihre Wohnung ist hell, sauber, minimalistisch eingerichtet. Wäre da nicht dieses Zimmer, in dem sie die »Erbstücke« ihrer Mutter weggeschlossen hat – und diese Kommode, in der Heathers ganz eigene Sammlung stetig wächst … Bis die Folgen eines Wasserrohrbruchs sie dazu zwingen, sich nicht nur mit den Gegenständen in diesem Zimmer, sondern auch mit ihrer Kindheit auseinanderzusetzen, an die sie sich nur bruchstückhaft erinnert: vor allem an die Tage am Meer mit der Frau im roten Mantel. Zusammen mit ihrer Schwester Faith und ihrem Nachbarn Jason taucht Heather mit jeder Hinterlassenschaft tiefer in ihre Vergangenheit ein und kommt dabei einem dramatischen Familiengeheimnis auf die Spur …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 462
Ähnliche
Cover
Titel
Fiona Lucas
Die Sammlerin der Erinnerungen
Roman
Aus dem Englischen von Claudia Feldmann
Insel Verlag
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Die englische Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel The Memory Collector bei HarperCollins Publishers.
eBook Insel Verlag Berlin 2024
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des insel taschenbuchs 5017.
Deutsche Erstausgabe© der deutschsprachigen Ausgabe Insel VerlagAnton Kippenberg GmbH & Co. KG, Berlin, 2024First published in Great Britain by HQ, an imprint ofHarperCollins Publishers Ltd 2018 under the title THE MEMORY COLLECTOR.Copyright © Fiona Harper 2018. Translation © Insel Verlag 2024,translated under licence from HarperCollins Publishers Ltd.Alle Rechte vorbehalten.Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Designbüro Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildungen: Emily Green Studio, Preston; iStock by Getty Images, München
eISBN 978-3-458-77816-5
www.suhrkamp.de
Widmung
Für Siân und Rose
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Dank
Informationen zum Buch
Die Sammlerin der Erinnerungen
Prolog
Der Mantel ist nicht signalrot wie die Briefkästen, sondern purpurrot wie der Lippenstift eines Filmstars. Er hat eckige Schultern, wird zur Taille hin schmaler, weitet sich dann wieder und endet über einem Paar wohlgeformter Waden. Selbst nach all den Jahren halte ich jedes Mal, wenn ich ans Meer fahre, Ausschau nach einem solchen roten Mantel. Ich glaube, ich habe nie wieder einen wie diesen gesehen.
Die Frau im roten Mantel lacht. Sie blickt lächelnd zu dem kleinen Mädchen hinunter, das neben ihr steht. Es ist windig, und der Strand ist nahezu verlassen, aber das kümmert sie beide nicht. Sie laufen um die Wette über die Pier, ihre übermütigen Schreie verlieren sich in der Weite des Meeres. Als das breite Geländer sie daran hindert, auf die steingrauen Wellen zu springen und bis zum Horizont zu rennen, bleiben sie keuchend stehen. Dann holt die Frau ihnen beiden ein Eis.
Das Mädchen denkt, das ist vielleicht das leckerste Eis, das es je gegessen hat, spricht es aber nicht aus, weil es ja sein könnte, dass es sich irrt. Ihre Mummy hat ein sehr schlechtes Gedächtnis, und manchmal fragt sie sich, ob das bei ihr genauso ist. Es gibt nämlich so viele Dinge, die sie im Kopf behalten muss. So viele Geheimnisse. Da ist es nicht leicht, auch noch all die Erinnerungen und die Sachen für die Schule darin unterzubringen. Vielleicht ist Pfefferminz-Schoko doch nicht ihre Lieblingssorte. Vielleicht mag sie eine andere noch lieber. Sie kann sich einfach nicht erinnern.
An das Geländer gelehnt schauen sie Eis essend hinaus aufs Meer; ihre Haare flattern wie Bänder im Wind.
»Ich glaube, das ist mein liebster Ort auf der ganzen Welt«, sagt das Mädchen.
Die Frau nickt. »Meiner auch. Immer wenn ich ans Meer komme, laufe ich als Allererstes ans Ende der Pier. Da gehen Land und Meer ineinander über, und man hat das Gefühl, alles ist möglich.«
»Sogar fliegen?«, fragt das Mädchen ehrfürchtig.
»Sogar fliegen«, sagt die Frau lächelnd. »Aber vielleicht nicht heute, hm? Ich glaube, dafür ist es ein bisschen zu windig.«
»Können wir dann morgen wieder hierherkommen?«
»Natürlich«, sagt die Frau und wendet den Blick zum Meer. »Wir sind bisher jeden Tag hierhergekommen, und wenn du willst, können wir das auch weiterhin jeden Tag machen.«
Das kleine Mädchen denkt eine Weile darüber nach, während es sein Eis isst. Wohin könnten sie fliegen? Nach Frankreich oder Spanien, oder vielleicht sogar nach Afrika? Aber sie weiß nicht, ob sie die richtigen Sachen für warmes Wetter dabeihat, deshalb wendet sie den Kopf, um die Frau zu fragen, was sie anziehen soll. Doch da merkt sie, dass die Frau nicht mehr lächelt.
Sie steht so reglos da, und ihr Blick ist so leer, dass das Mädchen an die Schaufensterpuppen bei C&A denken muss.
»Was ist?«, fragt sie. »Bist du traurig?«
Ganz lange rührt sich die Frau nicht, doch dann dreht sie sich zu ihr um. Ihre Mundwinkel biegen sich nach oben, aber in ihren Augen ist immer noch derselbe abwesende Blick, mit dem sie auf die grauen, unruhigen Wellen gestarrt hat.
»Ein bisschen«, sagt sie, und ihre Augen schimmern auf einmal ganz feucht.
Das Mädchen leckt ausgiebig an seinem Eis, dann nimmt es die freie Hand der Frau. Sie hat sehr hübsche Hände. Ganz sauber und immer mit glänzendem Nagellack. An diesem Tag ist er purpurrot, passend zum Mantel. »Warum bist du traurig?«
Die Frau geht in die Hocke, damit sie dem Mädchen in die Augen sehen kann. »Nur weil ich weiß, dass dieser schöne Urlaub bald zu Ende geht«, sagt sie. »Aber es macht mir solchen Spaß mit dir, dass ich das gar nicht will.«
Das Mädchen strahlt. »Ich auch nicht! Können wir nicht einfach für immer hierbleiben? Bitte, bitte, bitte?«
Hier am Meer ist es viel, viel besser als zu Hause. Hier gibt es kein Gebrüll und keine verschlossenen Türen, und hier ist Platz. Platz zum Laufen und zum Atmen. Manchmal, wenn das kleine Mädchen und die Frau draußen sind, saugt es immer wieder ganz tief die Luft ein, um das Salz hinten auf der Zunge zu schmecken und die kühle Frische in seiner Brust zu fühlen.
Bevor die Frau antworten kann, rutscht ihr die Eiskugel von der Waffel und fällt auf die rauen Planken der Pier. »So ein Pech! Dabei ist Himbeer meine Lieblingssorte!« Sie kramt in ihrer glänzenden schwarzen Handtasche, holt ein Taschentuch heraus und wischt sich die klebrigen Finger ab.
»Nicht weinen!«, sagt das Mädchen, als eine Träne über das Gesicht der Frau rinnt, und hält ihr sein Eis hin. »Meins ist nur Pfefferminz-Schoko, aber du kannst was davon abhaben.«
Da lächelt die Frau wieder richtig, aber aus irgendeinem Grund kommen nun noch mehr Tränen. Sie leckt einmal kurz daran und gibt dem Mädchen das Eis zurück. »Danke, Heather«, sagt sie, und das Mädchen findet, dass noch nie jemand seinen Namen so schön ausgesprochen hat, ganz weich und samtig, mit Augen voller Sonnenschein.
Das Mädchen umarmt die Frau, wobei es aufpasst, dass nichts von dem hellgrünen Eis auf dem schicken roten Mantel landet. »Ich hab dich lieb«, sagt sie und schmiegt das Gesicht an den kratzigen Ärmel.
»Ich hab dich auch lieb.«
Sie halten sich lange im Arm, dann gehen sie Hand in Hand über die Pier zurück. Als sie am Ende ankommen, biegt das Mädchen nach rechts ab, wo es zum Minigolf geht. Die Frau folgt ihr, doch plötzlich bleibt sie stehen. Das Mädchen zieht an ihrer Hand, aber sie rührt sich nicht, sondern starrt auf etwas an der gegenüberliegenden Straßenseite. Das Mädchen kann nicht sehen, was es ist, weil ein dicker Mann mit einem Donut in der Hand im Weg steht, doch dann ruft sein Freund nach ihm, und er eilt davon. Die Frau läuft mit schnellen Schritten los.
»Das ist der falsche Weg!«, protestiert das Mädchen. »Wir wollen doch zum Minigolf!«
»Nicht heute«, erwidert die Frau. Sie blickt stur geradeaus, und ihre Stimme klingt angespannt. »Wir gehen zurück zur Pension und spielen Karten und essen deine Lieblingschips mit Käse und Zwiebeln. Was hältst du davon?«
Das Mädchen nickt, obwohl es nicht das ist, was es will. Es ist sehr nett von der Frau, dass sie sie hierhin mitgenommen hat, und sie will nicht undankbar erscheinen, aber sie versteht nicht, was los ist. Die Frau sieht besorgt aus, dabei hat sie sich wegen Minigolf bisher noch nie Sorgen gemacht. Das einzige Mal, dass sie bei ihrem Urlaub bisher ängstlich ausgesehen hat, war, als der Spezialzug, der die Klippen rauffährt, beim Losfahren geruckelt hat. Da hat sie sich am Geländer festgehalten und nicht nach unten geschaut, als das Mädchen ihr zeigen wollte, wie klein die Menschen wurden.
Das Mädchen muss laufen, um auf dem Weg zur Pension mit der Frau Schritt zu halten. Es ist nicht leicht, über die Schulter zu blicken, weil ihr Kopf so auf und ab hüpft, aber schließlich gelingt es ihr. Doch hinter ihnen ist nichts Beunruhigendes. Nur ein Polizist, der einem alten, weißhaarigen Paar den Weg erklärt. Er sieht nicht einmal in ihre Richtung.
1
Ich greife nach einem vergilbten, modrig riechenden Atlas. Da steckt etwas zwischen den Seiten, das mich neugierig macht. Wahrscheinlich ein Lesezeichen. Ich könnte eigensinnig sein und den Atlas an einer anderen Stelle aufschlagen, aber ich lasse ihn aufklappen, wo er will. Es ist kein Lesezeichen, sondern ein Kranz aus Blumen, plattgedrückt und papierdünn. Gänseblümchen. Wenn ich sie berühre, zerbröseln sie vermutlich. Ich habe nicht viele Erinnerungen an meine Kindheit, aber ich weiß noch, wie ich die Blumen hier hineingelegt habe. Meine erste Gänseblümchenkette. Faith hat mir gezeigt, wie man so etwas macht. Sie hat mir beigebracht, dass man dafür die Gänseblümchen mit den dicksten, haarigsten Stängeln nehmen und dann vorsichtig mit dem Daumennagel einen Halbmond in das saftige grüne Fleisch drücken muss. Man musste immer aufpassen, dass man sie nicht aus Versehen kaputtmachte.
Heather sollte nicht hier sein. Alles in ihr drängt sie, sich umzudrehen, das Geschäft sofort zu verlassen und zu ihrem Auto zurückzulaufen, aber sie tut es nicht. Stattdessen bleibt sie vor einem Regal mit Schuhen stehen. Sie stellt sich die Füße vor, die dort hineinschlüpfen werden – rosig und pummelig, mit unvorstellbar winzigen Zehen, die man unbedingt küssen möchte.
Wie kann etwas so Unschuldiges so gefährlich sein?
Ein Paar fällt ihr ins Auge. Sie sind nicht laut und bunt und übertrieben fröhlich wie die meisten anderen, sondern klein und zart, aus cremefarbenem Cord mit aufgestickten Gänseblümchen über den Zehen und einem Perlmuttknopf statt einer Schnalle. Vielleicht streckt sie deshalb die Hand aus und berührt sie, obwohl sie weiß, dass sie es nicht sollte. Vielleicht streicht sie deshalb über die winzigen, samtigen Rillen des Stoffs.
Damit ist die Grenze überschritten. Das war's. Obwohl sie sich einredet, dass sie sich diesmal im Griff hat, ist ihr klar, dass sie es tun wird. Sie weiß, die hier sind es.
Sie zieht ihre Hand zurück und steckt sie in ihre Jackentasche, verankert sie dort, indem sie eine Faust macht, und wendet sich zum nächsten Regal: weiche Sonnenhüte für puppengroße Köpfe, hübsche, pastellfarbene Söckchen, ordentlich in Paaren aufgereiht. Sie versucht, die Schuhe zu vergessen.
Sie schlendert durch das Erdgeschoss der Mothercare-Filiale in Bromley – ein Weg, den sie schon so oft gegangen ist, dass sie gar nicht mehr darüber nachdenken muss. Seit Jahren kommt sie schon hierher und schaut sich um, betrachtet die winzigen Kleidungsstücke – alle so sauber und bunt und nach Hoffnung duftend –, obwohl sie gar kein Kind hat. Aber irgendetwas hat sich verändert. Es ist kein müßiger Zeitvertreib mehr, sondern ein Zwang.
Während sie umhergeht, sieht sie, dass die blonde Verkäuferin – die herrische mit dem scharfen Blick – mehrere Leute an der Kasse bedient. Die andere, die Neue, versucht, einer hochschwangeren Frau vorzuführen, wie man einen der Kinderwagen zusammenklappt, doch weiß sie offenbar selbst nicht, wie es geht. Zusammen mit der Kundin sucht sie nach dem entscheidenden Knopf oder Riegel. Sonst kann Heather niemanden sehen.
Da tut sie es.
Sie dreht sich um und geht zurück zum Schuhregal. Ihre Schritte sind auf dem PVC kaum zu hören. Wie ferngesteuert greifen ihre Hände nach dem Plastikbügel mit den Gänseblümchenschuhen und stopfen ihn in ihre Handtasche.
Sie blickt sich um. Die beiden Verkäuferinnen sind immer noch beschäftigt und schauen nicht in ihre Richtung. Niemand ruft. Niemand läuft auf sie zu. Mit wild pochendem Herzen steuert sie auf den Ausgang zu, bemüht, so zu tun, als wäre dies ein ganz normaler Samstagnachmittag.
Als sie durch die Tür in die warme Frühlingsluft tritt, ist ihr so übel, dass sie sich fast übergeben muss. Heftig blinzelnd geht sie die Fußgängerzone der High Street hinunter, ohne Plan, ohne Ziel.
Eine leise Stimme in ihrem Kopf drängt sie, umzukehren und das Ganze rückgängig zu machen, die Schuhe wieder an ihren Platz zurückzubringen – niemand wird je davon erfahren! – oder, noch besser, die Schuhe unauffällig aus ihrer Handtasche zu holen, sobald sie wieder im Geschäft ist, und sie an der Kasse zu bezahlen.
Da beginnt Heather zu laufen, angetrieben von Scham, Reue und Selbstekel, und sie hört erst auf, als sie in der obersten Ebene des Parkhauses angekommen ist und vor ihrem Auto steht. Sie erinnert sich nicht daran, wie sie auf den Knopf des Aufzugs gedrückt oder das Ticket in den Automaten gesteckt und wieder herausgezogen hat, während das Wechselgeld in das Ausgabefach klirrte. Aber es ist ihr egal. Sie springt in ihr Auto und knallt die Tür zu, um die Welt auszusperren und das, was sie gerade getan hat.
Sie wirft ihre Handtasche auf den Beifahrersitz und packt mit beiden Händen das Lenkrad. Nur so kann sie das Zittern unterbinden.
2
Heather ist versucht, ein Stück entfernt von ihrer Wohnung zu parken, obwohl sie weiß, dass es idiotisch ist. Die Polizei wird sie trotzdem finden. Vielleicht sind sie ihr schon von der High Street aus gefolgt. Oder sie fragen einfach ihr Kennzeichen ab, dann wissen sie, wo sie wohnt. Die haben mittlerweile Computer in ihren Autos, die so was können. Das weiß sie aus dem Fernsehen.
Sie parkt in der Einfahrt, so nah wie möglich an der Tür, dann schnappt sie sich ihre Handtasche und hastet in das große viktorianische Haus. Früher hat wahrscheinlich eine wohlhabende Familie aus der Mittelschicht dort gewohnt, aber jetzt ist es in drei Wohnungen aufgeteilt, hübsch, aber nicht besonders edel. Heather hält den Kopf gesenkt, als sie den Flur betritt, und geht, so schnell sie kann, zu ihrer Wohnungstür. Erst als sie ein Paar abgewetzte braune Wanderstiefel in ihrem Sichtfeld bemerkt, bleibt sie stehen und blickt auf.
»Ah«, sagt der Besitzer der Stiefel. »Ich habe gehofft, dass ich Sie treffe.«
Heather will etwas sagen, aber ihr Mund ist auf einmal ganz trocken. »W-wirklich?«, stottert sie.
Er nickt lächelnd. Diese kleine Geste genügt – ihr Magen macht einen olympiareifen Salto. Eine glatte Zehn von sämtlichen Wertungsrichtern.
Er fährt sich durch das Haar, das mal geschnitten werden müsste. »Ja … Ich habe nämlich ein Problem mit den Rohren. Es ist jemand dagewesen, der sich das Ganze angesehen hat, und fürs Erste funktioniert alles wieder, aber er hat Carlton gesagt, dass möglicherweise das ganze Haus betroffen ist, also wundern Sie sich nicht, falls der sich bei Ihnen meldet.«
Heather nickt. Sie mag Carlton, ihren Vermieter, nicht besonders – er ist neugierig und sucht ständig nach einem Vorwand, um in ihre Wohnung zu kommen und dort herumzuschnüffeln –, aber sie hat bisher kein Problem mit den Rohren, ist also wohl erst einmal sicher vor ihm. »Danke für die Info«, sagt sie leise.
Jason tritt auf die unterste Treppenstufe, um in seine Wohnung im ersten Stock zurückzukehren. Die Bewegung durchbricht Heathers Trance, und sie erinnert sich wieder, warum sie es so eilig hat, zu ihrer Tür zu gelangen, warum die Handtasche so unter ihrem Arm brennt. Gerade als sie weitergehen will, dreht er sich um und lächelt sie erneut an. Sie muss sich zusammenreißen, um sich nicht an der kühlen Flurwand festzuhalten.
»Irgendwie ist aus dem Kaffee nie was geworden«, sagt er und sieht sie unverwandt an. Meist fällt es ihr schwer, anderen Leuten in die Augen zu sehen, aber bei Jason ist es ein wenig leichter. »Meine Schwestern haben zusammengeworfen und mir eine von diesen schicken neuen Kaffeemaschinen zum Geburtstag geschenkt. Hätten Sie vielleicht Lust, sie zusammen mit mir einzuweihen?«
Sie spürt, wie alles in ihr zu ihm hindrängt, obwohl sie die Handtasche mit dem Ellbogen noch fester an den Körper drückt. Offenbar bemerkt er ihr Zögern, denn er fügt hinzu: »Oder lieber einen Instantkaffee? Ich bin berühmt für meinen Instantkaffee, wenn ich das mal ganz unbescheiden sagen darf.«
Der Inhalt ihrer Handtasche brennt noch heißer an ihren Rippen, und sie sieht ihn hilflos an. »Tut mir leid«, murmelt sie, »aber ich kann heute nicht …« Und bevor er ihre lahme Ausrede auseinanderpflücken kann, wendet sie sich ab und eilt zu ihrer Tür. Erst als sie sie von innen zugedrückt hat und sich dagegen lehnt, beruhigt sich ihr Herzschlag allmählich.
Sie atmet laut aus. Jason Blake. Er ist vor ein paar Monaten hier eingezogen, und jedes Mal, wenn sie ihm begegnet, fühlt sie sich so. Sie hat gedacht, es würde nach einer Weile aufhören, aber es wird eher noch schlimmer.
Sie schüttelt den Kopf, um das Bild von ihm loszuwerden – die große, lässige Gestalt und diese braunen Augen, die sie anlächeln –, dann öffnet sie die Augen, stößt sich von der Tür ab und geht durch den Flur in ihr Wohnzimmer.
Allein hier drinnen zu sein, macht das Atmen wieder leicht.
Ihr Wohnzimmer liegt an der Rückseite des Hauses und geht auf einen langen, schmalen Garten hinaus, den sie mit den anderen Mietern teilt. Sie tritt an das große Erkerfenster mit der Terrassentür und blickt nach draußen. Jason findet, dass der Garten in den Fünfzigerjahren steckengeblieben ist. Er hasst die beiden schmalen Beete rechts und links am Zaun und den geraden Weg aus Betonplatten, der auf der einen Seite entlangführt, aber Heather mag es so. Es ist beruhigend.
Auch dieses Zimmer ist beruhigend, eine regelrechte Oase. Es steht nur das Nötigste darin: ein Sofa, ein Sessel und ein Bücherregal, ein Fernseher und ein kleiner Schreibtisch mit einer Vase darauf. Sie hält nichts davon, Dinge zu besitzen, die nicht regelmäßig benutzt werden. Sie sind eine Verschwendung von Raum, Energie und Gefühl.
Es gefällt ihr, dass sie mit geschlossenen Augen mitten im Zimmer stehen kann und weiß, wenn sie die Arme ausstreckt, ist um sie herum nur freier Raum. Genau das tut sie jetzt, und das Gefühl von Platz, das Wissen, dass die Wände weiß und leer sind, dass die Bücher im Regal perfekt aufgereiht stehen und dass die unechte Hortensie in der Vase auf dem Tisch niemals ein trockenes, totes Blatt fallen lassen wird, hilft ihr, mehr sie selbst zu sein.
Doch dann beginnt die Handtasche unter ihrem Arm wieder zu brennen, und ihr fällt ein, dass sie noch etwas tun muss. Sie geht durch den Flur zurück (auch hier weiße Wände ohne Fotos oder Bilder), vorbei an der Küche (makellos saubere Arbeitsfläche, alle Teelöffel in der Besteckschublade aneinandergeschmiegt) und bleibt vor einer Tür stehen.
Für Heather liegt dahinter nicht das Gästezimmer, obwohl es als solches gedacht ist, sondern ein fremdes Gebiet in ihrem kleinen Reich. Sie starrt auf den Türknauf aus Messing. Sie spürt, wie die Ruhe, die sich eben erst im Wohnzimmer in ihr ausgebreitet hat, wieder zu schwinden beginnt, aber sie weiß, was sie jetzt tun muss. Anders geht es nicht.
Der lange Schlüssel steckt wartend im Schloss, und während sie ihn umdreht, wappnet sie sich für das, was sie dort erwartet und was sie so wenig wie nur möglich ansehen will. Dann legt sich ihre Hand um den glatten, kalten Knauf und öffnet die Tür.
Es fühlt sich an, als würde der Inhalt des Raums auf sie zustürzen, als würde alles kämpfen, drängeln, schubsen, um zuerst bei ihr zu sein. Sie braucht ihre ganze Willenskraft, um nicht zurückzuweichen und wegzulaufen.
Vom Boden bis zur Decke ist alles voller Zeug. Das Zeug ihrer Mutter, in schwankenden Stapeln hineingepfercht. Zeug aus ihrem früheren Zuhause, das Heather seit Jahren nicht mehr betreten durfte und in das sie ohnehin keinen Fuß mehr setzen wollte. Dieser ganze Krempel gehört jetzt ihr, laut einem Testament, von dem sie nichts gewusst und dessen Auffinden geradezu an ein Wunder gegrenzt hat. Die Kartons, die alten Koffer, die Plastikkisten und die Tragetaschen. Alles gefüllt mit Zeug, das sie nicht will und das sie nicht interessiert. Allein bei dem Anblick verspürt sie den Drang, in die Dusche zu steigen.
Sie blickt auf den Rand der Ansammlung, wo ein etwa zwei Quadratmeter großes Stück Teppich sich wie ein kleiner Strand tapfer gegen die Flut stemmt, die ihn zu überschwemmen droht. Auf der einen Seite steht eine kleine Kommode. Stapel von alten Zeitungen und Zeitschriften wanken bedrohlich, als sie die mittlere Schublade aufzieht, aber sie tut es rasch und versucht sich einzureden, dass sie all das überhaupt nicht wahrnimmt.
Die Schublade ist angefüllt mit ihrer Schuld. Hastig nimmt sie die kleinen Cordschuhe aus ihrer Handtasche und stopft sie zwischen diverse Babyhüte, Strampler, Plüschtiere und Decken, alle noch mit dem Preisschild daran. Dann drückt sie die Schublade wieder zu, weicht zurück in den Flur und knallt die Tür so heftig zu, dass ihre Schlafzimmertür ebenfalls klappert.
Da lässt es allmählich nach, dieses juckende, quälende Gefühl, das sie den ganzen Tag begleitet und sie überhaupt erst dazu getrieben hat, in das Geschäft zu gehen. Den Rücken an die Wand gelehnt, lässt sie sich zu Boden gleiten und starrt auf das makellose Weiß der Tür, die sie gerade geschlossen hat, in der verzweifelten Hoffnung, es möge das Wissen darum auslöschen, was dahinterliegt.
3
Heather hat ein zweischneidiges Gefühl, als sie am Sonntagmorgen ihre Wohnung verlässt und sich auf den Weg zu ihrer Schwester nach Westerham macht. Einerseits ist sie erleichtert. Obwohl sie sich nach Kräften bemüht, es zu ignorieren, ist da stets ein blinkendes rotes Lämpchen in ihr – das Wissen um all das Zeug, das hinter der gesichtslosen Tür ihres Gästezimmers lauert –, aber das Blinken wird langsamer und weniger grell, als sie auf die A21 Richtung Kent fährt. Andererseits ist sie draußen. Ungeschützt. Und die Schlösser an ihren Türen, die dafür sorgen, dass all das Zeug an seinem Platz und geheim bleibt, erscheinen ihr mit jedem Kilometer, den sie sich davon entfernt, unzuverlässiger.
Sie braucht nur eine halbe Stunde bis zu Faith. Bromleys viktorianische Backsteinvillen, Vorkriegsreihenhäuser und Mietblocks gehen nach und nach über in Felder und Knicks, ländliche Pubs und Cottages aus Naturstein. Laut Faith sind Mum und Dad früher mit ihnen oft in das hübsche Pendlerdorf gefahren, als sie noch klein waren. Das war natürlich vor der Scheidung. Bevor in Mums Kopf alles so durcheinanderging. Aber daran erinnert sich Heather nicht. Sie erinnert sich an fast gar nichts aus ihrer Kindheit.
Früher dachte sie, das ginge allen so und vor dem dreizehnten Geburtstag bestünde die Erinnerung nur aus Fetzen von Klang, Duft und Farbe, wie die verschwommenen Überreste eines Traums. Aber mittlerweile weiß sie, dass manche Leute sich sehr deutlich an ihre frühen Jahre erinnern: daran, wer ihre erste Lehrerin war, was für einen Kuchen es bei ihrem allerschönsten Geburtstag gab oder welche Gutenachtgeschichten ihre Eltern ihnen immer erzählt haben.
Aber das kümmert sie nicht. Vor allem weil sie sich gar nicht erinnern will. Die winzigen Schnipsel, die manchmal durch den Nebel zu dringen versuchen, sind nicht sonderlich angenehm.
Bis auf einen. Der Urlaub am Meer mit Tante Kathy. Die wunderbare Tante Kathy mit ihren dunklen Locken und ihrem roten Mantel. Die Erinnerung daran stört Heather nicht.
Als sie vor Faiths Haus anhält, denkt sie an Zuckerwatte, hochgekrempelte Jeans über blassen Waden und eisiges Wasser an ihren Zehen, daran, wie sie mit den Wellen Fangen gespielt hat.
Faiths Haustür geht auf, bevor Heather richtig ausgestiegen ist, und ihre Schwester steht wartend da. Sie lächelt nicht, aber sie sieht auch nicht verärgert aus. Einfach neutral, weil wieder einmal der allmonatliche Besuch ansteht.
Faith ist drei Jahre älter als Heather. Sie hat das gleiche allmählich dunkler werdende blonde Haar, in dem keine Welle hält, ganz gleich, was sie mit dem Lockenstab anstellt, und die gleichen grauen Augen. Obwohl sie genau gleich groß sind, ist ihr ihre Schwester immer größer vorgekommen. Heather hat nie herausbekommen, warum das so ist.
Sie folgt Faith ins Haus. Ihr Schwager Matthew tritt aus der Küche in den Flur, wischt sich die Hände an einem Geschirrtuch ab und zwinkert Heather zu. »Ich will schon seit Ewigkeiten einen richtigen Sonntagsbraten machen, aber nach der Kirche ist nie genug Zeit dafür, deshalb musst du wieder mal mit einem Schmortopf vorliebnehmen.«
Heather nickt lächelnd. Sie mag Matthew. Er behandelt sie immer, als wäre sie einfach ein weiteres Familienmitglied, sprich: normal. Viele würden sich gegen diese Bezeichnung wehren, weil sie sie für langweilig halten, aber Heather wäre nichts lieber als das. Und für ein paar Stunden im Monat gibt Matthew ihr das Gefühl, sie könnte es tatsächlich sein.
Doch dann denkt Heather an die Kommode in ihrem Gästezimmer, mit all ihren schmutzigen Geheimnissen in Pastelltönen, und sie beginnt wieder an sich zu zweifeln. Aber das zeigt sie Faith und Matthew nicht. Sie lächelt weiter, sagt die richtigen Dinge zur Begrüßung und fragt nach den Kindern, die sie irgendwo im Haus herumtoben hört. Sie sind der einzige Grund, warum sie dieses monatliche Treffen mit ihrer Schwester aufrechterhält. Ihr Herz pocht bereits voller Vorfreude.
Wie aufs Stichwort kommen die beiden die Treppe heruntergepoltert, weil sie eine fremde Stimme im Flur gehört haben, halten dann jedoch abrupt inne und sehen sie schüchtern an, wie jedes Mal zu Beginn. Alice ist sechs und Barney drei. Wie gerne würde sie die beiden umarmen. Sie sehnt sich danach, ihre kleinen Arme um sich zu spüren. Sie möchte das Kinn auf ihr weiches Haar legen und einfach nur ihren Duft einatmen, doch jetzt stehen alle steif da und starren einander an, und der Moment für eine natürliche Umarmung ist vorbei.
Zum Glück rettet Alice Heather mit einer ihrer typischen direkten Fragen. »Hast du uns was mitgebracht? Tante Sarah bringt uns immer was mit.«
Barney nickt ernst.
»Barney will wissen, ob du Schokolade mitgebracht hast«, übersetzt Alice seine Geste.
Heather schüttelt den Kopf und ärgert sich im Stillen über Matthews wohltätige Schwester. »Tut mir leid, heute gibt's keine Schokolade und auch keine Spielsachen.« Sie sieht zu Faith hinüber. »Mummy sagt, ihr habt schon jede Menge Spielsachen.«
Da passiert es – einer dieser seltenen Momente zwischen den beiden. Genau wie Alice kann Heather den Blick ihrer Schwester übersetzen, den Ausdruck auf Faiths Gesicht, der ausnahmsweise ihre gemeinsame Vergangenheit anerkennt, ihre gemeinsame Abneigung gegen überflüssiges Zeug.
»Aber nach dem Essen spiele ich mit euch, was ihr wollt«, fügt Heather in der Hoffnung hinzu, dass das Geschenk gemeinsam verbrachter Zeit – für das sie als Kind alles gegeben hätte – in dieser Ära leuchtend bunter elektronischer Welten nicht völlig uninteressant geworden ist.
Barney sieht sie verständnislos an, aber Alice wird sofort munter. »Darf ich das Spiel aussuchen?«, fragt sie mit Unschuldsmiene, und Heather nickt. Die Antwort scheint Alice zu gefallen. Leise in sich hineinlächelnd hüpft sie Richtung Wohnzimmer davon, sodass Heather sich fragt, was die Kleine wohl im Schilde führt.
Heather folgt ihrer Schwester und ihrem Schwager in die Küche, wo mehrere Töpfe auf dem Herd stehen, aus denen es köstlich duftet. Sie sieht zu, wie die beiden umeinander herumtanzen, um dem Essen den letzten Schliff zu geben. Als Matthew die Hand auf Faiths Hüfte legt, während er nach einem Holzlöffel greift, wendet Heather den Blick ab. Die Geste ist ihr zu intim. Das letzte Mal, dass ein Mann sie berührt hat, ist so lange her, dass sie sich nicht erinnern kann, ob überhaupt schon mal die Hand eines Mannes so auf ihrer Hüfte gelegen hat.
Faith scheint die zärtliche Berührung gar nicht zu bemerken, was Heather traurig macht. Und ein bisschen wütend. Sie muss an ihre Mutter denken, die so viel Zeug angehäuft hatte, dass selbst ihre Schätze darin untergingen. Bei Faith ist das ähnlich, nur hat sie keine Dinge angesammelt, sondern Liebe und Menschen – solche Momente, die für Heather überaus kostbar wären, gehen in Faiths Leben wohl einfach unter.
Wieder einmal fragt Heather sich, wie es kommt, dass sie so verschieden sind. Liegt es daran, dass sie auf eine Weise kaputt ist, beschädigt, wie Faith es nie war? Aber wie könnte das sein, nachdem sie doch beide dieselbe schreckliche Kindheit hatten?
Sie wartet darauf, dass Faiths Maske verrutscht, prüft das Lächeln ihrer Schwester jedes Mal auf seine Widerstandskraft. Doch entweder beherrscht Faith dieses Spiel sehr viel besser als Heather, oder ihrer Schwester ist das gelungen, woran sie selbst ihr Leben lang gescheitert ist: Sie hat all das hinter sich gelassen. Sie ist darüber hinweg.
Falls es so ist, weiß Heather nicht, ob sie sie dafür bewundern oder hassen soll. Denn Faith weiß Bescheid. Sie weiß, was hinter Heathers Fassade steckt. Sie hat ein Verständnis, das man nicht von außen erlangen kann, durch Beobachtung und logische Analyse. Es ist ein Wissen, das aus der Erfahrung kommt, das nur besitzt, wer in Elend und Chaos geworfen wurde und es überstanden hat. Obwohl sie beide häufig versucht sind, die Bande zu kappen, damit sie sich nicht länger damit beschäftigen müssen, ist es gerade dieser gemeinsame Kampf, der die beiden Schwestern aneinanderbindet. Noch etwas, woran ihre Mutter schuld ist.
Der Duft des schmorenden Hähnchens erfüllt nun die ganze Landhausküche, und Faith ruft ihre Truppen zum Appell. »Los, alle Mann Tisch decken!« Sie gehorchen sofort und machen sich an die Arbeit. Matthew holt das Geschirr aus dem Schrank, und Alice legt das Besteck auf den Tisch, allerdings muss Matthew alles in die richtige Reihenfolge bringen, als sie fertig ist. Sogar Barney hat seine Aufgabe, er legt vorsichtig einen Untersetzer neben jedes Gedeck.
Der Tisch sieht bezaubernd aus mit Faiths blau-weißem Blümchengeschirr und dem Krug mit Gartenblumen in der Mitte. Auch Faiths Familie ist bezaubernd – die Kinder sind noch so niedlich, dass man es ihnen nicht verübelt, wenn sie maulen, weil in dem Schmortopf Champignons sind, und ihre Erbsen nicht essen wollen, und Matthew sieht ab und zu seine Frau an und lächelt ihr zu. Einfach so, ohne erkennbaren Grund.
Bei dem Anblick hat Heather das Gefühl, sie hätte ein klaffendes Loch in der Brust, das von ihrer Sommerbluse nur notdürftig verdeckt wird, und während sie das buttrige Kartoffelpüree mit der Sahnesauce isst, stellt sie sich vor, wie es wohl wäre, wenn das ihr Esstisch wäre und ihr Ehemann, der ihr gegenübersitzt und sie anlächelt. Die Sehnsucht danach ist so stark, dass sie nur mit Mühe ein Stöhnen unterdrückt.
Plötzlich taucht Jason vor ihrem inneren Auge auf. Sie will das Bild wegschieben, weil es ihr unpassend erscheint, ihn hier zu haben, obwohl ja außer ihr niemand etwas davon mitbekommt, aber sie bringt es nicht fertig. Doch als es darum geht, die Plätze von Alice und Barney zu füllen, lässt ihre Vorstellungskraft sie im Stich. Schlagartig landet sie wieder im Hier und Jetzt. Sie merkt, dass Faith sie ansieht, auf diese abwägende Weise, und schon wächst in ihr wieder der Groll auf ihre Schwester.
Wie hast du das gemacht?, würde sie sie am liebsten anbrüllen. Wie hast du es geschafft, das alles zu kriegen? Es ist so ungerecht.
Und warum hat sie Heather nie ihre Geheimnisse zugeflüstert? Warum hat sie sie so sorgsam für sich behalten? Schwestern teilen doch alles miteinander, oder? Vielleicht auch nicht, denkt Heather verbittert, wenn sie in einem Zuhause aufwachsen, in dem es immer nur darum geht, wer was besitzt.
Als sie mit dem Hauptgang fertig sind, erbietet sich Heather, die Teller abzuräumen und in die Küche zu bringen. Dieser Teil des Rituals geht ihr immer auf die Nerven. Wenn sie ihre Hilfe nicht anbietet, ist Faith sauer, aber wenn sie es tut, scheucht Faith sie zurück ins Wohnzimmer.
Alice zeigt stolz ein Armband aus neonfarbenen Plastikperlen, das sie bei dem Fest einer Freundin gebastelt hat, und da sie darauf besteht, dass ihre Tante es sich genauer ansieht, setzt Heather sich auf den Stuhl ihrer Schwester. Es gefällt ihr hier, Barney auf der einen Seite, Alice auf der anderen und Matthew gegenüber, und während sie dem Geplapper ihrer Nichte lauscht, breitet sich ein warmes Gefühl in ihrer Brust aus.
Doch in dem Moment kommt Faith mit dem Apple Crumble herein. Sie bleibt abrupt stehen und wirft ihrer Schwester einen strengen Blick zu. Sofort steht Heather auf und huscht zurück auf ihren Platz neben Barney, sodass Faith wieder ihren in Shabby Chic gestylten Eichenthron einnehmen kann.
Nach dem Dessert stapfen alle pflichtschuldigst ins Arbeitszimmer, denn nun ist Faiths wöchentliches Skype-Gespräch mit ihrem Vater dran, der zurzeit in Spanien lebt, und wenn Heather da ist, wird erwartet, dass sie ein wenig Familienbewusstsein zeigt und mitmacht.
Heather hasst es. Es ist nicht so, dass sie ihren Vater nicht liebt – das tut sie –, aber es kommt ihr so vor, als würde sie für den kleinen schwarzen Punkt oben im Bildschirmrand Theater spielen. Und jetzt alle fröhlich gucken. Tut so, als wärt ihr eine große, glückliche Familie!
Matthew stellt die Verbindung her, und Sekunden später sieht Heather das strahlende Gesicht ihres Vaters, während Shirley, seit über fünfzehn Jahren ihre Stiefmutter, im Hintergrund herumwerkelt. Sie winkt kurz, zieht sich dann jedoch diskret zurück. Wahrscheinlich um irgendwas abzustauben. Meister Proper lässt grüßen, denkt Heather, obwohl sie versteht, warum ihr Vater Shirleys militärische Sauberkeit vermutlich wohltuend findet.
»Hallöchen!«, sagt ihr Vater, und Faith bringt die Kinder dazu, ihm zu erzählen, was sie in der Grundschule beziehungsweise im Kindergarten gemacht haben. Ein paar Fingermalbilder und Schreibübungen, die sie ihm zeigen können, liegen schon bereit. Danach berichtet Faith von den Wundern ihres häuslichen Lebens, was Heather die Vanillesoße, die es zum Apple Crumble gab, ein wenig sauer aufstoßen lässt, und dann, bevor sie sich irgendwas zurechtlegen oder eine Ausflucht überlegen kann, ist Heather plötzlich an der Reihe. Sie lächelt schwach in die Kamera.
»Hi, Dad«, sagt sie und spürt, wie ihre Schwester sie beobachtet und ihr Noten für ihren familiären Einsatz gibt.
»Hallo, Mäuschen«, erwidert er. Den Kosenamen hat er ihr schon als Kind gegeben, und niemand sonst hat sie so genannt. »Was macht die Arbeit?«
Heather atmet aus. Die Arbeit ist ein ungefährliches Thema.
»Alles gut. Allerdings läuft mein derzeitiger Vertrag nur noch vier Monate, deshalb bin ich auf der Suche nach etwas Neuem.«
»Und, zeichnet sich schon was ab?«
Sie zuckt die Achseln. »In Eltham suchen sie eine Leitende Archivarin, das würde mich interessieren, aber ich weiß nicht, ob ich dafür genug Erfahrung habe. Wir werden sehen. Aber die Arbeit in Sandwood Park macht mir wirklich Spaß.«
»Ah.« Ihr Vater nickt, dann zitiert er den ersten Satz eines Romans. »Das ist von ihm, nicht?«
Heather nickt. Sandwood Park war das Haus des berühmten Autors Cameron Linford. Seine Witwe ist vor Kurzem gestorben und hat das Haus einer privaten Stiftung vermacht. In ein, zwei Monaten soll es für das Publikum geöffnet werden, und Heather hat die Aufgabe, den umfangreichen Nachlass des Paares zu sichten und zu katalogisieren: Tagebücher, Briefe, Finanzunterlagen und Fotografien.
»Und, schon irgendwelche unveröffentlichten Meisterwerke gefunden?«, fragt ihr Vater mit einem Zwinkern. Den Scherz macht er jedes Mal, und Heather gibt ihm jedes Mal dieselbe Antwort.
»Noch nicht. Aber ich halte weiter Ausschau.«
Doch der Versuch, über diesen Running Gag eine Verbindung herzustellen, schlägt fehl. Anstatt Vater und Tochter einander näherzubringen, hebt er die Distanz zwischen ihnen nur noch deutlicher hervor. Vielleicht wäre es besser, wenn Heather allein mit ihm skypen würde, im Schutz ihrer eigenen Wohnung und ohne Faith, die jedes Wort aufmerksam verfolgt. Sie hat die App schon ein paarmal auf ihrem iPad geöffnet, schafft es aber nie, auf das Hörersymbol zu tippen.
Zum Glück können die Kinder es kaum erwarten, ihrem Grandpa noch etwas zu zeigen, und so kann Heather die Bühne verlassen. Alice dirigiert, während ihr kleiner Bruder »Twinkle, Twinkle, Little Star« singt, und mit diesem beeindruckenden Finale endet der Anruf.
Als der Bildschirm abgeschaltet ist, geht Matthew mit den Kindern ins Wohnzimmer, wo sie fernsehen wollen, doch Faith bleibt im Arbeitszimmer.
»Gehen wir nicht zu den anderen?«, fragt Heather. Obwohl sie jeden Monat hierherkommt, weiß sie nie, was sie tun soll, was das Richtige oder Natürliche ist.
»Wenn ich mir noch eine einzige Folge von Peppa Pig ansehen muss, erschieße ich mich«, entgegnet Faith trocken, doch dann sieht sie Heather an. »Wir gehen gleich rüber. Aber vorher muss ich noch was mit dir besprechen …«
Heather sackt der Magen in die Knie. Sie und Faith »besprechen« nie etwas. Sie gehen höflich, freundlich und sachlich miteinander um, aber sie reden nie über etwas Tiefschürfendes. Nach all dem Streit, den sie vor und nach dem Tod ihrer Mutter miteinander hatten, hat sich eine Schutzschicht aus zivilisierter Distanz über ihre Beziehung gebreitet, und das ist beiden auch ganz recht so. »O-kay …«, sagt sie vorsichtig.
»Hast du immer noch Mums Sachen?«
Ein kalter Blitz durchzuckt Heather, als wäre sie gerade in ein Eisloch gefallen. Faith hat sie überrumpelt, und nun, da sie gezwungen ist, sich ohne ihre sorgfältig konstruierten inneren Abwehrmechanismen mit »dem Zimmer« zu befassen, wird ihr ganz eng in der Brust, und sie bekommt kaum noch die Zähne auseinander. »W-was?«
»Mums Sachen«, wiederholt Faith mit leicht gerunzelter Stirn. »Du hast doch bestimmt ein paar alte Familienfotos, oder?«
Heather bringt keinen Ton heraus. Ihr Mund ist ganz trocken – wie immer, wenn sie an den Inhalt ihres Gästezimmers denken muss. Sie nickt.
»Alice hat ein Schulprojekt. Sie braucht Fotos von mir und Matthew als Kind, und ich dachte, du kannst mir vielleicht eins raussuchen?«
Für die meisten Menschen wäre es seltsam, keine Fotos von sich als Kind zu haben, denn in der Regel bekommt man welche von seinen Eltern, zum Beispiel wenn man von zu Hause auszieht oder seine eigene Familie gründet. Heather wünschte, sie könnte diese Karte jetzt ausspielen und ihrer Schwester sagen, sie soll doch mal in den Kartons auf ihrem riesigen Dachboden nachschauen, aber das kann sie nicht. Es ist nicht so, dass es keine Fotos gibt, sie sind bloß verschollen. Vergraben. Das nimmt sie zumindest an.
»Ich … ich weiß gar nicht, ob ich die habe«, stammelt sie in der verzweifelten Hoffnung, dass Faith nicht weiter nachbohrt.
Faith wirft ihr einen Seitenblick zu. Einen »Heather stellt sich wieder an«-Blick, wie ihn nur eine ältere Schwester beherrscht. »Na ja, du kannst dich doch wenigstens mal umsehen, ob du was findest, oder? Schließlich hat Mum alles dir vermacht.«
Ah, da ist er wieder. Der Stachel. Sie wusste, dass das kommen würde. Den holt Faith jedes Mal heraus, wenn sie Heather ein schlechtes Gewissen machen will, obwohl beiden klar ist, dass es ein Segen war, nicht als Miterbin bestimmt worden zu sein. Wenn überhaupt, müsste Heather es als Druckmittel gegen Faith einsetzen.
Bei der Vorstellung, die Sachen ihrer Mutter durchzusehen, wird Heather buchstäblich übel. Am liebsten würde sie Faith anschreien, dass sie doch selbst danach suchen soll, aber sie kann Faith auf keinen Fall in das Zimmer lassen. Sie wäre noch enttäuschter von Heather als ohnehin schon. Aber sie selbst kann auch nicht darin herumwühlen (allein bei dem Wort bricht ihr der kalte Schweiß aus). Eine Pattsituation.
Faith sieht den Kampf, der sich hinter Heathers stets so beherrschten Zügen abspielt, und schnaubt. »Warum machst du immer so ein Theater um Mums Sachen? So kostbar sind die doch nicht!«
Heather zuckt innerlich zusammen. Nicht kostbar, denkt sie, ganz im Gegenteil. Eher würde sie wassermelonengroße Wollmäuse unter ihrem Sofa ertragen, als in das Zimmer zu gehen und sich wirklich darin umzusehen. Darin sind zu viele Geheimnisse. Zu viele furchtbare, grauenvolle Dinge.
Faith stemmt die Hände in die Hüften. »Es ist für Alice!«, sagt sie genervt. »Ich weiß, es ist nahezu unmöglich, dich dazu zu kriegen, etwas für mich zu tun, aber ich dachte, da es für deine angeblich so heiß geliebte Nichte ist, würdest du wenigstens einmal so tun, als wärst du ein Teil dieser Familie, und ein wenig Loyalität zeigen.«
Ihre Worte treffen Heather mitten ins Herz. Sie liebt Alice wirklich, obwohl die Sechsjährige schon fast genauso missbilligend dreinschaut wie ihre Mutter, sobald ihre Tante das Haus betritt. Sie sehnt sich so sehr danach, von den Kindern geliebt zu werden und sie bei sich zu Besuch zu haben, sogar über Nacht, aber auch da steht ihr dieses verdammte Zimmer im Weg.
»Du verstehst nicht«, murmelt sie.
»Nein, natürlich nicht«, erwidert Faith mit honigsüßer Stimme. »Wie könnte ich auch? Schließlich ist Heather etwas Besonderes, Heather ist anders, niemand versteht sie.« Sie schüttelt den Kopf. »Wahrscheinlich bin ich selbst schuld«, sagt sie, mehr zu sich selbst als zu ihrer Schwester. »Ich hätte strenger sein müssen, hätte dir nicht erlauben sollen, so lange das Opfer zu spielen, aber ich …« Sie verstummt und schüttelt erneut den Kopf.
Heather starrt ihre Schwester wütend an. Sie hat immer gewusst, dass die Schuld bei ihr liegt. Daran braucht Faith sie nicht zu erinnern.
Faith atmet aus und sammelt sich. Es ist untypisch für sie, so heftig zu werden und den Groll, von dem Heather weiß, dass er unter der Oberfläche schwelt, tatsächlich in Worte zu fassen. Meistens beschränkt sie sich, wenn es um ihre jüngere Schwester geht, auf vielsagende Blicke und eine »Das war ja wieder klar«-Haltung.
»Hör mal«, sagt sie ein wenig sanfter. »Ich weiß, du hast … Probleme. Aber du musst dir davon doch nicht das ganze Leben bestimmen lassen. Sieh dir mich an! Ich habe mir Hilfe geholt und mit Leuten geredet. Bei uns in der Kirche ist eine wirklich tolle Frau. Sie nimmt sich bestimmt Zeit für dich, wenn ich sie nett frage.«
»Nein.« Heathers Stimme ist leise, aber entschieden.
Faith sieht sie nur an. »Also gut«, sagt sie schließlich, und ihre Augen verengen sich. »Aber allmählich glaube ich, du genießt es, so seltsam zu sein, weil du dir weder Hilfe suchst noch irgendwen an dich ranlässt.«
Da sie keine Veränderung an Heathers verschlossener Miene wahrnimmt, gibt Faith auf und geht ins Wohnzimmer; offensichtlich ist ihr die Gesellschaft der verhassten Peppa Pig immer noch lieber als die ihrer einzigen Schwester. »Aber such gefälligst ein Foto für Alice raus«, sagt sie im Hinausgehen über die Schulter. »Denn wenn nicht, komme ich vorbei und kümmere mich selbst darum. Das ist ja wohl das Mindeste, was du für diese Familie tun kannst.«
Heather zittert und schlingt die Arme um sich. So weit darf es nicht kommen, denkt sie. Auf keinen Fall. Ihr wird irgendwas einfallen, um Faith loszuwerden, zur Not wird sie im Internet nach alten Fotos suchen, auf denen ein Mädchen ist, das Faith gewesen sein könnte, als sie klein war, und die ausdrucken.
Leise geht sie ins Wohnzimmer und setzt sich auf einen Stuhl in der Ecke, der eher zu Dekorationszwecken dort steht, als weil er bequem wäre. Faith ignoriert sie konsequent, während die Kinder auf und ab hüpfen und Teile von Peppas Geschichte, die bunt über den Bildschirm läuft, nachspielen. In dem Zeichentrickfilm sieht man eine erfundene Welt, in der jeder dazugehört, in der jede Geschichte ein glückliches Ende hat und in der jedes Kind einen Gutenachtkuss bekommt, bevor es selig in seinem Bett einschläft.
Nach vier Folgen schaltet Matthew den Fernseher aus. Die Kinder maulen unisono, dann dreht Alice sich um und entdeckt ihre Tante. Heather hat sich bemüht, möglichst unauffällig dazusitzen, und die Minuten gezählt, bis sie verschwinden kann, ohne dass Faith gleich den nächsten Wutanfall bekommt.
»Tante Heather, du hast versprochen, dass du mit uns spielst!«
Heather nickt. Gott sei Dank. Wenigstens ein Lichtblick in diesem elenden Nachmittag. So muss sie nicht länger auf Faiths Hinterkopf starren, während ihre Schwester dasitzt und vor sich hin kocht. Sie strahlt, als Alice angelaufen kommt, gefolgt von ihrem kleinen Bruder.
»Was wollt ihr denn spielen? Snap? Oder das Prinzessinnen-Spiel, das ich dir zu Weihnachten geschenkt habe?«
Alice schüttelt den Kopf und sieht zu Barney, der breit grinst. Die beiden stecken offensichtlich unter einer Decke.
»Wir wollen Verstecken spielen«, sagt sie entschieden.
Das Lächeln auf Heathers Gesicht erstarrt. »Was?«
Alice verdreht die Augen, eine perfekte Kopie ihrer Mutter. »Verstecken! Du weißt schon, einer zählt, und die anderen verstecken sich. Und dann musst du uns suchen. Aber ich will zuerst zählen, weil, es war meine Idee, und dann entscheide ich.«
Heather schüttelt den Kopf, aber ihr Nacken ist so angespannt, dass die Bewegung kaum zu sehen ist. »Ich kann nicht Verstecken spielen«, flüstert sie.
Alice verschränkt die Arme. »Du hast es versprochen«, sagt sie, als würde sie eine Trumpfkarte ziehen.
Heather schüttelt erneut den Kopf. »Tut mir leid, Liebes. Es ist nur so, ich hasse … Ich kann einfach nicht …« Hilflos sieht sie zu Faith hinüber, die sich umgedreht hat und das Gespräch mit gerunzelter Stirn verfolgt. Aber ihre Schwester beißt nur die Zähne zusammen und schweigt. »Ich spiele mit euch alles andere, egal was«, setzt Heather nach. »Und so oft ihr wollt. Stundenlang!«
Da füllen sich Alice' Augen mit Tränen, und ihre Unterlippe bebt eindrucksvoll. »Aber du hast es versprochen!«
Auch Heathers Augen werden feucht, aber es gelingt ihr, die Tränen wegzublinzeln. Wer weiß, was Faith sagen würde, wenn sie jetzt auch noch einen Heulanfall bekäme. »Es tut mir leid«, flüstert sie.
Alice rennt weinend davon, und Barney folgt ihr mit verwirrter Miene. »Alles muss immer nach deiner Nase laufen, nicht?«, sagt Faith leise, aber schneidend. »Nach deinen Regeln und innerhalb deiner Grenzen.«
»Das ist nicht wahr!«, protestiert Heather zu ihrer eigenen Überraschung.
»Dann geh und sag dem kleinen Mädchen, das weinend auf seinem Bett liegt, dass du deine Meinung geändert hast.«
Heather starrt sie nur stumm an.
Mit einem Schnauben steht Faith auf. »Genau wie ich gesagt habe: Nach deinen Regeln oder gar nicht. Ich weiß echt nicht, warum du überhaupt hierherkommst, wenn du dich so benimmst.«
Nun läuft doch eine Träne über Heathers Gesicht, aber sie kann Faiths eisigen Gesichtsausdruck nicht zum Schmelzen bringen. Ihre Schwester geht zur Tür. Kurz bevor sie den Raum verlässt, dreht sie sich noch einmal um und schüttelt mit einer Mischung aus Abscheu und Mitleid den Kopf. »Weißt du, manchmal bist du genau wie Mum.«
4
Die Puppe ist die Königin dieses Hauses. Sie steht auf der Ecke des höchsten Regals und blickt über ihr Reich. Das Zeug strebt ihr entgegen wie ein Gläubiger seinem Gott. Cassandras Augen sind klar, blau und hochmütig, ihr glänzendes braunes Haar ringelt sich in perfekten Locken, und das rosa Rüschenkleid im viktorianischen Stil ist makellos. Wer könnte mit der kalten Porzellanhaut von Gesicht und Armen mithalten? Wer mit diesen rosigen Wangen und korallenfarbigen Lippen?
»Eins … zwei … drei … vier …«
Mit pochendem Herzen läuft Heather los, als Faith zu zählen beginnt. Diesmal muss sie das beste Versteck finden, eines, auf das ihre Schwester nie kommt, denn Faith gewinnt immer beim Verstecken. Jedes Mal findet sie Heather ganz schnell und sagt kopfschüttelnd, sie sei eine »Amateurin«, obwohl Heather gar nicht so genau weiß, was das ist. Vermutlich jemand, der beim Versteckenspielen richtig schlecht ist. Sie hofft nur, wenn sie zehn ist, kennt sie genauso viele schwierige Wörter wie ihre Schwester.
Im Laufen überlegt Heather, wo sie sich verstecken könnte. Auf jeden Fall darf sie nicht kichern wie beim letzten Mal. Sie zwingt sich zu einem langsameren Tempo. Was nicht allzu schwierig ist, denn in ihrem Haus kann man gar nicht richtig schnell laufen. Dafür steht zu viel herum.
Sobald Faith mit dem Zählen begonnen hat, ist Heather einem der »Kaninchenpfade« gefolgt. Sie weiß nicht, warum ihre Schwester sie so nennt – sie hat im Haus noch nie ein Kaninchen gesehen.
Diese Pfade führen zwischen den Sachen hindurch. Sie haben viele Sachen. Bücher und Papiere und Plastikkisten mit allen möglichen Dingen, von denen ihre Mummy nicht will, dass sie sie anfasst. Und Kleider, ganz viele Kleider. Sie liegen in großen Haufen auf dem Sessel und auf dem Tisch, an dem sie früher gegessen haben. Es gibt auch Spielsachen, manche davon alt und kaputt, aber ihre Mummy sagt, sie will sie irgendwann reparieren, und manche ganz neu, sogar noch mit dem Preisschild daran, aber mit denen könnte Heather nicht spielen, selbst wenn sie es wollte, weil sie zu weit oben liegen. Einige Haufen sind so riesig, dass sie manchmal beim Hochgucken das Gefühl hat, sie beugen sich vor und schauen zu ihr herunter, als überlegten sie, ob sie auf sie drauffallen sollen oder nicht. Das mag Heather gar nicht.
Es gibt auch viele Sachen, von denen ihre Mummy sagt, sie wird sie bald aussortieren und wegschmeißen, wenn sie nicht mehr so müde ist. Vielleicht tut sie das, wenn ihr Daddy nicht mehr so viel arbeitet und öfter zu Hause ist. Neulich Abend hat sie gehört, wie ihre Eltern darüber gestritten haben. Sie hat auch mal gehört, wie Tante Kathy gesagt hat, ihr Haus sei wie Aladins Höhle, nur dass sie nicht voller Schätze ist, sondern voller Scheiße.
Das Wort darf Heather nicht sagen. Patrick Hull hat es mal in der Schule gesagt, und da hat Miss Perrins ihn zur Strafe in der Ecke sitzen lassen, und als seine Mum kam, um ihn abzuholen, hat sie sie für ein kurzes Gespräch beiseitegenommen.
Mit ihrer Mummy hatte Miss Perrins auch schon öfter kurze Gespräche, aber nicht, weil Heather etwas Böses gesagt hat. Heather weiß nicht, worüber sie geredet haben, weil Mummy und Miss Perrins dabei im Flur waren, aber es sah wichtig aus, und Miss Perrins hat nicht wie sonst gelächelt.
Einmal ging es wohl um ihre Schuluniform (Mummy hat sie zwischen all den Kleidern im Haus nicht wiedergefunden, und Heather musste in ihrem blauen Trägerkleid zur Schule gehen), und ein anderes Mal juckte es Heather ganz schlimm, weil die kleinen Insekten von ihrer Katze Fluffy sie in den Bauch gebissen haben, sodass sie sich immerzu kratzen musste und nicht buchstabieren üben konnte. Manchmal haben sie sich in ihrem Pulli versteckt und sind mit in die Schule gekommen, und dann haben sie die anderen Kinder auch gebissen. Faith hat sie »verdammte kleine Trittbrettfahrer« genannt, aber das hat ihre Lehrerin nicht gehört, sodass Faith nicht in der Ecke sitzen musste. Danach gab es noch mehr kurze Gespräche, weil die Jungs sie in der Pause »Penner-Heather« genannt und sie immer geärgert haben.
Aber ihre Mummy ist deswegen nie böse auf sie gewesen. Hinterher, wenn sie wieder zu Hause sind, legt sie sich jedes Mal aufs Sofa vor dem Fernseher und weint. Sie umarmt Heather und sagt, sie ist ein braves Mädchen, und es ist nicht ihre Schuld, und sie wird es in Zukunft besser machen.
Heather bemüht sich, möglichst lautlos durchs Esszimmer zu schleichen, als sie hört, dass Faith zu Ende gezählt hat. Es ist schwierig, vollkommen leise zu sein, weil überall auf dem Boden alte Plastikbehälter und knisternde Zellophanfetzen herumliegen und sie auf Papierstücken und Kleidern ausrutscht, die von den Haufen heruntergefallen sind.
»Hea-ther!«, ruft Faith in einem Singsang, »jetzt komme ich und hole dich!«
Heather bewegt sich wieder schneller. Jetzt ist ihr gar nicht mehr nach Kichern zumute, und ihr Herz pocht noch lauter. Sie muss ein Versteck finden, ein ganz kleines, auf das Faith nicht kommt.
Sie dreht sich um und geht die Treppe hinauf. Ihre Füße sind kleiner als die von Faith, und sie findet die Lücken zwischen den Bücher- und Papierstapeln, die auf jeder Stufe liegen, ohne sie umzuwerfen. Als sie das kleine Stück freien Teppichs auf dem Treppenabsatz erreicht, wendet sie sich nach links und huscht in das Zimmer, das ihres war, bevor die Sachen sich darin breitgemacht haben. Früher waren die Sachen nur unten und im Zimmer ihrer Eltern, aber sie wandern immer weiter, und irgendwie werden die Haufen immer größer. Heather fragt sich, ob die Haufen Babys kriegen. Das hat sie Faith mal gefragt, und die hat nur gemeint, sie soll keinen Schwachsinn reden, aber Heather leuchtet das ein. Woher sollten die neuen denn sonst kommen?
Sie sieht sich in dem Zimmer nach einer guten Stelle um. Ihr fällt ein, dass Daddy seine Gitarre unter dem Bett hervorgeholt und sie an einen Mann unten an der Straße verkauft hat. Da, wo sie gelegen hat, ist eine Lücke, gerade groß genug, um sich hineinzuschieben. Sobald sie drinnen ist, zieht sie die Decke vom Bett ein Stück herunter, damit man sie nicht sieht.
Doch irgendetwas, das auf der Decke gelegen hat, fällt krachend herunter, und Heather erstarrt. Sie hört Schritte, die sich nähern. Faith kommt die Treppe herauf! Heather hält den Atem an und kneift die Augen zu. Wenn sie sich doch nur unsichtbar machen könnte!
»Hea-ther«, singt Faith erneut. »Du weißt doch, ich finde dich!«
Heather spürt, wie ein Kichern in ihr aufsteigt. Sie presst die Hand auf den Mund. Da sind Faiths Füße – sie kann sie unter dem Rand der Decke hinweg sehen. Ihre Schwester steht in der Tür.
Geh weg, geh weg, geh weg, betet sie.
Gerade als sie denkt, Faith würde die Decke hochziehen und sagen: »Ha! Hab ich dich!«, machen die Füße ihrer Schwester kehrt und verschwinden. Heather ist so überrascht, dass sie vergisst auszuatmen, bis ihr ganz komisch wird. Dann schnappt sie gierig nach Luft.
Sie hört, wie Faith umhergeht und ihren Namen ruft, aber jetzt klingt ihre Stimme anders. Nicht mehr so selbstgefällig. Eher genervt. Heather grinst in sich hinein und schiebt sich noch ein Stück weiter unter das Bett. Heute wird sie das Versteckspiel gewinnen, und dann ist Faith die Amateurin!
Heather bleibt sehr lange dort. Faith schaut in alle anderen Zimmer, dann geht sie wieder nach unten. Selbst als Mummy ruft, dass das Essen fertig ist, rührt sich Heather nicht. Es könnte ein Trick sein, und selbst wenn nicht, sie will nicht, dass Faith sagt, sie hätte aufgegeben. Sie kommt erst heraus, wenn Faith das tut, was Heather sonst immer tun muss, wenn sie sie nicht findet: sich in die Mitte des Hauses stellen und rufen, dass Heather die Königin des Versteckspiels ist und Faith die Verliererin. Das will Heather viel mehr als ein Schinkensandwich, auch wenn ihr allmählich der Magen knurrt.
Nach einer ganzen Weile wird Heather kalt, und sie öffnet die Augen. Ist sie eingeschlafen? Allmählich kommen die Geräusche zurück. Sie lauscht angestrengt. Irgendwo unten weint jemand, und jemand anders ruft.
»Heather! Heather? Wo bist du?« Faiths Stimme klingt gar nicht mehr herausfordernd. Ob das ein Trick ist, um sie herauszulocken?
»O Gott, o Gott!«, schluchzt ihre Mummy. »Meine Kleine ist weg! Meine Kleine ist weg! Nicht noch mal, bitte nicht noch mal!« Eine kurze Pause, dann hört sie, wie ihre Mutter Faith anschreit. »Du solltest doch auf sie aufpassen!«
Ein lautes Krachen auf der Treppe, dann noch mehr Geschrei. Heather bekommt es mit der Angst zu tun. Irgendetwas sagt ihr, dass das kein Spiel mehr ist, dass sie rauskommen muss, aber sie ist vor Angst wie gelähmt. Sie kann nicht mal den Mund aufmachen, um zu rufen.
Schließlich schafft sie es, zumindest ein Stück nach vorn zu rücken, und hinter der Decke tauchen Füße auf. Sie versucht, »Ich bin hier!« zu sagen, aber ihre Stimme ist ganz leise und kratzig, als hätte Heather vergessen, wie man sie benutzt.
Das Getrappel und Geschrei verstummt. Es wird ganz still.