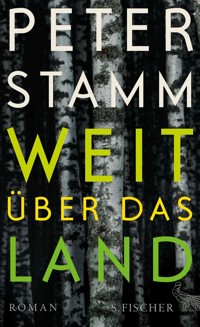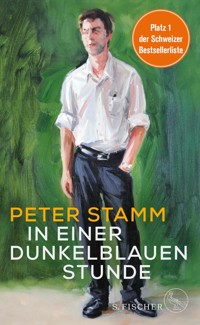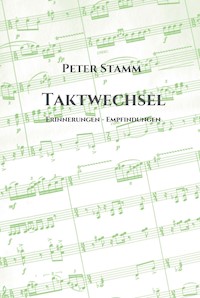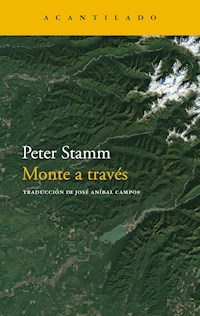9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schweizer Buchpreis 2018 Das eigene Leben noch einmal miterleben. Soll man sich das wünschen? Christoph verabredet sich in Stockholm mit der viel jüngeren Lena. Er erzählt ihr, dass er vor zwanzig Jahren eine Frau geliebt habe, die ihr ähnlich, ja, die ihr gleich war. Er kennt das Leben, das sie führt, und weiß, was ihr bevorsteht. So beginnt ein beispiellos wahrhaftiges Spiel der Vergangenheit mit der Gegenwart, aus dem keiner unbeschadet herausgehen wird. Können wir unserem Schicksal entgehen oder müssen wir uns abfinden mit der sanften Gleichgültigkeit der Welt? Peter Stamm, der große Erzähler existentieller menschlicher Erfahrung, erzählt auf kleinstem Raum eine andere Geschichte der unerklärlichen Nähe, die einen von dem trennt, der man früher war.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 133
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Peter Stamm
Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt
Roman
Über dieses Buch
Christoph verabredet sich in Stockholm mit der viel jüngeren Lena. Er erzählt ihr, dass er vor zwanzig Jahren eine Frau geliebt habe, die ihr ähnlich, ja, die ihr gleich war. Er kennt das Leben, das sie führt, und weiß, was ihr bevorsteht. So beginnt ein beispiellos wahrhaftiges Spiel der Vergangenheit mit der Gegenwart, aus dem keiner unbeschadet herausgehen wird.
»Würde Albert Camus heute leben, würde er vielleicht Bücher schreiben wie Peter Stamm …« The New Yorker
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
Motto
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
»Wir lagen regungslos da. Aber unter uns bewegte sich alles und bewegte uns, sanft, auf und nieder und von einer Seite zur anderen.«
Samuel Beckett, Das letzte Band
1
Sie besucht mich oft, meist kommt sie in der Nacht. Dann steht sie neben meinem Bett, schaut auf mich herunter und sagt, alt bist du geworden. Sie meint es nicht böse, ihre Stimme klingt heiter, liebevoll. Sie setzt sich auf den Rand meines Bettes. Aber dein Haar, sagt sie und zerzaust es mit der Hand, das ist noch so dicht wie immer. Weiß ist es geworden. Nur du wirst nicht älter, sage ich. Ich bin nicht sicher, ob mich das traurig macht oder glücklich. Wir reden nie viel, was sollen wir schon sagen. Die Zeit vergeht. Wir schauen uns an und lächeln.
Sie kommt fast jede Nacht, manchmal auch erst im Morgengrauen. Sie war nie sehr pünktlich, aber das macht mir nichts aus, je weniger Zeit mir bleibt, desto mehr Zeit lasse ich mir. Ich mache nichts anderes mehr als warten, und je später sie kommt, desto länger kann ich mich auf sie freuen.
Heute bin ich früh aufgewacht und gleich aufgestanden. Für einmal wollte ich sie nicht im Bett empfangen. Ich habe meine gute Hose angezogen, das Jackett und die schwarzen Schuhe und habe mich an den Tisch am Fenster gesetzt. Ich bin bereit.
Schon seit Tagen ist es kalt, auf den Dächern und Wiesen liegt Schnee, und aus den Kaminen des Dorfes steigen dünne Rauchfahnen. Ich nehme den kleinen Wechselrahmen mit Magdalenas Bild aus der Schublade, einer Fotografie, die ich vor Ewigkeiten aus der Zeitung ausgeschnitten habe und auf der ihr Gesicht kaum zu erkennen ist. Das Papier ist schon ganz vergilbt, aber es ist das einzige Bild, das ich von ihr habe, und es vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht wenigstens einen Blick darauf werfe. Ich streiche mit den Fingern über den schmalen Holzrahmen, und es ist mir, als sei sie es, die ich berühre, ihre Haut, ihr Haar, die Formen ihres Körpers.
Als ich wieder aus dem Fenster schaue, sehe ich sie draußen stehen. Ihr Atem dampft, und sie lächelt und winkt mir zu. Ihr Mund bewegt sich, ich errate, dass sie mich ruft. Komm!, wiederholt sie überdeutlich, damit ich es von ihren Lippen ablesen kann. Lass uns spazieren gehen. Ich komme, rufe ich zurück, warte auf mich! Das heisere Krächzen erschreckt mich, es ist die Stimme eines alten Mannes, eine Stimme, die mir so fremd ist wie der gebrechliche Körper, in dem ich gefangen bin. So schnell es geht, ziehe ich Mantel und Schal an. Ich eile die Treppe hinunter und falle fast hin auf den ausgetretenen Steinstufen. Als ich endlich aus dem Heim trete, ist Magdalena schon losgegangen. Ich folge ihr in Richtung des Flusses, zur Fußgängerbrücke, die hinüber in das Dorf meiner Kindheit führt, komme am kleinen Teich vorbei, an dem wir als Kinder Enten gefüttert haben, an der Stelle, an der ich einmal mit dem Fahrrad schwer gestürzt bin, und an jener, an der wir uns als Jugendliche nachts getroffen und Feuer gemacht haben. Es ist mir, als sei ich Teil dieser Landschaft geworden, die sich in all der Zeit kaum verändert hat.
Magdalena ist schon fast bei der Brücke. Sie tritt so leicht auf, dass es scheint, als schwebe sie über die schneebedeckten Wege. Ich habe in der Eile meinen Stock vergessen und bin hin- und hergerissen zwischen der Angst, an einer eisigen Stelle auszugleiten und zu stürzen, und jener, Magdalena aus den Augen zu verlieren. Warte!, rufe ich wieder, ich bin nicht mehr so schnell.
Bilder tauchen auf, wie sie in den Bergen vor mir davongelaufen ist, wie wir in der Stadt unsere Wege gesucht haben, wie wir Arm in Arm durch Stockholm gewandert sind in jener Nacht, in der ich ihr meine Geschichte erzählte, in der ich ihr ihre Geschichte erzählte, jener Nacht, in der sie mich küsste. Sie dreht sich nach mir um und lächelt. Komm doch!, ruft sie. Komm zu mir!
2
Magdalena musste sich über meine Nachricht gewundert haben. Ich hatte keine Telefonnummer und keine Adresse angegeben, nur die Zeit und den Ort und meinen Vornamen: Bitte kommen Sie morgen um vierzehn Uhr zum Skogskyrkogården. Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen.
Ich wartete beim Ausgang der S-Bahn-Station auf sie. Um Viertel nach zwei war sie noch nicht da, und ich dachte kurz, sie könnte ein Taxi genommen haben. Aber ihre Verspätung hatte nichts zu bedeuten, sie war immer unpünktlich gewesen, nicht auf die aggressive Art, die dem Wartenden zeigen soll, dass seine Zeit weniger wert ist als ihre, eher aus einer Art Zerstreutheit, mit der sie ihr ganzes Leben anging. Ich war sicher, dass sie kommen würde, dass ihre Neugier größer sein würde als ihr Misstrauen.
Fünf Minuten später fuhr der nächste Zug ein, und als ich schon dachte, sie sei auch in diesem nicht gewesen, kam sie mit hüpfenden Schritten die Treppe herunter. Ich hatte mich gleich zu erkennen geben wollen, aber kaum sah ich sie, verschlug es mir wieder den Atem wie am Tag zuvor, als ich ihr vor dem Hotel aufgelauert und sie dann doch nicht angesprochen hatte. Sie musste bald dreißig sein, zwanzig Jahre jünger als ich, aber sie sah aus wie ein junges Mädchen, und wer uns zusammen begegnet wäre, hätte glauben können, wir seien Vater und Tochter. Ich ließ sie an mir vorübergehen, ohne sie anzusprechen, und folgte ihr in Richtung Friedhof.
Sie wirkte nicht wie jemand, der verabredet ist. Sie ging mit schnellen Schritten die Straße hinunter, als sei sie den Weg schon hundertmal gegangen. Ich hatte angenommen, sie werde beim Eingang des Geländes warten, aber sie ging hinein und, ohne zu zögern, einen kleinen Hügel hoch, auf dem ein Kreis alter Bäume stand. Am Fuß des Hügels gab es ein riesiges Steinkreuz, dennoch hatte die Anlage etwas Heidnisches, die Landschaft und die Natur wirkten stärker als die sakralen Bauten und alle christlichen Symbole.
Magdalena hatte sich oben auf dem Hügel unter einen der kahlen Bäume gesetzt und schaute mir entgegen, als hätten wir ein Wettrennen gemacht und sie sei die Siegerin. Außer Atem kam ich bei ihr an, und obwohl sie mich noch nie gesehen hatte, schien sie sofort zu wissen, dass ich es war, der sie hierherbestellt hatte. Lena, sagte sie und streckte mir die Hand hin. Christoph, sagte ich und gab ihr etwas irritiert die Hand. Nicht Magdalena? Niemand nennt mich so, sagte sie mit einem Lächeln. Ein ungewöhnlicher Ort für ein Treffen. Ich wollte, dass wir ungestört reden können, sagte ich.
Ich setzte mich neben sie, und wir schauten hinunter zu den Gebäuden aus gelblichem Stein, die aus den dreißiger Jahren stammen mussten. Neben einigen quaderförmigen Bauten war ein monumentales, von viereckigen Säulen getragenes Dach, davor ein großer, zugefrorener Teich. Auf den Wiesen der sanft gewellten Landschaft lagen Flecken von Schnee. Vom Eingang des Friedhofs her kamen Menschen in dunklen Mänteln, einige allein, andere paarweise oder in kleinen Gruppen. Vor einem der Gebäude blieben sie stehen, eine verstreute Versammlung, die nicht recht zusammenzupassen schien.
Ich mag Friedhöfe, sagte Lena. Ich weiß, sagte ich. Es ist kalt, sagte sie. Wollen wir uns ein wenig bewegen?
Wir gingen den Hügel hinunter. Die Trauergäste waren inzwischen unter dem ausladenden Dach der Kapelle verschwunden, und der Platz war wieder menschenleer. Neben dem Gebäude stand ein Kandelaber mit einer Uhr. Seltsam, sagte Lena, das sieht aus wie auf einem Bahnsteig. Sie stellte sich unter die Uhr, schaute zu ihr hoch und prüfte dann die Zeit auf ihrer Armbanduhr wie eine Reisende, die die Abfahrt ihres Zuges nicht erwarten kann. Endstation, sagte ich. Sie lächelte mich an, aber spielte ihre Rolle weiter, bis ich ein paar Mal leise in die Hände klatschte, worauf sie sich linkisch verbeugte.
Wir liefen weiter in das Gelände hinein, vorbei an geometrisch angelegten Grabfeldern in Richtung eines lichten Kiefernwaldes. Wir gingen so nah nebeneinander, dass unsere Schultern sich manchmal streiften. Lena schwieg jetzt, aber es war kein ungeduldiges Schweigen, wir hätten wohl noch lange so gehen können, ohne zu reden, nur mit unseren Gedanken beschäftigt. Schließlich, wir waren eben zwischen die ersten Bäume getreten, blieb ich stehen und sagte, ich möchte Ihnen meine Geschichte erzählen. Sie gab keine Antwort, aber sie wandte sich mir zu und schaute mich an mit einem Blick, der weniger neugierig als vollkommen offen wirkte.
Ich bin Schriftsteller, sagte ich, oder besser, ich war Schriftsteller. Ich habe nur ein Buch veröffentlicht, und das ist fünfzehn Jahre her. Mein Freund ist Schriftsteller, sagte sie, oder möchte es gerne sein. Ich weiß, sagte ich, deshalb will ich Ihnen meine Geschichte erzählen.
Wir gingen langsam den Kiesweg entlang, der in gerader Linie durch den Wald führte, und ich erzählte Lena von jener seltsamen Begegnung vor vierzehn Jahren, die dazu geführt hatte, dass ich das Schreiben aufgegeben hatte.
3
Schon während des Studiums hatte ich angefangen, an ersten Romanprojekten zu arbeiten, ambitionierten Konstrukten voller Binsenweisheiten und literarischer Anspielungen, die niemand lesen, geschweige denn publizieren wollte. Diese jahrelangen Bemühungen und das ewige Scheitern waren es schließlich, die mir zu Erfolg verhalfen. Der Held des Romans, mit dem ich nach Jahren einen Verlag fand, war ein ebenso desillusionierter Autor wie ich. Das Buch erzählte eine Liebesgeschichte, es hatte eine Art Porträt meiner Freundin werden sollen, aber während ich es schrieb, trennten wir uns, und so wurde es eine Geschichte über unsere Trennung und über die Unmöglichkeit der Liebe. Zum ersten Mal hatte ich beim Schreiben gespürt, dass ich eine lebendige Welt erschuf. Zugleich entglitt mir die Realität immer mehr, erschien mir der Alltag langweilig und schal. Meine Freundin verließ mich, aber wenn ich ehrlich bin, hatte ich mich im Kopf schon Monate früher von ihr getrennt, war in die Fiktion entkommen, in meine künstliche Welt. Als sie mir sagte, dass sie nicht mehr könne, dass sie mich vermisse, selbst wenn ich bei ihr sei, empfand ich nur ein Gefühl des Überdrusses und der Ungeduld.
Der Roman kam gut an bei Buchhändlern und Lesern, und auch die Kritik wurde darauf aufmerksam. Dieses Debüt berge alle Möglichkeiten für die Zukunft in sich, schrieb eine Kritikerin. Tatsächlich glaubte ich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder an die Zukunft. Nachdem ich jahrelang von der Hand in den Mund gelebt hatte, verhalf mir der Erfolg des Romans zu keinem üppigen, aber einem anständigen Einkommen, und vor allem hatte ich endlich ein Buch in der Hand, das meine Bemühungen rechtfertigte. Die Jahre des erfolglosen Schreibens kamen mir jetzt schon vor wie eine längst vergangene Zeit, in der ich gefangen gewesen war in labyrinthischen Projekten, getrieben von überstiegenen Ambitionen.
Wie viel meine Geschichte mit mir zu tun hatte, gab ich nie zu. Wenn ich nach Lesungen darauf angesprochen wurde, wehrte ich ab und bestand auf der Unterscheidung zwischen Erzähler und Autor.
Mein Verlag hatte etliche Lesungen für mich organisiert, und ich genoss es, meiner leeren Wohnung zu entkommen, im Land herumzureisen, mir fremde Orte anzuschauen und nur am Abend für ein paar Stunden beschäftigt zu sein. Als ich eine Einladung der kleinen Buchhandlung meines Heimatdorfes erhielt, zögerte ich deshalb nur kurz. Der alte Buchhändler hatte mir einen so netten und schmeichelhaften Brief geschrieben, dass ich zusagte. Erst als das Datum näher rückte, wurde ich unruhig beim Gedanken, vor Menschen zu lesen, die mich schon als Kind gekannt hatten und die von den Figuren des Romans auf mich und mein jetziges Leben schließen könnten.
Es war spät im November. Ich war kurz nach Mittag losgefahren, absichtlich viel zu früh. Ich hatte das Dorf seit vielen Jahren nicht besucht und wollte sehen, ob die Wirklichkeit noch mit meiner Erinnerung übereinstimmte.
Der Zug leerte sich von Station zu Station immer mehr, als nähere er sich einer verbotenen Zone, ich war der Letzte in meinem Waggon, der Schaffner hatte sich seit längerem nicht mehr blicken lassen. Als ich losgefahren war, hatte die Sonne geschienen, aber je weiter östlich wir kamen, desto nebliger wurde es, inzwischen war vor den Fenstern nur noch Grau zu sehen, Wald, kahle Bäume, brachliegende Felder, eine Herde Schafe und dann und wann ein einzelner Hof oder ein Weiler. Kurz vor dem Ziel machte die sonst fast gerade Strecke eine Kurve, um den Fluss zu überqueren, der hier die Talseite wechselte. Schon vor der Kurve verlangsamte der Zug und schließlich kam er ganz zum Stehen. Die Neigung der Trasse, die bei der Durchfahrt kaum zu spüren war, verursachte mir im Stillstand ein Unwohlsein, es war mir, als sei ich selbst aus dem Lot geraten. Lange stand der Zug, dann setzte er sich mit einem Ruck wieder in Bewegung und überquerte den Fluss, ohne dass irgendetwas geschehen wäre, das den Halt hätte erklären können. Aber mein Unwohlsein hielt an, bis ich mein Dorf erreichte.
Im Winter lag der Nebel in dieser Gegend oft wochenlang, es war die Wetterlage, die ich wie keine andere mit meiner Kindheit verband, eine kalte Welt, grau und diffus und zugleich geborgen, in der alles, was nicht ganz nah war, nicht zu existieren schien. Erst als ich nach dem Abitur das Dorf verlassen hatte und in die Stadt gezogen war, hatte ich gelernt, wie weit die Welt war und wie unsicher. Vielleicht hatte ich deshalb zu schreiben begonnen, um die Landschaft, die Sicherheit meiner Kindheit wiederzugewinnen, aus der ich mich selbst vertrieben hatte.
Obwohl es möglich gewesen wäre, nach der Lesung zurückzufahren, hatte ich den Buchhändler gebeten, mir ein Zimmer zu buchen, und zwar im Hotel im Einkaufszentrum am Marktplatz, in dem auch ein Restaurant und ein Theatersaal untergebracht waren. Vor meinem Studium hatte ich dort ein paar Monate lang als Nachtportier gejobbt. Damals war der Gebäudekomplex noch neu gewesen und war mir groß und sehr modern vorgekommen. Jetzt wirkte alles bescheiden, ältlich und düster.
Ich hatte vorgehabt, ein wenig durch das Dorf zu spazieren, aber schon auf dem Weg vom Bahnhof zum Hotel hatte mich die Mischung von Vertrautem und Neuem irritiert und beunruhigt. Selbst die Gebäude, die noch immer aussahen wie in meiner Jugend, kamen mir fremd vor, als stünden sie in einem Museum, losgelöst von ihrer Funktion und ihrem Kontext.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: