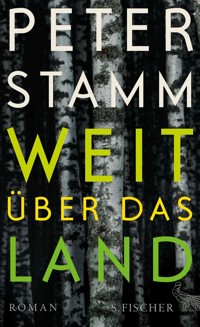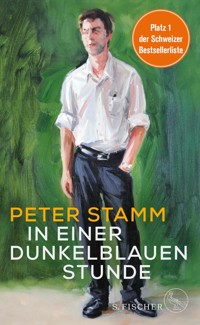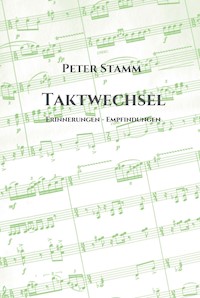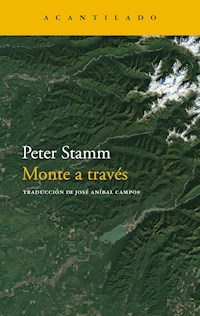12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Peter Stamms Roman »Das Archiv der Gefühle« fragt, ob wir im Leben unsere Chancen erkennen? Die Sängerin Fabienne heißt eigentlich Franziska, und es ist vierzig Jahre her, dass sie eng befreundet waren und er ihr seine Liebe gestand. Fast ein ganzes Leben. Seitdem hat er alles getan, um Unruhe und Unzufriedenheit von sich fernzuhalten. Er hat sich immer mehr zurückgezogen und nur noch in der Phantasie gelebt. Er hat sein Leben versäumt. Aber jetzt taucht Franziska wieder auf. Gefährdet das seine geschützte Existenz, oder nimmt er diese zweite Chance wahr?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Peter Stamm
Das Archiv der Gefühle
Roman
Roman
Über dieses Buch
Die Sängerin Fabienne heißt eigentlich Franziska, und es ist 40 Jahre her, dass sie eng befreundet waren und er ihr seine Liebe gestand. Fast ein ganzes Leben. Seitdem hat er alles getan, um Unruhe und Unzufriedenheit von sich fernzuhalten. Er hat sich immer mehr zurückgezogen und nur noch in der Phantasie gelebt. Er hat sein Leben versäumt. Aber jetzt taucht Franziska wieder auf. Gefährdet das seine geschützte Existenz, oder nimmt er diese zweite Chance wahr?
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Peter Stamm, geboren 1963, studierte einige Semester Anglistik, Psychologie und Psychopathologie und übte verschiedene Berufe aus, u.a. in Paris und New York. Er lebt in der Schweiz. Seit 1990 arbeitet er als freier Autor. Er schrieb mehr als ein Dutzend Hörspiele. Seit seinem Romandebüt »Agnes« 1998 erschienen sechs weitere Romane, fünf Erzählungssammlungen und ein Band mit Theaterstücken, zuletzt die Romane »Weit über das Land«, »Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt« sowie die Erzählung »Marcia aus Vermont«. Unter dem Titel »Die Vertreibung aus dem Paradies« erschienen seine Bamberger Poetikvorlesungen. »Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt« wurde ausgezeichnet mit dem Schweizer Buchpreis 2018.
Inhalt
Das Archiv der Gefühle
Das Archiv der Gefühle
Früher am Tag hat es ein wenig geregnet, jetzt ist der Himmel nur noch teilweise bewölkt mit kleinen, kräftigen Wolken, deren Ränder weiß leuchten im Sonnenlicht. Von hier aus ist die Sonne schon nicht mehr zu sehen, sie ist hinter der bewaldeten Hügelkette verschwunden, und es ist spürbar kühler geworden. Der Fluss führt viel Wasser, an den Schwellen bildet sich weißer Schaum, es ist mir, als könne ich die Energie spüren, die im bewegten Wasser steckt, als fließe sie durch mich hindurch, ein kräftiger, belebender Strom. Hundert Meter flussaufwärts, wo das Wasser über das Wehr stürzt, weicht das gurgelnde Geräusch einem lauten, vollen Rauschen. Das Wort Rauschen trifft es nicht, es ist viel zu ungenau in seinen vielen Bedeutungen und Anwendungen, alles rauscht, der Fluss, der Regen, der Wind. Der Äther rauscht. Ich muss eine Akte zum Thema Geräusche des Wassers anlegen, ich frage mich, wo in der Systematik sie hingehört, Natur, Physik, vielleicht sogar Musik? Geräusche, Gerüche, Lichtphänomene, Farben, so vieles fehlt noch in meinem Archiv, so viel Unbeschriebenes, Unerfasstes, Unerfassbares.
Ich bin den Pfad entlanggegangen, der den Fluss hochführt ins Tal hinein. Franziska hat sich zu mir gesellt, ich weiß nicht, woher sie gekommen ist, vielleicht wurde sie vom Wasser angezogen, wie es uns beide immer schon angezogen hat. Plötzlich geht sie neben mir. Sie sagt nichts, lächelt mich nur an, als ich zu ihr hinüberschaue, dieses verschmitzte Lächeln, das ich nie ganz deuten konnte und vielleicht deshalb so sehr liebe an ihr. Sie nickt mir zu, als wolle sie mich ermuntern, irgendetwas zu tun, zu sagen. Das Haar ist ihr dabei ins Gesicht gefallen, sie streicht es zurück. Ich möchte meine Hand auf ihren Nacken legen, ihren Nacken küssen. Ich liebe dich, sage ich. Ich will ihre Hand fassen, aber ich greife ins Leere.
Manchmal taucht sie so unvermittelt auf, ohne dass ich an sie gedacht habe, leistet mir ein wenig Gesellschaft und verschwindet dann, wie sie gekommen ist, und ich bin wieder allein.
Wie lange bin ich schon gegangen? Eine halbe Stunde, eine Stunde? Vor mir läuft ein schwarzer Käfer über den Weg, und ich stehe still und beobachte ihn. Was für ein Käfer ist das? Es gibt Hunderttausende von Insektenarten, und ich kenne kein Dutzend davon, Marienkäfer, Mai- und Junikäfer, Wanzen, Asseln, Tausendfüßler, Heuschrecken, Bienen und Hummeln, Ameisen, was weiß ich. So vieles fehlt mir noch.
Die matten Farben jetzt im Frühjahr, in denen sich schon die kräftigeren des Sommers ankündigen, der leichte Wind, der nicht kalt ist, aber auch noch nicht warm und mich erschauern lässt, nicht frieren, eine Wahrnehmung nur an der Oberfläche.
Ich habe die Fußgängerbrücke genommen und bin auf der anderen Seite des Flusses zurückgegangen. Der Weg ist etwas breiter hier, aber weniger begangen, an manchen Stellen ist die Erde aufgeweicht, Pfützen haben sich gebildet, in denen sich die Hochspannungsleitung und die Wolken spiegeln. Als ich mich dem Stadtrand nähere, werden die Geräusche wieder lauter.
Der namenlose Weg, auf dem ich gehe, die Schrebergärten, einige schon vorbereitet für die Frühlingsbepflanzung, andere noch im Winterschlaf und einige ganz verwahrlost, vermutlich seit Jahren nicht bestellt, dahinter die Bahnlinie und etwas weiter entfernt die Autobahn. Das Rauschen des Flusses, das Rauschen der Autos, der Lkws, ein hohes Sirren und dann noch ein anderes Rauschen, das metallisch klingt und pulsiert, ein Zug, der vorüberfährt. Wie soll das alles beschrieben, wie festgehalten werden?
Das Gehen hat mich müde gemacht, ich bin es nicht mehr gewohnt und habe mich unterhalb des Wehrs auf eine Holzbank gesetzt. Ich sitze am Fluss und bin überwältigt von der Fülle der Eindrücke, die auf mich einströmen. Es ist dieses Gefühl der Klarheit und Durchlässigkeit, das sich einstellt, wenn man nach einer langen Krankheit zum ersten Mal wieder das Haus verlässt, etwas geschwächt noch, nüchtern und mit geschärften Sinnen. Ich schließe die Augen, das Rauschen wird lauter, der Fluss führt mehr Wasser, fließt schneller, er ist ockergelb. Es regnet nur noch ganz leicht, schließlich hört es auf. Ich fröstle, ich trage nur Badehosen und habe ein Handtuch um die Schultern geschlungen. Die Kälte lässt mich meinen Körper deutlicher spüren als sonst, alles ist sehr klar und oberflächlich. Ich empfinde ein Glück, das sich wie Unglück anfühlt.
Ich muss an Franziska denken, die jetzt bestimmt daheim ist und Hausaufgaben macht oder einen Kuchen bäckt oder tut, was Mädchen eben tun. Wir teilen uns ein Stück des Schulwegs. An der großen Kreuzung, wo unsere Wege sich trennen, stehen wir oft lange und reden. Worüber haben wir uns damals nur immer unterhalten? Der Gesprächsstoff schien uns nie auszugehen. Dann schaut einer von uns auf die Uhr und merkt, wie spät es schon ist, und dass unsere Mütter mit dem Mittagessen auf uns warten. Ein Lachen, ein hastiger Abschied.
Der Weg nach Hause, in Gedanken noch immer bei Franziska, ihre Stimme, ihr Lachen im Ohr, die Dinge, die sie sagt, und jene, die sie nicht sagt. Dann das Quietschen des Gartentors, das Knirschen des Kieses in der mittäglichen Stille. Das Rauschen des Dunstabzugs, die Gerüche, die aus der Küche dringen, durch das geöffnete Fenster ist das Zeitzeichen zu hören, die Mittagsnachrichten, die Stimme der Mutter, das Klappern eines Topfes im Spülbecken.
Wenn am Nachmittag keine Schule war und ich herumstreunte, dachte ich oft an Franziska. Ich dachte nicht an sie, sie war einfach da, ging neben mir durch den Wald, beobachtete mich bei allem, was ich tat, saß mit mir am Fluss und warf Steine ins Wasser wie ich. Sie kitzelt mich mit einem Grashalm im Nacken, es ist wie eine scheue Liebkosung. Hast du gewusst, dass man sich selbst nicht kitzeln kann?, sagt sie und fährt sich mit dem Grashalm über das Gesicht und lächelt mich an.
War ich verliebt in Franziska? Dauernd hieß es in der Klasse, der ist in die verliebt oder die in jenen, die beiden gehen miteinander, aber was bedeutete das? Meine Gefühle waren viel größer, viel verwirrender als diese kindischen Pärchenspiele, die ebenso schnell zu Ende gingen, wie sie begonnen hatten. Meine Gefühle für Franziska überwältigten mich, wenn ich mit ihr zusammen war, kam es mir vor, als befände ich mich in der Mitte der Welt, als gäbe es nur uns beide und diesen Moment und nichts und niemanden sonst, keine Schule, keine Eltern, keine Kameraden. Aber Franziska liebte mich nicht.
Ich habe das Haus den Winter über kaum verlassen, eigentlich habe ich es seit Jahren immer seltener verlassen, seit mir die Stelle gekündigt wurde, seit der Trennung von Anita, die keine wirkliche Trennung war. Ich habe Anita aufgegeben wie so vieles in den vergangenen Jahren, und damit vielleicht meine letzte Chance, ein normales Leben zu führen, ein Leben, wie es von einem erwartet wird. Aber niemand erwartet noch etwas von mir, ich selbst am allerwenigsten, und so habe ich mich nach und nach immer mehr zurückgezogen. An manchen Tagen bin ich nur im Freien, wenn ich zum Briefkasten gehe oder in den Garten, um frische Luft zu schnappen. Ein- oder zweimal die Woche kaufe ich im kleinen Lebensmittelgeschäft hier im Viertel ein, kurz vor Ladenschluss, wenn selten andere Kunden da sind. Dort beschaffe ich mir das Wenige, was ich brauche, und bin jedes Mal dankbar, wenn der Ladenbesitzer mich grüßt, als sehe er mich zum ersten Mal. Was ich im Laden nicht kriege, bestelle ich aus Katalogen oder im Internet, ich liebe die menschenleere zweidimensionale Welt der Onlineshops, die sterilen Produktbilder auf weißem Grund, Vorderansicht, Rückansicht, Seitenansicht, Zubehör, technische Daten, ihr Einkaufswagen.
Ich gehe zur Bank, wenn mir das Bargeld ausgeht, zum Friseur, wenn meine Haare sich gar nicht mehr bändigen lassen. Wann ich zum letzten Mal bei einem Arzt war, weiß ich nicht, aber es ist lange her.
Die meiste Zeit verbringe ich damit, die Zeitungen und Zeitschriften durchzuarbeiten, die ich abonniert habe, die relevanten Artikel auszuschneiden und aufzukleben, zu codieren und in die entsprechenden Akten einzuordnen, die Arbeit, für die ich früher bezahlt wurde und die ich seit meiner Entlassung für mich alleine weiterführe, weil ich nicht weiß, wie ich sonst meine Zeit verbringen soll. Auch wenn alle sagen, das Archiv werde nicht mehr gebraucht, es sei ein Anachronismus in Zeiten der Datenbanken und der Volltextsuche. Warum taten sich meine Chefs dann so schwer damit, mir das Archiv zu überlassen? Die Entscheidung, alles wegzuwerfen, war schnell getroffen von irgendeinem Geschäftsleitungsmitglied, einem jener dynamischen Typen, die Leute wie ich nur bei der jährlichen Weihnachtsfeier aus der Ferne zu sehen bekamen. Aber als ich vorschlug, das ganze Archiv inklusive des fahrbaren Regalsystems zu übernehmen und in meinem Keller unterzubringen, wurde die Geschäftsleitung misstrauisch und rang wochenlang mit der Entscheidung. Mein direkter Vorgesetzter brachte alle möglichen Einwände vor, das sei doch viel zu teuer, ob mein Haus überhaupt das Gewicht der Akten aushalte, ob die Feuerwehr es erlaube, eine so große Menge Papier in einem Privathaus zu lagern? Ich hatte Geld genug und versprach, für die Kosten des Umzugs aufzukommen. Mein Keller war groß und hatte betonierte Böden, die das Gewicht problemlos tragen konnten. Bei der Feuerwehr schien man gar nicht zu verstehen, was die Bedenken waren. Wenn Sie wüssten, was die Leute alles in ihren Kellern und auf ihren Dachböden lagern, sagte der Mann am Telefon und lachte. Sein Lachen hatte einen unangenehmen Unterton, als teile er ein schmutziges Geheimnis mit mir.
Selbst nachdem ich vor meinem Chef alle Einwände entkräftet hatte, dauerte es noch einmal Wochen, bis man sich endlich dazu durchgerungen hatte, das Papierarchiv in meine Hände zu geben. Es wurde ein komplizierter Vertrag ausgearbeitet, in dem es um Urheberrechte und um den Persönlichkeitsschutz ging und in dem geregelt wurde, dass ich das Archiv weder zu kommerziellen Zwecken nutzen noch weiterveräußern dürfe. Ich las den Vertrag mehrmals Wort für Wort durch, ich habe Verträge immer gemocht, die winzige Schrift, das dünne Papier, die Struktur der Paragraphen und diese seltsam umständliche Sprache, die jede Eventualität erfassen soll. Es war mir manchmal, als fingen Dinge erst an zu existieren, wenn sie in einem Vertrag geregelt waren, eine Ehe, ein Arbeitsverhältnis, ein Hauskauf, eine Erbschaft.
Die Unterzeichnung des Schriftstücks war die einzige Gelegenheit, bei der ich dem zuständigen Mann aus der Geschäftsleitung begegnete, und ich sah ihm an, dass er mich für einen Spinner hielt, was mich in meinem Vorhaben nur noch mehr bestärkte.
Diese Leute haben den wahren Zweck des Archivs nie begriffen, sie haben nur die Kosten gesehen und sie durch die Anzahl der Rechercheaufträge geteilt und gemerkt, dass es sich nicht auszahlt. Aber was zahlt sich schon aus? Das Archiv verweist nicht nur auf die Welt, es ist ein Abbild der Welt, eine Welt für sich. Und im Gegensatz zur realen Welt hat es eine Ordnung, alles hat seinen festgelegten Platz und kann mit etwas Übung jederzeit schnell gefunden werden. Das ist der wahre Zweck des Archivs. Da zu sein und Ordnung zu schaffen.
Der Einbau der Rollregale in meinem Keller wurde durch eine spezialisierte Firma ausgeführt, die den Boden aufmeißelte und die Schienen verlegte. Der ohrenbetäubende Lärm des Presslufthammers erfüllte das Haus, der Staub drang bis herauf in die Wohnräume, ein feiner Nebel, in dem die Strahlen des Sonnenlichts hervortraten, das weiße Licht des Aufbruchs.
Dann kam endlich der große Tag, an dem ein Laster vor meinem Haus hielt und Packer stöhnend und fluchend die Kisten mit Akten in meinen Keller schleppten. Ich erschrak ein wenig, als ich sah, wie viele Kisten es waren, wie viel Material, das nun mir gehörte und für das ich die Verantwortung trug. Die Aufregung des Umbaus und des Umzugs war so groß, dass ich erst einmal ein paar Tage brauchte, um wieder zu mir zu kommen. Das Einräumen der Akten war dann wie ein langsamer Heilungsprozess, die Ordnung wiederherzustellen und schließlich alles an seinem Platz zu wissen.
Es ist jedes Mal eine Freude, die richtige Stelle für ein Ereignis zu finden. Eine Naturkatastrophe, die Scheidung einer prominenten Persönlichkeit, ein öffentliches Bauprojekt, ein Flugzeugabsturz, die gegenwärtigen Umstände, es gibt nichts, wofür es im System nicht einen Platz gäbe, wofür nicht ein Platz geschaffen werden könnte. Und indem etwas eingeordnet wird in die Hierarchie der Themen, wird es verstehbar und beherrschbar. Wenn alles wie im Internet gleichwertig ist, hat nichts mehr einen Wert.
Die Akten zu aktuellen Ereignissen, die oft täglich ergänzt werden und anwachsen, liegen auf dem Schreibtisch oder auf dem Boden meines Büros, die anderen verstaue ich in den Rollregalen im Keller, bis ein Thema wieder an die Oberfläche kommt und damit auch die Akte dazu.
Das Archiv nachzuführen bedeutet viel Arbeit und erfordert große Sorgfalt. Ein falsch klassierter Artikel ist so gut wie verloren. Bestimmt gibt es Hunderte solcher verwaister Texte, die in der falschen Mappe liegen. Irgendwann, habe ich mir vorgenommen, werde ich alle Akten durchgehen, um sie zu suchen und am richtigen Ort einzuordnen, aber selbst im Sommer, wenn die Zeitungen dünn sind und wenig Relevantes publizieren, reicht die Zeit dafür nicht aus.
Die viele Arbeit mag ein Grund sein, weshalb ich das Haus mit den Jahren immer seltener verlassen habe, und je weniger ich es tat, desto mehr Überwindung und Kraft kostete es mich. Nach meiner Entlassung war es wohl erst Scham, die mich davon abhielt, in die Öffentlichkeit zu gehen. Ich wollte nicht zu den verlorenen Männern gehören, denen man von weitem ansieht, dass sie nicht mehr gebraucht werden, also blieb ich zu Hause und tat meine Arbeit für mich. Mit der Zeit gewöhnte ich mich an dieses einsame Leben, und inzwischen fühle ich mich am wohlsten in meinen eigenen vier Wänden, im Haus, in dem ich aufgewachsen und in das ich nach dem Tod meiner Mutter wieder gezogen bin. Wenn ich draußen bin, fühle ich mich unsicher und befangen, zu Hause bin ich abgeschirmt vom Durcheinander der sich dauernd verändernden Welt, das mich stört in meinen Gedanken und Erinnerungen, in meinen täglichen Routinen.
Ich stehe jeden Morgen um halb sieben auf, dusche, lese die Daten meiner kleinen Wetterstation ab und trage sie ein im Heft, in dem schon mein Vater jeden Tag Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit eintrug. Ich koche Kaffee und arbeite in meinem Büro bis um zwölf. Zu Mittag esse ich meist nur ein Sandwich und höre dabei die Mittagsnachrichten im Radio. Ich lege mich für eine halbe Stunde hin und bin spätestens um halb zwei wieder am Schreibtisch, wo ich bis um sechs weiterarbeite. Abends koche ich einfache Dinge, die ich schon immer gekocht habe, die schon meine Mutter gekocht hat. Nach dem Abendessen öffne ich eine Flasche Rotwein, nehme mir ein Buch aus dem Regal und lese, bis die Flasche leer ist und ich müde genug bin, um zu schlafen. Früher habe ich oft Musik gehört, aber sie machte mich sentimental, und das war mir unangenehm. Selbst bei den Schlagern von Fabienne kamen mir manchmal fast die Tränen.
Ist das wahr? Franziska lacht. Lach mich nur aus. Ich weiß schon, es ist kindisch, aber wenn du von einem Geliebten singst, dann stelle ich mir vor, ich sei es, nach dem du dich sehnst. Da bist du nicht der Einzige, sagt sie und runzelt die Stirn. Aber ich wollte das nicht mehr, sage ich, also fing ich an, Musik zu meiden. Inzwischen liebe ich die Stille im Haus, die nur vom Summen des Kühlschranks, einem tropfenden Hahn, leisen Geräuschen von der Straße oder von irgendwoher durchbrochen wird. Ich mag die Vorstellung, wie meine Stimme durch dein Haus weht, sagt Franziska, sie kommt von draußen, es ist Frühling, jemand lässt ein Radio laufen, vielleicht ist es ein Nachbar, vielleicht ein Bauarbeiter auf einem Gerüst, und ich singe von der Liebe, und du kriegst feuchte Augen. Sie lacht. Ich habe das Radio eingeschaltet. Das Zeitzeichen ertönt, wurde das nicht längst abgeschafft? Es ist zwölf Uhr, null Minuten. Es folgen die Mittagsnachrichten.
Alle meine Tage verlaufen gleich, seien es Werk-, Sonn- oder Feiertage. Selbst meinen Geburtstag würde ich wohl vergessen, wenn nicht der oder jene mir ein Kärtchen schicken würden mit der Aufforderung, mich doch wieder einmal zu melden. Aber ich melde mich bei niemandem, ich wüsste nicht, was ich mit den Leuten reden sollte. Es geschieht ja nichts in meinem Leben, und Meinungen auszutauschen hat mich nie interessiert. Wen kümmert es, was ich von diesem oder jenem Politiker halte, wie ich die Situation in meinem Land oder in meiner Stadt einschätze, ob ich für oder gegen die Abschaltung von Atomkraftwerken bin. Meinungen haben nichts mit Fakten zu tun, nur mit Gefühlen, und meine Gefühle gehen niemanden etwas an. Meine Aufgabe ist das Sammeln und Ordnen. Das Interpretieren der Welt sollen andere übernehmen.
Mag sein, dass ich mir irgendwann ein anderes Leben für mich ausgemalt hatte, dass ein anderes Leben für mich möglich gewesen wäre. Ich war ja nicht immer ein Einsiedler, meine Versuche, ein normales Leben zu führen, sind einfach gescheitert, das kann passieren, und niemand ist schuld daran. Inzwischen lebe ich lieber mit meinen Erinnerungen, als dass ich neue Erfahrungen mache, die schlussendlich doch zu nichts anderem führen als zu Schmerz. Ich habe mir mein Leben nicht ausgesucht, es hat sich so ergeben aufgrund meiner Anlagen und zufälliger Begegnungen und Ereignisse. Vielleicht hätten andere Beziehungen etwas verändert, eine andere Arbeitsstelle, Kinder.
Es kommt vor, dass ich mich frage, warum alles so gekommen ist, wann es sich entschieden hat, wie ich leben würde, aber es hat keinen Sinn, sich das zu fragen. Ich hadere nicht mit meinem Schicksal. Vielleicht waren die entscheidenden Dinge gar nicht jene, die geschehen, sondern jene, die nicht geschehen sind. Den Rest erledigte die Zeit, die immer weiterlief und Kleines zu Großem machte, Zufälliges zu Unveränderbarem. Das Leben, das ich führe, ist nur eines von vielen möglichen, so wie diese Welt nur eine von vielen möglichen ist.
Ich habe keine sehr deutlichen Erinnerungen an meine Kindheit. Ich habe keinen Grund, sie nicht für glücklich zu halten, aber wenn ich über die Gefühle nachdenke, zwischen denen ich damals schwankte, waren es weniger Glück und Unglück als Ruhe und Unruhe, Sicherheit und Verunsicherung, Geborgenheit und Einsamkeit. Am deutlichsten in Erinnerung ist mir ein fast permanentes Gefühl der Verwunderung über die Dinge der Welt und die Gesetze, die sie lenkten. Ich verirrte mich nicht nur auf meinen Wegen, auch aus meinen Gedanken fand ich oft kaum mehr heraus, und ich verbrachte viel Zeit damit, nach Ordnung zu suchen oder sie herzustellen, wo immer ich konnte. Ich erstellte Listen von allen möglichen Dingen, von Lieblingsbüchern und Lieblingsfilmen, von Leibspeisen, von Freunden und Feinden, von Fragen und Argumenten, nur um einen Überblick zu haben in einer Welt, die mich verwirrte, die ich nicht begriff. Aber all das schuf wenig Klarheit, je ausgeklügelter meine Gedankensysteme wurden, desto mehr merkte ich, dass sie nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun hatten, und allmählich wich meine Verwunderung über die Welt der Angst vor ihrer Unberechenbarkeit.
Eine Kindheitserinnerung. Es ist der Tag vor Heiligabend. Auf dem Schulweg komme ich an einem brachliegenden Feld vorbei, auf dem im letzten Sommer Mais wuchs. Es ist früh morgens und noch dunkel, es ist kalt. Der Boden ist gefroren, und ich gehe quer über das Feld, stolpere über die Stoppeln und Furchen. Um die Straßenlaternen jenseits des Feldes haben sich in der nebligen Luft Halos gebildet, das orangefarbene Licht der Natriumdampflampen weist mir den Weg. Mitten im Acker finde ich eine halb abgebrannte weiße Kerze, vielleicht hat ein Kind, das wie ich über das Feld abkürzte, sie nach dem Laternenumzug vor ein paar Tagen hier weggeworfen oder verloren. Ich stelle die Kerze auf, drücke sie ein wenig im harten Boden fest, zünde sie an. Warum habe ich Streichhölzer dabei? Ich stehe da und betrachte die brennende Kerze, ein seltsames Ritual, dessen Sinn ich nicht begreife und das mir dennoch bedeutungsvoll erscheint, es ist ein fast religiöses Gefühl.
Wenn ich in meinem Leben an irgendetwas geglaubt habe, dann daran, dass alles einen Grund hat, auch wenn wir ihn in den seltensten Fällen erkennen, und daran, dass alles, was wir tun, von Bedeutung ist, auch wenn wir die Folgen nicht erahnen können.
Ich werde zu spät zum Unterricht kommen, ich werde keine Erklärung dafür haben. Mein Lehrer wird es hinnehmen, er weiß längst, dass es keinen Sinn hat, in mich zu dringen. Ich stehe da und schaue zu, wie die Kerze hinunterbrennt und erlischt.
Ich kann mich nicht erinnern, jemals getragen worden zu sein, das habe ich mir wohl auch gar nie gewünscht. Ich wollte schon früh auf eigenen Beinen stehen und in Ruhe gelassen werden. Vermutlich habe ich mir nie viel aus Menschen gemacht, ich erwartete nichts von ihnen und begriff schnell, dass sie mich am ehesten in Ruhe ließen, wenn ich ihre Erwartungen erfüllte und tat, was sie von mir erwarteten. Man konnte alles von mir verlangen, nur keine übermäßige Nähe. Selbst wenn ich jemanden mochte, meinen Lehrer, einen Mitschüler, einen Verwandten oder Freund meiner Eltern, tat ich das mehr in Gedanken, als sei es etwas Verbotenes, etwas Unrechtes, und achtete darauf, mich nicht zu verraten und womöglich Gefühle zu wecken, mit denen ich nicht hätte umgehen können. Niemand schien sich daran zu stören, vermutlich merkte meine Umgebung gar nichts davon. Mein einziger Vertrauter war ich selbst, und ich verhandelte mit mir wie mit einem anderen in einem dauernden stummen Zwiegespräch. Ich sprach nicht nur mit mir, ich spielte mir auch Szenen vor, ohne mir dessen wohl ganz bewusst zu sein. In meiner Phantasie konnte ich alles sein, was ich wollte, jede Aufgabe meistern, jeden Streit gewinnen, jeden Feind besiegen, jedes Mädchen gewinnen. Wenn die Welt nicht meinen Wünschen entsprach, dann veränderte ich sie eben in meiner Vorstellung und lebte mehr in dieser Phantasiewelt als in der wirklichen.
Äußerlich funktionierte ich, ich machte keine großen Probleme, war ein guter Schüler, zuverlässig und höflich und unkompliziert. Nur manchmal, selten, verlor ich die Kontrolle in einem Anfall von Wut oder Empörung oder Selbstmitleid und wütete und schrie und war nicht zu besänftigen, dass ich mich selbst kaum wiedererkannte. Dann drehte ich durch wie ein Motor, der ohne Widerstand läuft. Aber vermutlich war ich im Großen und Ganzen nicht seltsamer als andere Kinder, weil wir alle seltsam sind, wenn wir nur lange genug darüber nachdenken.
Eine Kindheitserinnerung. Wie alt war ich da? Ein kalter Sonntagmorgen, ich bin früh aufgewacht und gleich aufgestanden. Im Haus ist es ganz still. Draußen schneit es, der Wind bewegt die Flocken hin und her wie einen Vorhang vor einem geöffneten Fenster.
Ich bin im Freien, gehe die Straße entlang. Der Schnee schluckt alle Geräusche. Stiegen nicht dünne Rauchfahnen aus den Kaminen, man könnte meinen, sich in einer menschenleeren Welt zu befinden.