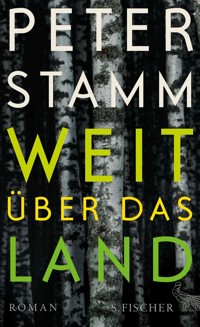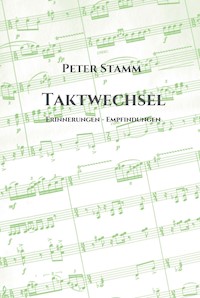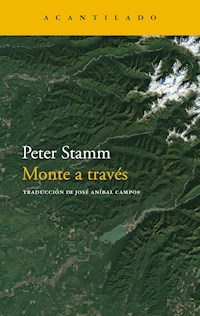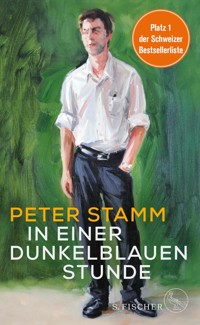
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»In einer dunkelblauen Stunde« - Das neue Buch von Peter Stamm: Ein Roman über einen Schriftsteller und die Geheimnisse seines Lebens Seit Tagen wartet die Dokumentarfilmerin Andrea mit ihrem Team auf Richard Wechsler in seinem Heimatort in der Schweiz. Bei ersten Aufnahmen in Paris hatte der bekannte Schriftsteller wenig von sich preisgeben wollen und nun droht der ganze Film zu scheitern. In den kleinen Straßen und Gassen des Ortes sucht Andrea entgegen der Absprache nach Spuren von Wechslers Leben. Doch erst als sie wieder seine Bücher liest, entdeckt sie einen Hinweis auf eine Jugendliebe, die noch immer in dem kleinen Ort leben könnte. Eine Jugendliebe, die sein ganzes Leben beeinflusst hat und von der nie jemand wusste.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Peter Stamm
In einer dunkelblauen Stunde
Roman
Über dieses Buch
»Und was wissen wir über Richard Wechsler? Wir wissen erstaunlich wenig über ihn, wenn man bedenkt, dass wir einen Film über ihn drehen.«
Über den bekannten Schweizer Schriftsteller Richard Wechsler soll ein Dokumentarfilm entstehen. Die Regisseurin Andrea und ihr Team müssen jedoch einsehen, dass es schwieriger wird, als sie es nach den ersten Drehtagen in Paris erwartet haben. Zu den vereinbarten Terminen taucht Wechsler nicht mehr auf, der Film droht zu scheitern, und doch wird Wechslers Geschichte Andrea über Jahre nicht loslassen. Mit »In einer dunkelblauen Stunde« hat Peter Stamm einen virtuosen Roman über einen Schriftsteller und die Geheimnisse seines Lebens geschrieben.
»Erstaunlich, wie subversiv Stamm die Literatur und das Leben behandelt« Tim Parks, New York Review of Books
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Peter Stamm, geboren 1963, lebt in der Schweiz. Seit 1990 arbeitet er als freier Autor. Er schrieb mehr als ein Dutzend Hörspiele. Seit seinem Romandebüt »Agnes« 1998 erschienen sechs weitere Romane, fünf Erzählungssammlungen und ein Band mit Theaterstücken, zuletzt die Romane »Weit über das Land«, »Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt« und »Das Archiv der Gefühle« sowie die Erzählung »Marcia aus Vermont«. »Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt« wurde ausgezeichnet mit dem Schweizer Buchpreis 2018.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
I know not what tomorrow will bring …
Fernando Pessoa
I
Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir bleibt, sagt Wechsler, aber wer weiß das schon? Es gab Momente, in denen mir das Ende näher schien als jetzt.
Er steht am Ufer der Seine, der Himmel ist bedeckt, ein paar Tauben fliegen vorüber. Wechsler macht eine unbestimmte Handbewegung, als wolle er den Gedanken verscheuchen. Im Hintergrund ist ein Touristenschiff zu sehen, das mit überraschend hoher Geschwindigkeit vorüberfährt. Wechsler dreht sich von der Kamera weg, schaut auf den Fluss, zuckt mit den Schultern.
Damit könnten wir doch anfangen.
Das war, nachdem er uns von jenem Unfall in den Bergen erzählt hat, nicht wahr?, sagt Tom. Er sitzt auf dem Bett und liest etwas.
Was liest du da? Es war kein Unfall. Nur beinah.
Für Wechsler war das ein Schlüsselmoment.
Sollen wir mit ihm in die Berge fahren und filmen, wie er da herumstolpert und sich erinnert? Wenn er überhaupt kommt. Die Geschichte haben wir doch schon. Thomas.
Seit kurzem will er, dass ich ihn Thomas nenne. Warum will jemand, der vierzig Jahre lang Tom gewesen ist, plötzlich Thomas sein? Ich springe zurück.
Es wäre schön, wenn wir die Aufnahme in den Bergen machen könnten, sagt Tom. Berge sind immer schön. Paris, das Dorf, die Berge.
Vermutlich wird die Geschichte mit jedem Mal erzählen etwas dramatischer. Was liest du da?
Den Hotelprospekt. Eine kleine Entdeckungsreise durch unser Hotel, umgeben von einer abwechslungsreichen Landschaft in einem verträumten Weinbauerndorf. Eine hochstehende Gastronomielandschaft, die für jeden Gaumen etwas Passendes bereithält. Bei uns lassen sich Arbeit und Vergnügen bestens verbinden. Nichtraucherzimmer, freier Internetzugang, ein Eldorado für jeden Geschäftsmann.
Und für die Geschäftsfrau?
Da ist es. Ich schalte auf normale Geschwindigkeit.
… hatte mich im Weg geirrt, sagt Wechsler, aber statt zurückzugehen … ich habe es immer gehasst, Wege zurückzugehen. Das Gelände wurde steiler und steiler, alles rutschte, es kam mir vor, als sei die ganze Welt in Bewegung, nichts mehr fest. Und dann waren da plötzlich Felsen. Da habe ich gedacht, jetzt … dass ich sterblich bin, wurde mir da erst so richtig … habe ich da erst begriffen.
Er hat die unangenehme Angewohnheit, Sätze nicht zu Ende zu sprechen. Man weiß zwar, was er meint, aber er sagt es nicht. Wir können keinen Film aus lauter angefangenen Sätzen machen.
Ich drücke auf schnellen Vorlauf.
… wer weiß das schon, sagt Wechsler. Es gab Momente, in denen mir das Ende näher schien als jetzt.
Wir könnten das auch ganz an den Schluss nehmen, sagt Tom. Quasi als Ausblick. Der Film ist zu Ende, aber das Leben geht weiter. Und dann verschwindet er in den Sonnenuntergang, da an dem kleinen See. So endet doch eines seiner Bücher.
Das war am Meer, sage ich. Ich möchte mein eigenes Zimmer.
Ich gehe spazieren, sagt Tom. Thomas.
Thomas? Ich muss grinsen, wenn ich ihn so nenne.
Andrea?, sagt er und hebt die Augenbrauen. Er bewegt sich mit einem Ächzen vom Bett herunter und zieht die Schuhe an.
Warum haben deine Schuhe keine Schnürsenkel? Und warum fällt mir das jetzt erst auf?
Die kommen aus Japan.
Und Japaner können keine Schuhe binden? Ach was! Ich müsste auch mal an die frische Luft. Ich drehe hier noch durch.
Tom ist den ganzen Nachmittag nicht zurückgekommen. Ich hätte auch Lust gehabt spazieren zu gehen, aber wir sind nicht zum Vergnügen hier, wir haben nur so und so viele Drehtage. Schon in Paris haben wir das Budget arg strapaziert, die Hotelzimmer, das Essen. Auch wenn wir im Moment nicht viel machen können, wenigstens da sein sollten wir, Präsenz markieren. Das ist so ein Wechsler-Wort: Präsenz. Heute sollte er kommen, ich bin zum Bahnhof gegangen, um ihn abzuholen, aber er war nicht im verabredeten Zug. Vielleicht hat er sich um einen Tag vertan.
Ruf ihn doch an, hat Tom gesagt.
Er hat kein Handy.
Natürlich hat er ein Handy, ich habe es selbst gesehen.
Jedenfalls hat er uns seine Nummer nicht gegeben. Ich schreibe ihm eine Mail.
Ich habe ihm eine Mail geschrieben. Das war vor dem Mittag, bis jetzt hat er sich nicht gemeldet. Ich habe noch gar nichts gegessen heute.
Ich nehme ein Blatt Papier und schreibe darauf: Kindheit, Berge, Wasser, Paris, Frauen. Und dann noch: Bücher. Wer ist die Frau?, schreibe ich. Ich zerknülle das Blatt und werfe es in den Papierkorb.
Ich spiele mit dem Material herum, füge ein paar Aufnahmen zu einem kleinen Video zusammen. Wechsler geht. Er geht über den Friedhof Montparnasse, er geht einen breiten Boulevard entlang, er geht durch den Jardin du Luxembourg. Er geht einen anderen Boulevard hinunter, er spaziert am Ufer der Seine, schaut sich die Auslagen der Bouquinisten an, zieht ein Buch aus einer der Kisten, einen Fotoband, blättert darin, bezahlt. Er geht durch eine schmale Straße, die Kamera ist ihm dicht auf den Fersen. Er kommt auf die Kamera zu, macht etwas mit der Hand im Gesicht, das sieht hübsch aus. Obwohl er immer so weltfremd tut, weiß er schon ziemlich gut, wie er vor der Kamera Wirkung erzeugen kann. Er geht an der Kamera vorbei. Ich könnte einen zweistündigen Film darüber machen, wie Wechsler durch Paris spaziert. Er betritt eine Bäckerei, kommt wieder heraus, sagt etwas und lacht. Da hat er Croissants für uns alle gekauft. Manchmal kann er ganz nett sein.
Mir ist etwas aufgefallen, ohne dass ich recht weiß, was es ist. Dass irgendetwas ungewöhnlich ist. Ich schaue mir die Aufnahmen noch einmal an. Jetzt sehe ich, dass im Hintergrund einmal auf dem Friedhof, einmal auf dem Boulevard, dieselbe Frau zu sehen ist. Sie ist zu weit weg und in der Unschärfe, ich kann ihr Gesicht nicht erkennen, aber sie trägt einen hellgrünen Regenmantel, und davon gibt es nicht viele. Auch wie sie sich bewegt, irgendwie hüpfend, ist unverkennbar, es muss dieselbe Frau sein. Vielleicht ist es Zufall, aber die Aufnahmen entstanden in einigem zeitlichen Abstand. Seltsam. Auch so ein Wort, das Wechsler dauernd benutzt: Seltsam.
Wo Tom nur bleibt?
An dem Tag hatte sich etwas verändert, da ist etwas geschehen, ich weiß nicht genau was, aber nichts Gutes. Es war am letzten Drehtag in Paris, wir hatten uns wie immer in jenem Café an der Rue du Bac getroffen, dem Café Les Mouettes. Ich kenne keinen Ort auf der Welt, an dem man weniger mit Möwen rechnen würde als dort. Vielleicht noch in der Wüste Gobi oder am Südpol. Erst hatten wir gedacht, es sei Wechslers Stammlokal, aber dann stellte sich heraus, dass er es zufällig ausgewählt hatte und nie vorher dort gewesen war. Ich glaube, er wollte uns auf neutralem Grund begegnen. Oder uns auf eine falsche Fährte locken. Es könnte mein Stammlokal sein, sagte er, wenn ich eines hätte.
Bei unserem ersten Treffen im Café Les Mouettes hatte er uns auf ein unscheinbares Tor hingewiesen, das in einen Hof führte und zur Chapelle de l’Epiphanie der Missions Etrangères. Von hier aus seien Tausende Missionare in die ganze Welt geschickt worden, um die Heiden … Er bemerkte den Nespresso-Shop gleich daneben, lachte. Das sind die neuen Missionare. Kaffee für alle, die Epiphanie des Geschmacks.
An jenem Tag gegen Ende des Drehs merkte ich gleich, dass Wechsler schlechte Laune hatte, dass ihn etwas irritierte. Früher Nachmittag, Durchhänger, typisch. Es gab ein Gefummel mit dem Mikrophon, Wechsler war ungeduldig, auch wenn er es zu verbergen suchte. Er versucht ja immer, alles zu verbergen. Diesmal sollte Tom das Gespräch führen.
Diese namenlosen Erzähler in Ihren Büchern, sind das Sie?
Ich hatte ihm eingebläut, diese Frage nie zu stellen, vermutlich war es deshalb das Erste, was er wissen wollte, das Einzige, woran er sich erinnern konnte.
Das bin nicht ich, sagt Wechsler zu Tom, das sind Sie, haben Sie das denn gar nicht gemerkt?
Ich musste lachen über Toms verdutzten Gesichtsausdruck. Zum Glück hört man das nicht auf der Tonspur. Da hat Wechsler noch gelächelt.
Reden wir über Frauen, sagt Tom jetzt aus dem Off. In Ihren Büchern spielen sie eine wichtige Rolle, trotzdem waren Sie nie verheiratet.
Wechslers Gesicht wirkt wie eingefroren, er blickt starr in die Kamera. Ich war mir kurz nicht sicher, das weiß ich noch, ob er die Frage überhaupt gehört hatte oder ob er in Gedanken anderswo war. Dann sagt er ganz langsam und mit müder Stimme, als müsse er einem begriffsstutzigen Kind etwas erklären, worüber soll ich denn sonst schreiben? Über Kaninchen? Tom lacht gequält. Er hatte mir am Abend vorher seine Theorie über Wechsler und die Frauen dargelegt, ein kompliziertes Gedankengebäude, in dem es um Begehren und Verführung ging, um Narzissmus und auch um Wechslers Mutter, wenn ich mich nicht irre oder um seinen Vater. Und er hatte auch eine Theorie über konfrontierende Kommunikation, die er offenbar gerade ausprobierte. Jetzt scheint er nicht weiterzuwissen, jedenfalls ist es lange still.
Ist es Ihnen wichtiger zu lieben oder geliebt zu werden?, fragt er schließlich. Was ist das denn für eine Frage?
Was ist das für eine Frage!, sagt Wechsler. Geht es in diesem Film um Literatur oder um Bettgeschichten? Ich schreibe über Frauen und Männer, weil unsere Welt nun mal von Frauen und Männern bewohnt wird. Er steht auf, ich versuche, ihm mit der Kamera zu folgen. Er verlässt das Café.
Die Kamera bleibt auf der Tür stehen, schwankt ein wenig, man sieht Wechsler draußen vor dem Café, er zündet sich eine Zigarette an, Leute gehen vorbei, etwas Grünes, ist das wieder die Frau mit dem Regenmantel? Der Verkehr auf der Straße, ein Bus, ein Fahrradkurier mit orangefarbener Jacke. Auf der Tonspur ist der Lärm der Autos zu hören und ganz leise Wechslers Stimme, er hat immer noch das Mikro am Kittel. Ich muss die Stelle zweimal laufen lassen, um die Worte zu verstehen: Das führt doch nirgendwo hin. Später hat er sich für sein Benehmen entschuldigt.
An dem Tag hatte ich mich zum ersten Mal gefragt, weshalb Wechsler überhaupt mitmachte bei unserem Projekt, wenn er doch nichts von sich preisgeben mochte. Schon bei einem unserer Vorgespräche hatte er Pessoa zitiert: Wenn ihr nach meinem Tode meine Biographie schreiben wollt, so ist nichts leichter als das. Sie hat nur zwei Daten – Geburt und Todestag. Alle Tage dazwischen gehören mir. Was hat er sich dann von unserem Film versprochen?
Um sechs taucht Tom wieder auf. Er klopft nicht mal an die Tür, bevor er reinkommt, aber ich habe keine Lust, ihn zu erziehen; das ist endgültig vorbei.
Ich habe den Metzger gefunden, sagt er.
Jetzt geh ich erst ein bisschen raus. Ich brauche auch mal frische Luft.
An der Tür drehe ich mich zu ihm um. Und, ist es dir wichtiger zu lieben oder geliebt zu werden?
Er schaut mich belämmert an.
Ich verstehe diesen Ort nicht. Ich finde mich nicht zurecht, obwohl das Zentrum beileibe nicht groß ist. Dauernd verlaufe ich mich und weiß nicht mehr, wo ich bin. Ich hätte schwören können, dass gegenüber des Hotels ein Supermarkt steht, jetzt ist da ein großer, fast leerer Parkplatz.
Überall gibt es Durchgänge, Fußwege, Verbindungsgassen, in denen man sich verirren kann. Ich habe mir ein paar Orte notiert, die Wechsler in den Gesprächen erwähnt hat, das Schulhaus, die Kirche, die Kneipe, in der er mit seinen Freunden verkehrte, auch die Adresse seines Elternhauses, das steht auf der anderen Seite der Bahnlinie. Ich frage mich, wie es sich anfühlen würde, wenn mir das alles vertraut wäre, diese Straßen, diese Häuser, die Menschen, ein Gewebe von Geschichten und Erinnerungen. Für mich ist es ein Ort wie jeder andere, nicht besonders schön, nicht besonders hässlich, nicht groß, aber auch nicht klein.
Als ich zum Bahnhof komme, fährt eben ein Güterzug vorbei. Ich muss die Wagen zählen, wie ich es schon als Kind immer getan habe. Dreizehn. Kann es sein, dass die Güterzüge früher länger waren? Oder kommt mir das nur so vor, wirken sie kürzer, weil ich größer geworden bin? Weil ich besser zählen kann?
Ich nehme die Unterführung und komme in eine Siedlung mit Einfamilienhäusern. Es ist erstaunlich kühl für die Jahreszeit, ich hätte einen Pullover anziehen sollen.
Nichts ist auffällig hier. Die Häuser scheinen aus den vierziger, fünfziger Jahren zu stammen, einige wenige sind Neubauten. Die Gärten wirken gepflegt. Kinder spielen auf der Straße. Wie es hier vor fünfzig Jahren wohl ausgesehen hat? Vermutlich nicht viel anders. Nur die Carports und Garagen, die inzwischen offenbar jedes Haus braucht, wirken neu. Damals hat vielleicht Wechsler auf der Straße gespielt, ist mit dem Fahrrad herumgefahren, hat auf dem Zaun gesessen und mit den Nachbarskindern geschwatzt. Ob da schon alles in ihm steckte? Die dunkle Erwartung des Schmerzes? Was wohl aus diesen Kindern hier einmal wird? Schreiner, Lehrerinnen, Buchhalter, Schriftstellerinnen. Plötzlich sind sie erwachsen und nichts ist mehr, wie es einmal war.
Ein Dorf brauchst du, hat Wechsler während eines der Gespräche jemanden zitiert, damit du nicht allein bist. In den Menschen, in den Pflanzen, in der Erde lebt ein Stück von dir, das, auch wenn du selbst nicht da bist, bleibt und auf dich wartet. Endlich Sätze, die er zu Ende sprach. Aber die waren halt nicht von ihm. Von wem war das noch mal? Und ob es stimmt? Lebt hier noch etwas von Wechsler? Oder lebt nicht viel eher etwas von hier in ihm?
Achtzehn, zwanzig, zweiundzwanzig, das Nächste muss das Haus sein, in dem er aufgewachsen ist. Eine Frau mittleren Alters steht am Gartentor, es wirkt, als warte sie auf jemanden. Vielleicht ist sie seine Schwester, seine Schwägerin. Hat er überhaupt Geschwister? Keine Ahnung. Ist das wichtig?
Ich überlege mir, ob ich die Frau ansprechen soll, aber noch bevor ich sie erreicht habe, dreht sie sich um und geht zurück ins Haus, als wollte sie sich vor mir verstecken. Der Name am Briefkasten sagt mir nichts.
Ich weiß nicht, ob wir Wechsler helfen wollten oder uns selbst, was seine Beweggründe waren und was unsere. Vielleicht spielt das auch gar keine Rolle. Irgendetwas muss man ja tun, um die Tage herumzubringen. Ein Grund hat viele Gründe, wer hat das gesagt? Wir hatten alle drei nicht viel zu Stande gebracht in den letzten Jahren, er einen Band mit kurzen Texten, die alle schon einmal erschienen waren, wir ein paar nie realisierte Projekte, für die wir Entwicklungsförderung gekriegt hatten, von der wir mehr schlecht als recht lebten, und ein paar Filmchen für ein Museum. Da lernten wir Wechsler auch kennen. Autorinnen und Autoren sagen etwas zu einem Kunstwerk aus der Sammlung. Er hatte ein Bild von Hopper ausgewählt, nein, stimmt nicht, von Vallotton. Wie komme ich auf Hopper?
Der Künstler ist der Liebhaber, der das Modell oder die Landschaft berührt und von ihnen berührt wird. Er feiert ihre Schönheit, das Bild ist eine Art Liebesakt. So was in der Art. Es gibt Künstlerinnen und Künstler, die fast verschwinden hinter ihrer Kunst, Félix Vallotton ist in seinen Bildern präsent wie wenige andere. Und doch wissen wir nicht viel über ihn.
Und was wissen wir über Richard Wechsler? Wir wissen erstaunlich wenig über ihn, wenn man bedenkt, dass wir einen Film über ihn drehen. Den Wikipedia-Artikel, ein paar Zeitungsinterviews. Bei einer Lesung waren wir, und seine Bücher haben wir gelesen, die meisten. Aber für einen Film braucht es auch nicht viel. Schöne Bilder.
Ich habe mir das Filmchen aus dem Museum noch einmal angeschaut, nach meiner Rückkehr ins Hotel. Wechsler liest alles ab, es klingt hölzern. Ich frage mich, ob er in seinen Werken präsent ist. Und in welcher Art? Der Liebhaber seiner Figuren? Das klingt ein bisschen, na ja. Pathetisch? Pornographisch? Pervers?
Große Kunst hinterlässt in uns Spuren, sagt Wechsler, die Bilder und Texte mögen in der Erinnerung verblassen oder sich verändern, aber was sie mit uns gemacht haben, bleibt. Die Narben. Ein seltsames Wort in diesem Zusammenhang. Was machen seine Texte mit mir? Ist er dafür verantwortlich? Ist das alles gewollt, oder bin ich nur ein zufälliges Opfer? Wie heißt es immer so schön? Ist meine Reaktion ein Kollateralschaden? Ich weiß nur noch, dass er als Mensch dieselbe Wirkung auf mich hatte wie seine Texte, aber vielleicht hatte das mehr mit mir selbst zu tun als mit ihm. Es fühlte sich an, als sei etwas zugleich ganz richtig und ganz falsch. Tom war ohnehin schon seit langem ein Fan, er hatte alle Bücher von Wechsler gelesen und sie mir dann untergejubelt. Ich hatte erst nur zwei oder drei gelesen, als Vorbereitung auf den Film dann natürlich die anderen auch, fast alle, die meisten. Ob die Bücher dasselbe mit Tom machten wie mit mir? Ich bezweifle es. Wenn wir über sie sprachen, hatte ich den Eindruck, wir hätten völlig verschiedene Geschichten gelesen.
Von wem kam die Idee, diesen Film zu machen? Ich glaube, es war Tom, der zuerst davon sprach, aber Wechsler hatte ihn, hatte uns an einen Punkt gebracht, an dem es nur noch darum ging, das auszusprechen, was uns schon allen klar war. Ich wollte ihn wiedersehen, das war mir sofort bewusst. Weil ich herausfinden musste, was dieses richtige Falsche, dieses falsche Richtige war. Gerade weil er uns so beiläufig behandelte. Höflich, aber beiläufig. Er war gar nicht wirklich da im Museum. Hätte er sich um uns bemüht, sich vor uns produziert, hätte ich wohl schnell das Interesse an ihm verloren und die Sache wäre erledigt gewesen, aber ich hatte den Eindruck, das alles gehe völlig an ihm vorbei, es könnte ihm nicht gleichgültiger sein. So blieb nach dem Dreh eine Leere zurück. Er saugt mich aus, das war eine der ersten Notizen, die ich mir machte. Er ist ein Vampir, der vom Blut anderer Menschen lebt. So ein Quatsch.
Dabei hat Wechsler uns einmal Menschenfresser genannt. Sie leben vom Herzblut der Menschen, die Sie sich einverleiben, hat er gesagt, ein höchst zweifelhaftes Metier. Darum ist es so wichtig, dass Sie es mit Liebe und mit Ehrlichkeit betreiben, mit Ehrlichkeit, aber auch mit Takt. Das sind Sie mir schuldig.
Tom denkt nicht über so was nach. Er ist im Grunde ein einfaches Gemüt. Ein freundlicher Mensch, der niemandem etwas zuleide tut, aber ein Simpel. Wenn alle Männer wie er wären, sähe die Welt anders aus, besser wohl, aber auch langweiliger. Tomcat habe ich ihn am Anfang manchmal genannt, das hat ihm gefallen, dabei hat er eher etwas von einem Hund. Ein treuer Gefährte, der alles mit sich machen lässt. Irgendwann hat er mich nur noch genervt. Und jetzt will er Thomas sein, das macht die Sache noch trauriger. Rex the Runt, Rex der Kümmerling, das waren doch diese Trickfilme mit den flachen Hunden. So sollte ich Tom nennen.
Es war peinlich, wie er sich während des Drehs benahm. Herr Wechsler hier, Herr Wechsler da. Stört das Mikrophon? Darf ich Ihnen ein Glas Wasser bringen? Ich habe nur darauf gewartet, dass er sich auf den Rücken legt und sich den Bauch kraulen lässt. Meine Beziehung zu Wechsler war von Anfang an anders, ein Kräftemessen. Wäre er zehn Jahre jünger, hätte er bestimmt versucht, mit mir zu flirten, jetzt deutete er es nur an, machte mir Komplimente, sagte, ich erinnere ihn an jemanden.
An eine Frau, die Sie mochten?
Noch eine Frage, die er nicht beantwortet hat. Vielleicht kann ich deshalb nicht von ihm lassen, weil er mir so viele Antworten schuldet. Was sind denn meine Gefühle für ihn? Er nervt, aber anders als Tom. Wie geht diese Redewendung? Er reicht mir den kleinen Finger … Nein, das passt hier nicht.
Willst du das verwenden?, fragt Tom.
Er ist hinter mich getreten, als ich mir den Museumsfilm noch einmal anschaue. Ich mag es nicht, wenn mir jemand über die Schulter schaut. Nicht, dass ich etwas zu verbergen hätte, ich mag es einfach nicht.
Natürlich nicht, ich schaue es mir nur an. Vielleicht bringt mich das auf eine Idee.
Das ist eine völlig andere Bildsprache.
Das weiß ich auch.
Er legt mir eine Hand auf die Schulter. Ich stehe auf und öffne das Fenster. Es hat zu regnen begonnen, der Regen klingt ein bisschen wie ferner Applaus. Ich möchte etwas kaufen, eine Jeans oder ein T-Shirt, ein Paar Schuhe, Unterwäsche, irgendwas. Einen Gürtel könnte ich brauchen. Aber jetzt sind alle Geschäfte geschlossen.
Die besten Gespräche hat man immer, wenn die Kamera nicht läuft. Einmal, wir hatten am Ufer der Seine gefilmt, räumten Tom und Sascha, die in Paris den Ton machte, ihre Ausrüstung zusammen. Wechsler und ich rauchten eine Zigarette, da habe ich noch geraucht. Ein Schwarm Tauben flog dicht über unsere Köpfe, es kam mir vor wie ein Angriff, den sie im letzten Moment abbrachen.
Wir sprachen über Sinn und Unsinn solcher Portraitfilme. Das jetzt aus dem Gedächtnis: Ich glaube, sagte Wechsler, ich habe mir von diesem Film versprochen, etwas über mich selbst zu erfahren durch Ihren Blick auf mich. Aber das ist Unsinn. Warum sollte jemand, der mich kaum kennt, etwas über mich herausfinden, was ich nicht längst weiß? Sie zeigen genau das, was ich von mir zeigen will oder kann, mehr nicht. Vermutlich sogar viel weniger. Und morgen bin ich ein anderer.
Ich sagte, ich hätte schon den Anspruch, einen Menschen, den ich portraitierte, zu erkennen, etwas Gültiges über ihn auszusagen. In einer Stunde wollen Sie etwas von einem Menschen erkennen?, sagte er. Das habe ich in meinem ganzen Leben nicht geschafft.
Die Arbeit am Film dauert länger als eine Stunde.
Er lächelt.
Er hat etwas Blaues in sich, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Es ist glatt und glänzend und durchsichtig, mal scheint es fest wie Glas, mal wie ein Wassertropfen, der zerfließen könnte, wenn man ihn berührt. Das Blaue ist nicht sehr groß. Wenn er nicht aufpasst, sieht man es manchmal in seinen Augen. Aber wenn er auf der Hut ist, sind seine Augen wie Spiegel, in denen er mich nichts als mich selbst sehen lässt. Aus dem Blauen kommen seine Geschichten, nicht alle, aber die besten. Dieses Blaue ist durch nichts zu trüben. Wenn ich es schaffen würde, das zu zeigen. Gab es nicht mal einen Film, der nur aus Blau bestand? Eine Stunde lang oder so sieht man nichts als eine blaue Leinwand. Stimmt, der war von Derek Jarman, als er schon fast erblindet war durch seine AIDS-Erkrankung. Eigentlich ist es nur eine Tonspur mit Tagebucheinträgen, Erinnerungen, philosophischen Gedanken, Exkursen über Politik und Ästhetik, spirituelles Geschwurbel und dazu esoterische Musik, alles ziemlich wehleidig, prätentiös und, am allerschlimmsten, langweilig. Darf man das sagen, wenn einer am Sterben ist? Darf man. Aber die Idee fand ich toll, einen Film ohne Bilder zu machen. Man schließt die Augen, und der Raum öffnet sich.
Musik ohne Töne, das waren die vier Minuten und dreiunddreißig Sekunden Stille von John Cage. Ein Bild, das nur als Rahmen existiert, ein Loch in der Decke, die Skyspaces von James Turrell. Ein Buch ohne Worte, hat das schon jemand gemacht? Ließe sich das machen?
Ich habe im Hotel in Paris die ganze Zeit das Fenster offen stehen lassen. Tom meckerte, aber ich mochte den Lärm der Straße, der bis spät nachts anhielt, dieses anschwellende und abebbende, sich dauernd verändernde Rauschen von Autos und Lieferwagen, von Lastern und Motorrädern. Manchmal verstummt es fast für einige Sekunden, um dann wieder anzuheben. Eine Hupe ist zu hören, nicht aggressiv, eher wie ein Zuruf, das Quietschen einer Bremse, Stimmen, ein Lachen. Ich stehe nackt am Hotelfenster, die Stadt wird aus mir geboren. Eine Sirene, die näher kommt und sich dann wieder entfernt. Hinter jeder dieser Sirenen steckt eine spannendere Geschichte als in all meinen Büchern zusammen, sagt Wechsler. Vor dem Hotel stehen Platanen, durch das Laub hindurch kann ich den Fluss sehen.
Mein roter Koffer liegt auf dem Bett. Ich packe meine Sachen, gehe hin und her. Wechsler schaut mir zu, lächelt, er spielt mit einem Kugelschreiber, nimmt einen Schluck Wasser, räuspert sich. Ja? Will er etwas sagen? Was macht er überhaupt hier? Ich ziehe frische Sachen an, raffe die schmutzige Wäsche zusammen, hole die Toilettentasche aus dem Bad, Bücher, all das Papier, das so eine Produktion mit sich bringt, die Festplatten, ein paar Dinge, die ich gekauft habe, ein Parfum, L’Heure Bleue von Guerlain. Ich benutze nie Parfum, ich habe es nur wegen des Namens gekauft. In einer blauen, dunkelblauen Stunde, und wenn sie ging, weiß keiner, ob sie war.
Wechsler drückt die Zigarette aus, macht ein paar Schritte zum nächsten Mülleimer. Ich folge ihm, werfe auch meine Kippe weg. Ich hätte Lust, mit ihm etwas trinken zu gehen. Er scheint nachzudenken, zögert.
Tom und Sascha haben ihre Sachen endlich zusammengepackt und kommen auf uns zu, sind vielleicht noch hundert Meter entfernt. Wechsler wirkt plötzlich scheu, unsicher, jetzt ist das Blaue deutlich zu sehen, dann verschwindet es. Gehen wir, sagt er schnell. Wir laufen tatsächlich einfach davon. Tom ruft etwas, aber mit der schweren Tasche und dem Stativ ist er langsamer als wir. Ich drehe mich nicht einmal mehr um. Ich gehe einfach mit Wechsler davon und lache vor Erleichterung.
Ich bin in Hochstimmung, weil ich Tom und Sascha stehen gelassen habe. Ich weiß, dass ich mich schlecht benehme, grundlos, das macht die Freude daran nur noch größer. Ich komme mir vor wie früher, beim Schule schwänzen, ein bisschen abenteuerlich. Und Wechsler ist mein Komplize.
Wir sitzen in einem Café auf einer der Seine-Inseln, weit sind wir nicht gekommen, ich trinke ein Glas Weißwein, einen Pouilly fumé, den hat Wechsler mir empfohlen. Es gibt eine ganze Geschichte zu diesem Wein, die er mir erzählt, aber die hier nichts zur Sache tut. Er kann manchmal endlos drauflosreden, ohne dass irgendetwas dabei herauskommt, und plötzlich verliert er das Interesse am Thema und schweigt.
Wechsler trinkt einen Ricard, auch dazu gäbe es eine Geschichte. Wie er Ricard erst nicht mochte und dann doch angefangen hat, ihn zu trinken. Es gibt zu allem eine Geschichte, es ist wie bei diesen Mandelbrotbäumen, wo in jedem Muster neue, noch feinere Muster stecken, man kann so nahe herangehen, wie man will, es hört nie auf, eine Geschichte in der Geschichte in der Geschichte in der Geschichte.
Die meisten anderen Gäste scheinen Touristen zu sein, sie trinken Bier, trotzdem wirkt alles sehr authentisch. Dieser lauschige Platz am Fluss mit den zwei Bäumen, sind das Linden? Die Terrasse, die kleinen Tische und die geflochtenen Stühle. Der Kellner mit seiner höflichen Beiläufigkeit, sogar die Tauben, obwohl es die wirklich überall gibt. Aber hier gehören sie hin. Die Stadt gibt keinen Deut auf uns, das hat etwas Befreiendes.
Habe ich Ihnen erzählt, dass ich noch nie in Paris war?
Und?, fragt er, als interessiere ihn das.
Es sieht genauso aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Es kommt mir vor, als würde ich schon alles kennen.
Die Stadt sieht nicht überall so aus wie hier.
Später sagt Wechsler: Ich bin immer weggegangen. Das war meine Lösung in jeder unangenehmen oder schwierigen Situation. Weggehen. Solange man in Bewegung bleibt, kann einem nicht viel passieren.
Aber Sie leben seit dreißig Jahren hier, sage ich, seit dreiunddreißig Jahren, nicht wahr?
Er antwortet nicht.
Später: Ich habe nie wirklich glauben können, dass eine Frau mich liebt. Dass ich es wert bin, geliebt zu werden.
Würde er das sagen? Zu jemandem, den er kaum kennt? Oder gerade zu jemandem, den er kaum kennt? Ist es Taktik? Flirtet er mit mir? Aber das kann er bestimmt besser. Da fällt man nicht gleich mit der Tür ins Haus.
Das ist ein bisschen traurig.
Eigentlich nicht, sagt er, es hat auch etwas Befreiendes. Die Angst ist die Möglichkeit der Freiheit.
Welche Angst?
Vor der Einsamkeit.
So etwas würden Sie mir nie in die Kamera sagen.
Natürlich nicht. Er lacht. Ich bin doch nicht verrückt.
Ich sollte einen Spielfilm über Ihr Leben drehen, dann könnte ich all das unterbringen. All die Dinge, die Sie mir off the record sagen, all die Dinge, die ich nur spüre, aber nicht beweisen kann. Das Blaue.
Führen Sie einen Prozess gegen mich?
Niemand klagt Sie an, wenn Sie es nicht selbst tun.
Nicht einmal das, sagt er mit einem traurigen Lächeln.
Thomas hat eine Theorie über Ihr Verhältnis zu den Frauen.
Zweifellos, sagt Wechsler. Aber Sie glauben nicht an diesen Unsinn, nicht wahr? Die Frauen. Wer sind die Frauen? Gibt es die überhaupt, die Frauen? Außerdem sind Filme nicht dazu da, Theorien zu transportieren.
Wozu sind sie denn da?
Da ist Schweigen viel wirkungsvoller, als irgendeinen Quatsch zu sagen.
Sie finden Ihr Hotel?
Das wäre der Moment, aber er ergreift die Gelegenheit nicht. Vermutlich ist ihm die Situation zu kompliziert. Weiß er, dass ich mit Tom zusammen bin? Dass wir in einer Krise stecken? Das hat er bestimmt gespürt. Würde der Film in Frage gestellt, wenn er, wenn wir … Vielleicht gefalle ich ihm nicht. Mag er Frauen in Jeans und Fleecejacke? Mag er kurze Haare? Mag er breite Hüften und kleine Brüste? Steht er auf Frauen, die aussehen, als hätten sie einen Hund? Gefällt er denn mir? Oder wäre er nur eine Trophäe? Ist das von Bedeutung?
Das Hotel liegt an der Seine, da kann ich mich nicht groß verlaufen.
Stromaufwärts oder stromabwärts?
Da lang.
Ich muss in die andere Richtung. Er zeigt zum gegenüberliegenden Ufer. Bis morgen.
Aber er bewegt sich nicht. Ich zünde mir eine Zigarette an, warte darauf, dass er geht. Er wirkt wieder unsicher, vermutlich wartet er darauf, dass ich als Erste aufbreche. Wieder so ein Kräftemessen.
Dass bei ihm zu Hause nicht gefilmt wird, hat er uns gleich beim ersten Vorgespräch klargemacht. Aber er hat auch verhindert, dass wir seine Adresse erfahren: Er sei am besten per E-Mail erreichbar. Als ich ihm alte Filme von uns schicken wollte: Ich solle sie mitbringen, wenn wir uns das nächste Mal träfen. Vertrag und alles: Läuft über den Verlag. Wir stehen immer noch da vor dem Café wie zwei Komparsen, die auf ihren Einsatz warten. Tom wundert sich bestimmt, wo ich bleibe. Ich schaue auf die Uhr.
Also …, sagt er, macht eine fahrige Handbewegung, als wolle er etwas wegwischen und geht los. Schon nach ein paar Metern muss er an einer Ampel stehen bleiben. Er dreht sich noch einmal um. Ich stehe immer noch da, winke ihm zu, lächle. Eins zu null für mich. Jetzt überquert er die Straße, obwohl die Ampel noch auf Rot steht, ziemlich riskant, ein Auto hupt. Es kommt mir vor, als fliehe er vor mir.
Ich habe ihm einen kleinen Vorsprung gelassen, dann bin ich ihm gefolgt. Er ist über die Brücke gegangen und dann immer den Quai entlang, kein sehr wohnlicher Ort, eine mehrspurige Straße, etwas heruntergekommene Wohnhäuser, vermutlich aus den siebziger Jahren, ein paar Bäume.