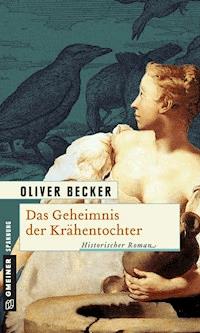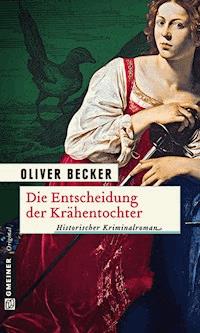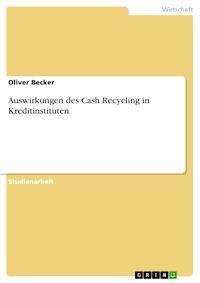4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Amerika, um 1870: Die junge Cynthia hat alles verloren: Statt mit ihrer großen Liebe ein neues Leben zu beginnen, wird das Hausmädchen wegen eines Diebstahls verurteilt, den es nicht begangen hat. Doch unter spektakulären Umständen gelingt ihr die Flucht aus dem Gefängnis. Cynthia ist fest entschlossen, herauszufinden, wer ihr so übel mitgespielt hat. Damit beginnt für sie eine gefährliche Odyssee, die sie bis in die Südstaaten nach New Orleans führt. Dort stößt die junge Frau auf einen Voodoo-Priester und einen jungen Mann, den es eigentlich nicht geben dürfte. Als Cynthia schließlich begreift, wer es auf sie abgesehen hat, gerät sie in größte Gefahr! Doch wem kann sie noch trauen?
Düster und geheimnisvoll - die Geschichte einer mutigen jungen Frau, Südstaatenflair und die dunkelsten Seiten New Orleans.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 664
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel des Autors
Über dieses Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Kapitel 1 – Das Rabennest
Der blinde Mann, der alles sieht
Kapitel 2 – Die brennende Tür
Der blinde Mann, der alles sieht
Kapitel 3 – Der Hafenpirat und die Hexe
Der blinde Mann, der alles sieht
Der blinde Mann, der alles sieht
Kapitel 4 – Die Kälte von St. Mortimer
Der blinde Mann, der alles sieht
Kapitel 5 – Die Stadt des schwarzen Lichts
Der blinde Mann, der alles sieht
Der blinde Mann, der alles sieht
Kapitel 6 – Der Sohn der Wildnis
Der blinde Mann, der alles sieht
Kapitel 7 – Vollmondnarben
Der Andere
Kapitel 8 – Baron Samedis düsteres Reich
Der blinde Mann, der alles sieht
Kapitel 9 – Die Verzweiflung des Mr Shelby
Der blinde Mann, der alles sieht
Der blinde Mann, der alles sieht
Der blinde Mann, der alles sieht
Kapitel 10 – Das Blut des Teufels
Der blinde Mann, der alles sieht
Der blinde Mann, der alles sieht
Kapitel 11 – Die verlorenen Seelen
Der blinde Mann, der alles sieht
Anmerkungen des Autors
Weitere Titel des Autors
Drachenspur
Schmetterlingstod
Der dritte Mord
Mara-Billinsky-Thriller als Leo Born:
Blinde Rache
Lautlose Schreie
Brennende Narben
Blutige Gnade
Vergessene Gräber
Sterbende Seelen
Über dieses Buch
Amerika, um 1870: Die junge Cynthia hat alles verloren: Statt mit ihrer großen Liebe ein neues Leben zu beginnen, wird das Hausmädchen wegen eines Diebstahls verurteilt, den es nicht begangen hat. Doch unter spektakulären Umständen gelingt ihr die Flucht aus dem Gefängnis. Cynthia ist fest entschlossen, herauszufinden, wer ihr so übel mitgespielt hat. Damit beginnt für sie eine gefährliche Odyssee, die sie bis in die Südstaaten nach New Orleans führt. Dort stößt die junge Frau auf einen Voodoo-Priester und einen jungen Mann, den es eigentlich nicht geben dürfte. Als Cynthia schließlich begreift, wer es auf sie abgesehen hat, gerät sie in größte Gefahr! Doch wem kann sie noch trauen?
Über den Autor
Oliver Becker stammt aus dem Schwarzwald und lebt mit seiner Familie in Frankfurt am Main. Er schreibt Historische Romane und Kriminalromane. Zu seinen bekanntesten Veröffentlichungen zählt die Trilogie um die »Krähentochter« und unter dem Pseudonym Leo Born die Thriller mit Kommissarin Mara Billinsky.
OLIVER BECKER
DieSCHATTENvonNEW ORLEANS
HISTORISCHER ROMAN
beHEARTBEAT
Überarbeitete Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2014 by Oliver Becker
Originalverlag: Bookspot Verlag, Planegg
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Rebecca Schaarschmidt
Covergestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de unter Verwendung von Motiven von © Sean Pavone/shutterstock; © Anastasiia Kucherenko/shutterstock; © John X Han/shutterstock; © Ironika/shutterstock; © Trevor Rousselle/shutterstock
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-0301-7
be-ebooks.de
lesejury.de
Kapitel 1Das Rabennest
Die Zellentür wurde mit einem dumpfen Knall hinter Cynthia Crane zugeschlagen. Gleich darauf ertönte das Rasseln, mit dem sich der Schlüssel im Schloss drehte. Beide Geräusche hallten mit einer Endgültigkeit nach, die Cynthia eisig unter die Haut kroch. Sie spürte Blicke auf sich und wagte es kaum, geradeaus zu sehen. Die fremden Schemen auf den Pritschen nahm sie nur aus den Augenwinkeln wahr. Kein Wort ertönte, kein einziger Ton, und nie zuvor war Cynthia Lautlosigkeit derart bedrohlich erschienen.
In der Zelle roch es nach Schweiß und dem feuchten, fauligen Stroh, aus dem die Matratzen bestanden. Es herrschte eine matte Dunkelheit, in der sich das einzige Fenster als graues Viereck abzeichnete. Unsicher bewegte sich Cynthia auf die kleine vergitterte Öffnung zu, hinter der sich der Himmel schwarz färbte. Sie stand da, die Nase knapp vor der schlierigen Scheibe, und spähte zwischen den eisernen Streben nach draußen.
Das Gebäude, in dem sie sich befand, lag in Brooklyn; es war groß und wuchtig, das größte, das sie je betreten hatte. Die Stadt, die sich vor ihr ausbreitete, wirkte ganz nah – und dank der gewaltigen Mauer, die sie von ihr trennte, zugleich unerreichbar fern. In dem schwachen Licht bildeten die Häuser, Dächer und Kirchtürme ein bizarr verschwommenes Muster. Längst war der Name Rabennest zu einem geflügelten Wort geworden, mit dem man Kindern einschärfte, brav und folgsam zu sein, um nicht an diesem Ort zu landen. Man vergaß beinahe, dass er nicht nur als strenge Ermahnung diente, sondern tatsächlich existierte.
Cynthia Crane jedenfalls hatte das vergessen – und jetzt fand sie sich verlassen von der Welt in dem berüchtigten Gefängnis wieder. Nach wie vor konnte sie nicht fassen, was heute geschehen war. Dieser Tag hätte doch einen ganz anderen Verlauf nehmen, hätte der aufregendste ihres Lebens werden sollen. In gewissem Sinne war er das ja auch geworden. Allerdings nicht wie gedacht.
Ein Albtraum, alles war zu einem einzigen großen Albtraum geworden.
Sie fühlte eine Gänsehaut unter dem harten Stoff, aus dem der graue sackartige Überwurf bestand, den sie trug. Alles war ihr abgenommen worden, sogar ihre Unterwäsche, und nie zuvor hatte sie sich so geschämt, sich so entwürdigt gefühlt wie in jenem Moment, als man einen Kübel kühles, seifiges Wassers über ihrem nackten Körper ausschüttete und ihr anschließend das kratzige Stück Stoff in die Hände drückte.
Wie lange würde es dauern, bis sich dieses unglaubliche Missverständnis aufgeklärt hatte, bis sie endlich dieses schreckenerregende Gebäude würde verlassen können?
Schrilles Gekicher ertönte, seitlich von ihr. Cynthia versuchte vergeblich, es zu überhören. Der Spott darin machte ihr bewusst, dass eine ganze Nacht im Rabennest vor ihr lag. Eine Nacht, die sich bereits unerträglich schwer auf ihre schmalen Schultern legte. Das Kichern wurde lauter, bösartiger.
Auf drei der vier Pritschen, von denen jeweils zwei übereinander an den beiden seitlichen Wänden angebracht waren, lagen Frauen – die vierte war für Cynthia vorgesehen. Während sie sich auf ihre Schlafstelle zubewegte, fühlte sie weiterhin die spähenden fremden Augen, die gewiss besser an die bedrückende Finsternis gewöhnt waren als ihre.
»Was für hübsches Haar«, schnatterte eine Stimme. »So lang und schwarz.«
»Ja«, antwortete eine zweite und fügte betont hinzu: »Noch.« Lautes Gelächter setzte ein.
»Und was für eine elegante, aufrechte Haltung.«
»Ja. Noch.«
Cynthia schob sich auf eine der beiden oberen Pritschen und rollte sich zusammen, die Beine an den Körper gepresst. Alles wirkte so erdrückend, der Gestank der Matratze, ihre Angst, ihre Ungewissheit. Von einem Moment auf den anderen hatte sich ein Abgrund vor ihr aufgetan, und jetzt blieb ihr nichts übrig, als in sein schwarzes Nichts hinabzustarren. Sie fühlte, wie Tränen in ihr aufstiegen, doch sie kämpfte gegen sie an. Sie versuchte sich ein wenig zu beruhigen und lauschte den Schreien der stets gegenwärtigen pechschwarzen Raben, denen das düstere Bauwerk seinen Spitznamen verdankte.
Alles war so schnell gegangen. Eine Verkettung schrecklicher Ereignisse, die über sie hinweggepeitscht waren wie ein Wirbelsturm. Sie sah sich selbst, sah die Aufregung, die in ihrem Gesicht aufgeflammt war, als sie morgens mit dem Bewusstsein aufgestanden war, dass große Veränderungen auf sie warteten. Die Kammer, in der sie ihr ganzes Leben verbracht hatte, nahm im fahlen Sonnenlicht Konturen an. Es war ein enges Zimmer, im obersten Stockwerk, im hinteren Teil eines eleganten Bauwerks in der Columbus Avenue. Ein Bett, ein Schrank und eine Faltwand, deren abgewetzter Stoff Kommode, Spiegel und Waschschüssel verbarg. Es gab nur ein winziges Fenster, das zur Rückseite auf den weitläufigen, stets bestens gepflegten Garten wies.
Seit Cynthia ein junges Mädchen gewesen war, arbeitete sie für die van Burens. Victor van Buren war ein allseits respektierter Mann, der bei etlichen geschäftlichen Unternehmungen mitmischte. Sogar während der Jahre nach dem Bürgerkrieg, der das Land blutend und ausgebrannt zurückgelassen hatte, war es ihm gelungen, sein beträchtliches Vermögen zu vergrößern.
An jenem Morgen hatte sich Cynthia beim Waschen lange im Spiegel betrachtet, in ihrem Gesicht geforscht, ob darin irgendetwas verändert wäre. Doch bis auf die unübersehbare Anspannung war sie genau die Cynthia Crane, die sie kannte. Eine junge Frau, schlank und recht groß, mit gleichmäßigen Zügen und dunklen Augen. Das volle schwarze Haar ließ sich mit der weißen Diensthaube kaum bändigen.
In ihrem einzigen Kleid und darüber einem Cape drehte sie eine zögerliche Pirouette vor dem Spiegel. Ihr Blick lag zweifelnd auf ihrer Gestalt, auf den abgetragenen Schuhen. Konnte sie es wagen, ausgerechnet diesen jungen Mann zu begleiten? Sich neben ihm sehen zu lassen, so zu tun, als gehörte sie zu ihm, als wäre sie kein einfaches Dienstmädchen? Ja, dieser junge Mann. David.
Cynthia hatte versucht, ihre Bedenken beiseitezuschieben, indem sie den Stoff ihres Kleides glatt strich und sorgsam mit einer Bürste letzte Staubkörnchen von ihren Schuhen entfernte. Abermals der Blick in den Spiegel. Zweifel. Immer noch.
Anschließend hatte sie einmal mehr die Reisetasche mit ihren wenigen Habseligkeiten überprüft, die sie am Vorabend zum ersten Mal in ihrem Leben gepackt hatte. Der heimliche Plan würde ihr Leben auf den Kopf stellen. Aber es war so schwer, vernünftig zu sein, wenn man verliebt war.
Sie war noch ein kleines Mädchen gewesen, da hatte sie schon immerzu nach David Ausschau gehalten, Victor van Burens Sohn. Die Gegensätze hätten nicht größer sein können. Der blonde, beliebte Sprössling einer der reichsten Familien der Stadt und die brave, unauffällige Hausangestellte. Als Kinder nahmen sie all diese Unterschiede nicht wahr. Heimlich trafen sie sich im Garten. Sie versteckten sich hinter Rosenhecken und Oleanderbüschen, entfernten sich lachend von der Rückseite des großen Hauses, um am anderen Ende des Gartens an dem schmalen Bachlauf zu sitzen, abgeschirmt von einigen Birken.
Für gewöhnlich wurden die beiden dann doch von Tante Molly entdeckt. Cynthia nannte sie Tante, obwohl sie nicht miteinander verwandt waren. Molly war schon seit Ewigkeiten als Bedienstete für die van Burens tätig. Sie sah es nicht gern, wenn Cynthia sich in Davids Nähe aufhielt. Allein schon deshalb, weil es auch Davids Eltern alles andere als gern sahen. Doch trotz ihrer Ergebenheit den van Burens gegenüber brachte Molly es oft nicht übers Herz, die beiden zu trennen. Das Bild der spielenden Kinder blieb ein kleines Geheimnis, das die Gänge und Räume des Hauses durchwehte, behütet von den Angestellten, allen voran Tante Molly.
Später, als Cynthia schon nicht mehr zur Schule ging, war David froh, wenn sie ihm bei seinen College-Arbeiten half. Er mochte ihre rasche Auffassungsgabe. Das, was sie verband, war nur ihnen beiden bewusst. Für alle Übrigen lebten sie zwar unter ein und demselben Dach, aber dennoch in zwei verschiedenen Welten. Aus dem Hintergrund und doch aus nächster Nähe erlebte Cynthia mit, wie David für seinen Platz in der Gesellschaft vorbereitet wurde, auf seine Rolle als Erbe Victor van Burens. Aus dem Kind wurde ein hübscher Knabe und schließlich ein gutaussehender junger Mann, dessen helle Locken inzwischen nicht mehr die Freundinnen seiner Mutter entzückten, sondern die heiratsfähigen Damen der wohlhabenden New Yorker Familien.
Mit ansehen zu müssen, wie David sich für einen Ball oder einen Theaterbesuch fertigmachte, war schwer für Cynthia.
»Sei nicht so töricht«, erklärte ihr Tante Molly unmissverständlich, »dich in den jungen Herrn zu verlieben. Vergeude dein Herz nicht an ihn, eines Tages wirst du es für einen anderen Mann brauchen. Für einen, der deinem Stand entspricht.«
Klar und deutlich hörte Cynthia auch jetzt Tante Molly, während die Nacht vor dem Fenstergitter noch dunkler wurde. Von einer der anderen Pritschen drangen Schnarchlaute zu ihr, draußen krächzten noch immer die Raben. Die Einsamkeit schien Cynthia zu ersticken. Sie dachte doch wieder an David, an die Zeit, als seine Theaterbesuche häufiger und die Bewerberinnen um einen der begehrtesten Junggesellen der Stadt zahlreicher wurden. Sie umschwirrten ihn, erschienen zum Nachmittagstee. Sie plauderten, lachten, spazierten mit David von einem Gesellschaftszimmer hinaus in den Garten und wieder zurück, umhüllt von Parfümwolken, die noch Stunden später in der Luft des Hauses hingen.
Zu dieser Zeit bat David Cynthia nicht mehr um Unterstützung bei seinen Lernaufgaben. Dennoch suchte er ihre Nähe, um ihre Ansichten zu bestimmten Themen zu hören oder auch einfach nur gemeinsam mit ihr zu schweigen. In der Finsternis des Rabennestes wirkte das alles wie aus einem anderen Jahrzehnt. Cynthia rollte sich noch mehr zusammen. Ihre rechte Hand strich unter dem rauen Ärmelstoff ganz sanft über die Narbe, die sich auf der Innenseite ihres linken Unterarmes befand: ein runder Fleck, der ein wenig an den Vollmond auf romantischen Gemälden erinnerte, mit leicht ausgefranstem Rand, einstmals fast grell lilafarben, mittlerweile zu einem zarten Rot verblasst.
Obwohl schon viele Jahre alt, war die Narbe immer noch gut sichtbar. Cynthia war so gewöhnt an sie, dass sie nicht einmal mehr wusste, woher sie stammte. In mancher Nacht hatte sie als Kind wach gelegen, über den Vollmond gestreichelt und von einer Zukunft geträumt, die es für sie nicht geben konnte. Von Tanzveranstaltungen in eleganten Ballkleidern, Bibliotheken und Lesezirkeln, anregenden Gesprächen mit ebenso anregenden Leuten. Doch sie war eine Hausangestellte, und das Wissen, mit dem sie sich insgeheim aus der Bücherei der van Burens versorgte, würde sie niemals mit jemandem teilen können.
Viele junge Frauen aus den Vorzeigefamilien waren bei David abgeblitzt, aber dann flatterte Melissa Kendrick wie ein Schmetterling in die Welt der van Burens, mit Kleidern in leuchtenden Farben und einer Entschlossenheit, die die ihrer Konkurrentinnen bei Weitem übertraf. Zudem hatte sie den Vorteil, dass ihr Vater geschäftliche Beziehungen zu Victor van Buren knüpfte, die rasch vertieft wurden. Eine Firma namens Van Buren & Kendrick entstand, und ganz New York wusste schon bald, dass David und Melissa die beiden Familien auch auf privater Ebene miteinander verflechten würden.
Obwohl Melissa und ihre Eltern bald ein fester Bestandteil im Leben der van Burens waren, passte David nach wie vor Gelegenheiten ab, um mit Cynthia allein zu sein. Genau zu dem Zeitpunkt, als sie überzeugt war, stark genug zu sein, um die eigenen Gefühle verdrängen zu können, gab er ihr den ersten Kuss.
Jahrelang hatten sie sich gekannt, jahrelang hatten sie ihre Zeit miteinander verbracht. Ihre Liebe allerdings gestanden sie sich erst dann ein, als die Hochzeit zwischen den Familien van Buren und Kendrick so gut wie beschlossen war.
Abermals begannen sie, sich heimlich zu treffen, wie damals als Kinder. Sie spazierten durch den Central Park, als wären sie ein normales Paar, das sich offen zeigen durfte. Sie schmiedeten Zukunftspläne, halb ernsthaft, halb im Scherz. Als der Winter kam, kaufte David für sie beide Kufen, die man unter die Schuhe schnallte, um Eis zu laufen. Dieses Geräusch, wenn die Eisen über den vereisten Hudson River kratzten, es war herrlich.
Eine Zeitlang lang ließ Cynthia sich einfach treiben. David versprach ihr, mit seinem Vater zu reden, mit Melissa Kendrick, notfalls mit der ganzen Welt, um die geplante Hochzeit zu vereiteln. Sie gab zu bedenken, dass Victor van Buren sich kaum umstimmen lassen würde – gewiss nicht, um seinen Sohn einem Dienstmädchen zu überlassen und damit für einen handfesten Skandal in der New Yorker Gesellschaft zu sorgen.
»Ich habe meinem alten Herrn schon einmal auf den Zahn gefühlt«, erklärte David ihr. »Natürlich ohne dass er etwas erahnen konnte. Aber glaub mir, Cynthia, es macht keinen Sinn. Er würde dich sofort entlassen und mir und Melissa eigenhändig Eheringe an die Finger stecken. Es geht nicht nur um sie und mich, sondern auch um Geschäfte zwischen unseren Vätern. Die Sache ist abgemacht.« Vielsagend musterte er sie. »Aber wärst du bereit, für uns beide viel, sogar sehr viel aufs Spiel zu setzen, Cynthia?«
Ihr fiel auf, dass in seinen sanften Zügen eine bislang nicht gekannte Entschlossenheit aufblitzte.
»Aufs Spiel setzen?«, wiederholte sie. »Wie meinst du das?«
***
Kaum zu glauben, dass es erst sechzehn Stunden her war, seit sie die gepackte Tasche ergriffen hatte, von der sie nie geglaubt hätte, sie je zu benutzen. Seit sie sich noch einmal eingehend im Spiegel betrachtet hatte. Seit sie auf dem wie immer sorgfältig gemachten Bett Platz genommen hatte, um auf David zu warten.
Das Haus der van Burens lag in gewohnter Lautlosigkeit da, in dieser noblen, etwas leidenschaftslosen Atmosphäre, in der Störungen geradezu undenkbar waren. Doch David und Cynthia hatten genau das geplant, eine Störung, einen Skandal, der für Aufsehen sorgen und gewiss im Gesellschaftsteil der Zeitungen Beachtung finden würde.
Cynthia saß auf dem Bettrand, die Knie aneinandergepresst, und sie spürte, wie die Unruhe in ihr mit jedem Wimpernschlag wuchs. Sie durfte gar nicht daran denken, welche Zukunft David sich verbaute, wenn er mit einem Dienstmädchen durchbrannte. Was er alles aufgab: eine ausgezeichnete berufliche Laufbahn, ein Leben in der vornehmen Gesellschaft, nicht zuletzt viel Geld, all das, wofür der Name van Buren stand.
»Aber was werden wir tun, wenn wir New York verlassen haben?«, hatte sie ihn gefragt.
»Mach dir keine Sorgen«, verwarf er ihre Zweifel. »Ich habe mir alles überlegt. Vertrau mir, Cynthia. Ich weiß, wie es weitergehen wird.«
Deshalb die gepackte Reisetasche an diesem Morgen, an dem sie viel zeitiger aufgestanden war, als es nötig gewesen wäre. Die ersten Fetzen von Sonnenlicht breiteten sich im Zimmer aus. Noch bevor das Haus erwachen würde, wären sie schon am Bahnhof, so hatten sie es sich ausgemalt. David wollte an ihre Tür klopfen, sie würden die hintere Treppe und den Seitenausgang nehmen, den sonst nur das Personal oder Lieferanten nutzten.
Cynthias saß da und rieb nervös über ihre vom Baumwollstoff des Kleides und der wollenen Strumpfhose verhüllten Knie, betastete gleich darauf die Narbe auf dem linken Unterarm, als könnte der verblasste Vollmond sie beruhigen.
Die Stille des Hauses kam ihr in jenen Minuten unwirklich vor, und schon dachte sie, die Abmachung mit David entspringe lediglich einem aberwitzigen Traum. Die Schritte allerdings, die plötzlich vom Gang in ihre Kammer drangen, bewiesen das Gegenteil. Eine verwirrende Sekunde lang glaubte Cynthia, sie kämen von zwei Personen. Nein, es waren seine Schritte. Davids Schritte.
Cynthia senkte kurz die Lider, ein Moment, um Kraft für das Bevorstehende zu sammeln, dann erhob sie sich. Ein kurzes Klopfen. Die Tasche in der Hand, öffnete sie die Zimmertür. Und hatte das Gefühl, der Boden würde unter ihren Füßen weggezogen. Die Schritte waren tatsächlich von zwei Personen gekommen.
Verwirrt starrte sie die Männer an, die sich gegenseitig mit einem Nicken verständigten. Der Holzfußboden knarrte, als sie schweigend das Zimmer betraten und Cynthia nach hinten drängten.
»Was wünschen Sie?« Ihre leisen Worte verloren sich in dem trockenen Laut, als die Tasche zu Boden fiel. Keine Antwort.
Victor van Buren stand vor ihr, größer, als er ihr jemals vorgekommen war. Maßgeschneidert sein Anzug, makellos glänzend die Schuhe, perfekt nach oben gezwirbelt die Enden seines Schnurrbartes. Seine Miene war unnachgiebig – wie immer. Doch zum ersten Mal, seit Cynthia ihn kannte, lag etwas Bedrohliches darin. Der zweite Mann war Cynthia völlig unbekannt. Er war kleiner und breiter als van Buren, mit weniger elegantem Anzug, einem winzigen Bowler auf dem breiten Schädel und einer Miene, die nicht zu deuten war.
Cynthias Gedanken rasten. Sie überlegte krampfhaft, ob sie noch etwas äußern sollte, aber ihre Stimme war einfach weg. Sie fragte sich, wo David stecken mochte. Victor van Burens beherrschte Stimme ließ sie aufschrecken.
»Inspektor«, sagte er zu seinem Begleiter, »es gibt keinen Grund, Zeit zu verschwenden. Tun Sie das, wozu Sie hier sind.«
Cynthia verfolgte fassungslos, wie der Fremde ihr kleines Zimmer durchsuchte. Er tastete das Bett ab. Er untersuchte den Schrank, in dem sich nur noch Ersatzbettwäsche befand. Er klopfte sogar den Boden und die Wände ab, als rechnete er mit einem geheimen Hohlraum. Die ganze Zeit über betrachtete van Buren allein ihn, als wäre Cynthia gar nicht anwesend.
Der als Inspektor angesprochene Mann trat hinter die Faltwand. Sein Kopf ging nach unten, offenbar bückte er sich zu der Kommode. Cynthia hörte, wie die Schubladen aufgezogen wurden. Auch die Kommode war so gut wie leer, nur im untersten Fach lagen noch einige Handtücher. Im nächsten Moment erschien der Fremde wieder. Sein Blick huschte durch den Raum, vorbei an Cynthia und van Buren, und er schob beiläufig den Bowler gerade.
»Nun?«, kam es von van Buren mit unüberhörbar drängendem Unterton. Der Mann wandte sich noch einmal dem Bett zu. Er kniete sich hin und schob seine Hand zwischen Rost und Matratze. Sekunden verstrichen. Als sich der Inspektor erhob, lag ein kleiner Beutel aus schwarzem Samt in seiner Hand. Er hielt ihn hoch und verständigte sich durch ein Nicken mit van Buren.
»Ist es das?«, wollte van Buren wissen. Bei diesen Worten bewegte er kaum die Lippen.
Der Inspektor äußerte nichts. Er zog an der Kordel des Beutels, stülpte den Stoff um und fing in seiner offenen Handfläche Schmuck auf. Cynthias starrer Blick fiel auf einen Armreif, mehrere Ohrringe und eine Halskette aus wunderschönen Perlen.
Der blinde Mann, der alles sieht
Das Zimmer befand sich in der hintersten Ecke des einsam gelegenen Hauses und war nur ein paar Quadratmeter groß. Dennoch hatte es der Mann geschafft, sein ganzes Leben, sein ganzes Reich darin unterzubringen. Hier fand sich alles, was ihn ausmachte, alles, was ihm etwas bedeutete. Hier, versteckt in dichten Wäldern, hunderte Meilen von New York City entfernt.
Der Mann hatte bewegte Jahre hinter sich und vieles gesehen, gewiss mehr als die meisten Menschen. Er wusste, was es hieß, zwischen den Welten zu pendeln, weder der einen noch der anderen anzugehören, nicht schwarz und auch nicht weiß zu sein. Er wusste, wie es sich anfühlte, wenn die eigene Haut nach einem Peitschenhieb platzte, wie es war, zu den Geächteten zu zählen und unter Ratten zu leben. Er kannte den Geschmack von Dreck auf der Zunge, jedoch auch den Genuss von Austern und Champagner. Der Kampf war ihm ebenso vertraut wie die Flucht. Reine Liebe war in ihm gewesen – und tiefer Hass.
Inzwischen fühlte er sich älter, als er war, viel älter. Sein Augenlicht war schwächer geworden, und der elegante schwarze Stock mit dem Silberknauf in Totenkopfform war nicht mehr nur ein exzentrisches Accessoire, sondern inzwischen auch eine Hilfe, um die Abstände zu Wänden, Tischen und Fremden besser abschätzen zu können. Ich werde blind, gestand er sich ganz ruhig ein.
Doch sein anderes Auge, tief in seinem Inneren, ließ ihn nach wie vor nicht im Stich. Dieses Auge lenkte, sah vorher und verfügte, wenn es darauf ankam, über einen Blick, der andere erzittern ließ. Symbolisch hatte er es sich vor langer Zeit auf die Brust tätowieren lassen, und bisweilen ertappte er sich auch heute noch dabei, wie er mit der Hand unter den Hemdenstoff fuhr, um das Abbild zu berühren.
Der Stock lag zu seinen Füßen, funkelnd der Totenkopf, während er selbst in den großen Sessel sank, der ebenfalls seine besten Jahre hinter sich hatte. Der Mann stammte aus dem Süden, er vermisste seine Heimat. Also hatte er sich in diesen vier engen Wänden einen Miniatursüden kreiert.
Über die Ränder der Blumentöpfe quollen Farne, die so oft gegossen wurden, dass sie faulten und übel rochen. Aber selbst dieser Gestank erinnerte den Mann an zu Hause. An früher. Der gesamte Süden moderte, wuchs, gedieh, starb ab, lebte neu auf. Der Mann war süchtig nach solchen Düften. Bronzeschalen füllte er mit Wasser, um dann Unmengen ätherischer Öle hineinzugießen, die die Aromen von Rosskastanie und Hibiskus im Zimmer verströmten. Überall, in jeder Ecke, gab es Blumen des Südens, manche noch frisch, vom einzigen Blumengeschäft des nahe gelegenen kleinen Ortes besorgt, die meisten getrocknet und mit Sorgfalt verkehrt herum aufgehängt. Monarda, Magnolie, Glyzinie, Azalee. Zahllose weiße Blütenblätter der Cherokee Rose lagen wild verstreut im Zimmer herum. Es herrschte eine matte Dunkelheit, obwohl draußen heller Tag war. Die Vorhänge des einzigen Fensters waren zugezogen, wie jedes Mal, wenn der Mann sich hier aufhielt.
Hinter ihm stand ein offenes Regal: eine Urne, alte staubige Folianten und Bücher, ein Totenschädel, Schalen voller Knochen, geschnitzte Figuren mit hypnotischen Glubschaugen, ausgefranste Stoffpuppen. Vor sich auf einem kleinen Beistelltisch hatte er zwei Kerzen aufgestellt und angezündet.
Die Flammen flackerten auf, warfen Kreise schwacher Helligkeit. Eine Kerze war weiß, die andere schwarz. Der Mann lächelte. Seine rechte Handfläche ließ er abwechselnd über den Flammen kreisen, immer tiefer, bis schließlich das Feuer in seine schorfige Haut biss – die Berührung war schmerzhaft und tat ihm dennoch gut. Die Kraft der Hitze ging auf ihn über. Das versteckt in ihm liegende Auge erwachte mit dem Licht und sah sofort eine junge Frau.
Verwundert runzelte er die Stirn. Hatte er die Frau nicht längst vergessen? Wieso zeigte sie sich hier und jetzt? Er beugte sich vor und beobachtete sie. Es war, als würde seine Hand sanft über ihre Seele streicheln. Was er wahrnahm, überraschte ihn gleichermaßen: Angst. Verwirrung. Einsamkeit. Außerdem Wut, die zu glimmen begann. Was hatte das zu bedeuten?
Das Bild der jungen Frau löste sich auf, ein anderes nahm Gestalt an: ein Gebäude. Die Lippen des Mannes bekamen einen harten Zug. Er kannte das Haus, kannte es sehr gut. Das Haus, die junge Frau. Was hatte diese Familie ihr angetan? Und aus welchem Anlass? War das womöglich auf ihn zurückzuführen? Bestimmt. Denn war es nicht so, dass alles, was in diesem großen stillen Anwesen in der Columbus Avenue passierte, untrennbar mit ihm zusammenhing?
Er ließ weiterhin seine Hand kreisen, mal über der einen, dann über der anderen Flamme, ignorierte den Gestank von verbrannter Haut, und betrachtete die Kerzen, an denen bereits das schmelzende Wachs hinabrann. Welche würde schneller abbrennen? Die weiße oder die schwarze?
Dann erblickte er wieder die Frau. Wie weiß ihre Haut, wie schwarz ihre Augen. Die Kerzen loderten auf. Abermals fragte er sich, welche der beiden zuerst erlöschen würde.
Er roch die Düfte des Südens und versuchte die Stimme der Frau zu hören. Was ihm jedoch nicht gelang. Er hörte überhaupt nichts. Und nun? Würde er sie einfach wieder verbannen aus dem zwielichtigen Reich seiner Gedanken? Oder stellte dieser Moment einen völlig unerwarteten Wendepunkt dar? War die Frau ein Zeichen? Dafür, dass der alte Kampf noch nicht vorüber war? Er räusperte sich, ein Laut wie das Knurren eines Tieres. Konnte es sogar von Vorteil für ihn sein, sich mit ihr zu beschäftigen? Zum ersten Mal in all den Jahren? Sollte er ihr einen Geist aus längst vergessenen Zeiten schicken? Aber wer aus der Vergangenheit käme dafür in Frage? Der Mann lehnte sich wieder bequemer nach hinten. Ein Grinsen umspielte seine Mundwinkel. Die Kerzenflammen knisterten.
***
Cynthia schreckte hoch. Zunächst glaubte sie, den vertrauten Geruch ihrer frischen Bettwäsche wahrzunehmen, die dezenten Duftwasser, die sie hin und wieder in ihrer Kammer versprühte. Aber es war nicht das Haus der van Burens, in dem sie sich befand, sondern die Zelle im Rabennest. Sie musste also doch irgendwann eingenickt sein, trotz der Kälte, die sie auch jetzt noch zittern ließ, trotz der Ungewissheit, die wie eine schwarze Wolke über ihr schwebte.
Sie blinzelte und orientierte sich an dem vergitterten Viereck. Ihr Blick wanderte dorthin, wo die Tür sein musste. Nun vermochte sie Einzelheiten besser zu erkennen. Plötzlich ging die Zellentür auf, völlig geräuschlos. Im nächsten Moment erkannte sie, wie ein Schatten durch den Rahmen schlüpfte. Wie gelähmt lag Cynthia auf ihrer Pritsche. Sie konnte nicht mehr atmen.
Schritt für Schritt näherte sich der Schemen ihrem Schlafplatz. Sie formte ein Wort mit ihren Lippen: David. Ja, er war es.
Sie richtete sich auf und blickte geradewegs in sein Gesicht. Erst jetzt wurde ihr bewusst, wie winzig David auf einmal war. Klein wie ein Kind. Er war wieder der Junge, mit dem sie zum Spielen zu den Birken am Bach gelaufen war. Wie damals tanzten die blonden Locken auf seinen schmalen Schultern. Sogar die Sommersprossen, die im Laufe der Jahre verschwunden waren, meinte sie wahrnehmen zu können.
Vor ihrer Pritsche blieb er stehen, der kleine David, nur vier oder fünf Jahre alt.
»David.« Diesmal sprach sie es laut aus, und ihre Stimme klang überglücklich. Dann jedoch veränderte sich etwas an ihm, ein verwegener Ausdruck schlich sich in das Blau seiner Augen, ein Ausdruck, den sie an ihm nicht kannte. Als wäre er ein anderer Mensch. Sie verstand nicht was, aber irgendetwas war mit ihm passiert. Und verblüfft verfolgte sie, wie er auf einmal ihr Handgelenk packte – hart umschlossen seine Finger ihre Haut. Sie wollte sich losreißen, wollte schreien, doch ihre Kehle war wie ausgetrocknet. Ein unergründliches Lächeln umspielte seinen Mund, und im nächsten Moment hatte er sich einfach in Luft aufgelöst. Es war vorbei. Sie war aufgewacht und wieder zurück in jener Wirklichkeit, die schlimmer war als jeder böse Traum.
Durch das Fenster sickerten erste Lichtschimmer. Ein Schnarchen rasselte von einer der anderen Prischen zu ihr, genau wie einige Stunden zuvor. Cynthia erschauerte, als sie ihre Umgebung betrachtete: die gemauerten Wände, die mit Eisenstreben verstärkte Holztür, den feuchten Boden, den großen Nachttopf. Sie schob ihren Kopf ein wenig über den Rand der Pritsche. Auf der gegenüberliegenden Seite der Zelle lagen zwei schmale, ausgehungert wirkende Frauen. Sie trugen graue Kleidfetzen, wie Cynthia. Beide hatten sie bleiche, fast durchsichtige Haut und kurzes, struppiges Haar, die eine rotes, die andere braunes.
Cynthia beugte sich noch ein Stück weiter nach vorn, um einen Blick auf die Pritsche unter ihr werfen zu können. Und sie erschrak. Unverwandt wurde sie angeglotzt. Von der größten und kräftigsten Frau, der sie je begegnet war.
»Böse Träume gehabt, was?«, schnarrte eine tiefe, geradezu männliche Stimme zu Cynthia hinauf. »Hast gestöhnt, als würde der Teufel höchstpersönlich versuchen, sich an dich ranzumachen.«
Sie war zu keiner Antwort fähig. Immer noch erschrocken, zog sie den Kopf zurück. Die Frau lachte auf.
Kurz darauf ertönte ein ohrenbetäubendes Geklingel. Ein Durcheinander aus Geräuschen entstand. Schlurfende Schritte auf dem Gang, Schlüssel, die ratternd Türen öffneten, laute Anweisungen des weiblichen Wachpersonals. Nacheinander kamen die drei Frauen, mit denen Cynthia die Zelle teilte, auf die Beine. Sie streckten sich, knurrten sich gegenseitig an, maßen Cynthia, die regungslos auf ihrer Pritsche lag, ohne jegliche Neugier, eher gleichgültig. Vor allem die beiden ausgemergelten Frauen sahen mit einem Ausdruck der Abgestumpftheit dem neuen Tag entgegen, während dagegen die Dicke ebenso hellwach und aufmerksam wirkte wie zuvor, als Cynthia sie zum ersten Mal gemustert hatte.
»Hoch mit deinem Hinterteil, Schätzchen«, polterte deren Stimme schon wieder zu Cynthia, »sonst werden die da draußen mit einem Stock nachhelfen.«
Cynthia rutschte von der Pritsche, allerdings nicht allzu hastig, während sie darauf achtete, dem Blick der Dicken standzuhalten.
»Jetzt gibt’s was zu futtern«, meinte die Frau hart. »Genieß es, wird schmecken wie der Himmel auf Erden.«
Cynthia erwiderte nichts.
»Einen Mund hast du. Aber gesprächig scheinst du nicht gerade zu sein.«
Erneut gab sie ihr keine Antwort.
»Wohl zu anständig, um sich mit so was wie mir zu unterhalten, was?«
Cynthia senkte nun doch den Blick. Noch immer war sie fassungslos über das, was sie durchleben musste, fühlte sich nackt und wehrlos. Tante Molly! David!, dachte sie. Wo seid ihr? Wo bleibt ihr?
Es konnte doch nicht sein, dass dieses Grauen weiterging und noch niemand erschienen war, um das schreckliche Missverständnis aufzuklären. Sie würde es keine Sekunde länger hier aushalten! Vor ihr verschwamm alles, ihre Beine wurden weich, der nackte Fußboden schien auf sie zuzurasen. Aber eine Hand, hart wie Eisen, packte sie an der Schulter, hielt sie aufrecht und drückte sie gegen die Pritschen. Die Dicke war plötzlich ganz nah vor ihr, die großporige Haut glänzte matt.
»Nicht durchdrehen, nicht aufgeben, Schätzchen.« Wie aus weiter Ferne drang die Stimme an Cynthias Ohren.
Die Zellentür stand offen, Cynthia hatte gar nicht mitbekommen, dass sie aufgeschlossen worden war. Eine der Aufseherinnen, in einer dunklen Uniform, ähnlich wie die Polizisten auf den Straßen New Yorks sie trugen, beäugte nacheinander die Frauen in der Zelle und gab einen Befehl, den Cynthia in ihrer Verwirrung gar nicht richtig verstand. Gleich darauf fand sie sich in einer Schlange von Frauen wieder, die im Gänsemarsch den langen Gang entlanggeführt wurden, dem Cynthia schon am Vorabend wie ein Häuflein Elend gefolgt war. Die grauen Kleider, die kurzen, struppigen Haare, die kleinen Schritte, vor allem das Schweigen. Es war das Trostloseste, was sie jemals gesehen hatte.
Der Gang mündete in einen großen Raum mit gemauerten Wänden, in dem Holzbänke und -tische standen. Der Speisesaal. Es gab Tee, der so dünn war, dass er aussah wie verschmutztes Wasser, und steinharten Zwieback. Cynthia kauerte verzweifelt zwischen der Rothaarigen und der Dicken und brachte keinen Schluck, keinen Bissen herunter. Die Dicke nahm ihr erst den Zwieback, dann den Tee ab und zwinkerte ihr frech zu. »Morgen kannst du’s schlucken, wirst schon sehen«, meinte sie.
Morgen werde ich nicht mehr hier sein, dachte Cynthia. Bereits heute Mittag werde ich nicht mehr hier sein.
Sie lauschte den verhaltenen Unterhaltungen, ohne auf deren Bedeutung zu achten. Aus einem anderen Teil des Gebäudes drangen Männerstimmen zu den Frauen – die männlichen Insassen, die sich in der Überzahl befanden, nahmen offenbar in einem nicht weit entfernten Raum ebenfalls das Frühstück ein.
Die ganze Zeit über kam sich Cynthia fremd vor. Sekundenlang hielt sie die Lider geschlossen, um einigermaßen die Ruhe bewahren zu können. Erneut sagte sie sich: Heute Mittag werde ich nicht mehr hier sein.
»Beten nützt nix, Schätzchen«, brummte ihre ausladende Banknachbarin. »Der Herrgott lässt sich nämlich hier nicht blicken. Aber das wirst du selbst noch merken.« Abwartend schwieg sie. »Also, irgendwann wirst du dich schon mal zu ein paar Silben herablassen müssen, das sag ich dir.«
Nach dem Frühstück wurden die Insassinnen in verschiedene Gruppen eingeteilt. Cynthia versuchte eine Aufseherin anzusprechen, um ihrer Verzweiflung Luft zu machen. Aber ein rüder Stoß trieb sie zurück in ihre Gruppe, mit der sie in einen mehrfach unterteilten Raum im Kellergewölbe gelangte. Die klare Luft wurde verdrängt von einer riesigen, Hitze starrenden Wolke, weiß wie der Dunst, der sich im Herbst vom Atlantik her in die Stadt schob und in den Straßen ballte. Ein überraschend reiner Geruch kroch in Cynthias Nase, der sie an ihre gestärkten weißen Kragen zu Hause erinnerte. Es war die Wäscherei des Rabennestes. Cynthia wurde zwischen zwei große Bottiche beordert. So winzig fühlte sie sich, so fremd. Befehle der Aufseherinnen, das Zischen des Waschwassers, Gesänge und Gekeife der Insassinnen.
Mit einem Holzknüppel musste Cynthia Unmengen an Wäsche in das heiße Wasser des einen Troges quetschen und so den Schmutz aus den Fasern drücken, um die Wäschestücke anschließend mit einer großen Blechzange herauszufischen und in dem zweiten Trog abzuladen, der nicht mit Wasser gefüllt war. Andere Hände wiederum sorgten dafür, dass alles auf Leinen gehängt wurde.
In den heißen Dämpfen hatte Cynthia das Gefühl, sie würde verschwinden, sich einfach in Luft auflösen, und erneut war es der Gedanke an David, der sie davor bewahrte, aufzugeben. Noch war Hoffnung in ihr, und die durfte sie auch nicht verlieren. Denn mehr blieb ihr nicht.
Nach einer scheinbaren Ewigkeit erklang erneut die Klingel. Marschieren in der Reihe, zurück in den Speiseraum. Der Anblick des kleinen fettigen Fleischstücks in ihrem Blechnapf drehte Cynthia fast den Magen um.
»Morgen wird’s von ganz allein deinen zarten Hals runterrutschen«, brummte ihr die dicke Frau zu. »Und bald schmeckt’s dir sogar. Du weißt ja: Nicht durchdrehen, nicht aufgeben, Schätzchen.«
Nach dem Essen zurück in die weiß dampfende Unwirklichkeit der Wäscherei. Auf einmal erschien eine Aufseherin neben Cynthia. Ein Kopfnicken bedeutete ihr, dass sie mitkommen solle.
Endlich!, durchfuhr es Cynthia.
Einen Schritt hinter der Frau verließ sie die Wäscherei, dann musste sie vorangehen. Kommandos wie »Links«, »Rechts« und »Weiter, weiter« wiesen ihr den Weg. Erst jetzt wurde ihr bewusst, wie groß das Gefängnis war, ein Labyrinth aus zahllosen, nahezu identisch aussehenden Gängen, in denen die immer gleichen modrig abstoßenden Gerüche hingen. Bis auf einmal die Luft angenehmer wurde, zumindest ein wenig nach dem Leben roch, das Cynthia kannte, nach offenen Fenstern und reinlichen Körpern. Ein Saal wartete auf sie, in dem sich Insassinnen und Besucher auf schlichten Stühlen gegenübersaßen. Der Raum wurde von einem Holzbalken geteilt, der in den Wänden rechts und links versank.
Ganz hinten an der Mauer stand ein Hocker für Cynthia. Sie setzte sich hin, und ihr Blick fiel unwillkürlich auf den freien Stuhl, der ihr gegenüber auf der anderen Seite des Balkens stand. Endlich!, dachte sie noch einmal. Jetzt musste sich etwas tun, jetzt musste das alles doch ein Ende finden.
Eine Tür öffnete sich, eine weitere Aufseherin kam herein, gefolgt von einer Person, die den Kopf verschüchtert eingezogen hatte. Ein Anblick, der Cynthia mitten ins Herz fuhr – und der eine Träne über ihre Wange rollen ließ.
***
Zwar war es nicht David, der in diesem Moment mit bangem Ausdruck auf dem Stuhl Platz nahm, aber dennoch wurde Cynthia von einer Welle der Erleichterung durchflutet.
»Mein armes Kind«, wehten Tante Mollys Worte zu ihr hinüber, zwischen den anderen Stimmen hindurch, die den Besuchersaal erfüllten.
»Wo ist David?«, stieß Cynthia hervor. »Hast du ihn gesehen? Hast du ihn sprechen können?«
»Nein«, kam die zögerliche Antwort. »Er ist nicht zu Hause. Seit vorgestern Abend hat ihn niemand vom Personal zu Gesicht bekommen.«
Cynthia spürte, wie ihre Schultern schwer wurden. »Warum? Wo ist er?«
»Ich habe nicht die leiseste Ahnung, Cyn.«
Sie betrachtete das runde, gütige Gesicht. Rund war alles an Tante Molly, die nicht einmal viel aß, deren Körper aber offenbar nichts davon hergab, was er einmal erhalten hatte. Mitte vierzig war sie, doch mit der Haube, die sie stets auf dem Kopf trug, und ihren vielen kleinen Fältchen wirkte sie älter.
Beinahe mehr noch als David war sie der große Bezugspunkt in Cynthias Leben. Sie war ihre beste Freundin und die Mutter, die sie nie gekannt hatte. Cynthias Eltern waren beide gestorben, als sie ein kleines Kind gewesen war, und Molly, eine Bekannte ihrer Mutter, nahm sich ihrer an. So war Cynthia ins Haus der van Burens gekommen, für die Tante Molly arbeitete, als Dienstmagd, Köchin, Näherin, Wäscherin, einfach als Mädchen für alles. Und jetzt saßen die beiden einander im Rabennest gegenüber, jede von ihnen völlig überfordert von der Situation.
»Was ist nur mit David?«, bemerkte Cynthia, mehr zu sich als zu Tante Molly.
»Du musst nun an dich denken.«
»Ich weiß überhaupt nicht, wo mir der Kopf steht«, erwiderte sie. »Was waren das für Schmuckstücke, die unter meinem Bett aufgetaucht sind?«
Tante Molly nickte. »Wir alle haben uns das gefragt.«
»Ihr alle?«
»Ja, alle Angestellten im Haus fühlen mit dir, Cyn. Wir sprechen von nichts anderem.« Sie seufzte. »Obwohl ich dir auch liebend gern deinen Allerwertesten versohlen würde. Mit David van Buren durchbrennen! Also wirklich!«
»Du weißt davon?«, fragte Cynthia kleinlaut.
»Von dir und David und eurem wahnwitzigen Plan? Und ob ich davon weiß. Und nicht nur ich! Wie konntest du nur annehmen, dass ihr damit durchkommt? Dass euch niemand durchschaut?«
Cynthia sank auf dem Stuhl zusammen. »Wir lieben uns, Tante Molly«, flüsterte sie.
»Ihr schwärmt füreinander.«
»Es ist mehr als das!«, gab Cynthia zurück.
»Mir bricht es das Herz, dich so zu sehen«, sagte Tante Molly. »Aber alle Bediensteten haben längst über euch getuschelt.«
Wehrlos nickte Cynthia. Und dachte gleichzeitig, wie naiv David und sie gewesen waren. Sie waren tatsächlich überzeugt gewesen, es käme ihnen niemand auf die Schliche.
»Ehrlich gesagt«, sprach Tante Molly weiter, »habe ich dafür gebetet, David würde dich endlich fallen lassen, heiraten und in die Flitterwochen aufbrechen. So schwer es für dich auch gewesen wäre. Cyn, es war aussichtslos. Von Anfang an aussichtslos.« Tränen glänzten auf Tante Mollys Wange. »Mr und Mrs van Buren sind außer sich. So wütend habe ich sie noch nie erlebt.«
»Haben sie getobt? Geschrien? Was haben sie gesagt?«
»Gar nichts haben sie gesagt. Das war ja das Unheimliche. Ihre Gesichter waren wie eingefroren.«
»Wenn sich erst einmal herausstellt, dass alles ein großer Irrtum ist und …«
»Im Haus heißt es, du wolltest mit David fliehen und hättest die Schmuckstücke gestohlen, um sie zu versetzen.«
»Das ist blanker Unsinn!«, protestierte Cynthia, lauter als beabsichtigt. Sofort ruckten die Köpfe der Aufseherinnen zu ihr. Mit mühsam unterdrückter Stimme fuhr sie fort: »Ich war doch schon bereit für die Reise, ich hatte alles gepackt. Dann erst war auf einmal Mr van Buren mit diesem Inspektor in meinem Zimmer. Und dann erst stieß der Inspektor auf den Schmuck. Es wäre doch völlig unsinnig, wenn ich den Schmuck in meinem Zimmer zurückgelassen hätte.«
In Tante Mollys Stirn hatten sich tiefe Krater gegraben. »Das wusste ich nicht. Also, das hört sich alles sehr seltsam an. Und du bist sicher, dass es so war? Sicher, dass …«
»Versteh doch endlich!«, unterbrach Cynthia sie ungeduldig. »Jemand muss den Schmuck bei mir versteckt und dann Mr van Buren einen Hinweis gegeben haben. Deshalb hatte er doch den Polizisten dabei. Die beiden haben gezielt nach dem Schmuck gesucht. Ich weiß nicht einmal, wem er gehört. Etwa Mrs van Buren? Ich habe ihn nie an ihr bemerkt.«
»Ich weiß es auch nicht. Uns erzählt niemand etwas.«
Cynthia sah Tante Molly an, dass ihre Gedanken kaum all den Worten folgen konnten, die gewechselt wurden.
»Bitte, Tante Molly, du musst mit Mr van Buren sprechen. Er ist nie sehr freundlich zu uns allen, aber doch ein gerechter Mann.« Cynthia erinnerte sich an van Burens versteinerte Miene, als der Inspektor den Beutel mit dem Schmuck in der Hand hielt, und fühlte sich entmutigt.
»Oder sprich wenigstens mit Mrs van Buren«, bat sie dann. »Ich weiß, ich bin nur ein Dienstmädchen, aber wenn Mrs van Buren in der Verhandlung ein Wort für mich einlegen könnte, wäre das viel wert. Und David ist sicher in der Lage, mir einen Anwalt zu besorgen«, sie merkte gar nicht, wie sie immer weiterredete, »ich könnte etwas von meinem Lohn nutzen, um den Anwalt anzuzahlen, einen, der nicht so teuer ist. Alles lässt sich gewiss aufklären, für alles gibt es eine einfache Erklärung …«
Tante Molly langte über den Holzbalken hinweg und berührte Cynthias Wangen, wie früher, als sie noch ein Mädchen gewesen war. Im Nu erschien eine Aufseherin mit strenger Miene bei ihnen, und Tante Molly zog erschrocken die Hand zurück.
»Mein Kind, wie hast du das gemeint?« Ganz schwach drang Tante Mollys Stimme über den Balken. »Das mit der Verhandlung. Es gab doch schon eine Verhandlung, oder?«
Noch einmal kreisten die Bilder durch Cynthias Kopf: Wie sie mit diesem Inspektor in einer vor dem Haus der van Burens bereitstehenden Kutsche Platz nahm, um zu einem Polizeirevier in der Nähe gefahren zu werden. Dort das Verhör, ganz kurz nur, die unerbittliche Anklage eines Polizisten, Cynthias Verteidigungen. Dann die Vorführung Cynthias in einem Gerichtssaal, wo ein Richter mit weißer Perücke die gleichen Fragen stellte und die mögliche Strafe auf einen mehrjährigen Aufenthalt in einem Staatsgefängnis bezifferte. Schließlich die Fahrt mit einem weiteren Gefährt, diesmal in einem ausbruchsicheren, mit Stahlwänden verstärkten Wagen und uniformierter Bewachung, die schließlich durch das große Portal und in den Innenhof des Rabennestes führte.
»Es gab keine Verhandlung«, sagte Cynthia jetzt. »Ich wurde zwar einem Richter vorgeführt, aber ich hatte keinen Anwalt, es gab keine Zeugen. Das war wohl so etwas wie eine Vorverhandlung, eine Anhörung, keine Ahnung, was das war. Mir hat ja niemand auch nur ein Wort mitgeteilt, mit dem ich etwas anfangen konnte.«
Während sie das aussprach, hatte sich etwas in Tante Mollys Gesicht verändert, als wäre deren Kummer auf einmal noch größer, gewaltiger geworden. Wortlos saß die Frau da, den Blick auf irgendetwas gerichtet, das allein sie sehen konnte.
»Tante Molly, was ist los?«, fragte Cynthia tonlos.
»Du kennst ja Mr van Buren, du weißt um seine guten Beziehungen zu allen möglichen Herren der Gesellschaft.«
»Du denkst, er kann mir helfen? Oder was meinst du damit?«
»Ich kann es noch nicht genau sagen, Cyn, aber mir kommt da ein bestimmter Verdacht.«
Die letzten Worte standen zwischen ihnen wie etwas, das man mit den Händen berühren konnte.
»Was steckt hinter alldem?« Cynthia hörte die Verzweiflung in der eigenen Stimme.
Erst eine, dann alle Aufseherinnen klatschten in die Hände. »Besuchszeit vorbei«, verkündeten sie barsch.
»Du musst mit David sprechen«, beschwor Cynthia Tante Molly. »Und auch mit den van Burens. Egal, wie enttäuscht sie von mir sein mögen, egal, was sie glauben. Du musst es unbedingt versuchen.«
Schwerfällig erhob sich Tante Molly. »Ich komme wieder, sobald es mir möglich ist.«
»Sprich mit David!«
Hinter Tante Molly wurde die Tür geschlossen, und Cynthia blieb zurück in der Kälte des Rabennestes.
***
Kings County Zuchthaus lautete der offizielle Name des von einer hohen, streng bewachten Mauer umschlossenen Baus. Obwohl es eng von anderen Gebäuden eingekreist wurde, stellte es etwas Ureigenes dar, eine lebensfeindliche Insel inmitten eines Meeres. Alte Frauen bekreuzigten sich, wenn sie bei ihren täglichen Besorgungen hier vorbeikamen und das kehlige Krächzen der Raben hörten. Seit den 1840er Jahren, als das Rabennest entstanden war, hatte sich Brooklyn erheblich vergrößert – und das nahe gelegene New York war gar zu einem Riesen geworden, der sich weiter ausbreitete und für immer mehr Auswanderer aus allen Herren Ländern zu einem Magneten wurde. Nach mehreren Phasen des Umbaus und einer großangelegten Aufstockung der beiden Hauptgebäude bot das Kings County Zuchthaus mittlerweile Raum für beinahe sechshundert Insassen.
Nach dem Gespräch mit Tante Molly war Cynthia wieder in die Wäscherei geführt worden, eine einsame hilflose Gestalt, eingehüllt von den beißenden Dampfwolken. Lautlos wiederholte sie Tante Mollys Worte. Dass David van Burens Eltern nicht gerade glücklich darüber gewesen wären, hätte sich ihr einziger Sohn und Erbe des Familienimperiums mit einem Dienstmädchen abgesetzt, das war ja nachvollziehbar. Auch dass sie in diesem Fall Cynthia auf Nimmerwiedersehen vor die Tür gesetzt hätten. Was jedoch verbarg sich in Wirklichkeit hinter dem Schmuck, der so plötzlich in Cynthias Kammer aufgetaucht war? Denn um sie loszuwerden, hätte doch wohl eine simple Entlassung genügt. Oder konnte es sein, dass die van Burens derart große Angst vor neuerlichen romantischen Fluchtplänen hatten, dass sie so weit gingen, Cynthias Leben zu zerstören?
Wieder und wieder hörte sie Tante Mollys erschrockene Stimme: Du weißt um seine guten Beziehungen … mir kommt da ein bestimmter Verdacht … Was hatte sie damit gemeint?
Kurz darauf erfolgte das Abendessen. Diesmal allerdings konnte Cynthia ein paar Bissen zu sich nehmen. Der Tee war heiß und verbrannte ihr Zunge und Lippen, aber sie merkte es gar nicht. Ihr Körper war taub, ihr Bewusstsein schwer wie Blei. Nach dem Essen wurden die Insassinnen zurück in die Zellen gebracht.
Die Rothaarige und die Braunhaarige sahen kurz zu der Dicken, die in ihrer gesamten einschüchternden Breite auf ihrer Pritsche lag, die Arme vor der Brust verschränkt.
»Na, Schätzchen«, knurrte sie mit ihrer Männerstimme. »Hast du einen schönen ersten Tag gehabt?«
Wie als Antwort drangen einige Rabenschreie von draußen durch das dünne Fensterglas. Cynthia zog sich hoch auf ihre Pritsche und äußerte kein Wort.
»Hey, Schätzchen.« Die Dicke erhob sich, bewegte sich auf Cynthia zu, die sich bemühte, geradewegs durch die Frau hindurch zu starren. »Ich spreche mit dir, verdammt.«
Cynthia bekam mit, wie sich die anderen beiden Frauen mit einem erwartungsvollen Grinsen verständigten.
»Ich spreche mit dir! Hältst dich wohl für was Besseres, stimmt’s?« Bedrohlich rückte sie noch ein Stück weiter nach vorn. »Meinst wohl, uns brauchst du nicht zu beachten, was?«
Lass mich doch einfach in Ruhe, dachte Cynthia.
»Ich will eine gottverdammte Antwort von dir.« Stille.
»Eine! Verfluchte! Antwort!«
Der Arm der Frau zuckte vor, unerwartet schnell. Starke Finger, die sich in Cynthias langes schwarzes Haar gruben. Sie wurde zu Boden gerissen, stöhnte auf. Bevor sie auf die Beine kommen konnte, war die Frau mit ihrem gesamten Gewicht über ihr und presste die Luft aus ihren Lungen. Die riesige Hand griff nach ihrer Kehle, drückte zu, unerbittlich. Cynthia wehrte sich, ihre Finger umschlossen das fremde Handgelenk, zerrten daran – ohne Erfolg. Sie wand ihren Körper nach links, nach rechts, versuchte sich hochzustemmen. Sie hatte keine Chance.
»Ich will eine Antwort von dir!«
Cynthias Kräfte, ihre Sinne schwanden, nur noch in ihren Augen war etwas Leben. Sie starrte der Frau ins Gesicht, so hart und unbeeindruckt sie nur konnte. Im Unterbewusstsein nahm sie die Rothaarige und die Braunhaarige wahr, die inzwischen neben ihnen knieten und sich nichts entgehen ließen.
»Ich will eine Antwort von dir!«
Die Stimme war ganz weit weg, ebenso das Gelächter der beiden Zuschauerinnen, die ihren Spaß an der Darbietung hatten.
»Ich will eine Antwort von dir!«
Die kriegst du nie und nimmer, sagte Cynthias Blick, in den sie alles legte, was sie noch hatte, all ihren Trotz, all ihre Gegenwehr angesichts der Ungerechtigkeit, die ihr Leben in so kurzer Zeit völlig auf den Kopf gestellt hatte.
»Du willst doch nicht sterben wegen einer dämlichen Antwort«, knurrte die breite, schwere Frau, sogar noch weiter entfernt.
Doch, vielleicht … vielleicht nur wegen einer dämlichen Antwort.
»Eine Antwort!«
Nein!
Alle Laute vermischten sich zu einem einzigen dumpfen Brummen. Das Lachen, das Schnaufen, die Schreie der Raben von draußen.
***
Es ertönte ein zweimaliges Klatschen, laut wie Peitschenhiebe. Schläge, mit denen zuerst die Rothaarige, dann die Braunhaarige eine Ohrfeige versetzt bekamen.
Nur ganz langsam gelang es Cynthia, die flach ausgestreckt dalag, ihren Kopf zu heben. Die eisenhart zugreifende Hand war von ihrer Kehle verschwunden. Die beiden Frauen lagen nun ebenfalls auf dem Boden und stierten verständnislos auf die Dicke, die sich erhoben hatte und einen Schritt von Cynthia entfernt dastand.
»Ich kann euer dummes Gelächter einfach nicht mehr hören«, herrschte sie die beiden an, während sie weiterhin Cynthia musterte, mit einem Ausdruck, der irgendwie zwischen Ungläubigkeit und Anerkennung zu schwanken schien.
Die beiden Frauen rappelten sich auf und achteten darauf, der Dicken nicht in die Quere zu kommen, sondern sich rasch auf die eigenen Pritschen zurückzuziehen.
Mühsam zwang sich jetzt auch Cynthia auf die Beine, schwach, aber auch stolz, dass sie es geschafft hatte, Widerstand zu leisten. Demonstrativ blickte sie an den Frauen vorbei, einfach nur aus dem kleinen Fenster hinaus, hinter dem ein schwarzer, wolkenloser Himmel prangte.
Vielleicht steckt mehr in dir, als du bislang gedacht hast, sagte sie sich.
Die Frau mit der urwüchsigen Kraft stemmte die Fäuste in die Hüften und musterte Cynthia nach wie vor ratlos. »Du bist ein ganz besonderes Früchtchen, was?«
Und sie erhielt – natürlich – keine Antwort. Was sie diesmal allerdings nicht in Wut versetzte, sondern lediglich zu einem schiefen Grinsen veranlasste. »Hast keinen Mucks gemacht, als ich deine hübsche Haarpracht geschnappt habe. Hat wehgetan, was? Und trotzdem: kein Mucks. Wirklich hübsche Haare. Na ja, in der Frühe kommen sie ab.«
Cynthia starrte aus dem Fenster, als böte es eine sehenswerte Aussicht.
Die Frau sagte: »Schätzchen, es würde mich jucken zu wissen, was da vorhin durch dein Dickschädelchen gegangen ist. Und was du jetzt gerade denkst.«
Nun erst wandte sich Cynthia vom Fenster ab und betrachtete die Frau. »Was ich denke? Ganz einfach: nicht durchdrehen, nicht aufgeben, Schätzchen.«
Worauf die Dicke laut auflachen musste. Das Lachen eines Grizzlybären. »Langsam gefällst du mir.« Erneut schoss ihre Pranke auf Cynthia zu. Diesmal jedoch nur zu einem knappen, aber kraftvollen Handschlag. »Man nennt mich Big Nose Kay.«
»Der Name passt«, sagte Cynthia. Obwohl ohnehin alles an der Frau big, also groß war, nicht nur die Nase.
»Und mit wem habe ich das Vergnügen?«
»Cynthia.«
»Gut, dass du dich doch noch dazu entschieden hast, deine Stimme zu gebrauchen, Schätzchen. Kann ja auch eine ziemlich scharfe Waffe sein, stimmt’s?«
Nun musste auch Cynthia lachen, zumindest ein wenig. Das erste Mal im Rabennest. »Stimmt«, meinte sie.
Polternd ließ sich Big Nose Kay auf die Pritsche fallen. Gleich darauf lag auch Cynthia wieder auf ihrer Schlafstelle. Ihre Kehle, die bestimmt blutunterlaufen war, schmerzte noch von Big Nose Kays hartem Griff. Seit sie das Rabennest betreten hatte, waren etwa vierundzwanzig Stunden vergangen. Eine Zeit, die ihr unfassbar lang vorkam. Sie konnte kaum glauben, dass das Leben außerhalb dieses gewaltigen Steinberges einfach weiter seinem gewohnten Gang folgte. Während sie von der Pritsche zur Zellendecke starrte, sah sie das Haus der van Burens vor sich, an dem nach und nach die Lichter angingen.
Wo mochte David sein, was mochte er tun? Wie groß war der Zorn seiner Eltern auf ihn? Dachte er an Cynthia, wie sie gerade an ihn dachte? Draußen krächzten die Raben.
Zu ihrer Überraschung verspürte sie eine gewisse Müdigkeit, womöglich sogar Gleichgültigkeit. Als wäre es etwas ganz Normales, sich in dieser Zelle zu befinden und sich auf dieser widerwärtigen Matratze auszustrecken. Sie lag auf der Seite und strich über jenen kleinen verblassten Vollmond auf ihrer Haut, der unerträglich juckte; fast schien es, als wäre im Rabennest etwas in ihr zum Leben erweckt worden. Nie hatte Cynthia die Narbe so deutlich gespürt wie jetzt.
Lediglich ein einziges Mal hob sie noch ihren Kopf, bevor die Welle aus Schlaf sie überwältigte, nur ganz kurz, und für einen verwirrenden Moment meinte sie vor der Zellentür David wahrzunehmen. Genau wie in der Nacht zuvor: als den kleinen Jungen von früher, das reizende Kind mit den Locken. Und abermals war da etwas, das ihr fremd erschien. Sie wollte genauer hinsehen, dann jedoch wurde die Müdigkeit übermächtig.
Sie erwachte erst wieder, als die Sonne verhalten in das von außen vergitterte Fenster mit der verdreckten Scheibe schien. Alles lief ab wie am Vortag. Wiederum nahm Cynthia ihren Platz zwischen den beiden Trögen ein. Sie hatte gerade erst ihre Arbeit begonnen, als eine Aufseherin sie aus dem sturen Trott riss und aus der Wäscherei hinausführte. Sofort lebte etwas in Cynthia auf. Sie machte sich innerlich bereit für den Besucherraum, hoffte inständig darauf, gleich Tante Molly gegenübertreten zu dürfen. Oder vielleicht sogar David?
Gewissheit durchflutete sie. David. Ja, er musste es sein, endlich, endlich. Das war der Moment, der alles ändern, alles in die richtigen Bahnen lenken würde. Cynthia spürte, wie ihr Herz heftig zu trommeln begann. Sie stellte sich vor, wie David sie ansehen, fragte sich, was er zu ihr sagen würde.
Zu ihrer Überraschung wurde sie zunächst eine Treppe hinaufgeführt ins oberste Stockwerk des Rabennestes. Ein zweiter Besuchersaal?, schoss es ihr durch den Kopf. Vor ihr öffnete sich eine Holztür, und sie erstarrte.
***
Kein Besucherraum. Keine Gespräche. Nichts. Big Nose Kay hatte mit der knappen, gehässigen Bemerkung, der Cynthia gar keine Beachtung geschenkt hatte, recht behalten.
Nicht David oder Tante Molly erwarteten Cynthia, sondern bloß eine Insassin des Rabennestes, die dazu eingeteilt war, den Neuzugängen die langen Haare abzuschneiden.
Wie betäubt saß Cynthia auf einem Schemel und verfolgte, wie ihre schwarzen Haare auf dem nackten Boden landeten und mit einem Besen weggefegt wurden. Es war, als würde ihr ganzes Leben zusammengekehrt, um in einem Mülleimer aus rostigem Blech zu enden. Und zum ersten Mal war sie nicht stark genug, gegen die Tränen anzukämpfen. Schluchzend sank sie in sich zusammen, das Gesicht in den Händen verborgen, während mit der Schere ungerührt die letzten Schnitte vorgenommen wurden.
In den folgenden Stunden in der Wäscherei bekam sie nichts von dem mit, was sie tat, nicht die allgegenwärtige Hitze oder die Zurufe der anderen Frauen, alles schien weit entfernt. Erst beim Abendessen kehrte Cynthias Bewusstsein zurück, als sie auf ein paar Kartoffelbrocken herumkaute.
Zurück in der Zelle wurde sie von einem meckernden Gekicher der Rothaarigen begrüßt: »Och, die ganze schöne Haarpracht, einfach weg, was?« Big Nose Kay antwortete kurz und bündig: »Halt die Klappe, du Miststück.« Keine Erwiderung. Es war wieder einmal klar, wer hier den Ton angab.
Cynthia stellte sich ans vergitterte Fenster, betrachtete die Welt da draußen, von der sie ausgeschlossen war. Hier und da wurden hinter Fenstern die ersten Kerzen oder Petroleumlampen entzündet. Schimmernde Lichtpunkte inmitten des grauen Dämmers, der sich vom Himmel hinabsenkte.
Sie wusste nicht, wie lange sie schon regungslos auf der gleichen Stelle stand, als Big Nose Kay neben sie trat. »Immer daran denken: Nicht durchdrehen, nicht aufgeben, Schätzchen.«
Cynthia erwiderte ihren Blick. »Ist nicht so einfach, wie es sich anhört.«
Ein kurzes freudloses Lachen. »Die Haare darf man verlieren, aber nicht den Verstand. Sonst wird es ganz bitter.«
»Es ist nicht wegen der Haare, es ist wegen allem«, betonte Cynthia. »Ich bin unschuldig. Ich habe nichts getan.«
Big Nose Kay winkte ab. »Alle hier sind unschuldig. Jedenfalls behauptet das jede von sich. Bei dir, das gebe ich zu, glaube ich es sogar.«
»Und wieso gerade bei mir?«, fragte Cynthia zweifelnd.
Kay lachte erneut. »Na, weil ich es riechen kann. Bei dir riecht man das doch. Dazu braucht man nicht mal eine so große Nase wie meine. So brav riechst du, so verdammt anständig, dass ich zunächst dachte, du wärst direkt vom Himmel zu uns armen Sündern herabgeschwebt.«
Cynthia lächelte schmal. Sie konnte kaum glauben, dass sie hier stand und sich so einfach mit dieser Frau unterhielt, die ihr zuvor höllische Angst eingejagt hatte.
Sie wechselten noch ein paar Worte, dann stellte Big Nose Kay ihr die beiden anderen Frauen vor. Die Rothaarige wurde Sue genannt, die andere hieß Esther. In den Blicken der beiden fand sich nicht mehr dieses Gehässige, Bösartige. Sie zuckten nur kurz mit den hageren Schultern. Big Nose Kay hatte beschlossen, dass Cynthia kein Opfer mehr war, und die beiden akzeptierten es, wie sie auch jeden anderen Beschluss Kays akzeptiert hätten.
Bedeutete das, dass Cynthia jetzt im Rabennest angekommen war? Sie stellte sich diese Frage mit einem Frösteln.
»Unschuldig riechst du auch jetzt noch«, bemerkte Big Nose Kay nach einer Weile. »Und das ist aller Ehren wert. Meistens genügen ein paar Stunden im Rabennest, um den Duft der Unschuld verschwinden zu lassen.« Sie grinste breit. »Aber in dir scheint tatsächlich ein Kämpferherz zu stecken, das man auf den ersten Blick nicht vermuten würde.«
»Ich könnte jedenfalls ein Kämpferherz gebrauchen.«
»Gestern habe ich es schon ganz deutlich gespürt, Schätzchen. Das kannst du mir glauben.«
Die Bemerkung tat Cynthia auf unerwartete Weise gut. Es gelang ihr, endlich mehr Ordnung in ihre Gedanken zu bringen. Und darüber hinaus ein paar Fragen zu stellen, die bislang einfach nicht an die Oberfläche gedrungen waren. Fragen, die das Rabennest betrafen. Was sie allerdings erfuhr, klang alles andere als ermutigend.
Das Rabennest galt als eines der schlimmsten Gefängnisse der gesamten Ostküste. Knallharte Aufseher, Schmutz, Ungeziefer. Im Winter herrschten unerträgliche Temperaturen: Viele der Insassen erfroren. Und an Flucht war nicht zu denken, das Gefängnis galt als beeindruckend sicher. Für die weiblichen Gefangenen gab es zwei Beschäftigungsmöglichkeiten, die Wäscherei und eine Schuhmacherei. Dort war die Arbeit laut Kay etwas angenehmer. Die Aufsicht führten neben den Wärterinnen gelernte Schuhmacher, die man von außerhalb des Rabennestes holte und die angeblich sogar gut bezahlt wurden. Jede der zwölf Insassinnen, die dazu eingeteilt wurde, Schuhe herzustellen, erhielt einen Platz an einer Nähmaschine. Die Schuhmacherei befand sich im zweiten Stockwerk des Gefängnisses. Egal, wo man arbeitete, der Lohn betrug nicht mehr als ein paar Cent täglich.
Natürlich erkundigte sich Cynthia auch nach den erlaubten Besuchszeiten, doch Big Nose Kays Antwort ließ sie aufseufzen.
»Die meisten, die in unserem gemütlichen Rabennest landen, bekommen sowieso kaum noch Besuch«, erklärte Kay. »Die will keiner mehr sehen. Aber offiziell darf man einmal im Monat Besuch erhalten.«
Einmal im Monat, wiederholte Cynthia stumpf in Gedanken.
»Willkommen im Rabennest«, setzte Kay trocken hinzu.
Trotz Kays Erklärungen hoffte Cynthia in den folgenden Tagen darauf, Tante Molly oder David würde es irgendwie gelingen, sie sehen zu dürfen. David würde ihr helfen, sie wusste es genau. Bald, dachte sie. Aber nichts geschah.
Zähflüssig kroch die Zeit voran, bis Cynthia eines Abends von einer Aufseherin etwas in die Hand gedrückt bekam: einen Brief. David!, fuhr es Cynthia durch den Kopf. Ein paar spitze Bemerkungen machten ihr klar, dass eine Nachricht von draußen Neid auslöste. Sie drückte das Schreiben fest an sich, während sie in der üblichen Reihe zurück zu den Zellen gebracht wurden.
Dort warf sie sich sofort auf ihre Pritsche, starrte gebannt auf den Schatz aus Papier und ignorierte dabei die Tatsache, dass der Umschlag ziemlich zerfetzt war – offenbar hatte ihn bereits jemand rücksichtslos geöffnet. Sie riss das Schreiben aus der Hülle.
Im ersten Moment machte sich Enttäuschung in ihr breit. Diese Zeilen stammten nicht von Davids gleichmäßiger, eleganter Handschrift, sondern waren von einer weniger geübten Hand gezogen worden. Die letzten Reste Tageslicht, die schwach durch das kleine Fenster flackerten, schenkten gerade noch genügend Helligkeit. Voller Anspannung las Cynthia, was Tante Molly ihr mitteilte:
New York City, Columbus Avenue, den 6. November 1877
Meine Cynthia, mein liebes Kind,
wie sehr vermisse ich es, Deine Stimme zu hören. Aber was fällt mir ein, jetzt zu jammern! Wo es doch Dir umso vieles schlechter ergeht! Mein armes Kind! Immer habe ich Dich Kind genannt, obwohl Du nicht mein Fleisch und Blut bist. Doch stets warst Du wie eine Tochter für mich.
Wie unvorstellbar schmerzhaft es war, Dich im Gefängnis zu sehen. Am liebsten würde ich Dich jeden Tag besuchen, doch das ist verboten. Nur ein einziges Mal im Monat darf ich zu Dir. Bestimmt hat man Dir das gesagt.
Ach, was bin ich gedankenlos! Ich weiß, wie sehr Du auf Neuigkeiten von David hoffst! Aber Cynthia – bitte verzweifle jetzt nicht – ich habe ihn seit Deiner Verhaftung nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, wo er sich aufhält, doch sobald ich etwas herausfinde, wirst Du es erfahren. Versprochen!
Und noch viel schlimmer ist, dass sich mein Verdacht wohl bestätigt hat. Denn wie es jetzt aussieht, hat