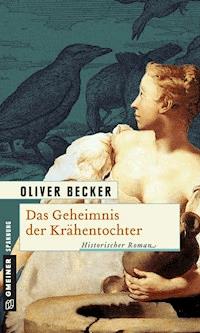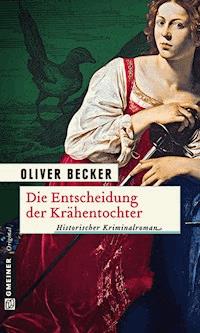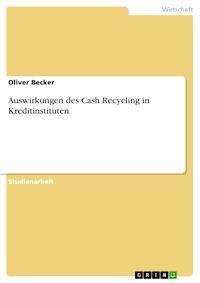3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Privatdetektiv John Dietz
- Sprache: Deutsch
Privatdetektiv John Dietz hat ein Problem: Er hat keinen Auftrag und muss sich mit kleinen Kaufhausjobs über Wasser halten. Doch dann steht plötzlich Laura Winter vor seiner Tür. Ihre Schwester Felicitas ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Überfahren von einem Unbekannten. Was Laura vor ein noch viel größeres Rätsel stellt: Felicitas hat vor ihrem gewaltsamen Tod ein Doppelleben geführt. Sie war nicht die, für die sie sich ausgegeben hat. Aber wer war sie wirklich? Und warum hat sie Freunde und Familie seit Jahren belogen? John Dietz ermittelt in seinem ersten Fall und sticht dabei schon bald in ein Wespennest ...
"Schmetterlingstod" ist der erste Roman der Krimi-Serie um Privatermittler John Dietz. Der Autor Oliver Becker führt seine Leser an Originalschauplätze in Freiburg und schildert gekonnt die Idylle einer Stadt, in die unvermittelt das Verbrechen einfällt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Prolog
1. Das Leben einer Toten
2. Die stumme Maja
3. Ein trauriger Bär
4. Lady Butterfly
5. Das falsche Haus
6. Eine kalte Dusche
7. Flecken an der Wand
8. Wer ist Mojtovian?
9. Gummibärchen
10. Kopf oder Zahl
Epilog
Leseprobe
Über dieses Buch
John Dietz zweifelt: War es wirklich eine gute Idee, die eigene Privatdetektei zu eröffnen? Ausgerechnet in Freiburg. Einer Stadt mit einem Image so sauber wie frisch gewaschene Wäsche. Tatsächlich ist weit und breit kein Fall in Sicht und John muss sich mit kleinen Kaufhausjobs über Wasser halten, als plötzlich Laura Winter vor seiner Tür steht. Ihre Schwester Felicitas ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Überfahren von einem Unbekannten. Was Laura vor ein noch viel größeres Rätsel stellt: Felicitas hat vor ihrem gewaltsamen Tod ein Doppelleben geführt. Sie war nicht die, für die sie sich ausgegeben hat. Aber wer war sie wirklich? Und warum hat sie Freunde und Familie seit Jahren belogen? John Dietz nimmt die Ermittlungen auf, ohne zu ahnen, dass er dabei schon bald in ein Wespennest sticht … Doch zum Glück kann er sich auf seine Helfer verlassen: Elvis, den sprechenden Papagei und Tante Ju, die kettenrauchende Zeitungsjournalistin.
»Schmetterlingstod« ist der erste Roman der Krimi-Serie um Privatermittler John Dietz – flott erzählt mit einem spannenden Plot zum Miträtseln und Freiburger Atmosphäre. Denn auch in den schönsten Städten schläft das Verbrechen nie.
Über den Autor
Oliver Becker stammt aus Blumberg im Schwarzwald und lebt mit seiner Familie in Frankfurt am Main. Er schreibt Historische Romane und Kriminalromane. Zu seinen bekanntesten Veröffentlichungen zählt die Trilogie um die »Krähentochter«. Bei beTHRILLED ist neben den John-Dietz-Romanen auch der Kriminalroman »Der dritte Mord« erschienen.
Oliver Becker
SCHMETTERLINGSTOD
Ein Fall für Privatdetektiv John Dietz
Kriminalroman
beTHRILLED
Digitale Originalausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion/Lektorat: Charlotte Inden
Covergestaltung: Kirstin Osenau unter Verwendung von Motiven © shutterstock/evannovostro, © shutterstock/Klaus Ulrich Mueller, © shutterstock/Ihnatovich Maryia
Dieses eBook enthält eine Leseprobe des in der Bastei Lübbe AG erscheinenden / erschienenen Werkes »Drachenspur« von Oliver Becker.
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Covergestaltung: Kirstin Osenau unter Verwendung von Motiven © shutterstock/evannovostro, © shutterstock/Jaromir Chalabala, © shutterstock/9Tiw, © shutterstock/takiwa
eBook-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-4504-9
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Prolog
Niemals zuvor hatte sie sich so lebendig gefühlt. Niemals zuvor hatte sie auch nur annähernd so intensiv gesehen, gehört, gerochen. Ihr eigenes Lachen war unglaublich klar und deutlich und schien in ihrem Kopf widerzuhallen. Die Farben, die in grellen Blitzen den Himmel zerschnitten, hatten eine geradezu elektrisierende Leuchtkraft.
Sie riss die Augen auf, so weit, dass es fast schmerzte, und am liebsten hätte sie die ganze Welt umarmt.
»Ich will fliegen«, hörte sie ihre vibrierende, sich überschlagende Stimme.
»Dann flieg doch einfach, mein Mädchen«, sagte sofort der Mann, der neben ihr stand und den sie erst jetzt wieder wahrnahm. »Na los, flieg, so hoch du kannst.«
Und plötzlich fühlte sie keine Erde mehr, nur noch ein Schweben, das um sie herum und tief in ihr war. Sie flog, flog, flog.
»Genieß es, mein Mädchen«, rief der Mann ihr hinterher, doch seine Stimme klang bereits weit entfernt.
Sie flog weiter, immer weiter, direkt auf die grellen Blitze zu, die wieder und wieder in das Nachtblau stachen, um sich in Sekundenschnelle aufzulösen. Ich fliege, dachte sie, und alles war perfekt, makellos.
Bis auf dieses Brummen, das auf einmal irgendwo vor ihr ertönte, erst leise, dann rasch lauter werdend. Was ist das?, fragte sie sich irritiert.
Das Brummen wurde kräftiger, kam noch näher und plötzlich war es so nah, so unmittelbar.
Was ist das?
Und dann spürte sie, wie das Brummen sie erfasste, sie zerquetschte, sie auffraß. So schnell, wie eben noch die bunten Blitze in der Nacht aufflammten, um für immer zu verschwinden.
1. Das Leben einer Toten
Er beobachtete sie von seinem Bürofenster aus. Zuerst war sie ihm aufgefallen, weil sie attraktiv war. Dann, weil er sie wiedererkannte.
Mehr als zehn Jahre war es her, seit er Laura Winter zuletzt gesehen hatte – bei ihrer gemeinsamen Abitur-Abschlussfeier. Er wusste nur, dass sie bald darauf aus Freiburg weggezogen war. In der gemeinsamen Zeit auf dem Gymnasium hatten sie nicht viele Worte miteinander gewechselt. Auf jeden Fall keine freundlichen. Und jetzt stand sie dort unten auf dem noch regennassen Kopfsteinpflaster und schien über irgendetwas nachzugrübeln. Auch wenn er sich im dritten Stock befand und sie ziemlich weit weg auf der gegenüberliegenden Seite der Kaiser-Joseph-Straße war, nahm er die Anspannung in ihrem Gesicht wahr. Menschen hasteten an ihr vorüber, sie hingegen blieb, wo sie war, und trat dabei unablässig von einem Fuß auf den anderen.
Nein, er hatte sie nie leiden können. Und sie ihn erst recht nicht.
Er ließ sich auf den Schreibtischstuhl plumpsen. Sein Blick fiel auf den Stapel Visitenkarten, die er für viel zu viel Geld hatte drucken lassen. Bewusst schlicht die Worte der Vorderseite, in dezenter Schrift:
John Dietz, Privatdetektiv
Ermittlungen jeder Art
Von den Karten sah er zu seinem Festnetztelefon, das seit Tagen ebenso stumm war wie das danebenliegende Handy. »Tja«, sagte er, und das Wörtchen hing leer im Raum. Er stand auf und wollte in den direkt angeschlossenen Rückzugsraum gehen, als die Klingel ertönte.
Rasch drückte er den Knopf der Sprechanlage: »Ja, bitte?«
»Bin ich bei der Detektei?«
»Na sicher«, sagte John Dietz und betätigte mit dem zweiten Knopf den Türsummer. »Im dritten Stock. Der Aufzug ist gleich rechts.«
Als er kurz darauf die Tür öffnete, war er überrascht. Obwohl er sie eben noch beobachtet hatte, war sie seinen Gedanken schon wieder entschlüpft. Sichtlich unschlüssig betrat sie das Büro. Ein Händedruck und sie nahmen einander gegenüber Platz.
»Du hast dich kein bisschen verändert«, sagte er und kam sich irgendwie albern vor.
»Du dich auch nicht.«
John Dietz versuchte ein Lächeln und musterte sie. Aufrechte Haltung, blondes Haar, nicht mehr ganz so lang wie früher, und dieser leicht überhebliche Ausdruck in ihrem Gesicht, der ihm noch bestens vertraut war, wie er jetzt feststellte.
»Was kann ich für dich tun, Laura?«
Ihre gerunzelte Stirn zeigte die Anspannung, die ihm bereits vom Fenster aus an ihr aufgefallen war. Oder die Zweifel, die sie hatte. Zweifel an ihm?
»Es geht um meine Schwester.«
»Ich wusste nicht, dass du eine Schwester hast.«
»Ich hatte eine.« Laura Winter sah ihm geradewegs in die Augen. »Sie ist tot.«
»Das tut mir leid«, sagte er ehrlich.
»Felicitas war deutlich jünger als ich, volle neun Jahre«, fuhr sie fort, als hätte er überhaupt nichts gesagt. »Vor zwei Monaten wurde sie überfahren. Der Täter beging Fahrerflucht.« Eine nüchterne Stimme, die nüchterne Worte sprach. Und die doch nicht verbergen konnte, wie sehr der Schmerz in Laura wütete.
John bemühte sich, mitfühlend zu klingen: »Wie gesagt, es tut mir sehr leid. Falls ich dir helfen kann …«
»Deshalb bin ich hier«, fiel sie ihm hart ins Wort.
Es hatte offensichtlich nicht geklappt mit dem Mitgefühl. Oder es war eher so, dass Laura Winter auf Mitgefühl pfiff.
»Okay«, sagte John nach einer kurzen Stille. »Du willst also, dass ich den Fahrer ausfindig mache.«
Prüfend sah sie ihn an. »Was hätte ich davon?«, fragte sie kalt. »Oder meine Schwester?«
Verdutzt sah er auf. »Na ja, ich denke, es ist doch nur normal, dass ein Angehöriger möchte, dass derjenige …«
»Es geht mir im Moment keineswegs um den Fahrer«, unterbrach sie ihn erneut. »Ich hoffe, dass ihn die Erinnerung an den Moment, als es passierte, jede Sekunde seines Lebens quält. Dass er keine einzige Nacht mehr friedlich schläft. Dass er sich selbst dafür unendlich hasst. Aber die Polizei hat seinen Wagen in den letzten zwei Monaten nicht ermitteln können und deshalb – entschuldige meine Offenheit – glaube ich nicht im Geringsten, dass du es schaffen würdest.«
»Um was geht es dir dann?«
Sie lehnte sich im Stuhl zurück. »Ganz offen: Ich weiß wirklich nicht, ob es eine so tolle Idee war, hierherzukommen.«
»Wenn du mir nicht erzählen möchtest …«
»Also schön, hör einfach zu«, schnitt Laura Winter ihm zum dritten Mal das Wort ab. »Es war kurz nach meinem Abitur: Unsere Familie zog nach Stuttgart. Alles war in Ordnung, Vater hatte eine neue Stelle in einem Stuttgarter Krankenhaus. Du weißt vielleicht noch, dass er Chirurg ist. Mutter stammt aus Stuttgart und freute sich sowieso auf den Umzug. Ich begann zu studieren, und Felicitas bereiteten der Wechsel der Stadt und der Schule keine Probleme. Felicitas und ich hatten immer ein gutes Verhältnis. Als sie älter wurde, waren wir wie Freundinnen. Wir erzählten uns alles, wir machten Quatsch miteinander, der Altersunterschied spielte keine Rolle.«
John betrachtete sie, während sie sprach. Eine attraktive Erscheinung, zweifellos. Eine Frau, die immer wusste, was sie wollte. Die es einem nicht leicht machte, sie sich trauernd vorzustellen. Gefasst und souverän, so saß sie auf dem Stuhl in seinem Büro.
»Nach ihrem Abitur«, fuhr Laura fort, »zog es Felicitas zurück nach Freiburg, sie mochte die Stadt schon immer. Das war vor drei Jahren. Das erste Semester, die ersten Klausuren, alles bestens. Wir sahen uns natürlich nicht mehr so häufig, aber wir haben oft telefoniert, uns Nachrichten über WhatsApp geschickt. Wie das eben so ist.«
»Und dann?«
»Und dann die Nachricht von ihrem Tod.« Wieder bemühte sich Laura, hart und souverän zu klingen. John fand, sie übertrieb es damit.
»Bei dem Unfall«, sprach sie im selben Tonfall weiter, »wurde Felicitas von dem Fahrzeug komplett überrollt. Sie war so entstellt, dass man sie kaum wiedererkannte.«
»Wo ist das passiert?«
»In der Kartäuserstraße. Ziemlich weit oben.«
»Gibt es einen besonderen Bezug zu der Straße?«
»Außer dass meine Schwester dort starb?«, kam die prompte Gegenfrage, als wäre das hier ein Duell, das mit Worten geführt wurde.
»Gibt es«, startete John einen neuen Versuch, »eine ganz bestimmte Verbindung von Felicitas zu dieser Straße? Hat sie sie je erwähnt?«
»Nein.« Sie räusperte sich. »Jedenfalls nicht, dass ich wüsste.«
»Wo hat deine Schwester gewohnt?«
»In einem Studentenwohnheim. Zwei Wochen nach Felicitas’ Beerdigung in Stuttgart fuhr ich mit unserem Vater nach Freiburg, um ihr Zimmer auszuräumen und ihre Sachen nach Hause zu bringen.« Sie holte Luft. »Was uns erwartete, war eine ziemliche Überraschung. Ihr Zimmer in dem Wohnheim: Da lebte eine andere Studentin. Schon seit einer ganzen Weile. Ihre Sachen waren einfach nicht mehr da. Der Hausmeister erinnerte sich an Felicitas, jedoch nur vage. Bereits vor mindestens einem Jahr soll sie ausgezogen sein.«
»Hast du ihr nie Post geschickt? Oder deine Eltern?«
»Doch, das haben wir. Aber an ein Postfach. Felicitas hatte uns erklärt, dass in dem Wohnheim manchmal Post verloren ginge. Die Briefkästen wären oft kaputt, betrunkene Chaoten würden die Namensschilder verschwinden lassen. Und so weiter.«
»Hast du dir die Briefkästen angesehen, als du mit deinem Vater da warst?«
»Nein«, erwiderte sie nicht ohne Schärfe. »Wir hatten andere Dinge im Kopf. Nach dem Gespräch mit dem Hausmeister fuhren wir zur Universitätsverwaltung. Dort war Felicitas noch immer unter der Adresse in dem Wohnheim gemeldet. Wir gingen zum Deutschen und zum Historischen Seminar. Aber es stellte sich heraus, dass sie seit mindestens einem Jahr keine Veranstaltung besucht, keine Arbeiten abgeliefert, an keiner Arbeitsgruppe teilgenommen hatte. Wir sprachen mit mehreren Professoren und Dozenten. Was schätzt du: Wie viele davon konnten sich an sie erinnern?«
John hob die Schultern und verzichtete auf einen Tipp.
»Einer. Und der auch nicht gerade lebhaft.« Sie verzog den Mund. »Er wusste noch, dass sie ›überaus attraktiv‹ war, wie er sich ausdrückte.«
»Was ist mit den Studiengebühren? Wären sie nicht mehr gezahlt worden, hätte man Felicitas exmatrikuliert.«
»Mein Vater hat ihr monatlich einen Betrag auf ihr Girokonto überwiesen, von dem die Gebühren per Dauerauftrag abgingen. Und daran hat sich, soweit ich weiß, nichts geändert.«
»Merkwürdig. Nicht mehr in ihrer Wohnung, nicht mehr bei den Seminaren an der Universität. Und du hast davon nichts geahnt?«
»Nein.«
John sah Laura an, wie schwer es ihr fiel, sich das eingestehen zu müssen. »Freundinnen? Ein Freund?«, hakte er weiter nach.
»Früher in Stuttgart wusste ich immer, für wen sie schwärmte, wen sie traf, welchen Freundinnen sie vertraute. Als sie dann nach Freiburg zurückging, änderte sich das automatisch. Sie nannte den einen oder anderen Vornamen von Studentinnen, mit denen sie sich angefreundet hatte. Aber eigentlich …« Ihre Stimme verlor sich.
»Also keinen Freund?«
»Ich habe sie oft danach gefragt, habe sie geneckt. Klar. Wie das so üblich ist unter Schwestern. Erfahren habe ich nur von einem gewissen Jan, mit dem sie ein paarmal ausging. Doch das ist lange her, und dieser Jan war bald Geschichte …« Wieder das Schweigen. Es schien ihr peinlich zu sein, nicht mehr über die eigene Schwester sagen zu können. Sie presste die Lippen aufeinander.
»Wann hast du sie zuletzt gesehen?«
»Am 60. Geburtstag unseres Vaters.« Nach einer kurzen Pause fügte sie hinzu: »Vor weit mehr als einem Jahr.«
»Ist dir da etwas an ihr aufgefallen? Etwas, das damals noch nicht, allerdings im Nachhinein irgendwie auffällig erscheint?«
»Nein, sie war, wie sie immer war. Blendend gelaunt, schlagfertig, interessiert. Sie freute sich, die Familie wiederzusehen.« Laura schien einen Moment lang nachzudenken. »Gut, sie wirkte ein wenig müde. Das käme vom Stress an der Uni, hat sie damals nur gesagt.«
Für einen Moment schien es, als würde Laura die Beherrschung verlieren, die sie sich offensichtlich aufgezwungen hatte. Als würde sie in Tränen ausbrechen. Schnell hatte sie sich jedoch wieder im Griff und starrte John mit festem Blick über den Schreibtisch hinweg an.
»Vor weit mehr als einem Jahr«, wiederholte er leise.
»Ja.« Sie räusperte sich. »Seitdem nur noch Telefonate. Und auf einmal die Nachricht von ihrem Tod.«
»Darf ich dich etwas fragen?«
»Bitte«, antwortete sie. Höflich, nicht freundlich.
»Warum hat deine Schwester in einem Studentenwohnheim gelebt? Ich kenne die meisten davon in Freiburg, und ich dachte …« Er wog seine Worte ab.
»Du meinst«, kam Laura ihm zuvor, »warum ein Wohnheim, obwohl meine Eltern genügend Geld haben, um ihr ein schickes kleines Loft zu mieten oder gleich zu kaufen? Das wolltest du fragen, oder?«
»So ähnlich.«
»Felicitas wünschte sich das so. Ich weiß noch, wie sie sagte: ›Ich bin eine Studentin. Also werde ich unter einem Dach mit anderen Studenten leben.‹« Laura Winter musterte ihn. »Weitere Fragen?«
Sie würde weitaus hübscher wirken, dachte John, wenn sie nicht ganz so schnippisch wäre. »Eine Frage habe ich tatsächlich noch.« Er verschränkte die Arme vor der Brust. »Was soll ich tun? Wie kann ich dir helfen?«
»Darf ich zuvor etwas wissen?« Es klang nicht wie eine Frage.
»Bitte«, sagte er in genau dem gleichen Ton wie zuvor sie.
»Wie lange bist du schon Privatdetektiv?«
»Lange genug, um einige Erfolge vorzuweisen«, erwiderte John so schnell, dass er sich selbst überraschte.
»Welche Fälle übernimmst du in der Regel?«
Jeden, den ich kriegen kann, dachte er. Laut sagte er: »Ach, ich bearbeite die unterschiedlichsten Angelegenheiten. In letzter Zeit ging es um Personenschutz, Betriebsspionage, um Wirtschaftskriminalität ganz allgemein. Nun ja, kleinere Sachen ebenfalls. Eifersüchtige Ehemänner, was auch immer.«
Laura sah ihn an, und er hatte das unangenehme Gefühl, dass sie ihn mühelos durchschaute. Es kam ihm vor, als könnte sie in seinem Gesicht lesen, dass er in den vergangenen Wochen und Monaten vor allem für ein Kaufhaus und eine Drogeriekette auf die Jagd nach Ladendieben gegangen war. Dass seine größten Fälle 15-jährige Mädchen betrafen, die Lippenstifte und Lidschatten stibitzt hatten.
»Also«, meinte John schließlich. »Was soll ich für dich tun?«
»Du sollst alles über das Leben einer Toten in Erfahrung bringen.« Beinahe unwirsch strich ihre Hand durch die Luft. »Ich will wissen, wie meine Schwester das letzte Jahr ihres Lebens verbracht hat.«
»Hast du ein Foto von ihr dabei?«
Wortlos legte Laura Winter eine Farbfotografie auf den Tisch. John nahm sie nicht an sich, sondern besah sich nur kurz das Gesicht, das ihm entgegenstarrte.
Aus dem kleinen Nebenzimmer drang auf einmal ein gekrächzter Gesang zu ihnen: »Love me tender …«
Lauras Augenbrauen schnellten in die Höhe. »Wer ist das? Ein … Mitarbeiter?« Skeptisch sah sie ihn an.
»Sozusagen meine rechte Hand: Das ist Elvis.«
»… love me sweet …«
»Elvis lebt also.« Ein trauriges Lachen Lauras. »Und das ausgerechnet bei John Dietz.«
Das Krächzen verklang.
»Elvis ist ein Papagei«, erklärte er überflüssigerweise.
Die Andeutung eines weiteren Lächelns. »Ich wusste immer, dass du einen Vogel hast.«
»Danke für dein Vertrauen«, erwiderte er ironisch.
»John, ich will wirklich ganz offen sein.« Zum ersten Mal nannte sie seinen Namen. »Mit Vertrauen hat das nicht das Geringste zu tun. Es ist eher die reine Verzweiflung. Ich habe einfach keine Ahnung, was ich sonst tun oder mit wem ich sonst sprechen könnte. Diese Ungewissheit, dieses Loch, nicht zu wissen, was Felicitas …« Sie stoppte sich. »Ich will mehr erfahren. Unbedingt.«
»Du warst bei der Polizei?«
»Sicher. Aber dort konnte man mir überhaupt nichts sagen. Die Polizei hat sogar angenommen, die Adresse in ihrem Studentenausweis wäre die korrekte.«
»Die Adresse des Wohnheims?«
»Richtig.«
»Wie viele Detekteien hast du bereits beauftragt?«, fragte er aus einem plötzlichen Impuls.
»Zwei«, entgegnete Laura, ohne überrascht zu sein. »Erst die Detektei Keller, dann Ulbricht & Heckler.«
Die beiden einzigen in Freiburg, die wirklich gut sind, dachte John. »Ohne Ergebnis, nehme ich an.«
Laura Winter erhob sich. »Gib dein Bestes, John.« Sie sah auf ihn herab. »Was immer dein Bestes sein mag.«
*
John Dietz war schon lange nicht mehr hier gewesen. Doch viel hatte sich offenbar nicht verändert. Er folgte einem jener langen Korridore, die immerzu leer wirkten. Nicht das Geringste war zu spüren von einer Atmosphäre, die auf Lebendigkeit und Aufbruch schließen ließ, wie man das womöglich erwartet hätte. Es war eher jene ihm altbekannte staubige Trägheit wahrzunehmen, die sich in die Mauern gefressen hatte. Kollegiengebäude 1, der altehrwürdige Teil der Albert-Ludwigs-Universität, der über diesen Gang direkt zum neueren Flügel führte, dem Kollegiengebäude 3.
Vor Jahren war John täglich über diesen Steinboden geschlichen, bereits damals mit dem Gefühl, nicht hierher zu gehören. Ein Gefühl, das sich auch an diesem frühen Nachmittag sofort wieder einstellte. Einfach abgebrochen hatte er sein Studium, von einem Tag auf den nächsten. Ohne Idee, was folgen würde. Vieles hatte er seitdem ausprobiert – und ebenfalls wieder aufgehört. Es wurde Zeit, wenigstens einmal im Leben eine Sache zu Ende zu bringen. Seine Detektei, er würde um sie kämpfen. Was blieb ihm auch übrig?
Er lauschte dem hohlen Klang seiner Schritte und atmete die muffige Luft ein. Es roch sogar noch genauso wie damals.
Er nahm den Aufzug und fuhr in den dritten Stock. Schon von Weitem sah er den Mann, der mit auf dem Rücken gekreuzten Armen am Ende eines weiteren dieser leblosen Korridore dastand. Irgendwie hatte John damit gerechnet, mit einer Sekretärin sprechen zu müssen und dann in einem Büro geparkt zu werden, ehe ihm ein paar Minuten mit dem Herrn Professor gewährt würden. Doch dem war nicht so.
Professor Trebitsch trat ihm entgegen. Ein kurzer Händedruck.
»Wir haben telefoniert, nehme ich an?«, fragte der schlanke, etwa 50-jährige Mann mit dem akkurat geschnittenen, grau melierten Haar.
»Ja, John Dietz. Schön, dass Sie sich etwas Zeit nehmen können.«
»Leider nicht viel«, beeilte sich Trebitsch mit der Antwort.
Kein Büro, nicht einmal ein Stuhl, um Platz zu nehmen. Sie blieben einfach an einem Fenster dieses Gangs stehen und sahen bei ihrem leise geführten Gespräch nach draußen auf eine Wiese vor dem Gebäude, auf der sich Studenten in kleinen Gruppen hingesetzt hatten, um die Sonne dieses Spätsommertags zu genießen.
John reichte Professor Trebitsch das Foto von Felicitas Winter. Von dem hageren, glatt rasierten Gesicht war keinerlei Reaktion abzulesen.
»Flüchtig erinnere ich mich an die junge Dame«, sagte der Mann schließlich mit dieser zurückhaltenden Stimme, die seine Studenten gewiss oft genug dazu veranlasste, in seinen Vorlesungen wegzudämmern. »Sie nahm an einem oder zweien meiner Seminare teil.«
»Das Foto wurde Ihnen ja schon mal gezeigt, nicht wahr?« John nahm es wieder an sich.
»Ja. Von einer Frau, die …« Ein Stirnrunzeln. »Von der älteren Schwester.«
»Richtig. Sie nannte mir Ihren Namen. Und die Polizei hat gewiss auch mit Ihnen gesprochen, oder?«
Wieder das Stirnrunzeln. »Nein, nur diese blonde Frau.«
»Und Sie erinnern sich an die Studentin? Felicitas Winter?«
»Erinnern ist zu viel gesagt. Eine attraktive junge Frau. Ob sie sich in den Seminaren zu Wort gemeldet hat, ob sie ein Referat gehalten hat, das weiß ich beim besten Willen nicht mehr. Denkbar ist auch, dass sie nie eine Semesterarbeit eingereicht hat.«
»Ist das möglich? Ich meine, nur teilzunehmen, ohne …«
»Ach, alles ist möglich. Manche Studenten kommen zwei- oder dreimal, um dann nie wieder aufzutauchen. Und geben trotzdem eine Arbeit ab. Andere sind jedes Mal da, beteiligen sich rege an den Diskussionen – und man bekommt keine Zeile von ihnen zu lesen.«
»Und sonst können Sie mir wirklich nichts über die Studentin …?«
»Gar nichts«, fiel der Professor John ins Wort. »Wie ich schon der blonden Dame erklärte.«
»Und Sie wüssten auch nicht, an wen ich mich …?« Ein entschiedenes Kopfschütteln brachte John dazu, den Satz verklingen zu lassen.
»Sie können sich nicht vorstellen, mit wie vielen Gesichtern man es im Laufe auch nur eines einzigen Semesters zu tun bekommt, Herr …«
»Dietz.«
»Viel zu vielen Gesichtern.«
»Aber bestimmt wenige, die derart hübsch sind, oder?«
»Es tut mir sehr leid, dass diese Studentin tot ist. Und auch, dass ich Ihnen keine größere Hilfe sein kann.«
»Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.«
Trebitsch nickte abschließend und verschwand hinter einer der Bürotüren.
John starrte den Gang hinab. Also wieder nichts. Erst ein paar kurze Unterhaltungen im Historischen, dann welche im Deutschen Seminar. Eine mühsame Befragung in der Universitätsverwaltung. Davor drei oder vier knappe Gespräche im Studentenwohnheim. Nicht einmal dort konnte sich jemand an Felicitas Winter erinnern. Abgesehen von dem Hausmeister, dem ihr Gesicht zumindest bekannt vorkam. Dann hatte er angemerkt, wie hübsch »die Kleine« sei und sich wieder mit dem Fahrrad einer Studentin beschäftigt, das er aus Gefälligkeit reparierte.
»Auch ’ne Hübsche«, meinte er.
»Gab es jemals Probleme mit den Briefkästen?«, fragte John.
Was ihm einen verständnislosen Blick eintrug. »Probleme?«
»Na ja, wurden die mal von irgendwelchen Spinnern kaputtgemacht? Kam Post weg? Irgendetwas in der Art?«
»Nichts in der Art, junger Mann. Und auch nichts in einer anderen Art. Hier läuft alles sauber. Dafür sorge ich schon.«
Noch bevor John sich auf den Weg zum Wohnheim gemacht hatte, war er mit dem Rad in die Kartäuserstraße gefahren. Ein unbestimmtes Gefühl, vielleicht einfach bloß Neugier, hatte ihn zu der Stelle geführt, an der der Unfall geschehen war. Minutenlang hatte er einfach dagestanden, ohne etwas Besonderes zu entdecken. Allerdings wollte er sich der Sache nicht annehmen, ohne wenigstens einmal den Ort besucht zu haben, an dem Felicitas Winter gestorben war.
Die Sonne blendete John, als er jetzt vor das Kollegiengebäude trat. Er trug Jeans, Kapuzenpullover und darüber die hüftlange, ziemlich abgewetzte Lederjacke, und angesichts dieses letzten heftigen Aufbäumens des Sommers wurde ihm sofort warm. Er ließ sich auf der Wiese nieder, auf der es sich mittlerweile noch mehr Studenten bequem gemacht hatten, und streckte die Beine aus. Er erinnerte sich an viele Stunden, die er hier zugebracht hatte, statt sich mit seinen Büchern zu beschäftigen. Aus der Jackentasche holte er die Fotografie, die Laura Winter ihm überlassen hatte.
Eingehend betrachtete er das Frauengesicht, das ihm von dem Bild mit sympathischem und irgendwie vorwitzigem Lächeln entgegenstarrte. Im ersten Moment war keinerlei Ähnlichkeit zwischen den Schwestern auszumachen. Beide waren attraktiv, jedoch auf unterschiedliche Weise – Laura war die Kühlere, mit klarem Blick aus ebenso klaren blauen Augen. Und Felicitas?
»Was für ein Mädchen warst du?«, flüsterte John dem Foto zu. Die Unterhaltungen rund um ihn vermischten sich zu einem monotonen Gebrumm.
Schwarzes Haar, dunkle Augen, weiche Lippen. Eine schöne junge Frau, keine Frage. Eine Frau voller Lebenslust. Je länger John das Bild betrachtete, desto anziehender wirkte Felicitas Winter auf ihn. Und erst nach und nach erkannte er doch Ähnlichkeiten zwischen den Schwestern: die Wangenknochen, die schmale Nase, das schön geformte Kinn. Man musste eben nur genauer hinsehen. Galt das nicht auch für diesen Fall? War das überhaupt so etwas wie ein Fall?
John steckte das Foto weg und ging zurück zu seinem Fahrrad, einem altersschwachen, schweren Ungetüm, von dem die letzten Reste des Lacks abblätterten. Zwischen all den Sporträdern der Studenten wirkte es wie ein Dinosaurier. Er trat in die Pedale, lavierte um Passanten und ließ die Altstadt mit dem alles überragenden Münster hinter sich. Allmählich konnte er es sich erlauben, schneller zu fahren, der Asphalt flog unter ihm dahin, wirkte wie dunkles morastiges Wasser.
Etwa dort, wo die Habsburger- in die Zähringer Straße überging, stoppte er das Rad und stellte es im Schatten des hässlichen Blocks ab, der ihm schon bei seinem ersten Besuch keinen Erfolg gebracht hatte. Eine Studentin verließ gerade das Wohnheim, und John nutzte die Gelegenheit, ins Innere zu schlüpfen. Er schlich an der ersten Tür vorüber, hinter der sich, wie er wusste, der Hausmeister ein Refugium eingerichtet hatte. Diesmal nahm John nicht den Aufzug, sondern die Treppe.
Jedes Stockwerk verfügte über eine Küche und je einen Duschraum für weibliche und männliche Studierende. Reihen von Eingangstüren zu Apartments oder Zimmern, die kaum mehr als zwölf Quadratmeter Platz boten. Schemenhaft blitzten bei John Erinnerungen auf – an Studentenfeten, an flüchtige Begegnungen und Unterhaltungen in den Küchen. Wie wenig ihm von dieser Zeit geblieben war, als hätte sie nicht mehrere Jahre, sondern nur ein paar Wochen gedauert.
Im vierten Stock angekommen, wandte er sich nun zum zweiten Mal jener Tür zu, hinter der sich einst Felicitas Winter zurückgezogen hatte. Bei seinem ersten Besuch hatte er festgestellt, dass das Apartment mittlerweile von einer chinesischen Studentin bewohnt wurde. Einer jungen Frau, die sehr gut Deutsch sprach, ihr Misstrauen gegenüber John Dietz jedoch keineswegs hatte verbergen können. Zu dem Bild von Felicitas wusste sie jedenfalls nichts zu sagen. John stand verloren auf dem kaum erhellten Gang und betrachtete die Tür, als könne allein deren Anblick ihm irgendeinen Hinweis geben.
Es war still im Gebäude. Kein Wunder, die Sonne schien, diejenigen Studenten, die nicht in ihren Seminaren waren, ließen es sich bestimmt in einem Biergarten gut gehen. Das einzige Geräusch bestand aus dem gedämpften Gewummer eines Hip-Hop-Songs, der sich von einem der unteren Stockwerke durch die Mauern quetschte.
War das überhaupt ein Fall?, fragte sich John wieder.
»Kann ich dir helfen?«
Überrascht fuhr John herum.
Eine junge Frau sah ihn an, mit gerunzelter Stirn und mindestens so skeptisch wie die Chinesin. »Suchst du jemanden?«
»Ja, so ist es.« Er kramte in seiner Jacke und hielt der Fremden das Foto hin. »Allerdings jemanden, der schon seit einiger Zeit nicht mehr hier wohnt. Seit mehr als einem Jahr.«
Sie betrachtete Felicitas’ Gesicht. Auch diese Studentin hier war hübsch, langes blondes Haar zum Pferdeschwanz gebunden, auf den Wangen ein paar versteckte Sommersprossen.
»Deine Exfreundin?« Es klang spöttisch.
»Ich habe den Auftrag, etwas über sie in Erfahrung zu bringen. Ich bin Privatdetektiv.«
In Erfahrung zu bringen, Privatdetektiv. Er musste sich noch daran gewöhnen, solche Worte auszusprechen.
Die junge Frau allerdings schien nicht sonderlich beeindruckt. »Was du nicht sagst«, murmelte sie, bevor sie den Kopf schüttelte. »Nie gesehen.« Ein Schulterzucken. »Ich wohne erst seit einem halben Jahr hier.«
Ein Rumpeln, nur einige Schritte von ihnen entfernt, und zischend öffnete sich die Aufzugtür. Etwas Quietschbuntes schlenderte auf sie zu, verschwitzt, aber vergnügt, ein Pfeifen auf den Lippen. Die Augen unter der schwarzen wilden, von einem Stirnband kaum gebändigten Lockenpracht blitzten auf, als sie die Studentin wahrnahmen. Ohrstöpsel wurden herausgezogen, ein lässiges Berühren des iPhones, zwei Reihen erschreckend makellos weißer Zähne.
»Hey, Baby«, kam die Stimme mit fremdländischem Akzent über die Lippen.
»Hallo, Santiago«, erwiderte die Studentin freudestrahlend.
Der junge Mann in den Sportklamotten beachtete John nicht im Geringsten, sein Blick tastete die Frau ab, während er sie dazu zu überreden versuchte, mit ihm unter die Dusche zu hüpfen. Sie lachte auf, mochte ihn offenbar so sehr, dass sie ihm sogar die ganz frechen Sprüche verzieh.
»Arriba, arriba«, rief er begeistert aus, als sie zusagte, sich abends mit ihm in einem Club zu treffen. Um dann noch, als er schon ein paar lässige Schritte weitergegangen war, mit spöttischem Ton anzufügen: »Heute Abend lässt du aber Onkelchen zu Hause.« Ein abfälliger Seitenblick streifte John.
Und bevor der etwas erwidern konnte, war der Jogger bereits hinter einer der Türen verschwunden. Die junge Frau bedachte John mit einem Grinsen und ließ ihn ohne ein weiteres Wort stehen.
Na toll, dachte er. Es blieb dabei. Nichts und wieder nichts.
*
Während er die Staubwüste dieses alten, bis unter die Decke vollgestellten Kellerbüros betrachtete, hallte in seinem Kopf noch ein bestimmtes Wort nach: Onkelchen!
Dieser kleine Pisser, dachte John Dietz. Er war kein »Onkelchen«, er war gerade einmal einunddreißig, bloß ein paar Jährchen älter als der großschnauzige Jogging-Studentinnen-Aufreißer.
»Worüber grübelt unser Sherlock Holmes im Kleinformat denn nach?« Tante Jus Frage holte John zurück in dieses nach altem Papier und Zigarettenqualm muffelnde Büro, das bei der Renovierung der Geschäftsstelle der Badischen Zeitung wohl einfach übersehen worden war. So wie man auch Tante Ju übersah und sie einfach weiter ihren Job verrichten ließ, als wäre sie ein Maskottchen, von dem man sich allein aus Aberglauben unmöglich trennen konnte.
»Tu mir den Gefallen«, antwortete John langsam, »und erspar mir deine Bosheiten.«
Tante Ju lachte auf. Wie das legendäre Flugzeug Junkers Ju 52, mit dem sie den Spitznamen teilte, war sie nicht mehr die Jüngste, etwas zu breit und schwerfällig. Doch wenn sie einmal auf Touren kam, war auf sie Verlass – ebenfalls wie bei dem Flugzeug. Und selbst ihr Lachen erinnerte an das Rattern von Propellern.
»Nun guck nicht so griesgrämig drein, Philip Marlowe.« Sie tätschelte Johns Schulter und ließ sich auf den uralten Drehstuhl fallen, der unter ihrem Gewicht ächzte. Staubwölkchen wurden aufgewirbelt. Tante Ju bearbeitete das Archiv, so lautete offiziell ihre Tätigkeit bei der Zeitung, aber im Grunde war sie einfach die gute Seele, die sich um alles Mögliche kümmerte.
John saß auf einem dreibeinigen schiefen Hocker, zog das Foto aus der Jackentasche und hielt es in die Höhe. Irgendwie war ihm, als hätte er es schon mindestens tausendmal angesehen.
Tante Jus lustiges, von Runzeln übersätes Hexengesicht schob sich über den randvollen Aschenbecher, die unzähligen Zeitungen, die halb leeren Kaffeetassen und die bekritzelten Notizzettel, die den Schreibtisch zu einem einzigen Durcheinander machten. Sie blinzelte über ihren Brillenrand. »Ein entzückendes Mädchen.«
»Entzückend«, nickte John. »Und leider tot.«
»Sag bloß, du hast tatsächlich so etwas Ähnliches wie einen Fall.«
»So etwas Ähnliches.« Säuerlich sein Lächeln. »Kommt dir das Gesicht bekannt vor?«
»Nö.« Das Blinzeln wurde intensiver. »Oder doch?« Tante Ju, die eigentlich Juliane Butzenberg hieß, kratzte sich irgendwo in den Tiefen ihres grauen, auf urzeitlich altmodische Art hochgesteckten Haardschungels. »Hm.«
»Ja oder nein?«
Schließlich ein entschiedenes Kopfschütteln. »Leider ein Nein. Zuerst dachte ich … Nö. Nie gesehen. Warum bist du so interessiert an ihr?«
»Interessiert ist vor allem ihre Schwester.«
Gepolter drang vom Erdgeschoss durch die Decke zu ihnen nach unten.
»Die Handwerker«, erklärte Tante Ju. »Hast ja gesehen, was oben los ist.«
»Da ist doch erst kürzlich renoviert worden.«
»Renoviert? Das hat doch damit nichts zu tun. Sondern mit dem Verrückten. Hab ich den gar nicht erwähnt?«
»Mit keinem Wort.«
»Meine Güte!« Tante Ju verlagerte ihr Gewicht, und der Stuhl protestierte knarrend. »Ein total Bekloppter. Groß wie ein Bär! Mit einem Walrossschnauzer. Steht da auf einmal oben vor einem unserer Kundentresen. Kann kaum Deutsch, faselt irgendwas vor sich hin. Angeblich auf Russisch. Jedenfalls klang es für einige unserer geschätzten Mitarbeiter danach. Und urplötzlich dreht der Kerl durch. Er schlägt einen Praktikanten nieder, schreit wie am Spieß, und dann fängt er an, mit einer Eisenstange die Schreibtische kurz und klein zu kloppen.«
»Jemand verletzt?«
»Nasenbeinbruch beim Prakti. Und ein mächtiger Schock für den Rest der Bande.«
»Wie ging’s weiter?«
»So unerklärlich, wie es angefangen hat: Plötzlich hält der Bär inne, mitten im Schlag. Er blickt sich um, als wäre ihm erst bewusst geworden, was er angerichtet hat. Dann rennt er einfach los, raus auf die Straße.« Tante Ju lachte ratlos. »Tja. Und ward nicht mehr gesehen.«
»Komische Geschichte.«
»Mehr als komisch. Wir haben natürlich sofort die Polizei informiert. Unsere Freunde und Helfer waren auch gleich da, nahmen die Beschreibung auf, aber seitdem habe ich nichts mehr über diesen rauflustigen Besucher gehört.«
»Da lebt man in einer ruhigen, schönen Stadt – und trotzdem kann man nie sicher sein, dass man nicht plötzlich Jack the Ripper über den Weg läuft.«
»Ach, Johnny«, meinte Tante Ju in beruhigendem Ton, »ganz so schwarz musst du es auch nicht sehen. Oder liegt das daran, dass du gerade mal keine Glückssträhne hast?«
»Gerade mal? Das hast du wirklich nett ausgedrückt.«
John kannte Tante Ju schon lange. Sie lebte in demselben schmucklosen Block wie er. Als er nach der Beerdigung seiner Mutter seine Wohnungstür aufschloss und das Gefühl hatte, das Ende der Welt wäre gekommen, stand sie plötzlich neben ihm. Sie starrte in seine verweinten Augen und lud ihn auf eine Tasse Kaffee in ihr Wohnzimmer ein. Das war der Beginn ihrer kuriosen Freundschaft. Das Unikum aus dem Keller der Zeitung und der junge Mann, der den eigenen Vater nie kennengelernt und seine Mutter aufgrund einer Krebserkrankung verloren hatte.
Sein Vater war ein kanadischer Soldat gewesen, stationiert in Lahr. Henry Wallace. Wenn John in den Spiegel sah, musste er zwangsläufig an diesen Fremden denken: Henry war Schwarzer, und Johns Hautfarbe war eine Mischung aus dem Teint seines Vaters und dem seiner deutschen Mutter. Auch durch das schmale Gesicht mit den tiefbraunen Augen und den vollen Lippen, das krause, pechschwarze Haar und die schlanke Figur ähnelte John, wie er von seiner Mutter wusste, dem fremden Vater. »Du bist ein genauso hübscher Herzensbrecher wie er«, hatte sie immer gesagt. Kurz nach Johns Geburt wurde Henry in die Heimat versetzt – und sorgte dafür, dass der Kontakt nach Deutschland abbrach. Anna Dietz zog ihren John allein auf. Sie war sein Anker gewesen. Nun war sie bereits über drei Jahre tot. Drei Jahre, in denen er noch richtungsloser gewesen war als zu ihren Lebezeiten. Bis ihm die Idee mit der Detektei gekommen war.
»Also, Junge, sag schon. Was ist mit dieser Frau auf dem Foto?« Tante Jus Blick ruhte liebevoll auf ihm.
In knappen Worten umriss John das, was Laura Winter ihm erzählt hatte.
Tante Ju hob die Augenbrauen. »Auch das klingt nach einer komischen Geschichte.«
»Vor allem ist es eine, bei der ich gar nicht vorankomme.« Er erhob sich von dem Hocker.
»Johnny, zeig mir noch mal das Bild.« Wie zuvor blinzelte sie Felicitas’ Gesicht eine Weile prüfend an. »Ich weiß nicht recht. Irgendwie kommt sie mir vielleicht doch bekannt vor.«
»Wirklich?« John zweifelte. Offenbar war es ihr bloß zuwider, ihn mit einer negativen Antwort gehen zu lassen.
»Wer weiß, womöglich fällt mir ja noch was ein. Mein Oberstübchen ist so verstaubt wie mein Büro.« Lächelnd nahm sie einen Schluck Kaffee, der bestimmt längst eiskalt war. Tante Ju trank immer aus mehreren Tassen parallel.
»Falls dir noch etwas einfällt«, antworte John ohne Hoffnung, »dann …«
»… sag ich dir Bescheid.« Sie zwinkerte ihm zu und steckte sich eine Zigarette an. Im gesamten Gebäude herrschte Rauchverbot – nur Tante Ju in ihrem kleinen Reich setzte sich darüber hinweg. Und man ließ sie gewähren. Vielleicht weil außer ihr ohnehin niemand das enge Zimmerchen betrat.
»Danke, Tante Ju.«
Sie warf ihm einen Handkuss zu.
Die Geschäftsstelle der Zeitung lag nicht weit entfernt von seinem Büro, und John überlegte kurz, dorthin zurückzugehen. Aber Papagei Elvis hatte noch genügend Wasser und Futter, und John verspürte einfach kein Verlangen danach, die leeren Wände anzustarren. Sein Handy war wieder seit Stunden stumm. Eine florierende Privatdetektei sah wahrlich anders aus. Und heute würde er sich bei Laura melden müssen. Dem Augenblick, wenn er ihr eröffnen würde, nichts Neues zu haben, sah er mit einem dumpfen Grollen entgegen. Allein schon deshalb, weil Laura genau damit rechnete. Das war ihm leider nur allzu klar und machte die Sache ja erst recht so unerfreulich.
Die Sonne wölbte sich als glimmender Lichtschirm über die Altstadt. John folgte einem der Bächle, die von der Dreisam gespeist wurden und die Innenstadtstraßen durchzogen, längst ein Wahrzeichen der Stadt, und wich Touristen, Studenten, Hausfrauen und Nachmittagsunterricht schwänzenden Schülern aus, dem üblichen Freiburger Leutegemisch.
Grübelnd nahm John Kurs auf das Krügle, eine Kneipe, die sich in einer der Gassen beim Schlossberg versteckte und einen Geheimtreff für ein ziemlich buntes Publikum darstellte. Vom Alt-68er-Kampftrinker über den scheuen, stets lesenden Philosophie-Studenten bis zum feuchtfröhlichen Damenkegelverein konnte man hier praktisch jeden antreffen. Als sich John an den um diese Zeit fast leeren Tresen auf einen Barhocker schob, war er immer noch in Grübeleien versunken. Die Universität, das Studentenwohnheim … Wo sollte er noch ansetzen? Was würde ein richtiger Detektiv machen? Nun ja. Das bedeutete wohl, dass er doch kein »richtiger« Detektiv war. Ein wenig wurde Johns Laune dann doch aufgehellt. Der Grund dafür war Blanca, eine neue Bedienung, die auf seine Sprüche mit überaus aufgeschlossenem Lachen reagierte.
Später, als er sich zu Hause in einen etwas in die Jahre gekommenen Sessel drückte, hatte sich seine Stimmung bereits wieder getrübt. Er starrte auf das Handy, und pünktlicher als die Tagesschau kam der Anruf. Er nahm ihn entgegen und hörte zunächst Musik und Stimmengewirr. Laura Winter rief ihn also aus einem Restaurant, eher einer Bar, an. Ob das vielleicht auf ihre durchaus frostige Art eine positive Auswirkung haben mochte?
Nein. Sie klang so sachlich und beherrscht wie bei ihrem Besuch im Büro. »John«, eröffnete sie die Unterhaltung ohne Gruß, »hast du irgendetwas herausgefunden?«
»Nun ja, ähm«, murmelte er. »Eigentlich …«
»Nichts, oder?«, fiel sie ihm ins Wort, und er wusste endgültig, dass sie sowieso nichts von ihm erwartete. Bevor er etwas anfügen konnte, sprach sie weiter: »Also, ich habe mich mit alten Freundinnen aus der Schulzeit getroffen. Und morgen um elf noch eine Verabredung auf einen Cappuccino. Um zwölf werde ich in deinem Büro vorbeischauen. Vielleicht hast du dann ja mehr für mich. Und dann können wir außerdem …« Sie überlegte kurz, das Gelächter um sie herum schien lauter zu werden. »Dann können wir das mit deiner Bezahlung regeln. Wir sehen uns. Um exakt zwölf Uhr.«
Punkt, aus, das war’s schon. Die Uhrzeit hatte sie ausgesprochen wie eine Richterin ihr Urteil. »›Deine Bezahlung.‹« Es hatte sich angehört, als ginge es um ein Trinkgeld. Und für Laura Winter war es wohl auch nicht mehr. Schon bei ihrem ersten Auftauchen hatte sie sich nicht einmal nach seinem Tarif erkundigt. Ach, diese Leute, die nie Geldsorgen hatten. John legte das Handy auf den Tisch und schaltete den Fernseher ein. Natürlich lief nichts. Genauso wie bei ihm.
*
Laura Winter lag gut im Zeitplan. Sie hatte ausgeschlafen, gefrühstückt, ihre Cappuccino-Verabredung getroffen. Nun konnte sie sich auf den Weg zu John Dietz machen.
Sie überprüfte ihr Handy. Nichts, kein Anruf, keine Nachricht. Hatte sie etwas anderes erwartet? Nein, sagte sie sich, selbstverständlich nicht. Dieser kleine, nichtsnutzige Schmalspurschnüffler war sowieso nicht ernst zu nehmen. Sie hätte sich das sparen können. John Dietz. Also bitte. Der war schon in der Schule ein Windei gewesen. Immer bei Klassenarbeiten mit Spickzetteln erwischt worden. Oder bei etwas anderem, das verboten war. Hatte er bei der Abschlussfeier nicht Joints geraucht? Ach Gott.
Sie sah auf, musste sich orientieren. War eben eine Weile her, seit sie zuletzt in der Stadt gewesen war. Und was für ein trauriger Anlass hatte sie zurückgeführt. Sie erreichte einen Zebrastreifen, ein Auto näherte sich, hielt an, sie ging los, warf einen weiteren Blick auf ihr Handy, um die Uhrzeit festzustellen. Und plötzlich kreischten Reifen auf, ein Motor brummte: durchdringende Geräusche, die Lauras Gedanken zerschnitten. Erschrocken riss sie die Augen auf. Der Motorenlärm war auf einmal so nah, groß, mächtig, und ihre jähe Angst entlud sich in einem gellenden Schrei.
*
Am nächsten Morgen war John früh im Büro – auch wenn es keinen Anlass dafür gab. In der anfänglichen Euphorie für seine Detektei hatte er oft auf der Liege im Nebenzimmer übernachtet. Deshalb hatte er Elvis hier untergebracht. Es wurde Zeit, den Vogel, der Johns Mutter gehört hatte, wieder zu Hause einzuquartieren. Er streichelte der Blaustirnamazone den Kopf, ein altes Ritual, das der ansonsten eher kapriziöse Papagei gern über sich ergehen ließ. Beim McDonald’s am Martinstor hatte sich John mit einem Frühstück versorgt. Von dem Croissant hielt er ein Stück zwischen die Käfigstäbe, und Elvis’ Schnabel schoss sofort hervor. Es gab so gut wie nichts, was dieser verrückte Kerl verschmähte.
Elvis intonierte eine besonders schaurige Version von Can’t help falling in love, während John sich den Kopf zermarterte, wo er noch hätte ansetzen können. Felicitas Winter schien ein Geist gewesen zu sein. Keine Spuren, überhaupt nichts war von ihr geblieben. Unter dem Fenster strömten die Leute vorbei. Endlich näherten sich die Zeiger der gitarrenförmigen Wanduhr der Zwölf. Laura Winter würde gewiss die Pünktlichkeit in Person sein. Sie würde sagen, dass sie nichts anderes von ihm erwartet hatte als genau das: nichts. Ihm dann einen Scheck geben, eine Überweisung ankündigen oder ihn sogar bar auszahlen, als hätte sie in einer Bäckerei ein paar Brötchen gekauft. Anschließend würde sie aus seinem Büro rauschen. Aus und vorbei. Als hätte es den Fall Felicitas Winter nie gegeben. John legte eine Elvis-CD ein, obwohl ihm klar war, dass der gefiederte Elvis gleich einstimmen würde.
Zwölf Uhr, zehn nach zwölf, zwanzig nach zwölf.
Die Pünktlichkeit in Person hatte es offenbar nicht eilig. Und es kümmerte sie wohl nicht im Geringsten, dass sie mit John Dietz eine Verabredung getroffen hatte.
Als es endlich an der Tür klingelte, warf John einen weiteren wütenden Blick auf die Uhr. Fünf nach eins. Ohne sich davon zu überzeugen, wer es war, drückte er grummelnd den Knopf, um die Eingangstür im Erdgeschoss zu öffnen. Wenig später betrat Laura Winter das Büro der Detektei Dietz. John machte sich bereits auf ihre hochnäsige Stimme gefasst. Doch als er von seinem Schreibtischstuhl aufsah, war schon im ersten Moment eines vollkommen klar: Das war eine andere Laura Winter. Eine ganz andere.
Mit verblüfftem Gesichtsausdruck stand John auf.
»Scheiße«, knurrte Laura.
2. Die stumme Maja
So schwer es ihm sonst fiel, den Schnabel zu halten: In diesen Minuten war nichts von Elvis zu hören. Auch die Stereoanlage gab keinen Ton von sich – die CD des wahren Elvis war längst zu Ende gespielt worden.
Mit ungewollter Faszination betrachtete John Dietz seine Auftraggeberin, nur getrennt durch den beinahe leeren Schreibtisch. Es bebte in Laura Winter, sie war drauf und dran, ihren Gefühlen nachzugeben, doch momentan hielt sie diese Mauer aufrecht, dieses Sture, Beherrschte.
Die Schulterpartie ihrer leichten eleganten Jacke war mit Dreck verschmiert, eine Naht der schlichten, aber sicher teuren Jeans geplatzt, der rechte Slipper ebenfalls durch inzwischen verkrusteten Schmutz in Mitleidenschaft gezogen. Ihr Haar wirkte durcheinander, obwohl John es förmlich vor sich sehen konnte, wie sie nach dem Zwischenfall immer wieder mit fahrigen Bewegungen versucht hatte, es in die gewohnte Ordnung zu bringen. Über ihrer rechten Schläfe hatte sie eine Beule; die Haut war abgeschürft. Und die Ader darunter pochte heftig, ein kleiner Rhythmusgeber für die Worte, die über ihre Lippen kamen. Der Ausdruck »Scheiße« fiel einige Male, aber das machte diese attraktive, doch allzu kühle Dame zumindest aus Johns Sicht ein gutes Stück menschlicher. Außerdem musste er sich eingestehen, eine fast boshafte Genugtuung zu verspüren: Laura Winters Panzer schien ein paar Kratzer abbekommen zu haben.
»Dieser …« Sie schien nach einem deftigen Schimpfwort für den Unbekannten zu suchen, presste jedoch die Lippen wieder aufeinander.
»Was war es für ein Auto?«, erkundigte sich John, um sie ein wenig darin zu unterstützen, ihre übliche Konzentration wiederzuerlangen.
»Alles ging so unglaublich schnell. Eine Limousine, wahrscheinlich ein Mercedes. Oder ein Audi. Schwarz oder nachtblau. Die Scheiben waren stark getönt, das ist mir aufgefallen. Ich war ja schon zwei Schritte auf dem Zebrastreifen, achtete auf mein Handy …« Immer noch voller Ungläubigkeit schüttelte sie ihren Kopf. »Eine ganz normale Situation, wie sie hundertmal am Tag passiert.« Sie nahm John ins Visier, als hätte er gewagt, zu widersprechen. »Das Auto hatte ja längst angehalten. Es stand.« Sie betonte jede Silbe exakt. »Und dann auf einmal – rast dieser blöde …«
»Idiot«, schlug John vor.
»Nein, ganz und gar nicht.« Wütend schnalzte sie mit der Zunge, wie eine Lehrerin, die einem begriffsstutzigen Schüler etwas beizubringen versuchte.
»Also kein Idiot.« John runzelte die Stirn.
»Du hast mir nicht richtig zugehört. Das Auto stand …« Erneut dieses Betonte in der Stimme. »Und dann raste es los.«
»Und du …«
»Und ich«, fiel sie ihm ins Wort, »habe mit einem Hechtsprung mein Leben gerettet. Zumindest meine Knochen. Der rechte vordere Kotflügel hätte mich fast erwischt. Ich landete mit voller Wucht auf dem Trottoir. Du siehst ja, wie ich …« Sie ließ den Satz offen und wies auf ihre Schrammen.
»Und die Limousine fuhr einfach weiter?«
Sie nickte.
»Jetzt verstehe ich langsam, worauf du hinauswillst.«
»Wird auch Zeit«, merkte Laura scharf an.
Selbst unter Schock funktionierte ihre spitze Zunge wie geölt.
»Du denkst, dass das kein Unfall war.«
»Genau das, Mr Sherlock Holmes.«
Noch einer dieser Sherlock-Sprüche. »Wenn es kein Unfall war, also kein rücksichtsloser oder blinder oder betrunkener Autofahrer, dann war es der Versuch …«