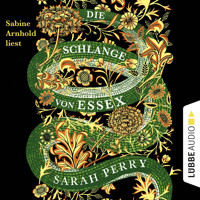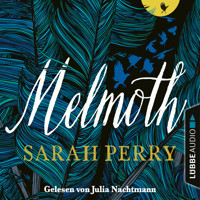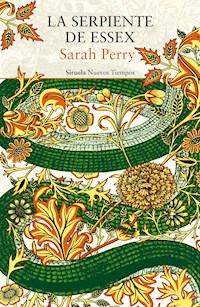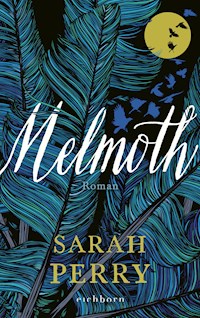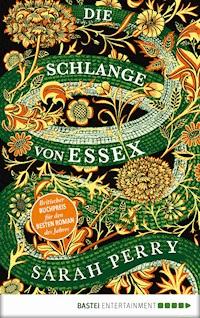
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
London 1893. Als Cora Seaborne vom Gerücht hört, der mythische Lindwurm von Essex sei zurückgekehrt und fordere die ersten Menschenleben, macht sie sich auf den Weg in den Küstenort Aldwinter. Cora, eine Anhängerin der provokanten Thesen Charles Darwins, vermutet hinter dem Sagengeschöpf eine bislang unbekannte Tierart. Auch der Vikar von Aldwinter, William Ransome, glaubt den Gerüchten nicht, und versucht, seine Gemeinde zu beruhigen. Zwischen Cora und Will entspinnt sich eine besondere Beziehung und obwohl sie in rein gar nichts einer Meinung sind, fühlen sie sich unausweichlich zueinander hingezogen.
Anmutig und intelligent erzählt dieser Roman - noch vor allem anderen - von der Liebe und den unzähligen Verkleidungen, in denen sie uns gegenübertritt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Über dieses Buch
London 1893. Als Cora Seaborne vom Gerücht hört, der mythische Lindwurm von Essex sei zurückgekehrt und fordere die ersten Menschenleben, macht sie sich auf den Weg in den Küstenort Aldwinter. Cora, eine Anhängerin der provokanten Thesen Charles Darwins, vermutet hinter dem Sagengeschöpf eine bislang unbekannte Tierart. Auch der Vikar von Aldwinter, William Ransome, glaubt den Gerüchten nicht, und versucht, seine Gemeinde zu beruhigen. Zwischen Cora und Will entspinnt sich eine besondere Beziehung und obwohl sie in rein gar nichts einer Meinung sind, fühlen sie sich unausweichlich zueinander hingezogen. Anmutig und intelligent erzählt dieser Roman – noch vor allem anderen – von der Liebe und den unzähligen Verkleidungen, in denen sie uns gegenübertritt.
SARAH PERRY
DIESCHLANGEVONESSEX
Übersetzung aus dem Englischenvon Eva Bonné
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der englischen Originalausgabe:
»The Essex Serpent«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2016 Sarah Perry
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Friederike Achilles, Köln
Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau
Unter Verwendung einer Gestaltung von © iStock and William Morris-Design: Peter Dyer
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-4930-6
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Stephen Crowe
Wenn man in mich dränge, ich solle sagen, warum ich meinen Freund liebte, so könnte ich nur antworten: »Weil er es war, weil ich es war.«
Michel de Montaigne, Über die Freundschaft
NEUJAHRSNACHT
Ein junger Mann geht unter dem kalten Vollmond am Ufer des Blackwater spazieren. Er hat das alte Jahr bis zur Neige ausgetrunken, und als seine Augen brannten und sein Magen schmerzte, hatte er von Lärm und Lichtern genug. »Ich gehe kurz ans Wasser«, sagte er und küsste die nächstbeste Wange, »beim Glockenschlag bin ich zurück.« Jetzt blickt er gen Osten, zum trägen, dunklen Meeresarm hin, wo die Flut im Anmarsch ist und weiße Möwen auf den Wellen leuchten.
Es ist kalt, und er sollte es merken, aber sein Bauch ist voller Bier, und er trägt den guten, dicken Mantel. Der Kragen scheuert am Hals; der Mann fühlt sich benebelt und beengt, seine Zunge ist trocken. Ich springe kurz hinein, denkt er, dann geht es mir besser; er verlässt den Weg und steht allein am Ufer, und draußen im schwarzen Schlamm warten alle Priele auf die Flut.
»I’ll take a cup o’ kindness yet«, singt er in glockenhellem Tenor und lacht; jemand lacht zurück. Er knöpft den Mantel auf und hebt die Arme, aber es reicht nicht; die scharfen Kanten des Windes sollen sich an seinem Körper wetzen. Er nähert sich dem Wasser und streckt die Zunge in die salzige Luft. Ja, ich springe kurz hinein, denkt er und lässt den Mantel fallen. Schließlich hat er es schon einmal gewagt, als Junge, mit seinen Spielkameraden: eine leichtsinnige Mutprobe, ein mitternächtliches Bad, als das alte Jahr in den Armen des neuen starb. Das Wasser ist nicht tief – der Wind hat nachgelassen – der Blackwater macht ihm keine Angst. Gäbe man ihm ein Glas, er würde es leeren, samt Salz und Seemuscheln, Austern und allem.
Aber dann kippen die Gezeiten, oder der Wind dreht; die Wasseroberfläche wellt sich, scheint (er tritt einen Schritt vor) zu pulsieren und zu beben, dann wird sie wieder glatt und still, nur um sich kurz darauf zu kräuseln, als zuckte sie vor der Berührung zurück. Er geht immer weiter, er hat keine Angst; die Möwen erheben sich eine nach der andern, die letzte schreit vor Schreck.
Der Winter trifft ihn wie ein Schlag in den Nacken, kriecht ihm unter das Hemd und bis in die Knochen. Die Heiterkeit des Zechers ist verschwunden, nun steht er schutzlos im Dunkeln. Er sucht nach seinem Mantel, aber Wolken ziehen vor den Mond, und er wird blind. Er atmet langsam, die Luft ist voller Nadeln. Plötzlich sind seine Füße nass, als hätte ihm jemand das Wasser entgegengeschoben. Nichts, es ist nichts, denkt er und sucht seinen Mut zusammen, aber da ist es wieder: ein seltsames Erstarren der Landschaft, als wäre sie plötzlich eine Fotografie, gefolgt von einer hektischen, sprunghaften Bewegung. Das kann nicht bloß der Mond sein, der an den Wellen zupft. Er glaubt, ist überzeugt zu sehen, wie eine riesige Gestalt sich langsam erhebt, gekrümmt und düster und von einem groben Schuppenkleid bedeckt; und dann ist sie wieder weg.
In der Dunkelheit wird ihm bange. Da ist etwas, er spürt es genau, es lauert ihm auf – gnadenlos, monströs, im Wasser geboren, und es hat ihn im Blick. In den Untiefen hat es geschlafen, und nun kommt es endlich herauf; er malt sich aus, wie es sich gegen die Wellen stemmt und gierig Witterung aufnimmt. Er fühlt Todesangst, sein Herz bleibt fast stehen – binnen Sekunden wurde er angeklagt, verurteilt und das Urteil vollstreckt, oh, wie hat er gesündigt, wie schwarz ist seine Seele! Er fühlt sich geplündert, aller Tugenden beraubt, und hat nichts mehr zu seiner Verteidigung vorzubringen. Er schaut auf den schwarzen Blackwater hinaus, und da ist es noch einmal, durchpflügt die Wellen und taucht wieder ab, und ja, es war immer schon da, es hat nur gewartet, und nun hat es ihn endlich gefunden. Er wird seltsam ruhig; am Ende muss Gerechtigkeit walten, er bekennt sich bereitwillig schuldig. So viel Reue und keine Rettung, doch er hat es nicht besser verdient.
Aber dann regt sich der Wind und zerrt an den Wolken, der schüchterne Mond zeigt sein Gesicht. Gewiss, das Licht ist schwach, aber es wirkt tröstlich, und da ist ja auch der Mantel, keinen Meter entfernt und mit schlammverschmiertem Saum. Die Möwen lassen sich wieder auf dem Wasser nieder, er kommt sich lächerlich vor. Weiter oben, auf dem Weg, wird gelacht: ein Mädchen und ihr Freund, beide in Festtagskleidern. Er winkt und ruft, »Ich bin hier! Ich bin hier!«, und denkt: Ich bin tatsächlich hier, hier auf dem Marschland, das er besser kennt als seine Westentasche. Die Gezeiten wechseln langsam, es gibt keinen Grund zur Angst. Ein Ungeheuer!, denkt er und muss über sich lachen, wird ganz albern vor Erleichterung. Als gäbe es dort draußen irgendetwas anderes als Heringe und Makrelen!
Am Blackwater gibt es nichts zu fürchten und nichts zu bereuen, nur einen Moment der Verwirrung im Dunkeln und zu viel Alkohol. Das Wasser steigt ihm entgegen und ist abermals der alte Freund. Wie um es zu beweisen, watet er hinein, macht sich die Stiefel nass und öffnet die Arme: »Hier bin ich!«, ruft er, und die Möwen geben Antwort. Nur mal kurz hineinspringen, denkt er, der alten Zeiten wegen, und reißt sich lachend das Hemd vom Leib.
Das Pendel schwingt von einem Jahr ins andere, und das Gesicht der Tiefe verfinstert sich.
ISONDERBARENACHRICHTENAUS ESSEX
JANUAR
1
Ein Uhr mittags an einem trüben Tag, und auf dem Dach der Sternwarte von Greenwich fiel die Zeitkugel herunter. Eis bedeckte den Nullmeridian, Eis klebte am Takelwerk der breiten Barkassen unten auf der belebten Themse. Die Kapitäne hatten Zeit und Gezeiten abgewartet und setzten im Nordostwind die blutroten Segel: eine Ladung Eisen für die Gießerei von Whitechapel, wo Glocken gegen Ambosse schlugen, als liefe die Zeit davon. Die Zeit wurde hinter den Gefängnismauern von Newgate abgesessen und von den Philosophen auf der Strand verschwendet; die einen verloren Zeit und wünschten, die Vergangenheit wäre Gegenwart, die anderen verfluchten sie und wünschten, die Gegenwart wäre Vergangenheit. Oranges and lemons, riefen die Glocken von St. Clement’s, nur die Parlamentsglocke von Westminster blieb stumm.
An der Börse, wo Männern im Laufe des Nachmittags der Glaube daran abhandenkam, das Kamel könnte doch noch durchs Nadelöhr gehen, war die Zeit Geld, und im Gebäude der Prudential-Versicherungsgesellschaft setzten die langzahnigen Rädchen der Hauptuhr eine elektrische Spannung frei, die ein Dutzend Sklavenuhren zu schlagen zwang. Die Büroangestellten hoben den Blick aus den Akten, seufzten und senkten ihn wieder. Auf der Charing Cross Road hatte die Zeit ihren Triumphwagen gegen eine drängende Flut aus Fuhrwerken und Droschken eingetauscht, und auf den Krankenstationen des St. Bartholomew’s und des Royal London Hospital dehnte sie Minuten auf Stunden aus. In der Wesley’s Chapel sangen die Leute »The sands of time are sinking« und wünschten insgeheim, der Sand könnte ein wenig schneller durchs Uhrglas rieseln, und draußen auf den Gräbern von Bunhill Fields schmolz das Eis.
In den Anwaltskammern Lincoln’s Inn und Middle Temple konsultierten die Advokaten ihre Kalender und sahen Verjährungsfristen enden; in Zimmern in Camden und Woolwich war die Zeit grausam zu Liebespaaren, die sich fragten, wo sie nur geblieben sei; doch schon bald würde die Zeit die üblichen Wunden heilen. In der ganzen Stadt, in allen Häusern und Wohnungen, in besseren Kreisen und schlechter Gesellschaft und der Mittelschicht und dazwischen wurde Zeit verbracht und verprasst, genutzt und vertrieben, und während der ganzen Zeit fiel ein eisiger Regen.
In den U-Bahn-Stationen Euston Square und Paddington strömten die Passagiere durch die Eingänge wie Rohmaterial, das gewalzt und veredelt und später aus der Form gehoben wird. Unter der zuckenden Beleuchtung eines Waggons der Circle Line stellte sich heraus, dass die Times wieder einmal nichts Gutes zu berichten hatte, aus einer Tüte im Gang kullerte Fallobst. Es roch nach Regentropfen auf Regenmänteln. Zwischen den Fahrgästen saß Dr. Luke Garrett in seinen hochgeschlagenen Kragen versunken und sagte sich die Bestandteile des menschlichen Herzens auf: »Rechte Kammer, linke Kammer, vena cava superior«, zählte er sie an seinen Fingern ab in der Hoffnung, die Litanei könnte sein klopfendes Herz beruhigen. Sein Sitznachbar sah ihn verwundert an, wandte sich schulterzuckend wieder ab. »Atrium dextrum, atrium sinistrum«, flüsterte Garrett. Neugierige Blicke seiner Mitbürger war er gewohnt; er hatte keine Lust, sie vorsätzlich auf sich zu ziehen. Der Kobold wurde er genannt, denn selten reichte er an die Schulter eines anderen Mannes heran, und sein beschwingter, energiegeladener Gang ließ stets befürchten, er könnte ohne Vorwarnung auf das nächste Fenstersims springen. Noch durch seine Kleidung hindurch war ihm die Spannung in allen Gliedern anzusehen, und seine Stirn wölbte sich vor, als könnte sie seinen riesigen wilden Intellekt kaum fassen. Eine lange schwarze Haartolle, Rabenfedern gleich, fiel ihm ins Gesicht und bis in die dunklen Augen. Luke Garrett war zweiunddreißig Jahre alt, ein Wundarzt mit unersättlichem, rebellischem Verstand.
Das Licht erlosch und flackerte wieder auf, Garretts Zug näherte sich dem Ziel. In weniger als einer Stunde wurde er zu der Beerdigung eines Patienten erwartet, und nie zuvor hatte ein Mann seine Trauerkleidung so unbekümmert getragen. Der Patient, Michael Seaborne, war vor sechs Tagen an Kehlkopfkrebs verstorben; er hatte die auszehrende Krankheit wie auch die ärztlichen Bemühungen mit derselben Gleichmut erduldet. In Gedanken war Garrett nicht bei dem Toten, sondern bei dessen Witwe, die sich (dachte er lächelnd) jetzt in diesem Augenblick vielleicht die zerzausten Haare kämmte oder merkte, dass am guten schwarzen Kleid ein Knopf fehlte.
Noch nie hatte er einen Menschen auf eine so merkwürdige Weise trauern sehen wie Cora Seaborne, dann wiederum hatte er schon bei seinem ersten Besuch in der Foulis Street gespürt, dass dort etwas nicht stimmte. Die chronische Beklommenheit in den hohen Räumen hatte offensichtlich nichts mit der Krankheit des Hausherrn zu tun. Seinerzeit war es dem Patienten noch relativ gut gegangen, auch wenn seine Krawatten da schon einen Verband verborgen hatten. Die Krawatte war immer aus Seide und immer hell und oft leicht verschmutzt. Dass ein so pedantischer Mensch wie Seaborne einen Fleck übersah, war kaum vorstellbar, und so mutmaßte Luke, der Kranke wolle seine Besucher vorsätzlich belasten. Seaborne hatte es geschafft, durch extreme Schlankheit den Eindruck von Größe zu erwecken, und er hatte so leise gesprochen, dass man sich, wollte man ihn verstehen, tief zu ihm hinunterbeugen musste. Seine Konsonanten zischten, seine Manieren waren tadellos, seine Nagelbetten blau. Er hatte die Erstuntersuchung gefasst über sich ergehen lassen und anschließend eine Operation abgelehnt. »Ich habe vor, die Welt so zu verlassen, wie ich in sie eingetreten bin«, sagte er und tätschelte die Seide an seinem Hals, »ohne eine Narbe.«
»Es gibt keinen Grund zu leiden«, bot Luke ungefragt seinen Rat an.
»Zu leiden!« Offenbar amüsierte die Vorstellung den Patienten sehr. »Eine lehrreiche Erfahrung, ohne Frage.« Und als ergäbe sich das eine aus dem anderen, fragte er: »Übrigens, haben Sie schon meine Frau kennengelernt?«
An seine erste Begegnung mit Cora Seaborne dachte Garrett oft zurück, obwohl auf seine Erinnerung kein Verlass war, hatte er sie doch auf der Grundlage späterer Treffen konstruiert. In jenem Moment war Cora hereingekommen wie bestellt. Sie war auf der Schwelle stehen geblieben, um den Besucher zu begutachten, dann hatte sie den Teppich überquert, sich zu ihrem Mann hinuntergebeugt, ihn auf die Stirn geküsst, sich hinter seinen Sessel gestellt und die Hand ausgestreckt. »Charles Ambrose sagt, kein anderer Arzt als Sie käme infrage. Er hat mir Ihren Artikel über Ignaz Semmelweis zu lesen gegeben. Wenn Sie so gut operieren, wie Sie schreiben, werden wir alle ewig leben.« Die beiläufige Schmeichelei war bestechend. Garrett lachte und beugte sich über die dargebotene Hand. Ihre Stimme war tief, aber nicht leise, und zuerst meinte er, den Akzent von Leuten herauszuhören, die nie länger in ein und demselben Land gelebt haben. In Wahrheit hatte sie einen leichten Sprachfehler, den sie geschickt verbarg, indem sie auf manchen Konsonanten länger verweilte. Ihr Kleid war schlicht und grau, doch der Stoff schillerte wie ein Taubenhals. Sie war groß und nicht schlank, ihre Augen waren so grau wie das Kleid.
In den darauffolgenden Monaten bot sich Garrett mehr als einmal die Gelegenheit, dem Unbehagen, das mit Jod und Sandelholz vermischt in der Foulis Street in der Luft hing, auf den Grund zu gehen. Gequält von unerträglichen Schmerzen sonderte Michael Seaborne eine Boshaftigkeit ab, die wenig mit der üblichen schlechten Laune des Schwerkranken gemein hatte. Seine Frau hielt kühlende Tücher und guten Wein allzeit bereit und lernte schnell, wie man eine Nadel in die Vene sticht; es war, als hätte sie das Handbuch der weiblichen Pflichten bis zur letzten Seite auswendig gelernt. Doch Zuneigungsbekundungen zwischen Cora und ihrem Mann erlebte Garrett nie. Manchmal verdächtigte er sie, das ohnehin schon trübe Lebenslicht ihres Mannes vorzeitig ausblasen zu wollen. Manchmal fürchtete er, sie könnte ihn, wenn er die Spritze aufzog, beiseitenehmen und sagen: »Geben Sie ihm doch mehr … Nur ein kleines bisschen.« Wenn sie sich hinunterbeugte, um das ausgemergelte Heiligengesicht auf dem Kissen zu küssen, geschah es zögerlich, als könnte ihr Mann sich aufbäumen und sie aus reiner Gehässigkeit in die Nase beißen. Pflegerinnen wurden eingestellt, um anzukleiden, auszuleeren und die Laken zu wechseln, hielten aber kaum länger als eine Woche durch. Die letzte (ein folgsames belgisches Mädchen) hatte Luke auf dem Flur fast umgerannt. »Il est comme un diable«, hatte sie gekeucht und beide Handgelenke vorgezeigt, doch Luke hatte nichts Ungewöhnliches erkennen können. Nur der namenlose Hund – loyal, räudig und nie weit von der Bettstatt entfernt – fürchtete den Hausherrn nicht. Oder vielleicht hatte er sich einfach nur an den Mann gewöhnt.
Nach einer Weile lernte Garrett Francis kennen, den stillen, schwarzhaarigen Sohn der Seabornes, und die Kinderfrau Martha, welche zu besitzergreifenden Gesten neigte und häufig ihren Arm um Coras Taille schlang – ein Anblick, der Luke sehr missfiel. Die Untersuchung des Kranken brachte er meist eilig hinter sich (was gab es groß zu tun?), danach wurde er eingeladen, sich ein Zahnfossil anzusehen, das gerade mit der Post gekommen war, oder über sein ehrgeizigstes Vorhaben zu sprechen: die Weiterentwicklung der Herzchirurgie. Er versuchte, Cora zu hypnotisieren – zu Kriegszeiten ein beliebtes Mittel, um die Amputationsschmerzen der Soldaten zu lindern –, oder sie spielten Schach, was unweigerlich damit endete, dass die glücklose Cora sich von gegnerischen Kräften umzingelt sah. Luke stellte sich die Diagnose selbst: Er war verliebt, und er hatte nicht die Absicht, ein Heilmittel zu finden.
Er nahm die Energie wahr, die sich in Cora angesammelt hatte und nur darauf wartete, herausgelassen zu werden; vermutlich würden ihre Absätze auf dem Straßenpflaster blaue Funken schlagen, sobald Michael Seaborne unter der Erde war. Das Ende kam tatsächlich. Bei Seabornes letztem Atemzug – angestrengt und aufgeregt, als hätte der Patient die ars moriendi kurz beiseitegelegt, um noch ein kleines bisschen länger zu leben – war Luke zugegen. In den Tagen danach wirkte Cora unverändert; weder schien sie zu trauern, noch freute sie sich. Nur einmal zitterte ihre Stimme, als sie Luke berichtete, der Hund sei tot aufgefunden worden; jedoch blieb unklar, ob sie ein Weinen oder Lachen unterdrücken musste. Als die Sterbeurkunde unterzeichnet und Michael Seabornes Überreste fortgeschafft waren, hatte Garrett eigentlich keinen Grund mehr, die Foulis Street aufzusuchen. Dennoch wachte er jeden Morgen mit demselben Gedanken auf, und wenn er durch das schmiedeeiserne Tor trat, wurde er bereits erwartet.
Die U-Bahn fuhr in die Embankment Station ein, Luke wurde mit der Menge auf den Bahnsteig gespült. Auf einmal überkam ihn eine gewisse Traurigkeit, was aber nichts mit Michael Seaborne oder dessen Witwe zu tun hatte. Ihn bekümmerte die Vorstellung, Cora heute vielleicht zum letzten Mal zu sehen, ausgerechnet beim Geläut der Trauerglocken. »Trotzdem«, dachte er, »ich muss hin, und sei es, um mich zu vergewissern, dass der Sarg zugeschraubt wird.« Jenseits der Ticketschranken überzog eine Eisschicht das Pflaster; die weiße Sonne ging schon unter.
Cora Seaborne saß in einem dem Anlass würdigen Kleid vor dem Spiegel. Von ihren Ohrläppchen hingen Tropfenperlen an Golddraht; die Haut schmerzte, weil sie ein zweites Mal durchstochen worden war. »Das«, sagte sie, »ist an Tränen genug für heute.« Ihr Gesicht war blass gepudert. Der schwarze Hut stand ihr nicht, doch mit den schwarzen Federn und dem schwarzen Schleier schien er äußerst passend. Die bezogenen Manschettenknöpfe wollten sich nicht schließen lassen, zwischen Ärmelsaum und Handschuh blitzte ein schmaler Streifen weißer Haut hervor. Der Ausschnitt des Kleides war für Coras Geschmack ein wenig zu tief und entblößte eine verschnörkelte Narbe am Schlüsselbein, etwa so breit wie Coras Daumen und ebenso lang. Die Umrisse der Narbe entsprachen den silbernen Blättern an den silbernen Kerzenhaltern rechts und links des Silberspiegels; ihr Mann hatte sie ihr auf die Haut gedrückt, wie man einen Siegelring in flüssiges Wachs taucht. Cora spielte kurz mit dem Gedanken, die Stelle zu überschminken, doch sie mochte ihre Narbe; in manchen Kreisen munkelte man gar, sie habe eine Tätowierung.
Sie wandte sich vom Spiegel ab und ließ den Blick durchs Zimmer schweifen. Ein Besucher hätte auf der Schwelle innegehalten und gestutzt; auf der einen Seite stand das hohe, weiche, mit Damastvorhängen geschmückte Bett einer wohlhabenden Frau, die andere glich einer Studentenbude. Eine Nische war mit botanischen Drucken und aus Atlanten ausgerissenen Karten tapeziert, ebenso mit Papierbögen, auf die Cora in ihrer großen, kantigen Handschrift Zitate geschrieben hatte (TRÄUME NIE MIT DER HAND AM RUDER! KEHRE DEM KOMPASS NIE DEN RÜCKEN ZU!). Auf dem Kaminsims standen ein Dutzend Ammoniten der Größe nach aufgereiht, darüber hing ein vergoldeter Rahmen. Das Gemälde darin zeigte Mary Anning und ihren Hund, wie sie in Lyme Regis einen Gesteinsfund untersuchen. Gehörte das alles jetzt ihr? Dieser Teppich, diese Sessel, dieses Kristallglas, das immer noch leicht nach Wein roch? Anscheinend ja, und bei dem Gedanken wurden ihre Glieder plötzlich ganz leicht, als wäre sie von Newtons Gesetzen freigesprochen worden und könnte jeden Augenblick an die Decke schweben. Sie unterdrückte das Gefühl, aus reinem Anstand, doch sie wusste, was es war: nicht Glück im eigentlichen Sinn, nicht einmal Zufriedenheit, sondern Erleichterung. Da war auch Trauer, gewiss, und sie war dankbar dafür, denn obschon er zum Ende hin hassenswert gewesen war, hatte er sie geprägt und würde ein Teil von ihr bleiben – und was käme schon dabei heraus, sich selbst zu hassen?
»Oh ja, er hat mich geprägt … ja«, sagte Cora, und die Erinnerung entfaltete sich wie der Rauch einer gelöschten Kerze. Sie war siebzehn und wohnte mit ihrem Vater in einem Haus oberhalb der Stadt, ihre Mutter war lange schon verstorben (jedoch erst, nachdem sie sichergestellt hatte, dass niemand ihre Tochter mit Handarbeiten und Französisch quälen würde). Ihr Vater – unsicher, was mit dem bescheidenen Vermögen anzufangen wäre, und von seinen Mietern auf verächtliche Weise geliebt – hatte Michael Seaborne von einer Geschäftsreise mitgebracht. Stolz hatte er seine Tochter vorgestellt: Cora barfuß, mit Latein auf der Zunge. Der Besucher hatte ihre Hand ergriffen und bewundert und das Mädchen für einen eingerissenen Nagel getadelt. Er kam wieder und wieder vorbei, bis er irgendwann erwartet wurde; er brachte ihr schmale Bücher und kleine, harte, nutzlose Objekte mit. Er machte sich über sie lustig, presste seinen Daumen in ihre Handfläche und rieb, bis die Haut schmerzte und ihre Aufmerksamkeit an der einen Stelle verharrte. In seiner Anwesenheit wurden die Teiche von Hampstead, die Stare in der Dämmerung, die gespaltenen Hufabdrücke der Schafe im Schlamm farblos und unbedeutend. Sie schämte sich dafür, wie sie sich für ihre lose, ungepflegte Kleidung und das ungeflochtene Haar schämte.
Eines Tages sagte er: »In Japan wird ein zerbrochener Krug mit Tropfen aus flüssigem Gold geflickt. Wäre das nicht etwas – ich breche dich und heile deine Wunden mit Gold.« Aber sie war erst siebzehn, sie trug die Rüstung der Jugend und spürte nicht, wie die Klinge versank; sie hatten beide gelacht. An ihrem neunzehnten Geburtstag tauschte sie Vogelgezwitscher gegen Federfächer und Kricketspiele im hohen Gras gegen eine Jacke mit Käferflügeln; sie wurde von Walknochen eingeschnürt und von Elfenbein durchstochen, in ihren Haaren steckte Schildpatt. Sie gewöhnte sich eine gedehnte Sprechweise an, um das Stolpern ihrer Zunge zu verbergen; sie ging nicht mehr zu Fuß. Er schenkte ihr einen zu engen Goldring, der im Laufe der Jahre noch enger wurde.
Schritte auf dem Korridor, langsam und so gemessen wie das Ticken einer Uhr, rissen die Witwe aus ihren Gedanken. »Francis«, sagte sie. Sie blieb still sitzen, wartete.
Ein Jahr vor dem Tod seines Vaters und etwa sechs Monate, nachdem dessen Krankheit sich zum ersten Mal gezeigt hatte (ein Kloß im Hals versperrte dem trockenen Toast den Weg), war Francis Seaborne ein neues Kinderzimmer zugewiesen worden, im vierten Stock des Hauses und am hinteren Ende des Flurs.
Sein Vater hätte derlei Wohnfragen selbst dann keine Aufmerksamkeit geschenkt, wenn er dem Parlament nicht bei der Einführung der neuen Wohnungsgesetze hätte helfen müssen. Die Entscheidung war allein von Cora getroffen worden und von Martha, die sich um Francis kümmerte, seit er ein Baby gewesen war, und die, wie sie es auszudrücken pflegte, seither den Absprung nicht geschafft hatte. Am besten hielt man Francis auf eine Armeslänge Abstand. Er war ein unruhiger Schläfer und tauchte nachts regelmäßig in der Tür, ein paarmal sogar am Fenster auf. Im Gegensatz zu anderen Kindern bat er niemals um ein Glas Wasser oder um Trost; nachts blieb er einfach auf der Schwelle stehen, einen seiner vielen Glücksbringer in der Hand, und wartete, bis das Unbehagen einen Kopf vom Kissen hob.
Kurz nach seinem Umzug in das, wie Cora es nannte, »obere Zimmer« gab er die nächtlichen Wanderungen auf und begnügte sich damit, zu sammeln (niemand sagte »stehlen«), was immer sein Interesse erregte. Seine Beute legte er auf dem Boden zu filigranen, rätselhaften Mustern aus, die bei jedem Besuch der Mutter ihre Gestalt verändert hatten; Cora hätte sie schön und wunderlich gefunden, wären sie das Werk eines anderen Kindes gewesen.
Weil heute Freitag war und die Beerdigung des Vaters bevorstand, kleidete Francis sich selbst an. Als Elfjähriger wusste er, dass ein Hemd zwei Enden hatte, was man sich nicht oft genug aufsagen konnte. (»NOTWENDIGERWEISE hat ein Hemd nur einen Kragen, aber zwei Ärmel.«) Der Tod seines Vaters war katastrophal, allerdings kaum schlimmer als der Verlust eines Schatzes am Vortag (eine gewöhnliche Taubenfeder, die sich allerdings ohne zu brechen zu einem geschlossenen Kreis verbiegen ließ). Als er die Neuigkeit erfuhr – er hatte bemerkt, dass seine Mutter nicht weinte, aber wie erstarrt war und glühte, als hätte der Blitz sie getroffen –, war sein erster Gedanke: Ich verstehe nicht, warum ausgerechnet mir das passiert. Aber die Feder war verloren und der Vater tot, und nun wurde von Francis offenbar erwartet, dass er in die Kirche ging. Mit dieser Vorstellung konnte er sich anfreunden. Er sagte, und dabei war ihm durchaus bewusst, wie unpassend heiter es unter den Umständen klingen musste: »Abwechslung tut Wunder.«
In den Tagen nach Michael Seabornes Ableben hatte der Hund am meisten gelitten. Er war untröstlich gewesen und hatte winselnd vor dem Krankenzimmer gesessen. Möglicherweise hätten ihm ein paar Streicheleinheiten gutgetan, aber weil niemand bereit war, seine Hände in das schmutzige Fell zu versenken, ging die Aufbahrung des Leichnams unter Winseln und Wehklagen vonstatten (»Drücken Sie ihm einen Penny auf die Augen, für den Fährmann«, sagte Martha. »Ich glaube nicht, dass Petrus sich die Mühe machen wird …«). Aber natürlich, der Hund ist ebenfalls gestorben, dachte Francis und strich zufrieden über ein Eckchen Fell vom Gewand des Vaters, nun gilt es, den einzigen Trauernden zu betrauern.
Er war unsicher, welche Rituale bei der Entsorgung eines Toten zur Anwendung kämen, aber er wollte auf alles vorbereitet sein. Seine Jacke hatte zahlreiche Taschen, und in jeder einzelnen steckte ein Objekt, das vielleicht nicht gerade heilig, für die bevorstehende Aufgabe jedoch bestens geeignet war. Ein angeknackstes Brillenglas, das einen gebrochenen Blick auf die Welt erlaubte; das Fellstück (Francis hoffte immer noch, ein Floh oder eine Zecke könnte darin hocken, mit etwas Glück sogar ein Floh oder eine Zecke mit einem Tropfen Blut im Bauch); seine beste Rabenfeder mit der blauschimmernden Spitze; ein Stofffetzen von Marthas Kleidersaum, den er herausgerissen hatte, weil ihn der hartnäckige Fleck darauf an die Isle of Wight erinnerte; ein Stein mit länglichem Loch in der Mitte. Nachdem er alle Taschen gefüllt, gezählt und abgeklopft hatte, ging er zu seiner Mutter hinunter, und bei jeder der sechsunddreißig Treppenstufen sang er: »Heute – hier – morgen – weg, heute – hier – morgen …«
»Frankie …« Wie klein er war. Sein Gesicht, in dem seltsamerweise keines der Elternteile zu erkennen war, höchstens der Vater in den scheinbar tiefenlosen, schwarzen Augen, war ungerührt. Er hatte sich gekämmt, das Haar klebte ihm in Rillen am Kopf. Dass er sich solche Mühe gegeben hatte, rührte Cora sehr; sie streckte eine Hand aus, ließ sie aber gleich wieder sinken. Francis klopfte der Reihe nach seine Taschen ab und fragte: »Wo ist er jetzt?«
»Er wartet in der Kirche auf uns.« Sollte sie den Jungen umarmen? Man muss dazusagen, dass er nicht aussah wie jemand, der eine Umarmung brauchte.
»Frankie, wenn du möchtest, darfst du weinen. Dafür muss man sich nicht schämen.«
»Wenn ich weinen wollte, würde ich es tun. Ich tue alles, was ich will.« Cora verzichtete darauf, den Jungen zurechtzuweisen; eigentlich hatte er nur eine Tatsache ausgesprochen. Francis klopfte noch einmal seine Taschen ab, und sie sagte sanft: »Du nimmst deine Schätze mit.«
»Ich nehme meine Schätze mit. Ich habe einen für dich (klopf), einen für Martha (klopf), einen für Vater (klopf) und einen für mich (klopf, klopf).«
»Danke, Frankie.« Cora war ratlos, aber da kam endlich Martha herein, und wie immer brachte sie den Raum zum Leuchten. Es brauchte kaum mehr als Marthas Anwesenheit, um eine unangenehme Spannung aufzulösen. Sie tätschelte Francis flüchtig den Kopf, als wäre er ein fremdes Kind. Sie schlang einen starken Arm um Coras Taille, roch nach Zitronen.
»Los geht’s«, sagte sie. »Er konnte es nie ausstehen, wenn wir uns verspäten.«
Um zwei Uhr nachmittags schlugen die Totenglocken von St. Martin’s, und ihr Läuten rollte über den Trafalgar Square. Francis, der an einem gnadenlos genauen Gehör litt, legte sich die behandschuhten Hände auf die Ohren und weigerte sich, das Haus zu verlassen, bevor der letzte Schlag verhallt war; als die verspätete Witwe samt Sohn endlich eintraf, seufzten alle Trauergäste zufrieden. Wie blass die beiden aussahen! Das war ja so passend! Und seht euch bitte diesen Hut an!
Cora beobachtete die Veranstaltung aus einem interessierten Abstand. Dort im Mittelgang stand der Sarg ihres Mannes auf einem Gestell, das an den Bock einer Fleischerbank erinnerte, und verdeckte ihr die Sicht auf den Altar. In dem Sarg lag ein Körper, den sie kein einziges Mal vollkommen nackt gesehen hatte; sie hatte stets nur flüchtige, manchmal panische Blicke auf dünne, sehr weiße Haut erhascht, straff gespannt über wunderschöne Knochen.
Auf einmal wurde ihr klar, wie wenig sie über seine öffentliche Rolle wusste, die er (wie sie sich vorstellte) in immer gleich ausgestatteten Räumen im Unterhaus und in der Kanzlei in Whitehall gespielt hatte und in seinem Club, zu dem ihr kein Zutritt gewährt wurde, weil sie leider eine Frau war. Möglicherweise war er überall freundlich aufgetreten – ja, so musste es gewesen sein –, und sie war der Abladeplatz für anderswo zurückgehaltene Grausamkeiten gewesen. Eine noble Geste, wenn man genauer darüber nachdachte. Cora schaute auf ihre Hände nieder, als könnte der Gedanke ihr biblische Wundmale aufgedrückt haben.
Hoch oben auf einem schwarzen Balkon, der im trüben Licht über meterhohen Säulen schwebte, die ihn eigentlich tragen sollten, saß Luke Garrett. Kobold, dachte sie. Seht ihn euch an!, und das Herz klopfte ihr gegen die Rippen, als wollte es zu dem Freund hinaus. Seine Chirurgenschürze hätte nicht unpassender wirken können als der Mantel, den er trug; sicher hatte er schon am Vormittag zu trinken begonnen, und die junge Frau neben ihm war eine neue Bekanntschaft, deren Zuneigung weit über seinem Budget lag. Trotz der Dunkelheit und der Distanz traf sie ein schwarzer Blick und lud zum Kichern ein. Auch Martha hatte ihn bemerkt und kniff der Witwe geistesgegenwärtig in den Oberschenkel, sodass die Leute später, beim Wein in Hampstead und Paddington und Westminster, sagen würden: »Seabornes Witwe hat vor Kummer nach Luft geschnappt, als der Pfarrer sagte: Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt; es war wirklich rührend.«
Francis saß neben Cora und flüsterte pausenlos. Er hielt sich einen Daumen an die Lippen und die Augen geschlossen. Plötzlich sah er wieder aus wie ein Kleinkind, und Cora legte ihre Finger auf seine, klein und heiß. Sie zog die Hand bald wieder weg, legte sie in den Schoß.
Danach flatterten schwarze Soutanen durch die Bänke wie Saatkrähen, und Cora stand auf der Treppe und verabschiedete die Trauergäste. Alle strotzten vor Güte und Hilfsbereitschaft; sie habe viele Freunde in der Stadt, sie und ihr hübscher Junge seien jederzeit zum Abendessen willkommen, man werde für sie beten. Cora reichte so viele Visitenkarten und Sträußchen und Büchlein und Tücher mit schwarzen Paspeln an Martha weiter, dass ein Außenstehender die Feier mit einer Hochzeit hätte verwechseln können, wenn auch mit einer besonders traurigen.
Es war noch nicht Abend, aber schon überzog der Frost die Stufen unter den Laternen mit einem harten Funkeln, und Nebel stand über der Stadt wie ein weißes Zelt. Cora zitterte, und Martha kam ein bisschen näher heran, um von ihrem in den zweitbesten Mantel gehüllten, kompakten Körper etwas Wärme abzugeben. Francis stand abseits, seine linke Hand wühlte in den Taschen, die rechte fuhr hektisch über seine Haare. Er sah nicht wirklich unglücklich aus; in dem Fall hätten die beiden Frauen ihn zu gern in ihre Mitte genommen und mit beruhigenden Worten überschüttet. Er hätte sich die Unterbrechung der geliebten Routine artig gefallen lassen.
»Gott sei uns gnädig«, sagte Dr. Garrett, als die letzten Trauergäste ihre schwarzen Hüte aufgesetzt und sich verabschiedet hatten, erleichtert darüber, dass es endlich vorbei war und sie sich der abendlichen Unterhaltung und den Geschäften des nächsten Tages zuwenden konnten. Auf eine charmante Art, wie sie typisch für ihn war, wechselte er übergangslos das Thema, nahm Coras behandschuhte Finger in seine und sagte: »Gut gemacht, Cora, Sie haben sich wirklich tapfer geschlagen. Kann ich Sie nach Hause begleiten? Bitte erlauben Sie mir das. Ich habe Hunger. Sie auch? Ich könnte eine Stute samt Fohlen verspeisen.«
»Eine Stute können Sie sich gar nicht leisten«, sagte Martha, die mit dem Doktor, wenn überhaupt, nur in gereiztem Ton sprach. Kobold war ihr Spitzname für ihn gewesen, auch wenn sich heute niemand mehr daran erinnern wollte. Seine Besuche im Haus in der Foulis Street – anfangs eine Angelegenheit der Pflicht, später der Ergebenheit – waren für Martha ein Ärgernis, fand sie ihre eigene Ergebenheit doch mehr als ausreichend. Er hatte seine Begleiterin entlassen und sich ein schwarz umsäumtes Tuch in die Brusttasche gesteckt.
»Am liebsten würde ich spazieren gehen«, antwortete Cora. Francis, der ihre plötzliche Erschöpfung witterte und eine Gelegenheit erkannte, seinen Vorteil daraus zu ziehen, stellte sich vor Cora hin und verlangte eine Heimfahrt mit der U-Bahn. Wie immer handelte es sich nicht um eine kindliche Bitte, die erfüllt werden mochte oder nicht, sondern um eine kühle Feststellung. Garrett, der noch nicht gelernt hatte, mit dem unbeugsamen Willen des Jungen umzugehen, sagte: »Ich persönlich habe für heute genug von der Unterwelt gesehen«, und winkte eine Droschke heran.
Martha ergriff Francis’ Hand, und aus reiner Überraschung über die forsche Geste zog er sie nicht weg. »Ich fahre mit dir, Frank; dort haben wir es warm, ich kann meine Zehen nicht mehr fühlen … Aber Sie, Cora, können gern den ganzen Weg zu Fuß gehen … Sicher sind es mindestens drei Meilen?«
»Dreieinhalb«, sagte der Doktor, als hätte er die Strecke persönlich gepflastert. »Cora, ich begleite Sie.« Der Kutscher gestikulierte ungeduldig und erntete eine obszöne Geste. »Das dürfen Sie nicht, Sie können nicht allein gehen.«
»Ich darf nicht? Ich kann nicht?« Cora zog ihre Spitzenhandschuhe aus, die vor der Kälte ohnehin nicht besser schützten als Spinnweben, und warf sie Garrett an die Brust. »Geben Sie mir Ihre. Ich frage mich wirklich, wer so etwas herstellt, oder warum Frauen es kaufen … Ich kann gehen, und ich werde gehen. Ich trage das richtige Schuhwerk, sehen Sie?« Sie hob den Rocksaum, und zum Vorschein kamen Stiefel, die besser zu einem Schulkind gepasst hätten.
Francis hatte sich von seiner Mutter abgewandt, ihn interessierte nicht, welchen Verlauf ihr Abend nehmen würde. Er hatte noch eine Menge zu tun, oben in seinem Zimmer; ein paar neue Stücke (klopf, klopf) erforderten seine Aufmerksamkeit. Er befreite sich aus Marthas Griff und marschierte los in Richtung Stadt. Martha warf Garrett einen argwöhnischen und der Freundin einen kläglichen Blick zu, verabschiedete sich und verschwand im Nebel.
»Lassen Sie mich allein gehen«, sagte Cora und streifte die geborgten Handschuhe über, die so abgetragen waren, dass sie kaum mehr wärmten als ihre eigenen. »Meine Gedanken sind so durcheinander, ich werde mindestens eine Meile brauchen, um sie zu entwirren.« Sie berührte das Tuch, das aus Garretts Brusttasche ragte. »Kommen Sie morgen mit ans Grab, wenn Sie möchten. Ich habe zwar gesagt, ich wollte allein hin, aber vielleicht ist es einerlei; vielleicht sind wir immer allein, egal, wer uns begleitet.«
»Sie sollten immer einen Schreiber um sich haben, der Ihre Weisheiten notiert«, spottete der Kobold und ließ ihre Hand fallen. Er verbeugte sich übertrieben tief, stieg in die Droschke und knallte die Tür zu, wie um ihr Lachen nicht hören zu müssen.
Cora wunderte sich sehr über seine Fähigkeit, ihre Launen immer wieder so umschlagen zu lassen. Sie wandte sich nicht nach Westen, wo ihr Zuhause war, sondern ging zur Strand. Sie wollte die Stelle östlich von Holborn suchen, wo der River Fleet in den Untergrund geleitet wurde; dort gab es ein ganz bestimmtes Gitter, auf dem man stehen und an stillen Tagen hören konnte, wie das Wasser dem Meer entgegenrauschte.
In der Fleet Street lauschte sie angestrengt in die graue Luft, um den Fluss in seiner länglichen Gruft zu hören, vernahm aber nur den Lärm einer Stadt, die sich weder durch Frost noch Nebel vom Vergnügen oder von der Arbeit abhalten ließ. Außerdem hatte ihr jemand erzählt, es handele sich im Grunde nur noch um einen Abwasserkanal, der nicht mehr aus dem Regenwasser von Hampstead Heath gespeist wurde, sondern von den Menschen, die sich massenhaft an seinem Lauf niedergelassen hatten. Sie blieb noch eine Weile stehen, bis ihre Hände vor Kälte schmerzten und die durchstochenen Ohrläppchen zu pochen anfingen. Seufzend trat sie den Heimweg an. Erst nach einer Weile merkte sie, dass sie das Unwohlsein, das sie normalerweise beim Gedanken an das hohe weiße Haus in der Foulis Street beschlich, irgendwo zwischen den dunklen Kirchenbänken verloren hatte.
Für Martha, die ihre Heimkehr (eine gute Stunde später; die Sommersprossen schimmerten durch Coras weißen Puder, und der schwarze Hut saß schief) sehnsüchtig erwartet hatte, war ein gesunder Appetit der beste Beweis für einen klaren Verstand, deswegen freute sie sich sehr, als die Freundin Rührei mit Toast verlangte. »Ich bin ja so froh, wenn das alles vorbei ist«, sagte Cora. »Die Beileidskarten, das Händeschütteln. Die Etikette des Todes langweilt mich so sehr!«
Das von der U-Bahn-Fahrt besänftigte Kind war wortlos mit einem Glas Wasser in sein Zimmer hinaufgegangen und mit einem Apfelrest in der Hand eingeschlafen. Martha hatte in der Tür gestanden und die schwarzen Wimpern auf der weißen Wange betrachtet, und ihr war warm ums Herz geworden. Aus unerklärlichem Grund lag ein Stückchen Fell des elenden Hundes in Francis’ Bett; Martha bildete sich ein, Läuse und Flöhe darauf herumkriechen zu sehen. Sie beugte sich hinunter, um es vorsichtig zu entfernen. Doch ihre Hand musste das Kissen gestreift haben; der Junge war hellwach, noch bevor sie einmal ausgeatmet hatte, und als er das Fell in ihrer Hand sah, stieß er einen wortlosen Wutschrei aus. Martha ließ den schmierigen Fetzen fallen und rannte hinaus. Auf dem Weg nach unten dachte sie: Wie kann es sein, dass ich Angst vor ihm habe; er ist doch nur ein vaterloses Kind!, und fast wäre sie wieder hinaufgestiegen, um die Herausgabe des gesundheitsgefährdenden Andenkens zu fordern und vielleicht sogar einen Kuss. In dem Moment hatte sich der Schlüssel klappernd im Schloss gedreht, und da war Cora, die ein Kaminfeuer wünschte, ihre Handschuhe fallen ließ, die Arme ausstreckte.
Später an dem Abend blieb Martha, die immer als Letzte zu Bett ging, vor Coras Schlafzimmer stehen, denn seit ein paar Jahren überzeugte sie sich gern noch einmal davon, dass es der Freundin gut ging. Die Tür stand halb offen, im Kamin knisterte ein kleines Feuer. Martha hielt auf der Schwelle inne, flüsterte: »Schläfst du schon? Soll ich hereinkommen?«, und setzte, obwohl sie keine Antwort erhielt, einen Fuß auf den dicken, cremeweißen Teppich. Auf dem Kaminsims standen Visitenkarten und schwarzgeränderte, eng beschriebene Kondolenzbriefe; ein kleiner Veilchenstrauß mit schwarzer Schleife war vor die Feuerstelle gefallen. Martha bückte sich, um ihn aufzuheben, fast schienen die Blüten vor ihr zurückzuschrecken und sich hinter den herzförmigen Blättern zu verstecken. Sie stellte die Blumen in das Wasserglas auf dem Nachttisch, damit die Freundin sie gleich nach dem Aufwachen sehen würde, und dann beugte sie sich zu einem Kuss hinunter. Cora murmelte leise und regte sich, ohne aufzuwachen. Martha dachte an ihren ersten Tag in der Foulis Street zurück, als sie eine hochmütige Matrone mit von Klatsch und Mode aufgeweichtem Hirn erwartet hatte, und wie sie aus der Fassung geraten war, als dieses schillernde Wesen ihr die Tür öffnete. Martha war fasziniert gewesen und auch ein bisschen wütend, denn wann immer sie sich an die eine Cora gewöhnt hatte, kam eine neue zum Vorschein. Im einen Moment war Cora ein Mädchen und wirkte wie eine ehrgeizige, selbstgefällige Schülerin, im nächsten verwandelte sie sich in eine vertraute Freundin, die Martha seit Jahren zu kennen glaubte; sie lud zu extravaganten Abendgesellschaften ein, fläzte sich aber, sobald der letzte Gast gegangen war, fluchend und mit offenen Haaren am Kamin.
Sogar ihre Stimme war auf verwirrende Weise schön. Dieses merkwürdige Beinahe-Lispeln, dieser unterdrückte Sprachfehler, der sich vor allem zeigte, wenn sie müde wurde und gewisse Konsonanten ihr Probleme bereiteten. Ihr Witz und ihr Charme (der sich, wie Martha einmal verbittert bemerkt hatte, an- und abstellen ließ wie das fließende Wasser im Bad) dienten zur Tarnung unsichtbarer Verletzungen, die sie umso liebenswerter machten. Michael Seaborne hatte Martha so viel Beachtung geschenkt wie einem Hutständer: Sie war praktisch unsichtbar gewesen. Bei Begegnungen auf der Treppe hatte er ihr nicht einmal ins Gesicht gesehen. Aber der aufmerksamen Martha war nichts entgangen. Sie hatte jede höfliche Beleidigung gehört und jeden mühsam versteckten blauen Fleck entdeckt. Sie hatte all ihre Kraft aufbringen müssen, um nicht einen Mord zu planen, für den sie sich bereitwillig hätte hängen lassen. Ein knappes Jahr nach ihrer Ankunft in der Foulis Street war Cora in Marthas Zimmer gekommen, im frühen Morgengrauen, als alles schlief. Sie zitterte heftig, aus welchem Grund auch immer, dabei war die Nacht sehr warm; ihr volles, zerzaustes Haar war nass. Martha hatte wortlos die Decke angehoben und Cora in den Arm genommen; sie hatte die Knie angezogen, sich angeschmiegt und Cora festgehalten, bis deren Zittern auf sie überging. Sobald er von beengenden Walknochen und Stoff befreit war, wirkte Coras Körper groß und kräftig. Martha spürte die Bewegungen der Schulterblätter im schmalen Rücken, den weichen Bauch, auf dem ihr Arm ruhte, die kräftigen Beinmuskeln; es war, als läge sie neben einem Tier, das nie wieder so stillhalten würde. Sie waren locker umschlungen aufgewacht, ohne sich zu schämen, und hatten sich liebevoll voneinander verabschiedet.
Martha war erfreut zu sehen, dass Cora nicht in Trauer eingeschlafen war, sondern wie jeden Abend ihr »Studienmaterial« durchgegangen war, wie ein Junge, der fürs College lernt. Neben dem Bett lag die alte Ledermappe ihrer Mutter. Das goldene Monogramm war abgewetzt, und das Leder roch (fand Martha) nach dem Tier, das es früher einmal umhüllt hatte. Da waren die Notizbücher, angefüllt mit Bemerkungen in Coras kleiner, kantiger Schrift und getrockneten Kräutern und Gräsern, daneben die Karte einer Küstenlandschaft mit Markierungen in roter Tinte. Cora lag in einem Kranz aus losen Blättern, in der Hand hielt sie immer noch den Ammoniten aus Dorset. Im Schlaf hatte sie zu fest zugegriffen; das Fossil war zerbröselt, und ihre Finger waren dreckverschmiert.
FEBRUAR
1
»Nimm beispielsweise den Jasmin.« Dr. Luke Garrett wischte die Papiere von seinem Schreibtisch, als erwartete er, darunter weiße Blüten aus kleinen Knospen platzen zu sehen, aber dann fand er nur seinen Tabakbeutel und machte sich daran, eine Zigarette zu drehen. »Sein süßlicher Duft ist angenehm und unangenehm zugleich. Die Menschen weichen zurück und kommen dichter heran, weichen zurück und kommen heran. Sie wissen nicht, ob sie sich ekeln oder ergötzen sollen. Wenn wir akzeptieren könnten, dass Lust und Leid nicht entgegengesetzte Pole sind, sondern zwei Seiten derselben Medaille, würden wir endlich begreifen …« Er verlor den Faden, schaute sich suchend danach um.
Der Mann am Fenster, er war Garretts Vorträge gewohnt, trank einen Schluck Bier und sagte freundlich: »Erst letzte Woche hast du mir noch erzählt, alle leidvollen Zustände wären schlecht und alle Zustände der Lust gut. Ich kann mich so genau an deine Worte erinnern, weil du sie oft wiederholt und sogar für mich aufgeschrieben hast, damit ich sie nicht vergesse. Warte mal, ich habe sie dabei …« Er klopfte sich hämisch alle Taschen ab und errötete dann, weil er sich beim spielerischen Necken im Zweifel sehr ungeschickt anstellte. George Spencer war alles, was Garrett nicht war: groß, wohlhabend, blond und schüchtern. Seine Gefühle waren meistens tiefer als seine Gedanken. Leute, die beide noch vom Studium kannten, scherzten gern, Spencer sei das gute Gewissen des Kobolds und aus unbekanntem Grund von ihm getrennt worden; seither bemühe er sich, den Freund einzuholen.
Garrett ließ sich tiefer in den Sessel sinken. »Die These erscheint natürlich widersprüchlich und unhaltbar, aber einem außerordentlichen Verstand ist es möglich, zwei unvereinbare Gedanken gleichzeitig zu denken.« Er leerte sein Glas und runzelte die Stirn, sodass seine Augen unter den schwarzen Brauen und der noch schwärzeren Haartolle zu verschwinden drohten. »Lass es mich dir erklären …«
»Ja, gern, aber ich bin mit Freunden zum Abendessen verabredet.«
»Du hast keine Freunde, Spencer. Nicht mal ich kann dich leiden. Sieh es ein: Leid zu verursachen oder zu spüren ist unbestreitbar die abstoßendste aller menschlichen Erfahrungen. Bevor es uns gelang, den Patienten bewusstlos zu machen, haben die Chirurgen sich im Angesicht der undankbaren Aufgabe vor Angst übergeben. Weise Männer und Frauen wollten lieber zwanzig Jahre früher sterben, als das Skalpell zu ertragen – selbst dir würde es so gehen und mir! Und doch ist es uns unmöglich zu bestimmen, was der Schmerz denn nun eigentlich ist, was wir eigentlich fühlen, und ob das Leid des einen so groß ist wie das eines anderen. Im Grunde scheint es weniger eine Frage der Konstitution zu sein als der Vorstellungskraft. Siehst du nun ein, wie hoch man die Hypnose schätzen muss?« Er kniff die Augen zusammen und fuhr fort: »Wenn du mir erzählst, du hättest dich verbrannt und starke Schmerzen – woher soll ich wissen, ob deine geschilderten Gefühle dem Zustand ähneln, in dem ich mich nach derselben Verletzung wiederfinden würde? Ich könnte nur sagen, dass wir beide eine körperliche Reaktion auf einen identischen Reiz zeigen. Ja, vielleicht jammern wir beide und planschen eine Weile in kaltem Wasser herum und so weiter, aber woher soll ich wissen, dass ich, steckte ich in deiner Haut, nicht in einer ganz anderen Tonlage jammern würde?« Er grinste wölfisch und fügte an: »Ist es von Belang? Hätte es Auswirkungen auf die Therapie, die der Arzt empfiehlt? Wie kann man, wenn man die Wahrheit – besser gesagt den Wert – des Schmerzes anzweifelt, Heilmittel anwenden oder verweigern und sich dabei auf einen Maßstab berufen, der, wie du selbst zugeben musst, vollkommen willkürlich festgelegt ist?«
Garrett verlor das Interesse an den eigenen Ausführungen und beugte sich vor, um die heruntergefallenen Blätter aufzulesen und auf säuberliche Stapel zu verteilen. »In der Praxis ist das alles egal. War nur so ein Gedanke. Mir fallen ständig Sachen ein, über die ich reden muss, und außer dir habe ich niemanden, der mir zuhört. Ich sollte mir einen Hund anschaffen.« Spencer ahnte, dass sein Freund jetzt in Trübsinn verfallen würde. Er holte eine Zigarette heraus, ignorierte das Ticken seiner Uhr, nahm auf einem harten Holzstuhl Platz und betrachtete das Zimmer. Es war so fanatisch sauber, dass die knauserige Wintersonne kein einziges Staubkörnchen aufklauben konnte, sosehr sie sich auch bemühte. Das Mobiliar bestand aus zwei Stühlen, einem Tisch und zwei auf den Kopf gestellten Packkisten. Der ans Fenster genagelte Stoffstreifen war dünn und ausgewaschen, der weiße Marmorkamin glänzte, es roch stark nach Zitrone und Desinfektionsmittel. Auf dem Sims standen schwarz gerahmte Fotografien von Ignaz Semmelweis und John Snow. Über dem kleinen Schreibtisch hing die Zeichnung (signiert von LUKE GARRETT, 13) einer Schlange, die sich um einen Stab windet und die gespaltene Zunge zeigt; Symbol des Asklepios, Gott der Heilkunst, der auf dem Scheiterhaufen aus dem Mutterleib herausgeschnitten worden war. Garretts Zimmer befand sich am Kopf einer weißgetünchten Treppe; Spencer hatte hier nie andere Nahrungsmittel gesehen als billiges Bier und Kekse von Jacob’s. Er schaute zu seinem Freund hinüber und war wie immer hin und her gerissen zwischen Gereiztheit und Zuneigung.
Er konnte sich noch glasklar an ihre erste Begegnung im Hörsaal des Royal Borough erinnern, dem Lehrkrankenhaus, wo Garrett seine Tutoren in Theorie und Praxis bald überholt hatte und ihre Vorlesungen schlechtgelaunt über sich ergehen ließ – außer, es ging um die Anatomie des Herzens und den Blutkreislauf. Dann war er so voller kindlicher Begeisterung, dass sie ihn des Hohnes verdächtigten und mehr als einmal vor die Tür setzten. Spencer, dem bewusst war, dass er die engen Grenzen seiner Intelligenz nur überwinden konnte, indem er lernte, und zwar sehr viel, ging Garrett aus dem Weg. Er vermutete, dass es ihm nur Nachteile bringen würde, mit dem Sonderling gesehen zu werden, außerdem hatte er ein bisschen Angst vor dem Blitzen in Garretts schwarzen Augen. Einmal traf er ihn abends im Krankenhaus an, als das Labor menschenleer war und alle Türen schon abgeschlossen waren, und zunächst fürchtete er, der Kommilitone sei in Not. Garrett saß mit gesenktem Kopf vor einem der angekokelten, bunsenverbrannten Arbeitstische und starrte auf seine gespreizten Finger nieder.
»Garrett?«, fragte Spencer. »Bist du das? Ist alles in Ordnung? Was tust du hier um diese Zeit?«
Garrett antwortete nicht, sondern drehte nur langsam den Kopf, und zum ersten Mal war das sardonische Lächeln verschwunden, das er trug wie eine Maske. Stattdessen lächelte er so offen und glücklich, dass Spencer fürchtete, er hätte ihn mit einem anderen verwechselt. Aber da winkte Garrett ihn heran und sagte: »Sieh mal! Komm und sieh dir an, was ich gemacht habe!«
Spencers erster Gedanke war, dass Garrett mit dem Sticken angefangen hatte. Es hätte ihn kaum verwundert; jedes Jahr fand unter den angehenden Chirurgen ein Wettbewerb darum statt, wem die feinsten Stiche auf einem weißen Stückchen Seidentuch gelangen. Manche behaupteten sogar, sie hätten an Spinnweben geübt. Das Objekt von Garretts Verzückung war wunderschön und erinnerte an einen japanischen Miniaturfächer mit aufwendig geknüpften Quasten. Es war nicht breiter als Spencers Daumen und das Muster aus Blau und Scharlachrot auf sattgelbem Untergrund so feinziseliert, dass man nicht mehr mit Bestimmtheit sagen konnte, wo genau die Fäden aus der Seide traten. Er beugte sich vor, um besser sehen zu können, er versuchte, den Blick scharfzustellen, und dann begriff er, was er da vor Augen hatte: ein säuberlich herausgetrenntes Stück menschlicher Mageninnenwand auf einem Objektträger, hauchdünn wie Pergament und mit blauer Tinte gefüllt, sodass die Blutgefäße deutlich hervortraten. Kein Künstler hätte diese fein verästelten Venen und Arterien malen können, die keinem Muster folgten und in denen Spencer trotzdem die nackten Äste eines Baumes im Frühling zu erkennen meinte.
»Oh!« Er sah Garrett in die Augen, und sie tauschten einen entzückten Blick, der wie ein Knoten war, und keiner von beiden hatte ihn je wieder gelöst.
»Du hast das gemacht?«
»Ja, ich! Als ich ein Kind war, habe ich einmal ein Bild von etwas Ähnlichem gesehen, ich glaube, der Arzt war Edward Jenner. Ich habe zu meinem Vater gesagt: Das kann ich auch … Wahrscheinlich hat er mir nicht geglaubt. Und hier sind wir nun, und ich habe es geschafft. Ich bin ins Leichenhaus eingebrochen. Du wirst mich doch nicht verraten?«
»Nein … niemals!«, sagte Spencer. Er war hingerissen.
»Ich glaube, bei den meisten von uns – bei mir jedenfalls – ist das, was unter der Haut liegt, interessanter als das darauf. Krempel mich um, und ich bin ein recht attraktiver Kerl!« Ehrfürchtig wie ein Priester legte Garrett den Objektträger in eine Pappschachtel, verschnürte sie und steckte sie ein. »Ich werde es zum Rahmenmacher bringen und in Ebenholz fassen lassen. Ist Ebenholz teuer? Kiefer, Eiche … Ich lebe in der Hoffnung, eines Tages einen Menschen kennenzulernen, der es ebenso schön findet wie ich. Wollen wir etwas trinken gehen?«
Spencer betrachtete erst die aus dem Studentenzimmer heruntergeschleppten Bücher und dann Lukes Gesicht. Zum ersten Mal kam Spencer der Verdacht, sein Kommilitone könnte schüchtern sein, vermutlich sogar einsam. »Warum nicht?«, sagte er. »Wenn ich schon durchs Examen falle, brauche ich mir nicht auch noch den Kopf darüber zu zerbrechen.«
Garrett grinste. »Hoffentlich hast du Geld dabei, ich habe nämlich seit gestern nichts gegessen.« Und dann lief er beschwingt durch den langen Flur voraus und lachte, über sich oder über Spencer oder über einen alten Witz, der ihm gerade wieder eingefallen war.
Offenbar hatte Garrett niemals den passenden Rahmen für seine Handwerksarbeit gefunden, denn nun, Jahre später, lag der Objektträger immer noch in der an den Kanten vergilbten Schachtel; sie war auf dem Kaminsims aufgebahrt wie eine Reliquie. Spencer rollte die Zigarette zwischen den Fingern hin und her und fragte: »Ist sie weg?«
Garrett hob den Kopf und wollte so tun, als habe er sich verhört, gab es aber auf. »Cora? Ist letzte Woche abgereist. In der Foulis Street sind alle Vorhänge zugezogen, und auf den Möbeln liegen Laken. Ich weiß das, weil ich hingegangen bin.« Er runzelte die Stirn. »Als ich ankam, war sie schon fort. Nur die alte Hexe Martha war noch da, aber sie hat sich geweigert, mir die neue Adresse zu geben. Hat behauptet, Cora benötige Ruhe und Erholung und werde mir schreiben, wann es ihr passt.«
»Martha ist nur ein Jahr älter als du«, sagte Spencer nachsichtig. »Und gib es zu, Garrett: Ruhe und Erholung ist nicht gerade das, was du zu bieten hast.«
»Ich bin ihr Freund!«
»Ja, aber kein ruhiger, erholsamer. Wo ist sie jetzt?«
»In Colchester. Colchester! Was gibt es da schon zu sehen? Eine Burgruine und einen Bach, Bauern mit Schwimmhäuten zwischen den Zehen und jede Menge Matsch.«
»An der Küste wurden Fossilien gefunden, ich habe davon gelesen. Die gebildeten Damen tragen jetzt Haifischzähne an Silberketten. Cora wird da oben so glücklich sein wie ein Junge beim Schulausflug, sicher steht sie jetzt gerade bis zu den Knien im Schlamm. Du wirst sie bald wiedersehen.«
»Was ist denn bald? Was ist denn Colchester? Wer braucht schon Fossilien? Es ist kaum einen Monat her, sie sollte noch trauern.« (Bei diesem Satz schauten beide zu Boden.) »Sie sollte unter Menschen sein, die sie lieben.«
»Keiner liebt sie mehr als Martha, und Martha ist bei ihr.« Spencer verlor kein Wort über Francis, der ihn mehrere Male beim Schach geschlagen hatte. Dass der Junge seine Mutter wohl auch liebte, brachte er nicht über die Lippen. Die Uhr tickte lauter, Garrett kochte in stiller Wut vor sich hin. Spencer dachte an das Essen, das auf ihn wartete, und an den Wein, an das warme Haus mit den tiefen Teppichen, und als wäre es ihm just in diesem Moment eingefallen, sagte er: »Übrigens, wie kommst du mit der Abhandlung voran?« Mit einem zu erwartenden akademischen Erfolg vor Garretts Nase herumzuwedeln, wirkte normalerweise, als zeigte man einem Hund einen blutigen Knochen. Nichts anderes schien Lukes Gedanken von Cora Seaborne ablenken zu können.
»Meine Abhandlung?« Garrett spuckte das Wort aus wie einen verdorbenen Bissen. Dann fügte er etwas milder hinzu: »Über die Möglichkeit einer Herzklappenverpflanzung? Ja, ganz gut, danke.« Fast ohne hinzusehen zog er vorsichtig ein halbes Dutzend eng beschriebene Blätter aus einem Bücherstapel. »Sonntag ist Abgabeschluss. Am besten mache ich gleich weiter. Würdest du bitte verschwinden?« Er wandte sich ab, legte sich fast auf den Schreibtisch und fing an, mit einer Rasierklinge einen Bleistift zu spitzen. Er klappte ein großes Blatt Papier auf, das den stark vergrößerten Querschnitt des menschlichen Herzens zeigte; der dazugehörige Text war von rätselhaften Markierungen in schwarzer Tinte durchsetzt, einzelne Passagen waren durchgestrichen und teilweise durch viele Ausrufezeichen wieder rehabilitiert. Garretts Blick blieb am Rand hängen; er schien aufgeregt oder verärgert, fluchte leise und kritzelte drauflos.
Spencer zog einen Geldschein aus der Tasche und ließ ihn zu Boden segeln, damit der Freund später glauben konnte, er hätte ihn selbst verloren. Dann zog er leise die Tür hinter sich zu.
2
Nachdem sie den Fluss nach Eisvögeln und die Burg nach Raben abgesucht hatte, ging Cora Seaborne an Marthas Arm durch Colchester spazieren. In der freien Hand hielt sie einen Regenschirm. Es gab keine Eisvögel (»Auf einer Nilkreuzfahrt vermutlich … Martha, sollen wir ihnen folgen?«), aber der Burgfried war schwarz vor grabgesichtigen Saatkrähen gewesen, die in ihren zerlumpten Federhosen herumstolzierten. »Eine gute Ruine«, sagte Cora, »aber ich hätte doch zu gern einen Galgen gesehen, oder wenigstens einen Schurken mit herausgepickten Augen.«
Martha, die wenig Sinn für die Vergangenheit hatte und den Blick stets auf einen helleren, mehrere Jahre in der Zukunft liegenden Punkt richtete, sagte: »Es gibt hier genug Elend, Sie müssen es nur sehen wollen«, und deutete auf einen Mann, dessen Beine oberhalb der Knie endeten und der sich gegenüber von einem Kaffeehaus niedergelassen hatte, weil sich den Touristen umso größere Schuldgefühle einflößen ließen, je voller ihr Bauch war. Martha hatte keinen Hehl daraus gemacht, wie schwer ihr der Abschied von der Stadt gefallen war; denn obgleich ihr dicker blonder Zopf und die starken Arme ihr das Aussehen eines Milchmädchens mit einer Schwäche für Sahne verliehen, war sie noch nie östlich von Bishopsgate gewesen. Die eichengesäumten Felder von Essex fand sie unheimlich, die rosa bemalten Häuser hielt sie für die Wohnstätten von Trotteln und Trampeln. Ihr Erstaunen darüber, dass man in der Provinz Kaffee bekam, war ebenso groß wie ihre Abscheu vor der adstringierenden Flüssigkeit, die unter der Bezeichnung serviert wurde, und mit den Einheimischen sprach sie im Tonfall übertriebener Höflichkeit, wie man ihn sonst nur dummen Kindern gegenüber anschlägt. Dennoch hatte Martha die kleine Stadt in den vierzehn Tagen, die seit der Abreise aus London vergangen waren – Francis hatten sie zu der unausgesprochenen, aber unübersehbaren Erleichterung seiner Lehrer von der Schule genommen –, fast schon liebgewonnen, hauptsächlich aufgrund der Wirkung auf ihre Freundin, die, einmal aus Londons Blickfeld entfernt, ihre pflichtbewusste Trauer aufgegeben und sich in ein zehn Jahre jüngeres, fröhlicheres Selbst zurückverwandelt hatte. Früher oder später, dachte Martha bei sich, würde sie Cora vorsichtig fragen, wie lange sie in den beiden Räumen auf der High Street zu bleiben, sich jeden Tag durch Spaziergänge zu ermüden und über Büchern zu brüten gedenke; aber vorerst war sie zufrieden damit, Cora so glücklich zu erleben.
Cora rückte den Regenschirm zurecht, der kaum mehr tat, als den schwächlichen Regen schneller in ihre Mantelkrägen zu leiten, und folgte mit dem Blick Marthas zeigender Hand. Der verkrüppelte Mann stellte sich weitaus geschickter an als sie, dem Wetter ein Schnippchen zu schlagen; aus der Befriedigung zu urteilen, mit der er den Inhalt seines umgedrehten Hutes untersuchte, hatte er heute einen guten Umsatz gemacht. Er saß auf etwas, das Cora zunächst für eine Steinbank hielt, das sich bei näherer Betrachtung jedoch als ein Stück gefallenen Mauerwerks entpuppte. Es war mindestens drei Fuß breit und zwei tief, und links von den Beinstumpen des Bettlers waren die Reste einer lateinischen Inschrift zu erkennen. Als er merkte, dass die beiden Frauen in den teuren Mänteln ihn von der anderen Straßenseite aus beobachteten, nahm er sofort einen Ausdruck verwirrten Elends an; doch dieser wurde schnell als übertrieben verworfen und durch eine edle Leidensmiene ersetzt, die suggerieren sollte, dass ihm sein Beruf zwar verhasst war, er ihm aber dennoch gewissenhaft nachging. Cora, die das Theater liebte, zog ihren Arm aus Marthas und eilte hinter einem vorbeifahrenden Fuhrwerk auf die andere Straßenseite hinüber. Sie trat unter das schmale Vordach und stand nun feierlich vor dem Mann.
»Einen schönen Tag.« Sie griff in ihre Tasche. Der Mann blickte gen Himmel, der sich just in diesem Augenblick teilte und sein erstaunlich blaues Herz zeigte. »Er ist nicht schön«, sagte er. »Aber das könnte er noch werden, so viel will ich Ihnen zugestehen.« Die vorübergehende Helligkeit beleuchtete das Gebäude, vor dem er saß; es sah aus wie durch eine Explosion zerrissen. Die linke Hälfte war mehr oder weniger so stehen geblieben, wie der Architekt sie geplant hatte – mehrere Stockwerke hoch, eine Privatresidenz oder ein Rathaus vielleicht –, aber die rechte war eingestürzt und einige Fuß tief im Erdboden versunken. Ein Bollwerk aus Planken und Pfosten sollte verhindern, dass die Ruine auf das Pflaster stürzte, doch es wirkte wenig stabil; Cora meinte, über den Lärm des trägen Verkehrs hinweg das Knarren und Scheuern von Eisen auf Stein zu hören. Martha tauchte an ihrer Seite auf, Cora nahm instinktiv ihre Hand. Sie war unschlüssig, ob sie zurückweichen oder die Röcke raffen und das Phänomen genauer in Augenschein nehmen sollte, wobei dieselbe Lust sie antrieb, mit der sie Ammoniten suchte und Steine zerklopfte, bis alles nach Kordit stank. Sie legte den Kopf in den Nacken und sah ein Zimmer mit unbeschädigter Einrichtung, aus dem ein scharlachroter Teppich über die abgebrochene Mauerkante hing wie eine Zunge. Weiter darüber hatte ein Eichensetzling auf einer Treppe Wurzeln geschlagen, und ein bleicher Pilz, fingerlosen Händen gleich, kolonisierte die verputzten Zimmerdecken.
»Nun aber Schluss damit, Miss!« Besorgt lehnte der Mann sich über seinen steinernen Sitz und ergriff den Saum von Coras Mantel. »Wozu sollten Sie es wagen? Nein, noch ein bisschen weiter zurück … Noch weiter … So ist es besser, ja; und tun Sie das nicht wieder.« Er sprach mit der Autorität eines Wachmannes, sodass Cora sich sehr beschämt fühlte und sagte: »Oh, es tut mir leid, ich wollte Sie nicht beunruhigen. Ich dachte bloß, da bewegt sich etwas.«
»Das werden die Schwalben sein, und die können Ihnen gestohlen bleiben.« Für einen kurzen Augenblick vergaß er seine Rolle, rückte sich die Krawatte zurecht und ergänzte: »Thomas Taylor, zu Ihren Diensten. Wie ich annehme, sind Sie neu in der Stadt?«