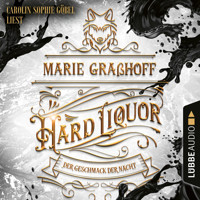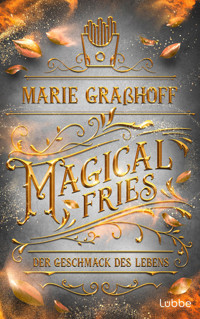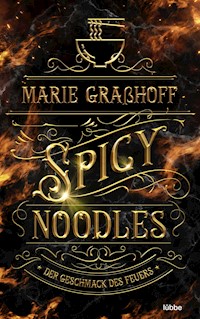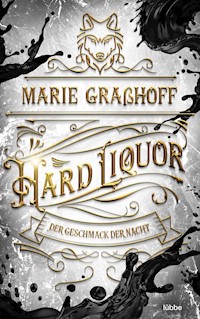Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Ciara kann in den Träumen anderer Menschen lesen wie in Büchern. Ihr ältester Bruder, der Schriftsteller Koba, ist der Einzige, der davon weiß. Als dieser jedoch auf unerklärliche Weise verstirbt, ändert sich für die junge Frau alles. Kobas letztem Wunsch folgend, reist sie mit seinem neusten Manuskript nach Shanghai, um es dort einem dubiosen Verleger zu überreichen. Doch in der fremden Stadt kreuzen Menschen ihre Wege, die so sind wie sie. Menschen mit besonderen Fähigkeiten. Als Erdbeben beginnen, den ganzen Planeten zu erschüttern, die Uhren verrücktspielen und fremde Dimensionen aus den Spiegeln dringen, begeben sich die jungen Erwachsenen gemeinsam auf die Suche nach dem wahren Grund ihrer Talente - und nach dem Grund dafür, warum die Welt um sie herum nach und nach zerbricht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 765
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Die Schöpfer der Wolken
云的创造者
Marie Graßhoff
Copyright © 2017 by
Astrid Behrendt
Rheinstraße 60
51371 Leverkusen
http: www.drachenmond.de
E-Mail: [email protected]
Lektorat: Dirk Busch
Korrektorat: Saskia Weyel
Layout: Michelle N. Weber
Umschlagdesign: Alexander Kopainski
Bildmaterial: Shutterstock
Illustrationen: Andrea Grautstück
ISBN 978-3-95991-099-6
Alle Rechte vorbehalten
Für alle, die die Welt
ein kleines bisschen besser machen.
Und sei es nur eine Welt von sieben Milliarden.
Für meinen Papa und meine Mama.
Ohne euch wäre ich nicht so frei, wie ich es bin.
Und für Alex.
Als ich sagte, ich will nach Shanghai,
weil mein Roman dort spielt,
hast du mich nicht ausgelacht, sondern einfach angefangen,
Flüge zu suchen.
Danke für deine verrückte Spontanität
Inhalt
Dimension 1
Prolog
1. Ciara
2. Xia
3. Xia
4. Ciara
5. Von Zeit und Sphärenmelodien
6. Xia
7. Brendan
8. Ciara
9. Xia
10. Brendan
11. Wesley
12. Xia
Dimension 2
13. Ashley
14. Ciara
15. Wesley
16. Brendan
17. Xia
18. Ciara
Dimension 3
19. Ashley
20. Xia
21. Brendan
22. Wesley
23. Ciara
24. Xia
25. Ciara
26. Von Welten und Fragen
Dimension 4
27. Ashley
28. Brendan
29. Wesley
30. Ciara
31. Thien & Linh
32. Xia
Dimension 5
33. Von Chaos und Enden
34. Ashley
35. Ciara
36. Thien & Linh
37. Xia
38. Ciara
39. Wesley
40. Xia
Dimension 6
41. Ashley
42. Thien & Linh
43. Ciara
44. Wesley
45. Von Zeit und Güte
46. Xia
47. Thien & Linh
48. Ciara
Dimension 7
49. Von Fallen und Sinn
50. Ashley
51. Xia
52. Ciara
53. Thien & Linh
54. Xia
55. Von Lachen und Liebe
Dimension 8
56. Wesley
57. Thien & Linh
58. Ciara
59. Wesley
60. Brendan
61. Ciara
62. Xia
63. Ciara
64. Ciara
65. Ciara
Dimension ?
66. Xia
Epilog
Danksagung
Über die Autorin
Bücher von Marie Graßhoff
Dimension 1
Die Zeit
2 0 2 1
Es gibt sie, die Welt des Lachens.
Die Welt der Lieder und Geschichten.
Die Welt der Freunde und Sagen und Sterne.
Wir können sie nur nicht suchen.
Wir müssen sie erschaffen.
Prolog
Von Schreibtischen und Wiesen
Koba. Ich kann nicht schlafen, denn seit du nicht mehr da bist, ist das Haus so kalt wie meine Gedanken. Das ist ein Paradoxon, denn als du noch am Leben warst, habe ich dir so oft Kaltherzigkeit unterstellt, dass ich glaubte, in deiner Nähe zu frösteln. Dabei muss es, wie ich nun erkenne, so gewesen sein, dass mir nur dann kalt wurde, wenn ich mich von dir entfernte – es muss so gewesen sein, dass es um dich herum so warm war, dass es mich plötzlich fror, wenn ich deine Zimmertür wieder hinter mir schloss.
Nun sitze ich an deinem Schreibtisch und kann nicht umhin, aus dem alten Fenster vor mir zu schauen und mich an deine Worte zu erinnern: »Du siehst nur so lange, was du sehen möchtest, bis die Vergangenheit dich vollends einholt.«
So konnte ich früher, wenn ich aus deiner Kammer sah, die Wiesen erkennen. Wie jetzt nebelverhangen im frischen Morgen, taubenetzt und unberührt. Ich konnte den Wald in einiger Entfernung erahnen, dabei zusehen, wie die Sonne hinter den großen Akazien aufstieg, um einen neuen Herbstmorgen anzukündigen. Ich konnte den kleinen Bach ausmachen und die Brücke, über die wir als Kinder so oft getollt sind.
Nun sehe ich nur noch dich. Du, wie du deine Beine im Wasser baumeln lässt. Du, wie du durch das kniehohe Gras streifst. Du, wie du im Wald verschwindest, um dich ins Moos zu legen und zu träumen.
Wie recht du mit allem hattest, was du jemals gesagt hast, und wie sehr ich dich dafür gehasst habe. Wie sehr ich mich selbst für meine Abscheu hasse, denn ich sollte doch, mehr als jeder andere, am besten wissen, dass es keinem Menschen genehm ist, immer und immer wieder nur die Wahrheit hören zu müssen. Und trotzdem konnte ich nicht umhin, dich zu verabscheuen. Trotzdem tue ich es jetzt manchmal noch immer, auch wenn ich mich dieses eine Mal an deinen Rat halten möchte. Dieses eine Mal, damit es mir danach vielleicht besser geht.
»Schreib deine Gedanken auf, wenn du sie ordnen möchtest«, hast du gesagt. »In geschriebener Form liegen sie dann so nackt und wahr vor dir, dass du ihnen nicht mehr entfliehen kannst. Gleichzeitig befreit es dich. Du wirst schon sehen.«
Also schreibe ich. Ich schreibe.
Was jedem Kind klar sein sollte, ist, dass man einen Anfang finden muss, möchte man eine Geschichte erzählen. Man beginnt mit »Es war einmal« oder mit »Vor langer, langer Zeit an einem weit entfernten Ort«. Man beginnt mit »Mir ist einmal etwas passiert« oder mit »Heute Morgen, als ich die Milch holen ging«.
Wo jedoch soll ich beginnen?
Ich erzähle kein Märchen und verfasse keinen Roman. Ich schreibe kein Tagebuch und keine Liebesgeschichte. Vielleicht sollte ich mit dir beginnen. Oder mit mir, denn im Grunde ist es dasselbe.
Dein Schreibtisch ist jetzt mein Schreibtisch, aber es ist nicht so, als würde er mir gehören. Es kleben so viele Erinnerungen an dem alten Holz, dass ich sie manchmal nicht fassen kann. Selbst die Maserung trägt so unverkennbar deine Spuren, dass ich dich vermutlich noch in hundert Jahren darin erkennen würde: Die Ringe vom Abstellen der Kaffeetassen erwecken fast den Eindruck, als hätte ich sie vor wenigen Minuten erst weggeräumt. Die Stellen, an denen das Holz deutliche Kerben hat, erinnern mich daran, wie tief du deine Fingernägel in die Maserung gedrückt hast, wenn du nervös warst. Unter diversen Blättern sieht man noch immer die blaue Farbe hervorschimmern, mit der du den guten Tisch ruiniert hast, als dein Kuli ausgelaufen ist.
Selbst der Zigarettengeruch, der noch kalt und schwer in den ungewaschenen Vorhängen sitzt, erinnert an dich. Atme ich ihn ein, kann ich dich fast vor mir sehen: jung und voller Leben. Du sitzt über deine Schreibmaschine gebeugt, in Gedanken so tief in deinen Texten versunken, dass dich selbst ein Schrei nicht daraus befreien könnte; die Augen starr auf deine Worte gerichtet, die Zigarette im Mundwinkel, die Finger schmutzig von Tabak und Tinte.
Wie sehr habe ich dich dafür gehasst, wenn du mich – nur wegen der Welten, in die du dich flüchtetest – ignoriert hast, obwohl ich direkt neben dir stand. Und wie sehr habe ich dich dafür bewundert, dass du fliehen konntest; dass es dir im Gegensatz zu uns allen immer gelungen ist, die Wahrheit zu verdrängen, die uns alle um den Verstand bringt.
Koba. Es irritiert mich, wie leicht es mir fällt, deinen Namen zu schreiben, bin ich doch sonst kaum in der Lage, ihn zu denken, gar auszusprechen. Vielleicht wissen meine Finger mehr als ich. Vielleicht können sie akzeptieren, was ich noch zu leugnen versuche: Alles hat mit dir begonnen.
Mit dir hat es begonnen und – ja, mit dir hat es auch geendet. Alles, denke ich manchmal. Manchmal denke ich, meine Welt ist nur wegen dir untergegangen.
Du warst wie der Blick aus einem Zugfenster bei Nacht. Dieses Gefühl, wenn du hinausschaust und in der Finsternis nach Lichtern suchst, an die du deine irrenden, haltlosen Augen heften kannst. Doch irgendwann bleibst du an deinem blassen Spiegelbild hängen und egal, was du tust, du kommst nicht wieder davon los. Dann fragst du dich, wer du bist und warum du tust, was du tust.
Eben so warst du; so finster, dass man nichts erkennen konnte – nur sich selbst, wenn man dich lang genug angesehen hat. Dich anzusehen war wie in den Spiegel zu sehen.
Das habe ich geliebt. Ich habe dich geliebt – das wusstest du immer, von Anfang an. Du hast es nie ausgesprochen, mich nie deswegen verachtet, obwohl du doch jeden Menschen für alles verachtet hast.
Warum also?
Ich schreibe, aber ich verstehe es nicht. Und ich habe das Gefühl, dass ich diese Geschichte vielleicht an ganz anderer Stelle ansetzen muss. Viel weiter in der Vergangenheit, irgendwo zwischen dir und dem, was dich antrieb, dem, was ich nie verstand.
Du siehst nur so lange, was du sehen möchtest, bis die Vergangenheit dich vollends einholt. Nun spüre ich die Wahrheit deiner Worte in jeder Faser meines Körpers, so echt, als wärst du nicht der Überbringer der Botschaft, sondern Schöpfer ihrer Realität. Die Vergangenheit holt dich immer ein, hast du gesagt. Wenn du zu lange vor ihr geflohen bist, vielleicht. Oder wenn du zu lange die Augen vor ihr verschlossen hast, in der Hoffnung, irgendwann würde sie einfach unsichtbar. Ich verrate dir etwas: Die Vergangenheit wird nie unsichtbar und sie lässt sich nicht abhängen, egal, wie schnell du zu rennen versuchst. Sie ist ein selbstsüchtiges Biest, das größer und wütender wird, je länger du es ignorierst. Und irgendwann, wenn du deine Augen einfach nicht öffnest, frisst es dich mit Haut und Haar.
1
Ciara
Von Manuskripten und Raben
Oakdale, Australien, Januar 2021
Ciara?« Das unerwartete Klopfen ließ sie zusammenzucken. Der Kugelschreiber war ihr vor Schreck aus den Fingern geglitten, hatte einen langen Strich auf dem gelblichen Papier hinterlassen, so sehr war sie in Gedanken versunken gewesen. »Ciara, bist du da drin?« Erst, nachdem ihre Mutter noch einmal durchdringend an die Holztür gehämmert hatte, hob die junge Frau den Blick von ihrer Liste und seufzte.
»Du weißt genau, dass ich hier drin bin, Mutter.« Als sie das Quietschen der Scharniere hinter sich vernahm, bückte Ciara sich, um den Stift wieder vom rauen Dielenboden aufzuheben. Sie machte sich nicht die Mühe, sich umzudrehen, lauschte den näherkommenden Schritten stattdessen ruhig und ließ den Blick durch das schmutzige Fenster vor sich schweifen. Die Sonne stand noch immer recht hoch über dem Horizont, wärmte ihr Gesicht und lockte all die schwirrenden Insekten auf die Wiese und zum Bach hinüber. Trotzdem war es inzwischen Abend geworden.
»Du bist schon den ganzen Tag hier drin, Schatz.« Die Hand auf ihrer Schulter fühlte sich besser an, als Ciara erwartet hatte. Die Wärme der Berührung wischte den kurzen Schreck und viele der schweren Gedanken, die ihr schon seit Tagen anhafteten, hinfort.
»Ich weiß«, murmelte sie, lehnte sich nach vorn und stützte sich mit den Ellenbogen auf das alte Holz, das Gesicht in den Händen vergraben.
Sie hatte geweint. Den ganzen Tag lang. Ebenso gestern. Und vorgestern.
Jetzt fühlte sie sich nur noch müde und leer, wollte sich in ihr Bett legen und erst wieder geweckt werden, wenn Wochen vergangen waren. Wenn alles sich wieder beruhigt hatte und die Tristesse zumindest wieder so etwas wie Alltag gewichen war.
»Kommst du zum Abendessen? Jane und Laura haben alles vorbereitet.«
»Ich komme gleich runter.« Sie fuhr sich mit den Fingerkuppen über die Augenlider und glitt dann weiter an ihren Wangen hinab, als würde sie noch immer die unsichtbaren Tränen trocknen, die sie nicht mehr imstande war zu weinen. Als würde es ihr eine gewisse Sicherheit geben, ihr Gesicht in Händen zu halten. So wie er es immer getan hatte, als sie noch ganz klein gewesen war.
»Ist gut.« Ihre Mutter zog sich leise zurück und Ciara war ihr endlos dankbar dafür, dass sie scheinbar so schnell verstanden hatte. Dass sie verstanden hatte, dass Worte jetzt nichts mehr nutzten und sie auch keine mehr hatte, die sie sagen wollte.
Erst als die nächsten Rufe zum Essen von ihren Schwestern die Treppe hinaufschallten, setzte Ciara sich langsam in ihrem Stuhl auf und strich ihr Sommerkleid vielleicht etwas zu sorgfältig glatt. Auf dem Tisch, neben der Liste an Habseligkeiten, die sie gerade zu verfassen versucht hatte, lag noch immer ihr Smartphone mit dem Display nach unten – und für einen kurzen Moment hätte sie fast dem Reflex nachgegeben, es in die Hand zu nehmen, um zu sehen, was es Neues gab. Aber was sollte es Neues geben?
In den letzten drei Tagen hatte sie so viele Nachrichten bekommen wie vermutlich in ihrem ganzen vorherigen Leben noch nicht. Hunderte, Tausende Freunde, Bekannte und Verwandte wünschten ihr in allen möglichen sozialen Medien herzliches Beileid, sprachen ihr Mut zu, wünschten ihr Kraft. Menschen, die Koba kaum gekannt hatten, posteten Bilder von ihm auf Facebook, trauerten in Büchergruppen um den großen Autor, den die Welt mit ihm verloren hatte, lobten seine Werke und verfassten bewegende Nachrufe.
So viele Worte.
Ciara schob den Stuhl zurück, ließ das Handy liegen, wo es war, und schlurfte über das ausgetretene Laminat zur Tür hin.
So verdammt viele Worte wurden in den letzten Tagen gesprochen, so verdammt viel Aufruhr betrieben, um diesen Menschen zu ehren, der ihnen allen genommen worden war. Aber das alles zählte nichts.
Koba war mehr als ein Autor gewesen. Mehr als ein Bruder und mehr als ein stiller Einzelgänger. Mehr als jemand, den man mit wenigen Worten, traurigen Smileys oder bewegenden Reden aus dieser Welt verabschiedete. Er war ihr liebster Bruder gewesen, sie allerdings nicht seine liebste Schwester. Doch egal, wie oft sie sich gestritten hatten, wie oft gelacht und wie oft geweint, eine unumstößliche Wahrheit hatte stets zwischen ihnen geruht: Er war der Einzige, der sie jemals verstanden hatte. Und dass er nun weg war, riss so ein tiefes Loch in ihre Gedanken, dass da nichts mehr war. Nur der unsägliche Wunsch zu fliehen. Egal wohin.
»Hey, Maus.«
Wieder ein kleiner Schreck, als sie Kobas Zimmer verließ und ihr Vater gerade auf die gegenüberliegende Seite des dunklen Flurs trat. Vermutlich hatte auch er den Ruf zum Abendessen in seinem Arbeitszimmer gehört.
»Hi«, grüßte sie knapp, als er zu ihr aufholte. Die Sonne hatte sein Gesicht in den letzten Wochen so braun gebrannt, dass er mit seinen leuchtend weißen Zähnen und dem vom Licht geblichenen Haar kaum mehr wiederzuerkennen war. Vorgestern hatte sie ihn zum ersten Mal seit Wochen wiedergesehen und konnte sich immer noch nicht an seinen Anblick gewöhnen. Immerhin hatte er vor seinem Ruhestand den ganzen Tag im Büro sitzen müssen und die Sonne dort nie zu Gesicht bekommen.
»Wie geht’s dir, Schatz?«
»Hm.« Sie wollte niemandem die Lüge auftischen, alles wäre okay. Gleichzeitig hasste sie sich für die trübe Stimmung, weil sie alle mit demselben Problem zu kämpfen hatten und es den anderen scheinbar weniger schwerfiel, mit der Situation umzugehen, als ihr.
»Sag Bescheid, wenn ich etwas für dich tun kann, ja?«
Irgendwie waren sie festgefroren. Ciara hatte sich eigentlich zur Treppe wenden wollen, aber ihr Vater war vor ihr stehen geblieben und musterte sie mit in die Hüfte gestemmten Händen. Das Lächeln auf seinen Zügen wirkte ehrlich, aber sie kaufte es ihm trotzdem nicht ab. Die dunklen Ringe unter seinen Augen sprachen von schlaflosen Nächten. Vermutlich ging es ihm noch schlechter als ihr.
»Ist gut.«
»Ich habe gehört, du bist mit Jack aneinandergeraten?«, wollte er wie beiläufig wissen, aber als sie sich zum Gehen wandte, legte er ihr – wie ihre Mutter zuvor – die Hand auf die Schulter.
Ciara räusperte sich und verschränkte die Arme etwas unangenehm berührt vor der Brust, wich dem Blick ihres Vaters aus. Jack war ein guter Freund der Familie, fast so alt wie ihre Eltern und ein gerngesehener Gast. Sie kannte ihn nicht weiter, aber seine rüpelhafte Art war ihr schon öfter etwas übel aufgestoßen.
»Ja«, gestand sie und presste die Lippen aufeinander. Es war klar gewesen, dass Jane und Ethan ihre Klappen nicht würden halten können.
»Was war denn?«
»Haben dir die beiden das nicht erzählt?« Und hatte er ihr nur aufgelauert, um sie darauf anzusprechen?
»Nein, Jack hat angerufen und irgendwas davon gefaselt, dass du ihn geohrfeigt hättest. Und dass ich dich zurechtweisen solle.«
Sie stöhnte schwer und sah trotzig zu ihrem Dad hoch.
»Na gut. Dann hör dir das an: Er war vorgestern da, um uns sein Beileid auszusprechen, als du und Mom gerade in der Stadt wart. Und bevor er gegangen ist, meinte er allen Ernstes zu mir: ›Mach dir nichts draus, Ciara. Du hast ja noch neun Geschwister übrig.‹« Sie legte so viel Hohn und Abscheu in ihre Stimme, wie es ihr möglich war und für einen Moment war das Gesicht ihres Vaters wie eingefroren.
»Was für ein Idiot!«, lachte er herzhaft. »Und du hast ihm einfach eine verpasst? Das finde ich herrlich!«
Dann brach er in schallendes Gelächter aus und stolperte einen Schritt nach vorn. Es dauerte eine ganze Weile, bis er sich wieder aufrecht hinstellte und die Tränen von seinen Wangen wischte.
»Ich bin ehrlich stolz auf dich.« Er legte Ciara die Hand auf den Rücken und schob sie zur Treppe, von deren unterem Ende schon wieder nach ihnen beiden gerufen wurde. »Ich wollte das schon so lange mal tun«, murmelte er, als sie sich der Küche näherten. »Wenn dir das guttat, kann ich dir gern noch einige Opfer besorgen. Solche Sprüche durfte ich mir die letzten Tage oft genug anhören.«
Sie lachte, ein wenig aus Belustigung, ein wenig aus Verzweiflung.
»Du schaffst sie her, ich erledige den Rest«, scherzte sie in gespielter Terminator-Stimme und unterdrückte das Grinsen, als sie in das Esszimmer traten.
Wenn Ciara an Koba dachte, dann erinnerte sie sich immer mehr an die Momente, die sie früher als Kind mit ihm erlebt hatte, und immer weniger an die vielen Streits, in denen sie verzweifelt versucht hatte, ihn aus seiner Gedankenwelt zu ziehen.
Wenn sie an ihn dachte, dann erinnerte sie sich an die langen Nächte, in denen sie gemeinsam auf der Wiese vor dem Hof gelegen hatten. Dort, wo das Gras so hoch wuchs, dass sie niemand von außen jemals hätte sehen können. Wo es nur sie, die Insekten und die Sterne gegeben hatte, die hoch über ihnen funkelten.
Er hatte ihr alle Himmelskörper gezeigt und erklärt. Und er hatte großen Wert daraufgelegt, dass sie sich jedes der Bilder, jede der Anordnungen einprägte, als wäre ihr Wissen um die Astronomie ihm das wichtigste Vermächtnis in dieser Welt.
Wenn sie jetzt auf dem Schreibtisch, vor dem weit geöffneten Fenster saß, erkannte sie in den Sternen nur noch sein Gesicht. Das war dumm, denn sie hatte ihn schon lange nicht mehr gesehen. Es gab Hunderte Menschen, mit denen sie mehr zu tun hatte als mit ihrem Bruder. Und trotzdem wollte und wollte die Leere in ihrem Inneren nicht begreiflicher für sie werden.
Ciara zog ihre Beine in einen Schneidersitz und riss sich vom Zirpen der Grillen und dem Flackern der Sterne los, um sich über den großen Karton mit alten Aufzeichnungen zu beugen. Ihre Mutter hatte ihr aufgetragen, in all den Kisten und Schränken nach einer Besitzurkunde für ein Haus in Irland zu suchen, die bisher niemand hatte aufspüren können. Aber alles, was Ciara fand, waren alte Manuskripte, unfertige Romanideen, wirre Notizen und Briefe. Endlos viele Briefe, die meisten von einem Mann, von dem sie sicher war, dass Koba nie über ihn gesprochen hatte.
Sie ordnete und glättete die Papiere, versuchte, bis auf die Namen so wenig wie möglich zu lesen, um nicht unnötig in die Privatsphäre ihres Bruders einzudringen. Abgesehen davon, dass sie im kühlen Licht des Sommermondes eh kaum etwas erkennen konnte.
Ciaras Handy vibrierte aufdringlich hinter ihr, bestimmt zum hundertsten Mal in dieser Stunde, dabei war es schon weit nach Mitternacht. Sie hatte den unbändigen Wunsch, es einfach auszustellen, es an die Wand zu werfen oder aus dem Fenster, irgendwohin, Hauptsache fort. Aber sie erwartete noch einen Anruf von Cooper, ihrem Bruder aus Perth, also musste sie es wohl oder übel weiter um sich haben.
Ein herzhaftes Gähnen schlich sich nach Stunden zum ersten Mal von ihren Lippen und nach und nach musste sie sich eingestehen, dass es keinen Sinn mehr ergab, in Dokumenten zu stöbern, wo sie doch kaum mehr die Augen offenhalten konnte.
Gerade streckte sie ihre Beine, um sich vom Schreibtisch zu schieben, als sie Schritte auf dem Flur vernahm. Wer war so spät noch wach?
Das leise Trommeln von Fingern an ihrer Tür kündigte ihren Vater an. Niemand klopfte so zaghaft wie er, nicht einmal in der Nacht.
»Ja, ich bin wach«, sagte sie leise und er trat ein, schloss die Tür rasch wieder hinter sich.
Er musste geschlafen haben. Das sah sie nicht nur an seinem zerknitterten Pyjamahemd, sondern auch an seinen Augen, in denen noch immer der letzte Traum vor sich hin sang. Er hatte vom Meer geträumt, von Riffen und vom Blut eines Tauchers, das zwischen den Korallen und Fischen waberte. Diesen Traum hatte er schon öfter gehabt, aber sie wusste nicht, ob er sich dessen bewusst war. Sie würde ihn gern fragen, aber Koba hatte sie damals darüber aufgeklärt, dass normale Menschen keine Träume sahen und sie niemandem von diesem eigensinnigen Talent erzählen sollte, um keine Zweifel an ihrer geistigen Gesundheit zu schüren. Wie eigenartig, hatte sie damals gesagt. Sie hörte ihre kleine Stimme noch immer in den Ohren. Wenn ich nie darüber spreche, wie soll ich dann herausfinden, ob es vielleicht doch jemanden gibt, der so ist wie ich?
Inzwischen bezweifelte sie, dass es so jemanden gab.
»Du schläfst schon halb, hm?«, wollte ihr Vater wissen, nachdem sie ihn eine ganze Weile angeschwiegen hatte. Sie fragte sich, warum er und ihre Mutter nicht bemerkten, dass sie irgendwie anders war. Oder ob sie es schon längst bemerkt hatten und nur nichts dazu sagten.
»Ja, ich gehe jetzt ins Bett.« Sie wies demonstrativ auf die großen Papierstapel, die sie sortiert hatte. »Keine Eigentumsurkunde für das irische Haus, leider.«
»Schade.« Ihr Vater lächelte mild. »Dann müssen wir wohl noch warten, bis wir uns dorthin absetzen können.«
»Wenn er das Haus uns überhaupt vermacht.« Ciara schmunzelte und schob sich vom Schreibtisch. Das frisch bezogene Bett an der anderen Seite des Raumes duftete noch immer nach Kirschblüten und Flieder, als sie sich hineinsinken ließ. »Noch hat der Notar nicht gesagt, an wen es geht, oder? Nur, dass es da ist.«
»Wohl wahr«, bestätigte ihr Dad und lehnte sich in den Türrahmen. »Deswegen bin ich auch hier. Nicht wegen des Hauses, aber wegen des Notars. Er hat mich gerade angerufen.«
»Mitten in der Nacht?«
»Ja. Er ist noch immer mit Kobas Testament beschäftigt. Das scheint ziemlich umfassend zu sein.«
Ciara zog die Augenbrauen überrascht in die Höhe, weil die Ausmaße, in denen ihr Bruder seinen Tod scheinbar vorbereitet hatte, ihr von Tag zu Tag größer erschienen. Jeden Tag wurden neue Dokumente benötigt, weitere Anweisungen gegeben, weitere Nach- und Vorbereitungen getroffen. Sie hatte das Testament nie gesehen, aber sie stellte es sich inzwischen wie eins seiner tausendseitigen Manuskripte vor.
»Und was wollte er?«
»Morgen fährt deine Mutter in sein Büro in Sydney, um ein paar Unterlagen abzugeben und ein paar Dinge zu klären. Er hat mich gebeten, dich mitzuschicken. Ein ziemlich ausführlicher Punkt in Kobas Testament betrifft scheinbar nur dich.«
»Mich?« Sie fragte nur aus Unglauben nach, denn die Worte ihres Vaters hatte Ciara durchaus verstanden. »Aber … worum geht es denn?«
»Keine Ahnung«, meinte ihr Vater leise lachend. »Vielleicht erbst du das Haus in Irland.«
»Oder ein anderes. Wer weiß, wo er noch welche hat«, scherzte sie. »Aber im Ernst: Hat der Mann nicht gesagt, worum es geht?«
»Nein. Er will es mit dir unter vier Augen besprechen.«
Ciaras Augenbrauen hoben sich immer weiter, weil sie nicht wusste, was sie darauf noch erwidern konnte.
»Wie … wie seltsam«, sprach sie erst nach einigen Momenten ihren Gedanken aus. »Ich meine, ich … hatte in den letzten Jahren wirklich nicht viel mit ihm zu tun.«
»Ich weiß«, murmelte ihr Vater. »Das hatte kaum jemand von uns.«
»Und … gibt es noch jemanden, der morgen mitkommen soll?«
»Nein, nur du.«
Sie holte tief Luft und drückte sich über das Bett nach hinten, bis ihr Rücken die kühle Wand erreichte, an die sie sich anlehnte.
»Okay … Wann soll’s losgehen?«
»So gegen acht. Also leg dich jetzt hin, damit du wenigstens noch ein paar Stunden Schlaf bekommst.« Er öffnete die Tür wieder und trat langsam heraus.
»Träum schön«, flüsterte sie und zog die Decke um ihren Körper. Zumindest besser als von Meer und Korallen und Blut.
Ein Junge steht auf einer nächtlichen Wiese und fängt einen herabfallenden Stern. Der Himmel über ihm ist unendlich klar und so voll funkelnder Sterne, dass es scheint, als sei die Welt in einen helleren Teil des Universums gewandert, um den Menschen besser zu gefallen. Und wie er dort steht, das blonde Haar im warmen Licht des Splitters zwischen seinen Fingern schimmernd, die Knöchel unter der hochgekrempelten Hose von Tau benetzt, die Wangen rot und warm wie die aufgehende Sonne, lächelt er. Er lächelt wie noch nie in seinem Leben zuvor.
Der Stern zwischen den kleinen Fingern versprüht Hunderte Funken in alle Richtungen, schafft einen Lichtkegel, hier irgendwo im Nichts, wo kein Mensch und kein Tier sie sehen kann.
»Auf dich habe ich schon ganz besonders lange gewartet«, murmelt der Junge aufgeregt und kann seinen Augen noch nicht trauen. Er lagert den Stern in eine Hand um und zieht mit der anderen ein großes Einmachglas aus seiner Umhängetasche.
Seine Eltern schlafen und wenn sie wüssten, dass er noch wach ist, würden sie gewiss böse sein. Aber er hat sie zu dieser Reise in das fremde Land überredet, um genau in diesem Moment an diesem Ort sein zu können. Also fühlt er sich nicht schlecht dabei, weggelaufen zu sein.
»Heute sind noch drei andere Sterne vom Himmel gefallen«, flüstert er dem glitzernden Funken zu und legt ihn vorsichtig in das Glas. Fast scheint es, als würde der Stern einige freudige Funken mehr sprühen. »Ich weiß sogar, wo. Aber dich wollte ich einfach am allerliebsten haben.«
Vorsichtig schraubt er den Deckel fest, dann hält er seine Errungenschaft so dicht wie möglich vor sein Gesicht. »Ich hab dich lieb«, raunt er. Sein Gesicht strahlt fast so sehr wie der kleine Splitter vor seinen Augen. »Ich hoffe, das weißt du.«
»Verdammt.« Schmerz brannte sich so heftig in Ciaras Kopf, dass sie mitten auf dem Gehweg stehen blieb, um ihre Hände vor ihr Gesicht zu halten, mit den Zeigefingern auf ihre Schläfen zu drücken und zu hoffen, das Ziehen und Zerren hinter ihrer Stirn so schnell wie möglich wieder vertreiben zu können.
»Schatz, ist alles in Ordnung?« Die klackernden Schritte ihrer Mutter kamen wieder zu Ciara zurück, als das Stechen in ihrem Schädel nachzulassen begann.
Sie atmete. Vorsichtig. Ein und aus. Der salzig-frische Geruch des Ozeans lag in der Luft, vermischt mit dem Sommerduft sich aufwärmender Parkwiesen, dem Dreck von Vögeln und ein wenig Smog.
Sydney. Die Stadt beruhigte sie. Die Schreie der Möwen, das Dröhnen der Motoren, die Stimmen der Menschen ziepten zu Beginn noch hinter ihrer Stirn, dann reihten sie sich wieder ordentlich und monoton in die Gesamtkulisse aller Wahrnehmungen ein.
»Schatz?« Ihre Mutter schob sie leicht zur Seite, vermutlich, damit sie den anderen Passanten nicht im Weg standen.
»Ja, alles gut«, presste Ciara zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor, atmete noch einmal tief ein, dann nahm sie wieder eine aufrechte Haltung ein. Ihr Herz hämmerte noch immer gegen ihre Rippen, ihr Atem war schwer zu beruhigen, aber gleich würde es vorbei sein.
Sie kannte das Gefühl schon zu gut, als dass es ihr noch Angst machen konnte.
»Ist es wieder dieser Kopfschmerz?«, wollte ihre Mutter fahrig wissen. Sie musste die Frage eigentlich nicht stellen, aber hatte ihre Hand auf Ciaras Rücken gelegt und wollte sie vermutlich einfach nur zum Sprechen bewegen. Ciara litt unter diesen Anfällen schon, seit sie sich erinnern konnte, aber ihre arme Mutter erschrak darüber jedes Mal so sehr, als wüsste sie nicht genau, dass sie schnell vorübergingen.
»Ja. Aber es geht schon wieder.«
»Bist du sicher? Komm, setz dich erst mal …«
»Nein, ist schon gut.« Erst jetzt öffnete Ciara die Augen und schaute ihr so sicher ins Gesicht wie möglich. Lächelnd, ein wenig aufmunternd vielleicht. »Du kennst das doch, das ist immer nur kurz.«
Ihre Mutter nahm ihre Hand zu sich zurück, presste die schmalen Lippen aufeinander und versuchte sich ebenfalls an einem Lächeln, auch wenn nicht viel davon in ihrem Gesicht zu sehen war. In den letzten Tagen schien sie um mehrere Jahre gealtert zu sein. Ihre Haut war blasser geworden, die Augenringe hatten eine dunkle Färbung angenommen und die Lachfältchen in ihren Augenwinkeln wirkten plötzlich nur noch müde.
»Alles gut, Mom, wirklich. Lass uns weitergehen.« Bildete sie es sich nur ein, oder war sogar das Haar ihrer Mutter ein wenig grauer geworden? Die sonst so strahlend braune Mähne wirkte heute selbst im Licht der neuen Morgensonne, die sich über die Dächer der hohen Häuser stahl, so matt und stumpf.
»Na gut. Aber sag mir, wenn es wieder schlimmer wird, ja?« Der weinrote Blazer schmeichelte ihrer schlanken Figur und die leuchtende Farbe sollte vielleicht ein wenig Stolz und ein wenig Stärke ausdrücken in dem Termin, zu dem sie beide unterwegs waren. Aber er passte nicht zu ihrer Mutter, fand Ciara.
In diesen Tagen passte nichts zusammen.
Sie hielten an einer Fußgängerampel an und Ciara schob die Hände in die Taschen ihres dünnen Cardigans. Das lange Haar hatte sie sich nach dem Waschen zu einem wirren, goldbraunen Knäuel auf dem Kopf zusammengebunden, das noch immer nach Minze und Brombeeren roch. Sie versuchte, sich auf den Duft zu konzentrieren, als sie standen. Und auch als sie weitergingen. Als sie um die nächste Ecke bogen und an einem kleinen Park vorüberkamen.
Sie versuchte, sich auf alles an und um sich herum zu konzentrieren, nur nicht auf die Bilder, die sie gerade heimgesucht hatten. Sie durfte sich durch das, was sie sah, das, was sie träumte, nicht von der Realität ablenken lassen.
»Gleich sind wir da«, ließ ihre Mutter sie wissen und trippelte weiter voran. »Dann lasse ich dir erst mal ein Glas Wasser bringen.«
Ciara brauchte kein Wasser, lächelte aber dankbar.
Wenn Koba ihr damals nicht wieder und wieder gesagt hätte, dass sie schweigen sollte, wüsste ihre Mutter vielleicht schon, was mit ihr nicht stimmte. Sie wüsste, dass ihre Tochter die Träume anderer Menschen sah, aber selbst nie träumte wie andere. Dass sie Stunde um Stunde mit ihrem Bruder darüber gesprochen hatte, wie es sich anfühlte, zu schlafen und hilflos Bildern und Gefühlen ausgeliefert zu sein, um dann wach zu werden und festzustellen, dass nichts davon wirklich passiert war.
Nein, Ciara träumte nicht, wenn sie schlief.
Sie träumte mit offenen Augen, mitten am Tag. Egal ob sie allein war oder in Gesellschaft, egal ob morgens oder abends. Sie träumte nicht an jedem Tag, aber oft genug, dass es eine Belastung für sie war. Denn wenn die Bilder aus ihrem Inneren über sie herfielen, wurden ihre Augen blind und ihre Ohren taub und alles um sie herum verschwand im Nichts. Alles zog sie in diese Welten, die es eigentlich gar nicht gab.
»Das da vorn ist es.« Ihre Mutter deutete auf ein hohes Gebäude, das sich wie ein Koloss aus Stahl und Glas von all den alten charmanten Häusern in den Straßen abhob. Die Sonne spiegelte sich so grell in seinen Fenstern, dass es in den Augen blendete, und nur die Blätter einiger knorriger Bäume am Fußweg spendeten etwas Schatten.
»Noch alles gut bei dir, Schatz?«
»Ja.« Ciara lachte etwas hilflos, als ihre Mutter ihr Tempo verlangsamte, um zu ihr zurückzuschauen. Sie wirkte so tapfer mit ihrem steifen Outfit, den ordentlich lackierten Fingernägeln und dem sorgsam aufgetragenen Lippenstift. So viel seriöser, als man sie sonst kannte. »Wirklich alles gut, Mom.« Und so viel seriöser, als Ciara sich selbst gab. Mit ihren knappen Shorts, den neonpinken Turnschuhen und der wüsten Frisur war sie in diesem Laden sicherlich fehl am Platz. Egal war es ihr trotzdem.
»Miss Gunn?«
Ciara sah von ihrem Smartphone auf, als ihr Name leise durch den Warteraum eines der höher gelegenen Stockwerke schallte und ihren Blick auf die Tür lenkte, hinter der ihre Mutter vor etwas mehr als einer Stunde verschwunden war. Direkt hinter dem bärtigen Mann, der nun seinen Kopf daraus hervorstreckte, tippelte sie auch schon hervor. Sie machte einen müden, aber zufriedenen Eindruck, was Ciara zumindest ein wenig Mut für das kommende Gespräch gab.
Sie hatte so lange darüber nachgedacht, was wohl Kobas letztes Vermächtnis an sie sein konnte, bis sie es nicht mehr ausgehalten hatte, sich den Kopf darüber zu zerbrechen, und dazu übergegangen war, doch all die Nachrichten auf ihrem Phone zu lesen, die ihr in den letzten Tagen den letzten Nerv geraubt hatten.
Sie erhob sich aus dem unbequemen schwarzen Designerstuhl, schob ihr Handy in die Hosentasche und ging auf ihre Mutter und den Notar zu. Die Neonschuhe an ihren Füßen quietschten nicht nur unangenehm laut auf dem weißen Fliesenboden, sie hoben sich auch irgendwie alarmierend von all den tristen Tönen in dem großen Vorzimmer ab. Die hätten hier wenigstens eine Kunststoffpflanze aufstellen können.
»Ich muss Sie leider bitten, draußen zu warten, Rose.«
Oh, er war mit ihrer Mutter schon beim Vornamen. War das ein gutes Zeichen? Allerdings hatten ihre Eltern in den letzten Tagen vermutlich auch häufiger mit diesem Mann gesprochen als miteinander.
»Natürlich. Ich warte da drüben, ja?«
»Du kannst auch ruhig schon nach Hause gehen, Mom«, murmelte Ciara und nickte Mr. Shane Jonsberg zu, dessen Name auf einem goldenen Schild neben seiner Tür prangte.
»A-aber bist du sicher, dass du den Weg finden wirst?«
Mr. Jonsberg nickte ebenfalls, dann trat er in sein Büro zurück, öffnete die Fenster und ließ gleichzeitig die Jalousie mechanisch ein Stück weiter hinab.
»Ich hab Google Maps«, versicherte Ciara und klopfte auf die Tasche mit ihrem Handy. »Und die Wohnung ist nur zwanzig Minuten entfernt. Da kann nichts passieren.« Sie lächelte so ermutigend wie nur irgend möglich und tatsächlich schien es zu funktionieren. Ihre Mutter seufzte ergeben, trat einen Schritt auf sie zu, hauchte ihr einen raschen Kuss auf die Wange und schob sich dann an ihr vorbei.
»Na gut. Aber wenn etwas ist, dann ruf mich an, ja?«
»Natürlich, Mom. Bis gleich.« Sie wusste nicht, ob ihr die vorsichtige Art ihrer Mutter Sorgen bereiten sollte, denn für gewöhnlich war sie nicht so. Für gewöhnlich war sie das perfekte Gegenteil.
»Bis gleich!«
Ciara wartete, bis ihre Mutter um die Ecke gebogen war und ihre klackernden Schritte vor dem Fahrstuhl stockten, dann trat sie in das Büro des Notars ein, der sich wieder hinter seinem Schreibtisch niedergelassen hatte.
Überall lagen Dokumente, handgeschriebene Notizen und Gesetzbücher. Zwischen dem Papierkram fielen Ciara mindestens drei kunterbunte Kaffeetassen ins Auge, jede von ihnen noch halb gefüllt.
»Setzen Sie sich, bitte«, forderte der Mann Ciara knapp, aber freundlich auf und wies ihr den einzigen anderen Stuhl im Raum an. Durch die Fenster drang ein recht erfrischender Wind in das kleine Büro, während die Sonne nur in Punkten durch den fast gänzlich zugezogenen Rollladen fiel. Ein Ventilator in der Ecke ließ den Geruch nach Meer im Zimmer zirkulieren.
Mr. Jonsberg schob einige der Dokumente vor sich zu unordentlichen Stapeln und zur Seite. Er wirkte gleichzeitig besonnen und etwas fahrig, suchte mit den Händen immer wieder etwas Neues, das er zurechtrücken konnte. Durch den dunklen Bart und seine breite Gestalt hatte er etwas von einem gutmütigen Bären. »Kann ich Ihnen einen Kaffee anbieten?«
Ciara legte ihre Handflächen zusammen und klemmte ihre Hände leicht zwischen ihre Knie, um sie davon abzuhalten, nervös an ihrer Kleidung herumzuzupfen. All die kleinen Leberflecke auf ihrer braungebrannten Haut sahen aus wie die Funken des Sterns aus ihrem letzten Traum.
»Nein, danke.« Sie wollte nur endlich wissen, warum sie hier war. Nur um sich abzulenken, während Mr. Jonsberg nach einer bestimmten Seite in einem Ordner blätterte, sah Ciara sich um. Bis auf einige massive schwarze Aktenschränke und eine etwas angetrocknete Pflanze im Fenster gab es allerdings nichts zu entdecken.
Ob er auf Diät war? Nirgends war etwas Essbares zu sehen. Und in seinen Augen sah sie, dass er in den vermutlich wenigen Minuten Schlaf heute Nacht von Kuchen geträumt hatte. »Also, der Grund, aus dem Sie heute hier sind, ist folgender«, setzte der Mann an und Ciaras Herz machte einen Satz, als sich all ihre Aufmerksamkeit ruckartig wieder auf ihn richtete. »Ihr Bruder hat in seinem Testament genau spezifiziert, was welches Familienmitglied erben wird und wie mit seinen veröffentlichten und unveröffentlichten Büchern umgegangen werden soll. Ich habe auch schon zu Ihrer Mutter gesagt: Einen so organisierten Eindruck hat hier bisher selten jemand hinterlassen. Und ich mache den ganzen Tag nichts anderes.«
Ciara nickte, als Mr. Jonsberg eine kleine rahmenlose Brille auf seine Nase schob.
»Ich habe das gesamte Testament studiert und Ihnen fällt bei der Verwirklichung von Mr. Gunns letztem Willen wohl die außergewöhnlichste Rolle zu.«
Ob der Mann Übung darin hatte, Menschen auf die Folter zu spannen? Er wirkte nicht so, als täte er es absichtlich, aber vielleicht steckte hinter all diesem Herauszögern auch Kalkulation. Vermutlich war das der einzige Spaß, den dieser Mann in seinem tristen Job hatte.
»Ich soll also etwas tun?«, hakte sie nach, als er noch einmal die Zeilen auf dem Papier studierte.
»Ja. Ihr Bruder hat vor seinem Ableben sogar persönlich mit mir über diesen Wunsch gesprochen.« Er legte den Zettel wieder auf den Stapel zurück, faltete die Hände zusammen und lehnte sich auf den Tisch. »Er wünscht, dass Sie sich persönlich um die Handhabung seines neusten und letzten Manuskripts kümmern. Es befindet sich nicht bei den anderen Dokumenten auf seinem Laptop, sondern wurde komplett mit der Schreibmaschine geschrieben und hier bei mir hinterlegt.«
Ciara runzelte die Stirn so tief, dass sich die Geste auf dem Gesicht ihres Gegenübers spiegelte. »Wann hat er Ihnen dieses Manuskript denn gegeben?«
»Zwei Tage vor seinem Ableben. Zusammen mit den letzten Anpassungen seines Testaments.«
Zwei Tage? Aber er war doch ganz plötzlich gestorben, hatten alle gesagt. Er war einfach eines Morgens tot in seinem Bett gefunden worden. Eingeschlafen. Vielleicht war es ein Schlaganfall gewesen, hatten die Beamten vermutet. Genaueres wusste man bisher noch nicht.
Aber zwei Tage vor seinem Tod. Das bedeutete, er war erst vor sechs Tagen hier gewesen, um alles für die Zeit nach seinem Tod zu arrangieren. Hier in diesem Raum. Das war weniger als eine Woche her und er hatte … nein, das konnte kein Zufall sein.
Die Verwirrung, die diese Erkenntnis mit sich brachte, traf Ciara mit solcher Wucht, dass sie sich in ihren Stuhl zurücklehnte und sich so sehr auf das Atmen konzentrieren musste, dass sie kaum bemerkte, wie Tränen ihre Sicht verschleierten.
Eilig wischte sie sie weg, bevor sie ihre Wangen erreichen konnten, presste dann die Fingerkuppen kurz auf den Mund und fragte sich, ob ihre Eltern bereits eine ähnliche Vermutung angestellt hatten. Himmel.
»Alles in Ordnung? Soll ich Ihnen ein Glas Wasser bringen, oder wollen Sie eine Pause …«
»Nein, schon gut«, fiel Ciara dem Notar leise ins Wort und schüttelte wie für sich selbst den Kopf. »Was … was soll ich denn mit dem Manuskript tun?«
»Also.« Der Mann schob seinen Drehstuhl ein Stück zurück, zog eine Schublade auf und holte einen gewaltigen Stapel Papier daraus hervor, dick wie ein Bund Druckerpapier und mit Fäden an der Seite zusammengebunden. »Er hat genaue Anweisungen dafür hinterlassen. Er wünscht, dass Sie mit dem Dokument bereits nächste Woche nach Shanghai reisen, um es dort persönlich einem Verleger zu übergeben. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass das Manuskript nicht verschickt wird, sondern dass Sie es persönlich überreichen. Und nur Sie persönlich.«
Ciara fuhr sich mit der Zunge über die Lippen, um zu überspielen, dass ihr die Kinnlade fast heruntergefallen wäre.
»Shanghai?«, wiederholte sie perplex und versuchte, all das Gesagte, all das Gehörte zu einem Puzzle zusammenzusetzen. Sie versagte kläglich.
»Ja, ein chinesischer Verlag scheint bereits nach dem Exposé einen Vertrag mit Ihrem Bruder aufgesetzt zu haben. Das fertige Manuskript geht also an ihn. Das ist auch der Wunsch Ihres Bruders.«
Warum schickte er das Manuskript dann nicht einfach per Mail dorthin wie jeder normale Mensch? Und warum gerade sie? Sie hatte seit so vielen Jahren nichts mehr mit Koba zu tun gehabt und sie war weder die älteste noch die verlässlichste Schwester, die er hatte.
»O-okay«, stammelte sie über all ihre Gedanken hinweg und streckte die Hände nach dem gewaltigen Text aus, der dort in gedruckter Form vor ihr lag. Mr. Jonsberg schob ihn bereitwillig zu ihr herüber.
1744 Seiten zählte das ganze Dokument, so schwer wie zehn Aktenordner. Eine pechschwarze Feder war mit dünnen Klebebandstreifen auf der ersten Seite befestigt, direkt über dem Titel: Die Schöpfer der Wolken.
»Der Flug nach Shanghai geht nächste Woche Freitag. Er wurde bereits für Sie gebucht.«
»Er hat … schon den Flug für mich gebucht?« ›Was soll das?‹, schrie es immer lauter in ihrem Kopf. ›Das kann nicht sein, das ergibt keinen Sinn!‹
»Ja. Außerdem wurde am Todestag Ihres Bruders eine Überweisung auf Ihr Konto veranlasst. Mit dem Betrag sollten sämtlichen Reise- und sonstige Kosten gedeckt sein. Über den Rückflug werden Sie selbst flexibel entscheiden können, allerdings ist das Hotelzimmer in Shanghai nur für eine Woche gebucht.«
Ciara schluckte.
»Gut. Ich denke nicht, dass ich eine Woche brauchen werde, um ein Manuskript zu übergeben.« Sie hörte selbst, dass ihre Stimme sich monoton und leer anhörte. Was sollte das alles? Was war das Besondere an dieser Geschichte und was war das Besondere an ihr?
»Er sagte, Sie würden sich vielleicht einen kleinen Urlaub genehmigen wollen. Fern Ihrer üblichen Gesellschaft.«
Nun sah sie wieder zu dem Mann auf. In seinem Blick lag etwas Eigenartiges. Etwas Wissendes, das ihr selbst bei den sommerlichen Temperaturen in diesem Zimmer eine Gänsehaut bereitete.
Sie wünschte sich Abstand. Sie wünschte sich Urlaub fern ihrer üblichen Gesellschaft. Schon lange. Aber darüber hatte sie mit niemandem gesprochen. Nie.
»Gibt es sonst noch etwas, das ich tun oder beachten muss?« Sie räusperte sich und war sicher, dass es ihr noch nie so schwergefallen war, ihre wahren Gefühle zu verbergen. All die Gedanken, die jetzt sofort einfach nur aus ihr ausbrechen wollten, die schreien, Fragen stellen, wild im Raum umherspringen wollten, bis sie Antworten gefunden hatten. Alles wirbelte. Sie wollte nichts mehr hören, sondern nur noch raus hier. Weg hier.
»Ja, allerdings.«
Mist.
Der Mann suchte aus einem schmalen Hefter einige Dokumente heraus, warf kurz einen Blick darauf und reichte ihn Ciara über den Tisch. Es kostete sie einiges an Beherrschung, das Zittern ihrer Finger zu verbergen.
»Hier ist alles zusammengefasst, was Sie für die nächsten Tage wissen müssen. Dort steht, wann und wo Ihr Flug geht. Die Flugtickets sind mit angeheftet. Und hier hinten finden Sie eine Beschreibung, wo Sie Ihr Geld in Renminbi umtauschen können, wo sich Ihr Hotel in Shanghai befindet, wie Sie dorthin kommen und natürlich auch wann und wo Sie sich mit dem Verleger treffen. Er spricht übrigens hervorragend Englisch, hat Ihr Bruder gesagt. Die Verständigung sollte also kein Problem sein.«
Das war bisher ihre geringste Sorge gewesen.
»Ist gut.« Sie drückte das Manuskript an ihre Brust, als ihr die nächste Frage einfiel.
»Darf ich den Text lesen?«
»Ja. Aber nur Sie. Und Sie sollen dafür Sorge tragen, dass niemand anderes außer Ihnen es tut, bis Sie es dem Verleger überreichen.«
Sie nickte vorsichtig vor sich hin.
»Sonst noch etwas?«
Der Notar hatte inzwischen wieder den weichen Blick des friedlichen Bären aufgesetzt und schaute abermals so wirr über all das geordnete Chaos vor sich, dass Ciara sich für eine Sekunde fragte, ob sie sich den eigenartig intensiven Ausdruck auf den Zügen des Mannes zuvor nur eingebildet hatte. Noch bevor sie ihre Gedanken zu diesem Thema vertiefen konnte, schüttelte ihr Gegenüber den Kopf.
»Nein, ich denke, wir haben es schon geschafft. Was Ihr Erbe angeht, wird Ihre Mutter Sie aufklären können. Es sei denn, Sie wollen es lieber persönlich von mir hören?«
»Nein, schon gut.« Sie schüttelte den Kopf. Was auch immer es noch gab, sie wollte es nicht wissen. Ihr Kopf war schon voll genug.
Langsam erhob Ciara sich aus ihrem Stuhl, das Manuskript noch immer an sich gedrückt. Sie fühlte sich so leer und voll zugleich. Sie wollte rennen, um ihren Kopf zu reinigen, und sich gleichzeitig bewegungslos auf den Boden sinken lassen und einfach nur still sein. Nie wieder etwas sprechen müssen, bis sie verstanden hatte. Bis sie eine logische Erklärung für das alles hier gefunden hatte.
Der Notar in seinem weit sitzenden Anzug erhob sich ebenfalls, schob sich um seinen Schreibtisch herum und öffnete ihr die Tür. Er wirkte überraschend agil, wenn man bedachte, was für Nachrichten er gerade überbracht hatte. Er musste doch schon zu demselben Schluss gekommen sein wie sie, oder? Ihre Mutter und ihr Vater auch. Sie alle mussten es wissen. Dass das alles hier kein Zufall war.
»Gut, dann bis bald.«
»Bis bald.«
Ciara schaute sich im Eingangsbereich um, aber niemand außer ihnen beiden befand sich hier. Durch die großen Fenster zu ihrer Linken konnte sie das Meer in der Ferne glitzern sehen.
Sie hörte bereits das Quietschen der sich schließenden Tür hinter sich, als sie einem so spontanen Impuls folgte, dass die Frage schon ihre Lippen verlassen hatte, bevor sie sie überhaupt hatte denken können.
»Mr. Jonsberg?«
»Ja bitte?«
Sie holte tief Luft und nickte, nur um sich selbst zu bestätigen, dass sie es einfach wissen musste.
»Waren Sie mit meinem Bruder befreundet?«
Der Mann zog die Augenbrauen leicht in die Höhe, dann nahm er sofort eine aufrechte Haltung ein.
»Wir kannten uns seit vielen Jahren.«
Natürlich taten sie das. Es war nur logisch. Koba hätte sich nie jemandem anvertraut, der fremd für ihn war. Es hatte immer nur einen sehr beschränkten Kreis an Personen gegeben, mit denen er sich ausgetauscht hatte. Vor allem, wenn es etwas für ihn so überaus Wichtiges wie sein Testament betraf.
»Er …« Sie musste es einfach fragen. Sie musste, sie musste, sie musste! Aber sie wusste nicht, ob sie die Antwort hören wollte. »Er wusste, dass er sterben würde, oder?«
Zu ihrem absoluten Entsetzen nickte der Mann.
Kein Herumreden, kein Drucksen, kein Schweigen.
Nur ein einfaches, ehrliches Nicken.
Und diese Geste, diese Gewissheit, diese Offenbarung fiel mit einem so großen Gewicht in Ciaras Gedanken ein, dass es sie zu Boden drückte. Dass es die Luft aus ihren Lungen entweichen ließ, und sie – die Hände und Knie auf dem kühlen Boden der Eingangshalle ruhend – versuchte, nach Luft zu schnappen, zu atmen, zu denken, um es irgendwie zu verstehen.
Bis selbst ihre Tränen zu schwer wurden und langsam – nach und nach nur – auf den kühlen Boden unter ihr perlten.
2
Xia
Von Motorrädern und Talenten
Shanghai, China, Januar 2021
Es schneite in Shanghai. Schon am Vormittag hatten die weißen Flocken begonnen, vom Himmel zu schweben, immer größer und schneller werdend, bis sie alles unter einer zentimeterdicken Schicht aus gräulichem Weiß begraben hatten. Die Menschen waren hinausgeeilt, hatten Kinder, Tiere und Kameras mitgenommen, um sich in Parks zu tummeln, auf Dächern zu versammeln oder einfach durch die engen Straßen der Altstadt zu schlendern und Tee zu trinken.
Xia liebte den Schnee. Die profillosen Sommerreifen auf ihrem Motorrad allerdings weniger. Die Straßen waren rutschig vom Schneematsch, der sich dreckig auf den Fahrbahnen und Wegen sammelte, die Autos stauten sich auf Brücken und an Kreuzungen, teils kilometerweit ohne einen Ausweg in Sicht.
Doch sie raste an ihnen vorbei.
Dröhnendes Hupen im Rücken war sie gewohnt. Sie hatte es fast als eines von vielen immer gleich klingenden Hintergrundgeräuschen aus dem Bereich des Wahrnehmbaren verdrängt, als sie mit Vollgas zwischen zwei stehenden LKW hindurchschoss, die enge Kurve dahinter gerade so meisterte, ohne eines der Autos zu streifen, und ein weiteres Mal beschleunigte.
Mit einem Aufheulen der alten Motoren drehten erst die Räder auf dem glitschigen Untergrund durch, dann machte die Maschine einen Sprung nach vorn, der ihr den Schweiß auf die Stirn treten ließ. In ihrem Sichtfeld verschwommen die alten und neuen Fassaden all der Häuser am Straßenrand zu einer grauen Masse. Wenn das Visier in ihrem Helm noch weiter beschlug, würde sie gar nichts mehr sehen können. Und wenn einer der im Stau stehenden Menschen auf die Idee kam, seine Autotür zu öffnen, wäre sie sowieso geliefert.
Ein weiteres Hupen in ihrem Rücken. Ein Fahrer machte sich sogar die Mühe, sein Fenster herunterzulassen und ihr den Mittelfinger herauszustrecken, wie sie in ihrem zerbrochenen Rückspiegel gerade noch so erkennen konnte.
Und hinter dem Kerl sah sie die beiden Typen auf ihren schwarzen Maschinen, die ihr noch immer auf den Fersen waren. Scheiße!
»Kommt schon, Jungs, gebt endlich auf«, murmelte sie nur für sich, aber über das Dröhnen ihres Motorrads drang ihre Stimme nicht einmal bis an ihre eigenen Ohren.
Die beiden folgten ihr schon seit dem Universitätsgebäude. Und das seit etwa zehn Tagen, jeden Tag. Hatte sie sich selbst zu Beginn noch Paranoia unterstellt, waren ihre anfänglichen Zweifel an ihrem Verstand am Ende doch unbegründet gewesen. Egal wann, egal von welcher Ausfahrt aus sie das Gelände der Fudan Universität verlassen hatte, nach spätestens einer Minute waren diese beiden Witzfiguren in einiger Entfernung hinter ihr aufgetaucht.
Zwei kleine Männer auf großen Motorrädern, viel moderner und sicherlich auch um einiges schneller als ihr eigenes. Die schwarzen Helme ließen keine Vermutung zu, wer sie waren oder ob sie – nun ja – freundlich gesinnt sein konnten. Letzteres hatte Xia im Grunde schon ausgeschlossen.
Sie nahm die nächste Abfahrt von der Schnellstraße und drosselte ihr Tempo deutlich, als die Fahrbahn einspurig wurde, sie einige letzte wartende Autos überholte und sich dann in eine halbwegs flüssige Verkehrsader einreihte.
Sie hatte keine Ahnung, was die Kerle von ihr wollten. Vielleicht waren es auch Frauen, nicht einmal das konnte sie sagen. Alles, was Xia wusste, war, dass die beiden ihr in jede Gasse, in jeden verdammten Winkel folgten. Dieses Spiel hatten sie in den letzten Tagen immer wieder gespielt, immer wieder auf anderen Wegen, immer weiter hinein in die Stadt, bis es ihr doch Mal um Mal gelungen war, sie abzuschütteln. Langsam wurde es lästig.
Die Skyline der neuen Stadt schob sich in ihr Sichtfeld, als die junge Frau eine weitere Abbiegung nahm und die Straße sich ein weiteres Mal verengte. Sie war heute einen weiten Weg gefahren, um die beiden Fremden hinter sich zu lassen. Vor allem, weil sie gehofft hatte, der Stau würde die Idioten daran hindern, ihr zu folgen. Aber ihre Annahme, dass die beiden nicht von ihr entdeckt werden wollten, hatte sich ebenfalls als falsch herausgestellt. Im Gegenteil, sie schrien ja förmlich nach ihrer Aufmerksamkeit.
Der Weg, in den sie als Nächstes einbog, stammte noch aus den Ursprüngen von Yangpu. Ein kleines Geschäft reihte sich an das andere, vor allem Einheimische tummelten sich in den engen Gassen zwischen Motorrollern und Fahrrädern, so eng aneinandergestellt, dass es kaum mehr ein Durchkommen gab und sie ihr Tempo fast auf Schrittgeschwindigkeit drosseln musste. Eine Rikscha vor ihr bahnte sich langsam einen Weg durch die Menschen, die noch immer begeistert vom Schnee durch die Straßen schlenderten. Xia folgte ihr für einige Meter, dann schaltete sie den Motor ab, hüpfte vom Bike und schob es – geduckt und so schnell wie möglich – in eine der Einfahrten, die zu den Hinterhöfen führten, die sich meist mehrere Familien teilten.
Sie lehnte ihr Motorrad an die Mauer unter dem Tor, hockte sich so dicht wie möglich daneben und griff gleichzeitig mit einer Hand nach dem Handy in ihrer Jackentasche. Sie hatte die Polizei schon auf Schnellwahl eingespeichert. Wenn die Typen sie hier wirklich entdecken sollten, würde ihr nichts anderes übrigbleiben, als sich tatsächlich Hilfe zu holen. Außerdem hatte sie hier massig Zeugen.
Rufe waren zu hören, das Dröhnen von Motoren und einige harsche Flüche aus Frauenmündern, die Xias Laune kurz anhoben. Ihre alte Schrottkarre hatte niemanden hier gestört. Warum auch, so alte Bikes wie ihres sah man hier jeden Tag auf- und abklappern. Die neuen großen Maschinen ihrer Verfolger waren allerdings weder für diese engen Gassen gemacht, noch für die Art von Bevölkerung, die hier lebte.
Als die wummernden Motoren näherkamen, kauerte Xia sich weiter zusammen. Der Eingang, in dem sie sich versteckte, lag halb hinter einem kleinen Straßenladen, in dem es einen der besten Tees der ganzen Umgebung gab – und um ihn sammelten sich so viele Menschen, dass man sie hier von der Straße aus kaum erkennen sollte.
Eine ältere Frau sah Xia und wollte sich gerade zu ihr herabbücken, als diese sie mit einer fahrigen Handbewegung von sich fortscheuchte. Die Fremde murmelte irritiert und Xia tat es leid, sie so harsch abgewiesen zu haben, aber ihr Herz schlug zu schnell, ihre Muskeln waren zu angespannt, als dass sie mit Höflichkeiten Zeit verschwenden konnte.
Als der Helm des ersten Fremden zu sehen war, verfestigte sich ihr Griff um ihr Handy. Wie sie zuvor kam er nur im Schritttempo voran, ließ aber immer wieder seinen Motor aufheulen, als wäre es ihm so möglich, die Menschen dazu zu bewegen, ihm aus dem Weg zu gehen. Was für ein Dummkopf. Die beiden kamen wirklich nicht von hier, das sah sogar ein Blinder.
Der erste Verfolger fuhr vorbei, ohne sie zu sehen. Dann passierte der zweite ihr Sichtfeld, schaute sich aufmerksamer um als sein Vorgänger, aber …
Jemand schob sich direkt vor sie und Xia zuckte zusammen. Noch bevor sie aufsehen konnte, hörte sie, wie die beiden Motorräder wieder beschleunigten. Sie mussten am nahegelegenen Ende der Gasse angekommen sein. Nach einigen Momenten verschwand das Dröhnen in der Ferne.
Erst als sie sicher war, dass die beiden außer Reichweite waren, sah Xia auf.
»Entschuldigung«, räusperte der Mann sich und mit noch immer vor Adrenalin zitternden Knien richtete sie sich auf, nahm den Helm von ihrem Kopf und hängte ihn über ihren Motorradlenker.
Die türkisfarbenen Haare klebten an ihrer schweißnassen Stirn und Xia gab sich nur halbwegs Mühe, ihren Bob mit den behandschuhten Fingern wiederherzustellen.
»Kann ich Ihnen helfen?«, fragte sie in so abweisendem Tonfall, wie es ihr nur möglich war, als sie dem Unbekannten ins Gesicht sah. Vermutlich war er einer der vielen Studenten, die sich in dieser Gegend für ein paar Semester niedergelassen hatten. Er sah zumindest nicht aus wie ein Chinese. Er war groß, überragte sie bestimmt um ein bis zwei Köpfe. Sein schokobraunes Haar war kurz, aber in den leicht gelockten Spitzen fingen sich winzige Schneeflocken.
»Hast du zufällig eine Zigarette für mich?«
»W-was?« Er hatte bemerkt, dass sie vor einigen Sekunden noch in Panik auf dem Boden gehockt hatte, oder? Oder hatte er angenommen, sie hätte dort unten nur ein wenig entspannt? Abgesehen davon sprach er überraschenderweise akzentfrei Chinesisch.
»Ob du vielleicht eine Zigarette für mich hast, wollte ich wissen«, wiederholte er mit einem Engelslächeln, das Xia ihm nicht wirklich abkaufte. Mit seinem dunklen Mantel, den Lederhandschuhen, dem dunklen Bartschatten und seinen Locken sah er aus wie eine Mischung aus einem ziemlich taffen Kerl und einem netten Jungen von nebenan.
»Ich hab nur Menthol«, antwortete sie wie automatisch auf die Frage. Wie dumm, sie hätte auch einfach sagen können ›Hab keine‹. Oder ›Hier sind etwa Millionen andere Menschen, die du fragen kannst, Mann!‹
»Das ist sogar noch besser«, meinte er grinsend und sie stöhnte innerlich.
Na gut. Sie war zwar aufgebracht von der Verfolgungsjagd, aber das war kein Grund, unfreundlich zu sein. Zumindest redete sie sich das ein, als sie ihre Taschen nach dem Schächtelchen durchwühlte.
Trotz der Eiseskälte waren ihre Wangen brennend heiß. Sie schwitzte unter ihrem Mantel, also zog sie zumindest die Handschuhe von ihren Fingern, bevor sie die Zigarettenschachtel öffnete und ihrem Gegenüber hinhielt.
»Verbindlichsten Dank«, meinte er, als er sich eine herausfischte, ein Klippfeuerzeug aus seiner Manteltasche zog und den Tabak anzündete.
Xia beschloss währenddessen, dass es sinnlos war, noch weiter regungslos in der Gegend herumzustehen. Die Typen waren weg, sie war in Sicherheit. Alles war gut. Bis auf den Umstand zumindest, dass sie ein Vermögen an Sprit und Zeit verloren hatte.
Sie zog sich ebenfalls eine Zigarette aus der Schachtel und ließ sie sich von dem Mann anzünden, der noch immer nicht von ihrer Seite gewichen war. Bereits der erste kribbelnde Zug in ihren Lungen tat unendlich gut.
»Danke«, nuschelte sie und versuchte noch immer, ihr viel zu schnell pochendes Herz zu beruhigen. »Kann ich sonst noch irgendwie helfen?«
»Na ja«, setzte der Fremde an, von einem Fuß auf den anderen wippend. Auch er hatte seine Handschuhe nun ausgezogen und seine Finger waren bereits rot vor Kälte. »Ich muss mich ja irgendwie für die Zigarette bedanken«, meinte er und Xia hatte Mühe, ein Stirnrunzeln zu verbergen.
»Und deswegen belohnst du mich … mit deiner Anwesenheit?«, wollte sie irritiert wissen.
Der Mann lachte ertappt und grinste seine Schuhe an, als schämte er sich selbst ein wenig für seinen Spruch.
»So in etwa«, meinte er und ihr Widerstand war gebrochen. Xia grinste kopfschüttelnd, vielleicht einfach viel zu erleichtert über diese Situation. Über diese Möglichkeit, den Stress abzubauen, denn mit diesen weichen Knien käme sie sicherlich nicht mehr nach Hause.
»Na gut, dann leg mal los.«
Nun war es an ihm, verwundert zu schauen. Seine Augen waren von einem sonderbaren Eisblau.
»Womit?«
»Es muss ja etwas geben, was deine Anwesenheit lohnend macht. Erzähl mir ’ne Geschichte«, forderte sie und nahm einen weiteren wohltuenden Zug. Als er darauf noch immer ein wenig überrumpelt wirkte, seufzte sie und verschränkte die Arme halb. »Bist du von hier?«
»Du meinst aus China? Nein.«
Wow. Wie aufschlussreich.
»Dafür sprichst du die Sprache aber verdammt gut.«
»Vielen Dank«, meinte er lächelnd, schien aber nicht weiter ausführen zu wollen.
Was sollte das jetzt? Das war kein Kompliment gewesen, das war eine versteckte Frage. Du kommst nicht aus China, aber du sprichst perfektes Chinesisch. Wer antwortet darauf einfach mit Danke? War er plötzlich doch schüchtern?
Anstatt weiter nachzubohren, begnügte sich Xia mit einem etwas zu breiten Lächeln.
»Und du so?«, fuhr er dann aber doch fort, vielleicht einfach nur, um die Stille zwischen ihnen zu überwinden. Warum konnte er nicht einfach seiner Wege gehen?
»Also ich stamme von hier«, erklärte sie, was wiederum ihm ein etwas ironisches Schmunzeln entlockte. Natürlich stammte sie von hier, das war dank ihrer Gesichtsform und ihrer mandelförmigen Augen nur schwer zu übersehen.
Und wieder Stille.
»Sag mal …« Sie konnte nicht anders. »Warum hast du gerade mich nach ’ner Zigarette gefragt und keinen anderen?« Er hatte nicht mal wissen können, dass sie welche besaß.
»Du warst die Hübscheste von allen«, murmelte er, ohne sie anzusehen.
»Netter Versuch«, erwiderte sie mit leicht zusammengekniffenen Augen. »Ich hatte meinen Helm auf, als du mich angesprochen hast.«
»Ach ja.« Er presste die Lippen ertappt aufeinander, nahm einen Zug von seiner Zigarette und hob dann die Hände leicht nach oben, zum ersten Mal mit einem vermutlich halbwegs ehrlichen Ausdruck auf den Zügen. »Okay, ich geb’s zu, ich hab mir Sorgen gemacht.«
Xia sah ihn an, ohne etwas zu erwidern. Einfach weil sie wollte, dass er weitersprach.
»Also, ich meine das nicht als Männerding oder so. Du wirktest, als hättest du ’ne Panikattacke. Ich dachte, ich schau mal vorbei und versuche, was aus dir rauszukitzeln.«
»Weil du dich um deine Mitmenschen sorgst?«, hakte sie nun doch nach und wusste nicht, ob sie den Kerl süß oder zwielichtig finden sollte. »Das ist ziemlich umsichtig«, gestand sie ihm schließlich zu. Das war mehr, als andere Menschen tun würden. Mehr als die meisten getan hatten. Abgesehen von der Oma, die Xia fauchend von sich gescheucht hatte.
Er zuckte mit den Schultern, nahm den letzten Zug von seiner Zigarette und schnippte sie weg. Der Stummel landete in einem kleinen Schneehaufen und sank ein paar Zentimeter ein.
»Auf jeden Fall alles Gute.« Er trat einen Schritt zurück, schob die vermutlich frierenden Finger in die Taschen und nickte ihr zu. »Danke für die Zigarette«, meinte er und wandte sich um.