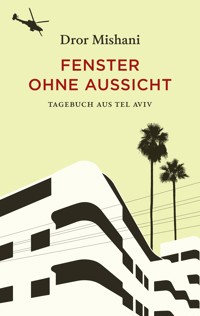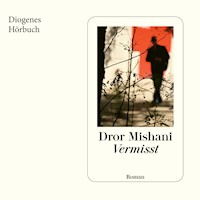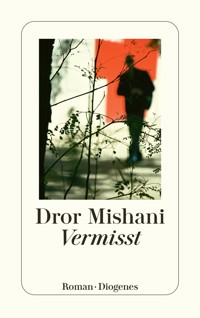Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Avi Avraham, der „melancholische Sturkopf“, ist soeben zum Leiter des Ermittlungsdezernats von Cholon-Ayalon, Israel, ernannt worden. Beim nächsten Einsatz erkennt er die Leiche sofort: Lea Jäger. Sie war vor ein paar Jahren vergewaltigt worden, der Täter sitzt im Gefängnis. Jetzt fällt der Verdacht auf einen Mann in Polizeiuniform. Trotz heftiger Widerstände in den eigenen Reihen sucht Avi weitere Frauen, die nach einer Vergewaltigung erneut von einem Polizeibeamten vernommen wurden. Dabei stößt er auf eine junge Bankangestellte, die einige Jahre zuvor von einem Unbekannten brutal misshandelt wurde. Als er sie und ihren Mann aufs Revier bittet, kommt es zur Tragödie. Der dritte Krimi des international gefeierten Schriftstellers Dror Mishani.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
»Er erkannte die Leiche sofort, verlor aber im ersten Moment kein Wort darüber.« Avi Avraham, soeben zum Leiter des Ermittlungsdezernats von Cholon-Ayalon ernannt, weiß, dass es sich bei der Toten um die etwa sechzigjährige Lea Jäger handelte. Sie war vor ein paar Jahren in ihrer Wohnung vergewaltigt worden, der Täter hatte sich gestellt und sitzt im Gefängnis. Jetzt lenkt der einzig verwertbare Hinweis den Verdacht auf einen Mann in Polizeiuniform.
Trotz heftiger Widerstände in den eigenen Reihen sucht Avi weitere Frauen, die nach einer Vergewaltigung erneut von einem Polizeibeamten vernommen wurden. Bei seinen Ermittlungen stößt er auf die junge Bankangestellte Mali Bengtson, die einige Jahre zuvor bei einem Betriebsausflug nach Eilat von einem Unbekannten brutal misshandelt wurde. Als er sie und ihren Mann zu einer Befragung aufs Revier bittet, kommt es zur Tragödie.
Zsolnay E-Book
DROR MISHANI
DIE SCHWERE HAND
AVI AVRAHAM ERMITTELT
Roman
Aus dem Hebräischen von Markus Lemke
Paul Zsolnay Verlag
Dem Gedenken an meinen Vater Mordechai Mishani gewidmet
(10.4.1945 bis 9.4.2013)
Auf halbem Weg des Menschenlebens fand
Ich mich in einen finstern Wald verschlagen,
Weil ich vom rechten Weg mich abgewandt.
Wie schwer ists doch, von diesem Wald zu sagen,
Wie wild, rauh, dicht er war, voll Angst und Not;
Schon der Gedank’ erneuert noch mein Zagen.
Nur wenig bitterer ist selbst der Tod;
Doch um vom Heil, das ich drin fand, zu künden,
Sag ich, was sonst sich dort den Blicken bot.
Dante Alighieri, Die Hölle
(in der Übersetzung von Carl Streckfuß)
PROLOG
Anfang Dezember landete eine Boeing 737 auf dem Flughafen Ben Gurion, unter den Passagieren eine junge Frau mit Kurzhaarschnitt und großen, braunen Augen. Oberinspektor Avraham Avraham beobachtete sie von seinem Versteck hinter einer der dicken Betonsäulen, als sie die Milchglastüren passierte und die Ankunftshalle betrat, einen Gepäckwagen mit drei Koffern vor sich herschiebend. Bis zuletzt hatte er nicht geglaubt, dass sie kommen würde, und war sich sicher gewesen, allein nach Hause zurückzukehren. Er betrachtete sie noch einen Augenblick lang aus der Entfernung, ehe er aus seinem Versteck trat und seine Augen den ihren begegneten, die in der Menge der Abholenden nach ihm suchten.
Sie hatten keine großen Pläne für die Zukunft, wollten nur einige Monate zusammenleben. Einander neu entdecken und erst danach darüber nachdenken, was weiter sein würde. Und tatsächlich entdeckten sie einander, langsam und behutsam, mit den verstohlenen Blicken von Menschen, die es gewohnt sind, aufmerksam zu beobachten. Er entdeckte, dass Marianka morgens gerne duschte – und das ausgiebig. Wenn sie herauskam, hinterließ sie auf dem Boden im Badezimmer einen kleinen See, führten nasse Spuren ins Schlafzimmer. Und sie fand heraus, dass Avraham sich nach dem Abendessen unbemerkt in die Küche stahl, um allein für sich hinter geschlossener Tür noch weiterzuessen. Die Koffer versuchte Avraham, nachdem sie deren Inhalt über die Wohnung verteilt hatten, auf dem Kleiderschrank im Schlafzimmer zu verstauen, aber da dort nicht genug Platz war, blieb einer der Koffer den ganzen Winter über neben ihrem Bett stehen.
Marianka wollte sein neues Büro sehen, und früh an einem Freitagmorgen, als noch keiner auf dem Revier war, nahm er sie mit dorthin. Im Unterschied zu seinem Kämmerchen im ersten Stock war das Büro des Leiters der Ermittlungsabteilung großzügig geschnitten und bot vom dritten Stock aus den Blick auf die Fichman-Straße, auf der Wohntürme aus altem Sand wuchsen. Er konnte durch das Fenster die grauen Morgen oder die kühlen Abende mitverfolgen, die die Stadt, in der er geboren war, bedeckten. Und zum ersten Mal überhaupt hätte er sich in seinem Büro auch eine Zigarette anzünden können, aber ausgerechnet da hatte er das Rauchen gerade aufgegeben.
Der Winter war launisch, und als Avraham feststellte, dass das Wetter Einfluss auf Mariankas Stimmung hatte, begann er, jeden Morgen die Wettervorhersage bang zu studieren. Wenn die Temperaturen zurückgingen und es regnete, war sie glücklich. Wenn der Himmel klar und die Luft lau, schon fast angenehm warm war, erzählte sie ihm vom Schnee in Brüssel und vermochte nicht, die Sehnsucht auf ihrem Gesicht und in ihrer Stimme zu verbergen. Das war das Einzige, was seine Freude trübte. Stundenlang stand er in seinem Büro am Fenster und wartete für sie auf den Regen.
Als es Ende Februar in den Nachrichten hieß, ein letzter Wintersturm nahe, beschlossen sie, einen Tag freizunehmen und die Kaltfront gemeinsam zu begrüßen. Was sie tatsächlich auch taten, doch nur wenige Stunden nach Beginn des stürmischen Wetters ereignete sich der Mord, der ihre Pläne zunichtemachte.
TEIL I
DAS OPFER
1
Sie hatte die Pistole in jener Nacht gesehen, als sie aufs Dach gegangen war, um Coby zu überreden, ins Bett zu kommen.
Es war ein Uhr in der Früh, und die Pistole lag auf dem Tisch in der kleinen Kammer auf dem Dach, aber sie maß dem keine Bedeutung bei, weil sie zu verletzt und zu erschöpft war und vor so vielen anderen Dingen Angst hatte. Außerdem war die Pistole ja nichts Beängstigendes, sondern vermittelte im Gegenteil ein Gefühl von Sicherheit. Und erst ein paar Tage danach erinnerte sie sich an jene Nacht und verstand. Alles hätte anders ausgehen können, hätte sie Coby in jenen Stunden aufmerksamer wahrgenommen.
Am Morgen, als sie noch zusammen im Bett lagen, hätte keiner ahnen können, dass ihr letzter gemeinsamer Hochzeitstag so enden würde. Daniela und Noy waren vor ihnen aufgewacht, hatten auf dem Fußboden im Schlafzimmer elf Ballons verteilt und hüpften auf dem Bett herum. Als die zwei sich anziehen gingen und nur sie beide im Bett zurückblieben, rutschte sie an ihn heran und berührte ihn von hinten, flüsterte ihm »Herzlichen Glückwunsch« ins Ohr und war überrascht, als sie spürte, dass seine Schultern und sein Rücken sich unter der Berührung ihrer Hände regten. Sein Hals war warm vom Schlaf, und seine Wangen waren unrasiert. Durch das Fenster waren die ersten Regengüsse des Sturmtiefs zu hören und in der Wohnung alle Lampen angeschaltet, weil der Himmel dunkel verhangen war. In der Küche erwartete sie ein festliches Frühstück, das die Mädchen vorbereitet hatten: Orangensaft, von ihnen selbst gepresst, und Croissants, die sie am Vorabend im Geschäft an der Ecke gekauft und aufgewärmt hatten. Wasser durften sie allein noch nicht zum Kochen bringen, weshalb Mali den Kaffee machte.
Sie sah, dass Coby angespannt war, und verlor in Gegenwart der Mädchen, die am Tisch saßen, kein Wort über das Bewerbungsgespräch. Stattdessen bot sie an, ihm die dunkle Hose und das weiße Hemd zu bügeln, aber Coby sagte, er würde das selber machen, ehe er aufbräche. Sie redete nicht weiter darüber, auch nicht, als sie wieder allein im Schlafzimmer waren, damit die Enttäuschung nicht zu groß wäre, wenn er den Job nicht bekäme, aber als sie sich voneinander verabschiedeten, küsste sie ihn auf die Lippen und flüsterte ihm sogar ins Ohr: »Viel Erfolg heute.«
Sie fuhr Daniela zum Kindergarten und Noy zur Schule und hatte bis um elf Kundentermine.
Zumeist erschienen nur die Ehemänner, und selbst wenn ihre Frauen mitkamen, brachten die so gut wie kein Wort heraus, weshalb sie besonders darauf achtete, wie sie es immer versucht hatte, sich auch an diese zu wenden, ihnen die Unterschiede zwischen den verschiedenen Hypothekenarten und die jeweiligen Tilgungsformen zu erklären. Einer der Männer, dessen Frau die Haare über ihrem schönen, stillen Gesicht unter einem Kopftuch verbarg, starrte sie an. Er war bärtig, und sein Jackett, das er nicht ablegte, roch nach Mottenkugeln und altem, stockigem Tuch. Seine Frau schaukelte den blauen Kinderwagen vor und zurück, damit der Säugling darin nicht aufwachte. Als er dann doch zu weinen begann, öffnete sie zwei Knöpfe ihres Kleides und stillte ihn ohne Scham vor ihnen beiden.
Da sie zwischen elf und zwölf keine weiteren Termine hatte, bat sie den Filialleiter um Erlaubnis und verließ die Bank, um Coby ein Geschenk zu kaufen, obwohl sie vereinbart hatten, sich dieses Jahr nichts zu schenken. Sie überlegte, zu Fuß bis zur Sokolov zu gehen, fuhr wegen des stürmischen Wetters dann aber doch mit dem Auto zum Einkaufszentrum. Die Straßen waren überflutet und die Ampeln außer Betrieb. Und vielleicht wegen des Regens beschloss sie, ihm anstelle des einen, den er verloren hatte, einen Schirm zu kaufen und keinen Boxsack oder ein Businesshemd für die Vorstellungsgespräche. Bei »Zara« waren alle Schirme zu teuer, aber in einer Boutique »Für den Herrn« im dritten Stock sah sie einen schwarzen Stockschirm mit elegantem Griff aus Holzimitat. Die junge Verkäuferin, deren lange Fingernägel glitzernd schwarz lackiert waren, war einverstanden, mit dem Preis sogar noch ein bisschen runterzugehen.
Hatte sie die Verkäuferin zu lange angestarrt, als diese den Regenschirm in silbernes Geschenkpapier verpackte? Sie war so jung. Vielleicht sogar noch Schülerin. Als Mali den Laden betrat, las sie in einem Buch, das sie dann aufgeklappt und mit dem Rücken nach oben auf den Tresen legte. Ihre schwarzen Haare waren kurz geschnitten, ihre Lippen mit einem tiefdunkelvioletten Lippenstift angemalt, und in der Nasenscheidewand trug sie einen Ring. Als sie registrierte, dass Mali sie anschaute, fragte sie: »Ist was?« Und Mali sagte: »Nein, Entschuldigung. Haben Sie auch das Preisschild entfernt?«
Cobys Bewerbungsgespräch sollte um zwei beginnen, genau als sie ihren letzten Termin hinter sich gebracht hatte, und sie sah ihn vor dem Personalmenschen sitzen, bemüht, seine Aufregung zu verbergen. Wie immer wusste er bestimmt nicht, was er mit seinen Händen anfangen sollte. Spreizte sie auf seinen Knien und legte sie dann auf den Tisch, neben den Lebenslauf, danach erneut auf die Knie, um unter der Tischplatte die ständige Bewegung der Finger zu verstecken. Sie rief ihn vor dem Bewerbungsgespräch nicht an und auch nicht, als sie unterwegs war, um die Mädchen abzuholen. Sein Wagen stand nicht auf dem Parkplatz, weshalb sie sich sicher war, dass er noch nicht zurück sei, aber im Fahrstuhl, der sie in den siebten Stock beförderte, roch sie sein Aftershave. Und die Wohnungstür war nicht abgeschlossen, wie sie es hätte sein müssen. Als sie im Schlafzimmer war, hörte sie das Wasser rauschen. Harry lag auf dem Fußboden in einer Pfütze aus Urin und hob seinen Schädel nicht zu ihr. Und Cobys Handtäschchen, das er immer zu den Bewerbungsgesprächen mitnahm, lag achtlos hingeworfen neben ihm. Das war kein gutes Zeichen.
Es war drei Uhr, und sie war sich sicher gewesen, Coby würde nicht zu Hause sein.
Noy schaltete im Wohnzimmer den Fernseher an, und Mali machte den Mädchen Mittagessen. Als die Nudeln weich wurden, rauschte im Badezimmer das Wasser immer noch. Sie klopfte an die Tür und fragte Coby, ob er mit ihnen essen wolle, und er verneinte aus der Badewanne. Sie fingen ohne ihn an, weil die Mädchen Hunger hatten, und während des Essens hörten sie Coby aus dem Bad kommen und die Tür zum Schlafzimmer schließen. Daniela und Noy sagten kein Wort, aber Mali stand auf und ging hinüber. »Ist alles in Ordnung?«, fragte sie und war sich sicher, er sei wach, obwohl er mit geschlossenen Augen auf dem Bett lag.
Sie kannte seine Stimmungsumschwünge und hatte sich seit dem Morgen darauf eingestellt, dass es auch heute geschehen würde, und sei es unbewusst. War er bei dem Bewerbungsgespräch gefragt worden, warum er zuletzt so viele Arbeitsplätze gewechselt hatte, und hatte sich, anstatt die Wahrheit zu sagen, um eine Antwort gedrückt? Sie hatte ihn gedrängt zu sagen, es sei ihre Schuld, und wusste, das würde er nicht tun.
Coby öffnete die Augen nicht, obwohl sie ein, zwei Minuten lang dort stand. Über dem Bett hing noch das große Foto von ihrer zweiten Schwangerschaft, mit Daniela, wie eine bittere Reminiszenz oder wie ein Denkmal für sie beide. Sie fragte: »Bist du dir sicher, dass du nicht erzählen willst, wie es war?«
Am Nachmittag prasselten Hagelschauer gegen die Fenster, und danach herrschte Stille in der Wohnung.
Mali machte, während Daniela fernsah, mit Noy Mathematik-Hausaufgaben. Und Coby kam um fünf mit der Tasche für die Boxstunden aus dem Schlafzimmer, sagte, er fahre zum Training, und fragte, wo die Schlüssel seien. Sie erkundigte sich, was mit seinem Wagen los sei, und ob er gestern kein Training gehabt habe, bekam aber keine Antwort. Auch als sie ihn daran erinnerte, dass sie am Abend ausgehen wollten, sagte Coby kein Wort, und als sie fragte: »Wozu hast du vor dem Training geduscht?«, sah er sie an, als hätte sie etwas Schreckliches gesagt.
Den ganzen Nachmittag über bis zum Abend war sie angespannt und kontrollierte mindestens zweimal, ob sie die Tür hinter ihm abgeschlossen hatte; spähte durch die Sonnenblenden im Wohnzimmer nach draußen, um zu sehen, ob Coby schon zurück war. Als sie den eingepackten Regenschirm auf ihr Bett legte, damit er ihn dort erwartete, sah sie sich abermals auf dem großen Foto und wusste noch immer nicht, ob sie ihm am Abend von der Schwangerschaft erzählen würde, wie sie es geplant hatte. Sie hatte gezögert, ehe sie damals eingewilligt hatte, sich fotografieren zu lassen, aber Coby hatte sie gedrängt, hatte gesagt, wenn sie sich nicht fotografieren ließen, würde sie es hinterher bereuen, weil es doch ihre letzte Schwangerschaft sein sollte. Und mit den Jahren hatte sie gelernt, die riesige Schwarzweißaufnahme nicht mehr zu hassen, die ihren dunklen, langen Körper zur Schau stellte und den kugelrund vorstehenden Bauch, den Coby so gern streichelte, auch in der Öffentlichkeit, und den sie während der Schwangerschaft zuweilen auch berührt hatte, wenn sie allein gewesen war. Die Idee, Gäste würden sie so sehen, hatte ihr nicht behagt, vielleicht hatte sie sich vor allem vor ihrem Vater geschämt, Coby jedoch hatte ausgerechnet das gefallen. Auf dem Bild war sie von der Seite zu sehen, ihr Körper ein wenig gegen ihn geneigt, der hinter ihr stand, weshalb der Größenunterschied zwischen ihnen nicht zu erkennen war. Beide waren sie nackt. Seine Hände verbargen und offenbarten gleichzeitig ihre Brüste. Nach Eilat hatte sie das Bild abnehmen wollen, aber Coby hatte gebeten, gerade darum sollten sie es hängen lassen, und mitunter gab es Augenblicke, da dachte sie, er habe recht gehabt, weil das Foto ihr manchmal sie selbst zurückbrachte.
Der Regen setzte gegen Abend wieder ein. Sein Prasseln gegen die Fenster und auf das Dach steigerte die Unruhe noch. Nur die Mädchen waren ruhig, als merkten sie, dass sie ihre Hilfe brauchte. Die meiste Zeit beschäftigten sie sich selbst im Wohnzimmer und in ihrem Zimmer, ohne nach ihr zu rufen. Erst um halb sieben meinte Daniela, sie sei hungrig, und Noy fiel ein, dass Mali ihr versprochen hatte, sie würden Kostüme für Purim anprobieren. Sie holte die Verkleidungskiste aus dem Schrank im Schlafzimmer, und Noy zog das Prinzessinnenkleid an, das sie ihr vor zwei Jahren gekauft hatten, aber es war zu klein geworden. Und Daniela weigerte sich, es anzuprobieren, und sagte, dieses Jahr werde sie sich nicht verkleiden. Mali bestand darauf, dass sie es trotzdem versuchte, weil das Kleid ein Vermögen gekostet hatte, und sie hoffte, in diesem Jahr nur ein Kostüm und nicht zwei kaufen zu müssen. Doch als sie es vor dem Spiegel vor Danielas kleinen Körper hielt, begegnete sie darin sich selbst und wandte sofort die Augen ab.
Es gab eigentlich keinen Grund, dass all das jetzt wieder hochkam, außer, vielleicht, die Schwangerschaft und die Angst vor Cobys Stimmung.
Sein Boxtraining dauerte immer zwischen einer und anderthalb Stunden, weshalb sie dachte, er würde zum Abendessen wieder da sein, und ihn um Viertel nach sieben anrief, damit er unterwegs noch Pitabrote und Eier besorgte, aber sein Mobiltelefon war abgeschaltet. Sie versuchte es noch ein paarmal, und am Ende aßen sie ohne ihn. Um halb neun waren die Mädchen im Bett. Als die Tochter der Nachbarn zum Babysitten heraufkam, sagte Mali ihr, sie würden doch nicht ausgehen, weil sie leichtes Fieber bekommen habe. Danach rief sie ihn erneut an, und diesmal war das Gerät nicht abgeschaltet, aber Coby ging nicht ran. Als sie aufs Dach stieg, um zu sehen, ob man noch Wäsche aufhängen konnte, standen schwere Regenwolken am Himmel, und Windstöße ließen die Solarwarmwassertanks wackeln, sodass sie beschloss, erst einmal nichts aufzuhängen, und stattdessen mit ihrer Schwester Gila und mit Aviva telefonierte. Und als sie gefragt wurde, ob sie nicht ausgehen wollten, um zu feiern, erklärte sie, sie hätten keinen Babysitter für die Mädchen gefunden.
Coby war erst gegen elf zu Hause, ohne Erklärung und ohne sich zu entschuldigen.
An ihrem zehnten Hochzeitstag, ein Jahr zuvor, war alles anders gewesen.
Sie hatten, zum ersten Mal überhaupt seit Eilat, die Mädchen bei ihren Eltern gelassen und waren für zwei Nächte in ein B&B auf die Golanhöhen gefahren. Coby hatte gerade begonnen, für eine Firma zu arbeiten, die Baustellen entlang der Grünen Linie sicherte, und war bester Stimmung. Eigentlich hatten sie vorgehabt zu wandern, wie sie es gemacht hatten, bevor die Mädchen geboren wurden, einen ganzen Tag einem der Bachläufe zu folgen und einen weiteren Tag im Chule-Naturschutzgebiet zu verbringen, aber das Wetter war miserabel, und sie verließen das Zimmer so gut wie nicht. Schauten Filme auf DVD und schliefen zum ersten Mal seit etlichen Wochen miteinander. Redeten stundenlang vor dem Kamin. Am Abend saßen sie in Decken eingehüllt auf der Veranda, und Coby sprach von der Reise auf die Farm seines Vaters im Sommer und vom Kauf einer Wohnung, jetzt, da sie wieder zwei Gehälter hätten. Als sie die Mädchen anriefen, um ihnen gute Nacht zu sagen, hatte sie gemeint, sie seien dabei, wieder ein normales Paar zu werden.
All das war im letzten Winter gewesen, und seither hatte sich das Leben erneut zum Schlechten gewandelt.
Im Sommer war Coby entlassen worden, weil sein Vorgesetzter bei der Sicherheitsfirma, der zehn Jahre jünger war als er, ihn schikaniert hatte. Er war sich sicher gewesen, einen anderen Job zu finden, aber nach ein paar Wochen erfolgloser Suche hatte sie gespürt, wie er resignierte, mit niemandem mehr sprach, sie, die Mädchen und seine Freunde mied und kaum noch ausging. Immer schweigsamer wurde. Anfing, zum Boxtraining zu gehen, zwei-, manchmal dreimal die Woche, und mit verquollenem Gesicht und Blutergüssen an Bauch und Beinen nach Hause kam, um gleich unter die Dusche zu verschwinden und dann schlafen zu gehen. Auch das Notsignal, das sie an ihm kannte, seit sie sich begegnet waren, trat wieder auf: Wenn er meinte, niemand beachte ihn, überdehnte er den Hals nach hinten und holte in heftigen Zügen Luft, als sei er dabei zu ersticken.
Mali dachte, er würde, als er in jener Nacht vom Training zurück war, ohne ein Wort zu sagen ins Bett kommen – aber er überraschte sie. Er schaltete den Fernseher an und setzte sich im Wohnzimmer aufs Sofa. Sie sagte: »Wir hätten eigentlich heute Abend ausgehen sollen, oder?« Im Fernsehen lief ein Reality-Programm von der Art, die Coby verabscheute, aber er bestand darauf, die Sendung nicht abzuschalten.
»Coby, bist du okay? Du redest nicht mit mir, seit du von dem Bewerbungsgespräch zurück bist.«
Er starrte weiter auf den Bildschirm, sagte aber: »Tut mir leid, Mali. Ich kann jetzt nicht reden.«
»Du kannst mir nicht erzählen, wie es war?«
Er wollte nicht. Sagte nur: »Aus dem Job wird nichts.« Und als sie ihn fragte: »Woher weißt du das? Haben sie es dir gleich gesagt?«, nickte er.
Und sie wusste nicht einmal, wo das Gespräch stattgefunden hatte und bei welcher Firma. Nach den Kündigungen hatte er beschlossen, sich nicht mehr auf Jobs in der Sicherheitsbranche zu bewerben, und sie hatte ihn bestärkt, aber in den letzten Wochen hatte er komplett aufgehört zu suchen, weshalb sie sich freute, als er ihr erzählte, er habe ein Vorstellungsgespräch, und nicht einmal fragte, wo. Und vielleicht schaute sie ihn in jener Nacht tatsächlich nicht genug an, denn hätte sie ihn aufmerksam betrachtet, hätte sie auf seinem Gesicht nicht nur die Resignation gesehen.
Harry lag zu seinen Füßen, nach Urin und Verwesung stinkend.
»Ich hab ihn nicht abgebraust, weil ich Angst hatte, er würde sich auf dem Dach verkühlen«, sagte sie, und Coby fuhr fort, auf den Bildschirm zu starren.
»Wann bringst du ihn weg? Man kann ihn nicht weiter so leiden lassen.«
»Vielleicht morgen.«
»Die Mädchen können ihn nicht mehr sehen. Sie nähern sich ihm nicht mehr. Als wäre er schon tot.«
Hätte es einen anderen Weg geben, ihn zu erreichen, den sie nicht fand? Sie hätte ihm von der Schwangerschaft erzählen können, wie sie es vorgehabt hatte, aber sie wollte darüber nicht sprechen.
»Ich hab heute mit Aviva gesprochen. Sie sagt, es kann sein, dass ihr Bruder etwas für dich hat. Erinnerst du dich an Ami? Er hat angefangen, E-Bikes zu importieren.«
Coby sagte: »Ich suche keinen Job mehr«, und sie verstummte.
Im Fernsehen begann wenig später die Nachtausgabe des Nachrichtenmagazins, und an die erinnerte sie sich hinterher genau.
Häuser und Straßen im ganzen Land standen unter Wasser, besonders in Haifa und Umgebung, und es hatte auch Stromausfälle und Überschwemmungen gegeben. Coby stand vom Sofa auf und ließ sich auf dem Lederschemel dicht vor der Mattscheibe nieder, als störte ihn ihre Gegenwart neben ihm, und auch sie stand auf und ging, gekränkt. Als sie ins Wohnzimmer zurückkam, sah er sich eine andere Nachrichtensendung an, im Ersten. Auf dem Bildschirm waren zwei Mitglieder einer Rettungswagenbesatzung zu sehen, die eine Trage schoben, auf der eine mit einem Tuch abgedeckte Leiche lag.
Coby sog Luft ein, als fiele ihm das Atmen schwer, weil er nicht bemerkte, dass sie sich ihm von hinten näherte. Der abgedeckte Leichnam wurde in den Krankenwagen verfrachtet, neben dem zwei in Regenmäntel gehüllte Polizisten standen. Mali meinte, die Umgebung zu erkennen.
»War das hier?«, fragte sie und fügte, als er nichts erwiderte, hinzu: »War das in Cholon?« Er sagte: »Ja, auf der anderen Seite.«
»Und haben sie gesagt, wer das ist?«
Der Bericht war schon fast zu Ende, und sie hatte nicht mitbekommen, ob der Mörder gefasst war, verstand aber, dass unter dem Laken eine Frau lag.
»Kannst du das ausmachen? Das macht mir Angst, und ich möchte, dass wir reden«, sagte sie leise und berührte seine Schulter. Sie gab nicht nach in jener Nacht, weil sie in solchen Momenten nicht aufstecken durfte. Sie kam mit dem Regenschirm, der verpackt in dem silbernen Geschenkpapier noch immer auf ihrem Bett gelegen hatte, aus dem Schlafzimmer zurück und sagte: »Hast du nicht gesehen, was ich dir gekauft habe?«
Aber der Regenschirm machte ihm keine Freude. Im Gegenteil. Als er das Geschenkpapier aufgerissen hatte, stierte er ihn verstört an, und erst viele Tage danach verstand sie, dass es einen Grund dafür gab.
»Für den, den du verloren hast. Er war nicht so teuer, wie er aussieht.«
Coby legte den Regenschirm auf den Fußboden, ohne ihr zu danken, und ausgerechnet das war es, was ihr den Rest gab. »Willst du unbedingt, dass wir so unseren Hochzeitstag feiern?«, fragte sie, und als er aufstand, schrie sie ihn fast an: »Coby, hörst du mich? Hörst du, dass ich mit dir rede? Hier ist Mali, aus deiner Klasse. Der Krieg hat begonnen.« Er drehte sich zu ihr um, seine Augen flackerten, und spätestens da hätte sie begreifen müssen, dass etwas passiert war.
Beide waren sie ungefähr fünfzehn. Und das Jahr war 1991. Im Januar, mehr als zehn Jahre, bevor sie heiraten würden.
Es war ihr erstes Gespräch oder zumindest das erste, an das sie sich erinnerten, und manchmal, vor allem, wenn sie Streit hatten, verwendete sie es, um ihn aus seinem Schweigen zu locken. Ihr Vater hatte sie nachts um zwei geweckt und ihr gesagt, Bush sei dabei, Bagdad zu bombardieren, worauf sie sich schnell angezogen, ihn angerufen und gesagt hatte: »Coby? Guten Morgen, hier ist Mali aus deiner Klasse. Der Krieg hat begonnen.« Und er hatte mit verschlafener Stimme und dem fremden Akzent, den er damals noch hatte, geantwortet: »Mitten im Schlaf?«
In den letzten Jahren hatte sie immer wieder versucht, sich ihn und sich selbst in jenem Alter vorzustellen, was ihr, ohne sich die alten Bilder anzusehen, nicht gelungen war. Coby war damals hagerer und sein Körper weich gewesen, der eines Jungen. Sein Rücken und seine Brust, die sie stundenlang streicheln konnte, waren hell und glatt. Sie wusste in jener Nacht nichts über ihn, außer dass er allein und ohne seine Eltern aus einer Stadt namens Perth gekommen war und in Cholon bei Verwandten seiner Mutter wohnte. Er spielte ausgezeichnet Basketball und war vom Englischunterricht freigestellt, weil er viel besser Englisch sprach als die Lehrerin und sie zum Gelächter der Schüler korrigierte, bis sie ihn bat, nicht mehr zum Unterricht zu erscheinen. Es gab Gerüchte, seine Mutter hätte sich in Australien das Leben genommen, und später fand sie heraus, dass nichts von dem zutraf. Die meisten Jungen in ihrem Alter fürchteten sich vor dem Schlacks, der mit seinen blauen Augen, den Jeans und Nike-Turnschuhen, die damals noch keiner hatte, aus Perth gekommen war, und erfanden Geschichten über ihn. Am ersten Tag in der Klasse, als er sich vorstellte, sagte er, er sei nach Israel gekommen, um sich zum Dienst in der Spezialeinheit des Generalstabs zu melden.
Ihr Kennenlernen kam vollkommen zufällig zustande. Eine Kapriole des Schicksals oder des Glücks, genau wie alles, was danach geschah. Mali hätte niemals gedacht, er könnte sich für sie interessieren, weil niemand sich für sie interessierte. Sie war zu dünn und zu lang und fiel weder im Unterricht noch auf Partys auf. Sie war zwar Schulmeisterin im Kurz- und Langstreckenlauf, aber das war nichts, was ihr die Aufmerksamkeit der Jungs eingetragen hätte. Doch ihr Familienname lautete Ben-Asher, und Bengtson war der nächste Name auf der Telefonliste der Klasse, weshalb sie ihn, gesetzt den Fall, ein Krieg brach aus, anrufen sollte. Und drei Stunden nach jenem Telefonat, morgens um halb sechs, waren ihr Vater und sie in dem alten Subaru-Pick-up da, um ihn ins Wolfson-Hospital nach Tel Aviv mitzunehmen. Er wartete vor dem Haus auf sie, einen Discman in der Hand und die Ohren unter silbernen Kopfhörern verborgen. Mali schämte sich für den Wagen, dessen Polsterung den Geruch von Abwasserrohren verströmte, und vielleicht ihr Vater auch, der kaum Englisch sprach und dennoch versuchte, sich unterwegs mit ihnen zu unterhalten. »Was macht ihr dort?«, fragte er, und als sie ihm erklärten, sie würden die Opfer der chemischen Raketen, die Saddam Hussein auf den Ballungsraum Tel Aviv niedergehen lassen würde, aus dicken Schläuchen mit Wasser abspülen, bat ihr Vater Coby, er solle auf sie achtgeben.
Das war ihre erste Begegnung, und wer hätte damals ahnen können, dass sie Jahre später nebeneinander unter dem Traubaldachin stehen würden? Eine Woche danach war Coby zu ihnen nach Hause gekommen, und sie hatte vor Aufregung und Verlegenheit keinen klaren Gedanken fassen können. Ihr Vater war verspätet aus der Synagoge zurückgekommen, und während sie auf ihn warteten, versuchte auch ihre Mutter, in holprigem Englisch mit Coby zu reden. Gila nahm damals bereits vor dem gemeinsamen Sabbatessen Reißaus, was eine Erlösung war, denn Mali hatte keinen Zweifel, wären sie sich begegnet, hätte Coby sich in ihre Zwillingsschwester verliebt, die bereits ein Jahr zuvor von zu Hause ausgezogen war und längst ihr eigenes Geld mit Kellnern verdiente. Später, als sie endlich allein in ihrem Zimmer waren, ertönte Raketenalarm, und sie mussten alle in den mit Folien hermetisch abgeklebten Schutzraum, der das kleine Schlafzimmer ihrer Eltern war, wo sie sich zu Tode schämte, weil die Unterhosen ihres Vaters achtlos auf den Boden geworfen herumlagen.
Auch das erste Mal, dass sie miteinander schliefen, war an einem Sabbat, einige Monate später.
Ihre Eltern waren mit ihrem kleinen Bruder zu Verwandten nach Tiberias gefahren, und sie lud Coby ein, bei ihr zu schlafen, obwohl ihr Vater das nicht erlaubt hatte, weil sie so sehr wollte, dass sie es endlich taten, und es keinen anderen Ort gab. Gila war im Nebenraum, und Mali gab keinen Laut von sich, weil sie wusste, ihre Zwillingsschwester lauschte durch die Wand. Und tatsächlich erwartete sie Mali, als diese aus dem Zimmer kam, um sich die Beine abzuduschen, noch immer ganz benommen von dem, was geschehen war.
Sie wartete noch eine Weile im Schlafzimmer auf Coby, aber er kam nicht. Dennoch gelang es ihr, für einen Moment den Schlacks mit den Kopfhörern zu sehen, der im Dunkeln auf der Straße auf sie und ihren Vater gewartet hatte, die Hände in den Taschen vergraben. Und vielleicht unternahm sie deshalb um ein Uhr nachts einen letzten Versuch. Sie stieg aufs Dach und fand ihn dort auf dem weißen Plastikstuhl sitzend, bei empfindlicher Kälte und absoluter Dunkelheit, reglos. Was durchaus eine Gelegenheit gewesen wäre, ihm von der Schwangerschaft zu erzählen, aber sie ließ es. Etwas Erloschenes und Wildes in seinem Blick und auch dieses Sitzen in der Finsternis machten ihr Angst. Sie streichelte seinen Kopf und seine Brust durch das Poloshirt, das er trug. Flüsterte: »Coby, lass mich nicht allein. Bitte.« Und gab ihm auch alle Signale, dass, wenn er ins Bett käme, sie miteinander schlafen würden. An seinem Hals war eine tiefe Schramme, aber er kam immer mit Blessuren vom Boxtraining.
Spürte sie vielleicht trotz allem etwas?
Als sie durch den Abstellraum auf dem Dach kam, sah sie die Pistole und erinnerte sich, dass die am Nachmittag noch nicht dort gelegen hatte. Und als sie versuchte einzuschlafen und die Hand auf ihren Bauch legte, tauchte in ihr plötzlich das Gesicht des jungen Mädchens auf, das ihr im Einkaufszentrum den Regenschirm verkauft hatte, nur um sogleich von der abgedeckten Leiche abgelöst zu werden, die sie im Fernsehen gesehen hatte, als die auf einer Trage in den Rettungswagen geschoben wurde. Verstört riss sie die Augen auf. Das nächste Bild war das, das sie mit aller Macht zu vergessen suchte: Die schwere Hand kam aus der Finsternis auf sie zu und drückte ihr die Kehle zu.
2
Er erkannte die Leiche sofort, verlor im ersten Moment aber kein Wort darüber, weil Personen in der Wohnung waren, die von dieser Tatsache nichts wissen mussten, und auch wegen der Stille.
Zwei Mann einer Rettungswagenbesatzung standen in der Küche und warteten auf Anweisungen, und ein Streifenbeamter stand am Eingang zur Wohnung. Und jeder, der umherging oder sprach, tat dies wie auf Zehenspitzen und flüsternd, als wollte er die Frau nicht wecken, die auf dem Teppich im Wohnzimmer lag. Einer der Rettungssanitäter deutete auf sie, als Avraham eintrat, aber da hatte er sie bereits bemerkt. Näherte sich ihr vorsichtig, bückte sich. Sie lag auf dem Rücken, die Knie angewinkelt, und nur ihr rechtes Auge war geöffnet. Auf dem Teppich unter ihr lugten farbenfrohe Vögelchen hervor.
Und vielleicht auch wegen des Schocks, den er beim Anblick der Leiche empfand, sagte er in den ersten Minuten niemandem, dass er wusste, wer sie war. Seit er zum Leiter des Ermittlungsdezernats im Ayalon-Distrikt ernannt worden war, hatte er gewusst, sein erster Mordfall würde irgendwann kommen, und ausgerechnet als es dann so weit war, war er sich nicht sicher, bereit dafür zu sein.
Am Vorabend hatte es in den Nachrichten geheißen, der Sturm werde in den Morgenstunden einsetzen, und als er aufwachte, waren schwere Regengüsse am Fenster zu hören. Er rief auf dem Revier an und teilte Lital Levi, der für die Ermittlungen zuständigen Disponentin, mit, er werde einen Tag freinehmen. Er hätte an dem Tag ohnehin nur im Hauptquartier der Polizeikräfte in Jerusalem an einer Fortbildungsmaßnahme zu Internetkriminalität teilnehmen sollen. Dann machte er schwarzen Kaffee für sie beide und brachte ihn ans Bett. Den ganzen Morgen über blieben sie unter der Decke und sahen sich auf dem Laptop vier Folgen der Serie »Die Brücke« an.
Avrahams Augen fielen immer wieder zu.
Sein Vater kam ins Zimmer, legte ihm die Hand auf die Stirn und bestimmte, er könne im Bett bleiben und müsse nicht zur Schule. Als die Wohnungstür hinter seinen Eltern ins Schloss fiel, breitete sich eine wohlige Wärme in seinem Körper aus, weil er begriff, er war ganz allein zu Hause. Sie würden nicht vor dem Abend zurück sein, und er hätte Zeit, in der Wohnung herumzulaufen, als wäre es allein seine. Und sich ein gigantisches Frühstück zu machen. Marianka stieß ihn sanft an, sobald sie an seinen Atemzügen hörte, dass er schlief, und jedes Mal, wenn er die Augen aufschlug, hatten die Ermittler eine weitere Leiche entdeckt. Er fragte: »Was? Hatten sie schon wieder einen Mord?«
Er hatte keine Chance, vor der eigenbrötlerischen schwedischen Kommissarin Saga Norén herauszufinden, wer der Mörder war, was ihn aber nicht weiter störte.
Mittags nahmen sie den Wagen und fuhren nach Tel Aviv.
Avraham hüllte sich in seinen unförmigen blauen Steppparka, den er das letzte Mal beim Betriebsausflug des Distrikts zum Berg Hermon im Winter 2007 getragen hatte, und Marianka trug den Wollmantel, den sie aus Brüssel mitgebracht hatte. Sie stellten den Wagen auf einem fast leeren Parkplatz am Strand ab und nutzten eine Regenpause, um auf einer nassen Bank mit Blick aufs Meer zu sitzen, das sich vor ihnen tosend an den Felsen brach. Außer einem arabischen Paar mit Baby war niemand auf der Strandpromenade unterwegs. Und Avrahams Telefon klingelte nicht.
Die meisten Polizisten im Distrikt waren bestimmt damit beschäftigt, Straßen, die wegen des Regens blockiert waren, freizubekommen oder überschwemmte Häuser räumen zu lassen oder sich um Verkehrsunfälle zu kümmern. Genau das hatte er während seiner ersten Jahre bei der Polizei an solchen Tagen auch gemacht. Jetzt aber war er Leiter des Ermittlungsdezernats, dank der Aufklärung eines brutalen Überfalls, der sich nicht weit von der Stelle, wo sie jetzt auf der Strandpromenade saßen, ereignet hatte, und dank zweier Kinder, die er vor dem Tod bewahrt hatte, und es war kaum anzunehmen, dass man ihn bitten würde, bei strömendem Regen an einer Kreuzung zu stehen und anstelle der ausgefallenen Ampel den Verkehr zu regeln. Als der Regen wieder einsetzte, stellten sie sich am Dolphinarium unter und aßen danach Reis und Bohnensuppe in einem Restaurant auf dem Markt. Und Marianka redete nicht sehnsüchtig von den Wintern in Koper oder in Brüssel.
Als sein Telefon kurz nach halb fünf zum ersten Mal klingelte, ging er nicht ran, und erst beim dritten Mal fiel ihm ein, es könnte vielleicht dringend sein. Da er nicht erwartet hatte, dass es das sein würde, was er zu hören bekam, erinnerte er sich hinterher nicht mehr, mit welchen Worten genau Lital Levi ihm mitteilte, was geschehen war. Hatte sie gesagt, es sei Mord? Oder nur, dass die Leiche einer Frau in ihrer Wohnung gefunden worden sei? Einen Namen auf jeden Fall erwähnte sie nicht am Telefon, denn hätte sie den Namen genannt, hätte sich Avraham sofort an die Frau erinnert und wäre nicht wie vor den Kopf gestoßen gewesen, als er ihr Gesicht am Tatort entdeckte. »Wer ist dort?«, fragte er, und Lital Levi sagte: »Niemand. Nur die Kollegen von der Streife, die den Tatort gesichert haben. Die Spurensicherung ist unterwegs, aber die Situation auf den Straßen ist chaotisch, und die werden einige Zeit brauchen. Könnten Sie trotz allem kommen?«
»Ich brauche eine halbe Stunde. Und wenn Maalul oder Schärfstein aus Jerusalem zurück sind, schicken Sie auch einen von den beiden hin.«
Erst als er das Telefonat beendet hatte, fiel ihm ein, dass sie ihm gar keine Adresse genannt hatte. Diesmal rief er sie an, aber die Leitung war besetzt.
Marianka schlug vor, sie sollten gleich zum Tatort fahren, sie würde von dort mit dem Taxi weiterfahren, aber er bestand darauf, sie nach Hause zu bringen. Zügig und schweigend fuhren sie nach Cholon, und als sie das Stadtzentrum erreicht hatten, wirkte alles zugleich real und surreal auf ihn, wie immer bei einem Sturm. Äste waren auf Fußwege gestürzt, und auf den Straßen hatten sich Seenlandschaften gebildet, in denen die Lichter des frühen Abends vexierten, als hätte sich Cholon in Amsterdam oder Venedig verwandelt, und mit einem Mal fiel Avraham ein, dass der erste Roman, den er über Inspektor Jules Maigret gelesen hatte, von Anfang bis Ende während eines Sturms spielte, und dass die Kleidung des massigen Inspektors das ganze Buch über triefnass gewesen war. War es ein Mordfall gewesen? Und wie ermittelte man überhaupt beim Tod eines Menschen? Er erinnerte sich nicht, wie der Fall ausgegangen war, wusste aber noch, dass er das Buch mit neunzehn gelesen hatte, an einem Sabbat, als er während des Ermittlerlehrgangs in der Armee am Standort geblieben war. In der Sokolov-Straße gingen die Leute gegen den Wind ankämpfend nach vorne gebeugt, und Avraham steuerte einen Wagen, dessen Windschutzscheibe beschlagen war, als durchquerten sie eine Nebelwolke, und für einen Moment war ihm, als läge er noch immer im Bett und sähe sich selbst in einer Fernsehserie. Ein Oberinspektor auf dem Weg zu seinem ersten Mordfall. Was ihn da schon störte, war, dass die Leiche in einer der friedlicheren Gegenden von Cholon gefunden worden war. Einbrüche und Autodiebstähle mochte es dort geben, aber so gut wie keine Gewaltverbrechen. Und am schlimmsten war, dass Lital Levi niemanden erwähnt hatte, der auf frischer Tat gefasst worden war, oder einen Verdächtigen, der das Weite gesucht hatte.
Vor der Krausestraße 38 standen zwei leere Streifenwagen und ein Rettungswagen, und auf dem Gehweg drängten sich hinter den Absperrbändern Schaulustige. In dem Haus an der Straßenecke wurde renoviert, und auch vor dem angrenzenden Gebäude stand ein Bauschuttcontainer. Avraham blieb einen Moment vor der Eingangstür stehen, wartete, dass man ihm öffnete, und drückte dann einfach die Klinke. Er hatte Zeit, sich auf das vorzubereiten, was er dort sehen würde, denn die Wohnung lag im obersten Stockwerk, und im Haus gab es keinen Fahrstuhl.
Die Frau, die auf dem Teppich lag, hieß Lea Jäger.
Ihr rechtes Auge, das weit aufgerissene, war grün und ausdruckslos.
Avraham suchte in den Taschen des Steppparkas nach seinem Notizblock, weil er erste Kommentare zu dem, was er sah, hätte aufschreiben sollen, aber der Block war nicht da. Stattdessen fand er eine Quittung über zwei Kaffee und ein Vollkornsandwich, die er 2007 am Imbiss auf dem Hermon erstanden hatte. Was aber nicht weiter wichtig war, da er, auch ohne sich etwas aufzuschreiben, alles im Kopf behalten würde. Und da er der einzige Ermittler am Tatort war, konnte es durchaus sein, dass er die ersten Ermittlungsschritte nicht alle in der richtigen Reihenfolge durchführte, aber er ließ nichts aus. Er bat alle, bis auf den Rettungssanitäter, der ihren Tod festgestellt hatte, und einen der Streifenbeamten, die Wohnung zu verlassen. Straßensperren in der näheren Umgebung zu errichten, ergab in dieser Phase keinen Sinn mehr, da seit dem Mord schon einige Zeit vergangen war, und auch, weil es niemanden zu suchen gab. Avraham zog seinen Parka aus und legte ihn zusammengefaltet neben der Tür ab. Seine Schuhe steckten in Plastiküberziehern und an den Händen trug er dünne Latexhandschuhe. Niemand durfte sich dem Wohnzimmer nähern, bis die Techniker von der Spurensicherung da waren, und bis dahin sah er alles. Sah die Druckmale der Finger an ihrem Hals, die geröteten oberen Ränder der Ohren und die geschwollene Zunge, die ihr aus dem Mund hing. Sie lag auf dem Teppich, zwischen blauen und roten Vögeln, deren Namen er nicht kannte und die zum Teil den Schnabel aufgesperrt hatten, als versuchten sie, Hilfe herbeizurufen. Seine Augen flohen von der Leiche und wurden von einer halbvollen Kaffeetasse und einem Tablett mit Schokoladenwaffelröllchen auf dem Tisch in der Küche angezogen. Und dann von den Autoschlüsseln, die in einer Schale auf der Anrichte lagen. Der Fernseher lief ohne Ton. Und es bestand kein Zweifel, das Wohnzimmer war der Tatort: Ein Bild, auf dem zwei Frauen inmitten eines gelben Feldes saßen, war von der Wand gefallen, offenbar während des Kampfs mit dem Mörder, und daneben, auf dem Teppich, war eine Stehlampe zu Bruch gegangen. Der Streifenbeamte, der in der Wohnung geblieben war, ein Polizist, dessen Gesicht Avraham wiedererkannte, dessen Namen er aber nicht parat hatte, meinte: »Ein Glück, dass es nicht zu einem Brand gekommen ist.« Worauf Avraham einfiel, dass er ihn gar nicht gefragt hatte, wer genau Lea Jäger gefunden hatte. Und erst da erfuhr er, dass sich ihre Tochter im Schlafzimmer aufhielt.
»Sie ist hier? Allein?«
»Nein, nicht allein. Eine Kollegin ist bei ihr und jemand vom Roten Davidstern.«
Früher wäre Avraham in solchen Situationen auf die Straße gegangen und hätte eine Zigarette geraucht, um nachzudenken, Zeit zu gewinnen und vielleicht auch Ilana Liss anzurufen, aber er hatte zu Beginn des Winters aufgehört zu rauchen, weil Marianka ihn gedrängt hatte und sein vierzigster Geburtstag vor der Tür stand. Nur ab und zu versuchte er, sich die Pfeife anzustecken, die sie ihm in Brüssel gekauft hatte, aber die Pfeife lag in seinem Büro. Und Ilana Liss anzurufen war nicht möglich. Also kehrte er zurück in die Küche, fand dort ein Blatt Papier und einen Stift und notierte sich trotz allem ein paar Angaben, die der Rettungssanitäter gemacht hatte, zum Tathergang, der ihm klar war, weil er es selbst gesehen hatte: Lea Jäger sei durch Erwürgen zu Tode gekommen, nach einem Kampf.
Ihre Körpertemperatur belegte, dass sie vor etwa zwei oder drei Stunden noch am Leben gewesen war.
Ihre Hände waren geschlossen, und er hoffte, wenn sie sie in der Pathologie öffneten, würde sich zwischen ihren Fingern mehr finden als nur Verletzungen, die ihre Fingernägel in den Handinnenflächen hinterlassen hatten, als sich ihre Hände verkrampften, oder Hautpartikel, die sie beim Versuch, sich aus den Händen, die sie erwürgten, zu befreien, vom eigenen Hals gekratzt hatte. Das war seine große Hoffnung in diesen Stunden. Landete man so nicht immer beim Mörder? Durch eine systematische Entschlüsselung der am Tatort hinterlassenen Spuren, genau wie bei einem Einbruch oder einem Überfall mit Körperverletzung? Doch obgleich er diese Gedanken für sich formulierte, dachte er da schon, dass etwas mit dem Tatort nicht stimmte. Vielleicht war er zu sauber? Als hätte jemand nach dem Mord aufgeräumt? Oder davor? Die Frage, die ihn auf dem Weg zum Tatort im Wagen begleitet hatte, ließ ihm keine Ruhe, aber diese Frage schrieb er nicht auf: Weißt du überhaupt, wie du ihren Tod ermitteln sollst?
Um sechs rief er Maalul an, um zu klären, wann er denn da wäre, und als Maalul sagte, der Bus stecke vor Modi’in wegen eines Unfalls zweier Lastwagen auf der Schnellstraße 443 fest, blieb ihm keine andere Wahl, als ins Schlafzimmer zu gehen und selbst die Erstbefragung der Tochter durchzuführen. Sie saß auf dem Bett. Er trug einen Stuhl ins Zimmer und nahm vor ihr Platz, sehr dicht vor ihr, weil der Raum so klein war. Die Freiwillige vom Roten Davidstern wurde gebeten, das Zimmer zu verlassen, aber die Streifenbeamtin, die sie Orit nannte, blieb und hielt während des ganzen Gesprächs ihre Hand.
Avraham schickte ein »Mein aufrichtiges Beileid« vorweg, stellte sich dann vor und fragte: »Können Sie mir erzählen, wie das passiert ist.« Und bedauerte sofort die unbeholfene Formulierung, obschon sie verstand, was er meinte.
»Sie sollte die Kleine aus dem Kindergarten abholen«, sagte sie. »Heute ist ihr fester Tag, weil ich für nachmittags keine Betreuung habe.«
»Wann hat sie sie abgeholt?«
»Der Kindergarten macht um halb vier zu. Aber sie hat sie nicht abgeholt. Sie ist nicht gekommen.«
Orit Jägers Augen waren grün, wie die Augen ihrer Mutter. Am nächsten Tag sollte er erfahren, dass sie dreiunddreißig Jahre alt war, geschieden und Mutter einer Tochter, aber während der Befragung dachte er, sie sei älter, Anfang vierzig mindestens. »Wie haben Sie erfahren, dass sie nicht gekommen ist?«, fragte er, und sie sagte: »Sie haben angerufen, dass die Kleine noch da ist. Daraufhin habe ich sie auf dem Handy und zu Hause angerufen, doch sie ist nicht rangegangen. Ich dachte, sie steckt irgendwo im Regen fest.«
»Und wann haben Sie zuvor mit ihr gesprochen?«
»So gegen eins.«
»Und sie hat nicht gesagt, sie werde nicht kommen? Wissen Sie, ob sie während des Telefonats hier in der Wohnung war?«
Sie nickte. Bekräftigte dann: »Ich glaube, ja.«
»War jemand bei ihr, als Sie mit ihr telefoniert haben?«
»Wer soll denn bei ihr gewesen sein?«
»Ich weiß nicht.«
»Es war niemand da.«
»Und klang sie für Sie normal? Wie sonst auch?«
»Ja. Hätte ich angenommen, etwas ist nicht in Ordnung, wäre ich …«
Sie stockte, und Avraham machte nicht gleich weiter, sondern ließ ein paar Sekunden verstreichen, ehe er mit seiner Befragung fortfuhr, damit sie nicht in Tränen ausbrach.
»Und wann genau sind Sie hergekommen, um zu überprüfen, was los ist?«
»Ich musste ja zurück zur Arbeit und wollte sie nach dem Kindergarten hierlassen. Von drinnen haben wir den Fernseher gehört.«
»Arbeiten Sie hier in der Nähe?«
»In einer Boutique in der Sokolov.«
»Und wo ist der Kindergarten?«
»In der Weizman.«
Er erklärte ihr, er stelle diese Fragen, weil er versuche zu verstehen, wann genau die Leiche gefunden worden sei.
»Ich war um Viertel nach vier hier. Und habe gleich die Polizei angerufen.«
»Und erinnern Sie sich, ob die Tür geschlossen war oder offen stand?«
»Die war geschlossen. Aber ich habe mit dem Schlüssel aufgeschlossen.«
Sie brach in Tränen aus, weil sie offenbar in ihrer Vorstellung den Moment sah, in dem die Tür aufgeschwungen war. Und daher wartete er diesmal nicht ab, sondern fragte umgehend: »Orit, als Sie die Tür geöffnet haben, haben Sie darauf geachtet, ob sie abgeschlossen war?« Sie zögerte, meinte dann: »Ich erinnere mich an gar nichts. Ich glaube, ich habe den Schlüssel umgedreht.«
»Und Sie sind sich sicher, dass in der Wohnung niemand außer Ihrer Mutter war?«
Sie krümmte sich zu der Polizistin, die neben ihr saß, und beantwortete seine Frage nicht. Er hätte die Befragung später fortsetzen sollen, auf dem Revier, beherrschte sich aber nicht und fragte: »Wo ist die Kleine jetzt?« Und ausgerechnet da antwortete sie ihm. »Sie hat alles gesehen. Hat gesagt: ›Warum liegt Oma auf dem Boden?‹, hat aber alles verstanden. Ich habe sie zurückgeschoben und die Tür zugemacht, aber sie hat es gesehen.«
Es war zehn nach sieben, und unten, vor dem Hauseingang, warteten bereits zwei Fernsehteams. Noch immer war Avraham der einzige Ermittler am Tatort. Alle Räume bis auf das Wohnzimmer waren ordentlich aufgeräumt, und nirgends waren Spuren eines Einbruchs oder einer Durchsuchung zu sehen. Dennoch fragte er, ob es in der Wohnung einen Tresor gebe oder ob Lea Jäger größere Geldbeträge dort aufbewahrt habe, und ihre Tochter sagte, davon sei ihr nichts bekannt. Er hatte ihr noch nicht gesagt, dass er wusste, was ihrer Mutter vor zwei oder drei Jahren widerfahren war, aber weshalb erwähnte sie dies im gesamten Verlauf ihres Gesprächs nicht ein einziges Mal? Lediglich die Handtasche war nirgendwo zu finden: weder im Schlafzimmer noch in der Küche oder im Wohnzimmer. Und wie Avraham vermutet hatte, fehlten auch die Wohnungsschlüssel, denn diese steckten weder im Schloss der Eingangstür, noch lagen sie in der Schale im Wohnzimmer, neben den Autoschlüsseln. Während der Unterredung im Schlafzimmer hatte er sich bereits auf seinem Zettel notiert: Hat hinter sich die Tür abgeschlossen? Er dehnte die Befragung aus, stellte ihr Fragen, die er teilweise schon zuvor gefragt hatte, nur weil er sie nicht allein lassen wollte. Und obgleich er nicht wusste, was genau, hatte er da schon das Gefühl, außer der Handtasche und den Schlüsseln sei noch etwas aus der Wohnung mitgenommen worden. Plötzlich erinnerte er sich, dass Lea Jäger auch einen Sohn gehabt hatte, worauf er sie fragte: »Sie sind nicht die einzige Tochter, richtig?« Sie nickte und fragte: »Haben Sie meinen Bruder schon benachrichtigt?«