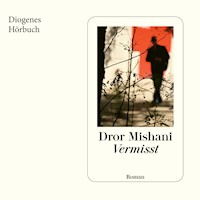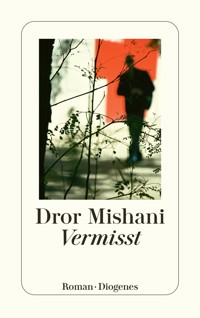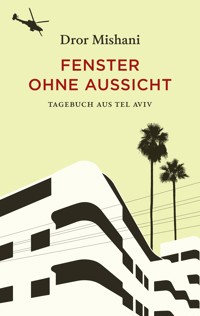
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Mit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ist auch für den Schriftsteller Dror Mishani mit einem Schlag alles anders. Zwischen Luftalarm, Diskussionen mit den Teenagerkindern am Küchentisch, Freiwilligenarbeit auf Salatfeldern und dem Versuch, auch in Kriegszeiten Alltag zu leben und zu schreiben, hält Dror Mishani fest, wie der Gaza-Krieg die israelische Gesellschaft und seine Familie verändert – und hält daran fest, dass das Leid auf beiden Seiten aufhören muss.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Dror Mishani
Fenster ohne Aussicht
Tagebuch aus Tel Aviv
Aus dem Hebräischen von Markus Lemke
Diogenes
TEIL ISchock und Mobilisierung
(7.10.–14.10.2023)
La grande guerre a commencé. Samstag, sechs Uhr morgens. Ich wache im Hotel in Toulouse auf und sehe, es ist eine Nachricht von Martha gekommen: »Guten Morgen. Hier geht’s drunter und drüber, aber so richtig.« In diesem Moment, ehe wir telefonieren, bin ich sicher, bei uns zu Hause ist irgendetwas passiert. Etwas, das nur uns betrifft. Vielleicht ist die Waschmaschine schon wieder kaputt und hat die Wohnung unter Wasser gesetzt. Vielleicht ist eines der Kinder krank. Als ich Martha anrufe, erzählt sie mir, sie seien vom Luftalarm geweckt worden und säßen jetzt im Schutzraum. Aus Gaza kämen sehr viele Raketen.
In Toulouse ist es noch dunkel. Ich stehe langsam auf, putze die Zähne. Noch habe ich den Plan nicht abgeschrieben, zu einer morgendlichen Joggingrunde am Ufer der Garonne aufzubrechen, vor einem langen Tag und unzähligen Lesungen und Veranstaltungen auf dem Krimifestival, das der Grund meiner Reise ist. Aus Gaza werden immer mal wieder Raketen auf Tel Aviv abgefeuert, bestimmt alle paar Monate. Und meine Frau Martha ist es, obwohl nicht Israelin, schon gewohnt, mit den Kindern in den Luftschutzraum zu gehen. Außerdem gibt es noch den Iron Dome, der Tel Aviv schützt und die Raketen in aller Regel am Himmel abfängt.
Erst als ich den Computer anschalte und auf israelische Nachrichtenseiten gehe, fange ich an zu verstehen, dass diesmal etwas anderes los ist. Ein Video wird wieder und wieder ausgestrahlt, weil Fernsehsender und Nachrichtenportale noch kaum Informationen haben über das, was sich im Süden des Landes abspielt. In dem Video sieht man einen weißen Pick-up mit Hamas-Kämpfern, die Uniformen tragen, denen der israelischen Armee nicht unähnlich. Der Pick-up hält mitten in der Stadt Sderot, vor der Polizeistation, die Bewaffneten springen herunter und schießen in alle Richtungen. Niemand erwidert das Feuer. Ein Privatwagen gerät in die Straße und kommt neben dem Pick-up zum Stehen. Einer der Bewaffneten tritt zu dem Wagen und richtet den Fahrer hinter dem Steuer hin.
Nach und nach kursieren weitere Videos. Einige sind von Israelis aufgenommen, von Balkonen aus oder durch die Sonnenblenden vor den Fenstern ihrer Wohnungen, andere von den Terroristen selbst. Man sieht Männer in Uniform – teilweise auf weißen Pick-ups, teilweise auf Motorrädern oder zu Fuß –, die den Grenzzaun des Gazastreifens durchbrechen und ungehindert nach Israel eindringen. Sie tragen Maschinengewehre, Granatwerfer und Munitionsgurte. Laufen durch die Straßen israelischer Ortschaften – und schießen wahllos um sich.
Reporterinnen und Moderatoren in den Studios verstehen nicht, was gerade geschieht. Hunderte von Raketen gehen weiterhin überall im Land nieder. Wo ist die Armee? Gerüchte machen die Runde, Terroristen seien in Kibbuzim eingedrungen und hätten Armeestützpunkte unter ihre Kontrolle gebracht. Einwohner aus dem Süden rufen bei Fernsehsendern an, werden live zugeschaltet und berichten flüsternd, sie seien in Schutzräumen gefangen, hörten vor dem geschlossenen Fenster Stimmen auf Arabisch – und Schüsse. Erst im Nachhinein werden wir begreifen, dass wir Zeugen eines Massenmords an Zivilisten werden, live übertragen. »Kommt und holt uns hier raus«, ruft eine Frau weinend. »Warum kommen keine Soldaten, um uns zu retten?« Aus dem Schutzraum, in dem sie sich mit ihren Kindern versteckt hält, hört sie, wie Terroristen in ihr Haus eindringen, es durchsuchen, sich der Schutztür nähern, die Klinke niederdrücken und versuchen, die Tür aufzuschießen. Niemand kommt ihr zu Hilfe. Ich schicke eine kurze Nachricht an Marie-Caroline Aubert, meine Freundin und Lektorin beim französischen Verlag Gallimard, um sie zu warnen, dass ich meine Reise womöglich abkürzen muss. Schreibe: MERDE. LA GRANDE GUERRE A COMMENCÉ.
Zurück nach Hause? Um zehn, als ich beim Veranstaltungszelt des Literaturfestivals eintreffe, ist mir bereits klar, dass ich meinen Rückflug nach Tel Aviv, der übermorgen von Paris gehen soll, vorverlegen muss. Immer mehr Raketen fliegen in Richtung Tel Aviv, und Martha und die Kinder sind nach wie vor im Schutzraum. Ich habe ein schlechtes Gewissen – die Organisatoren des Festivals haben mein Flugticket und Hotel bezahlt, und jetzt bitte ich noch vor der ersten Lesung darum, früher abzureisen. Deshalb wohl bausche ich das Ausmaß der Attacke auf, als ich ihnen die Lage schildere. (Auf den französischen Nachrichtenseiten fangen sie gerade erst an, darüber zu berichten.)
Es habe Dutzende von Toten gegeben, man spreche bereits von unserem 9/11, und die Antwort der Armee werde nicht auf sich warten lassen und massiv ausfallen. Ein Krieg stehe unmittelbar bevor. Innerlich aber glaube ich noch gar nicht recht, was ich da erzähle. Auch wenn ich Marie-Caroline etwas vom »GROSSEN KRIEG« geschrieben habe. Ich habe das Gefühl, zu flunkern oder zu übertreiben, vielleicht, weil ich in jenen Stunden die Dimension des Mordens und den Abgrund der Katastrophe, in die es uns stürzen wird, nicht wahrhaben will. Vielleicht ist es trotz allem nur ein Anschlag mehr, auf den unsere Luftwaffe mit Bomben auf Ziele im Gazastreifen reagieren wird – und das war’s? Aber jedes Mal, wenn ich auf eine der israelischen Nachrichtenseiten gehe, stelle ich fest: Ich habe den Festival-Leuten nicht nur nichts vorgemacht, die Lage ist viel schlimmer, als ich sie ihnen – und mir selbst – geschildert habe. Die Raketen waren nur ein Ablenkungsmanöver, unterdessen dringen Terroristen weiter in Ortschaften und Städte im Süden des Landes ein und bringen wahllos Zivilisten um. Unweit der Grenze zum Gazastreifen hat ein großes Open-Air-Musikfestival stattgefunden, die Terroristen richten ein Massaker unter den Scharen von Feiernden an, die versuchen, um ihr Leben zu fliehen. Die Armee ist noch immer nicht auf der Bildfläche erschienen, es sind vor allem Polizisten oder Privatpersonen, die gegen die Hamas-Männer kämpfen, mit Pistolen oder Messern oder auch nur mit bloßen Händen.
Ich sitze derweil noch immer am Stadtrand von Toulouse in einem Veranstaltungszelt, hinter einem Tisch, auf dem meine Bücher in Stapeln liegen. Signiere sie für Leserinnen und Leser, die eines davon kaufen, antworte freimütig jedem, der mit mir über Kriminalliteratur sprechen möchte. Alle paar Minuten verdrücke ich mich in die Raucherecke, um die Nachrichten zu checken und zu erfahren, ob die Organisatoren des Festivals einen früheren Flug nach Tel Aviv für mich gefunden haben. Sie buchen Flüge bei jeder nur möglichen Airline. Und alle werden innerhalb kürzester Zeit annulliert.
Als ich S. anrufe, eine gute Freundin, um zu hören, wie es ihr geht, erzählt sie mir, sie sei verzweifelt auf der Suche nach Flugtickets, um mit ihrer Familie das Land zu verlassen, egal wohin, und dass es keine Tickets mehr gebe, alle seien innerhalb von Minuten ausverkauft gewesen. Zum ersten Mal denke ich, dass es vielleicht ein Fehler ist zurückzufliegen. Ich könnte ebenso gut in Frankreich bleiben, und Martha und die Kinder fliegen her. Oder sie könnten versuchen, Flugtickets nach London zu kriegen, und zu Marthas Eltern fahren, und ich würde dann den Zug nehmen und sie dort treffen. Wenn der Abgrund der Katastrophe, in den wir stürzen, so bodenlos ist, muss ich sie und die Kinder dann nicht dort herausholen?
Ich rufe Martha an und bitte sie, im Schlafzimmer mit mir zu reden, damit die Kinder unser Gespräch nicht mithören. Ich frage, wie es ihr geht. Sie und unsere Tochter Sarah kleben seit dem Morgen im Schutzraum vor dem Fernseher, und die Bilder seien grauenerregend. Sarah ist auch in den sozialen Netzwerken unterwegs und sieht dort offenbar veritable Horrorvideos. Sie halte vor Martha verborgen, was sie dort sieht: Menschen, die live und vor laufender Kamera hingerichtet werden. Leichen, die in Brand gesteckt werden. Es heißt, es gäbe auch Videoaufnahmen von brutalsten Vergewaltigungen.
»Willst du mit den Kindern hierherkommen?«, frage ich und hoffe, sie nicht zu sehr in Panik zu versetzen.
»Meinst du, wir sollten?«
»Ich weiß nicht.«
Ich weiß es nicht. Was ich befürchte, will ich nicht aussprechen. Danach rufe ich meinen Bruder Ariel an. Er war in einer Kampfeinheit, hat im Libanon gedient, danach seinen Reservedienst unter anderem beim Inlandsgeheimdienst SHABAK geleistet. Er ist der Mensch, mit dem ich mich beraten kann. Er hat zwei kleine Töchter und schwankt vielleicht auch, ob sie bleiben oder fliehen sollen.
»Wann kommst du zurück?«, fragt er.
»Übermorgen. Ich versuche, früher zu fliegen, aber im Moment wird ein Flug nach dem nächsten annulliert.«
»Und hast du dort einen Ort, wo du bleiben kannst?«
»Ich denke schon.«
»Dann komm erst mal nicht zurück«, bestimmt er.
Als ich gegen Abend wieder im Hotel bin, gibt es bereits Videos von Entführungsopfern. Eine junge Frau (später erfahre ich, sie heißt Noa) wird auf einem Motorrad nach Gaza verschleppt und streckt die Hand nach ihrem Freund aus, der auf einem anderen Motorrad entführt wird. Im Fernsehen wird geraunt, die Zahl der Todesopfer könnte in die Hunderte gehen, aber es herrscht allgemein große Ungewissheit. Jetzt, da das Ausmaß der Katastrophe sich allmählich abzeichnet, kommt es einem vor, als sollte es nicht an die Öffentlichkeit. In einem Teil der Kibbuzim und der Armeestützpunkte dauern die Kämpfe noch immer an, nach etlichen Stunden. In den Rucksäcken von gefassten oder getöteten Terroristen finden sich jede Menge Munition, Landkarten, aber auch Datteln, Proviant für einen langen Aufenthalt. Möglich, dass einige von ihnen ins Landesinnere vorgedrungen sind und planen, auch dort Städte anzugreifen, genauso denkbar, dass weitere Angriffe erfolgen werden, aus dem Libanon oder dem Gebiet der Westbank.
Ich rufe erneut Martha an. Frage, ob die Kinder gerade bei ihr sind. Als sie verneint, sage ich, falls die Terroristen es bis nach Tel Aviv schaffen, könne sie sich mit den Kindern in dem kleinen Abstellraum in der Tiefgarage unseres Gebäudes verstecken, wo wir Koffer und Kisten mit alten Spielsachen aufbewahren. Er lässt sich von innen verschließen und ist möglicherweise sicherer als der Schutzraum, dessen Tür nicht richtig zugeht. (Ich sage mir schon seit Monaten, dass ich sie mal reparieren müsste.) Und ich bitte sie, Sarah nicht in den Plan einzuweihen, um sie nicht unnötig in Panik zu versetzen, doch Martha sagt: »Sie hat schon vor dir daran gedacht. Hat mir vorhin gesagt, wenn sie kommen, würde sie sich im Wäschekeller verstecken, oder im Abstellraum, in einem der Koffer.«
Die Festival-Organisatoren informieren mich, es lasse sich noch immer kein Flug nach Tel Aviv finden. Fürs Erste bleibe ich hier in Toulouse.
(Überlegen, verstehen: Warum guckst du dir von all den Videos immer wieder das eine an, auf dem eine junge Mutter zu sehen ist, die auf einem Motorrad in den Gazastreifen verschleppt wird, mit ihren beiden kleinen Töchtern im Arm? Plötzlich lässt sie sich seitlich vom Motorrad fallen und flieht mit den Mädchen in Richtung Israel. Und niemand schießt auf sie. Auf einem anderen Motorrad wird ihr zwölfjähriger Sohn nach Gaza entführt, und er dreht sich um und sieht ihr nach, als sie sich immer weiter entfernt.)
Lässt sich ein Krieg vermeiden? Am nächsten Tag, wieder im Veranstaltungszelt in Toulouse, ist das Ausmaß der Katastrophe bereits allen klar: dem Organisationsteam, den anderen Autoren, den zahlreich erschienenen Leserinnen und Lesern, die an diesem Sonntagmorgen, vielleicht nach einem Café-Besuch oder nach dem Gottesdienst, gekommen sind, um Bücher zu kaufen und Autoren und Autorinnen zu lauschen, die über ihre Bücher sprechen. Alle sind liebenswürdig, einfühlsam, bedenken mich mit tröstenden Worten. Die Zahl derjenigen, die sich für meine Bücher interessieren, ist größer als am Vortag. Die Empathie der Menschen hat einen Effekt, den sie sicher nicht beabsichtigen. Sie verstärkt bei mir das Gefühl von Angst. Aus der Trauer und dem Bedauern in ihren Augen lese ich die Dimension des Unglücks. Ich nehme an zwei Panels über Detektivromane teil, habe aber das Gefühl, sie seien bedeutungslos, genauso wie meine Bücher, über die ich jetzt reden muss. Welchen Sinn hat es noch, einen ausgedachten Roman zu lesen über einen vom eigenen Vater ermordeten Sohn oder über eine Frau, die von ihrem Mann umgebracht wird, wenn an einem einzigen Morgen Hunderte von Männern, Frauen und Kindern in ihren Häusern oder auf ihrer Straße abgeschlachtet werden? »Ich habe angefangen, Kriminalromane zu schreiben, um die Wahrheit menschlicher Gewalt zu dokumentieren und den Versuch zu unternehmen, sie zu verstehen«, sage ich auf dem Podium. Aber was habe ich denn gewusst über das Böse und über Gewalt?
Als ich Martha aus der Raucherecke anrufe (ich rauche Zigaretten eigentlich immer nur zur Hälfte, aber seit gestern habe ich meine mir selbst zugestandene Tagesration schon weit überschritten), um ihr mitzuteilen, dass das Festival ein Ticket für einen früheren Flug für mich ergattert hat, erzählt mir Martha, dass ihre Eltern angerufen und ihr Vater angeboten habe, ihnen allen Flugtickets nach England zu kaufen. Es gäbe noch freie Plätze auf einem Flug, der in der Nacht von Tel Aviv nach Heathrow gehe. Marek, Marthas Vater, hat sich nie mit unserer Entscheidung damals vor zehn Jahren anfreunden können, Cambridge zu verlassen und in Israel zu leben. Möglicherweise zu Recht.
»Willst du fliegen?«
»Nein.«
»Bist du sicher?«
»Ja. Denkst du denn, das wird alles lange dauern?«
Diesmal spüre ich, ich muss ihr die Wahrheit sagen, was ich vom ersten Moment an empfunden und versucht habe zu verleugnen: Wir Israelis fühlen uns durch die Berichte in den Nachrichten an Schilderungen der osteuropäischen Pogrome erinnert. An Namen wie Chișinău und Kielce. Und die Bilder und Videosequenzen erinnern uns an die Schoah. Martha arbeitet in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, forscht dort über Transporte von Juden in die Vernichtungslager während des Krieges, und sie kennt die Traumata, die jetzt im Bewusstsein aller Israelis hochgespült werden, aber möglicherweise versteht sie nicht, was die Reaktion darauf sein wird. Sie ist nicht Jüdin, ist nicht hier aufgewachsen und erzogen worden. Kennt das Grauen nicht, das die israelische Seele bestimmt. »Ich fürchte, unsere Antwort wird eine Großoffensive sein. Dass wir in einen Krieg schlittern, aus dem wir so bald nicht wieder herauskommen.« Auf verschiedenen Fernsehkanälen hört man bereits Forderungen, Waffen an alle Bürger auszugeben, damit sie ihre Familien gegen Terroristen verteidigen können, es werden Rufe laut, Gaza dem Erdboden gleichzumachen und sowohl die Hisbollah als auch den Iran anzugreifen, die bestimmt verantwortlich sind für das Massaker. Man bereitet uns auf einen Krieg um unsere nackte Existenz vor.
Ich denke, ja, sage ich zu Martha. Das Ganze wird lange dauern. Wer weiß, wie lange. Und das ist erst der Anfang, es wird noch viele Tote geben, in Israel und in Gaza, vielleicht sogar im gesamten Nahen Osten. Noch verlange ich von mir selbst keine Erklärung für meine Entscheidung, in dieses Katastrophen- und Gefahrengebiet zurückzukehren und meine Kinder dortzulassen, noch akzeptiere ich dies als instinktiven Schritt, aber ich weiß, eines Tages werde ich mir selbst, und vielleicht auch ihnen, mein Verhalten erklären müssen.
Jean-Paul, der Leiter des Festivals, fährt mich früh am nächsten Morgen zum Flughafen in Toulouse. Es ist ein herbstlicher Morgen, kühl und regnerisch, wie ich sie liebe und es sie in Israel kaum gibt. Auf dieser Reise habe ich solche Morgen in Pau, am Fuß der Pyrenäen, und auch in Bayonne, am Ufer des Adour, erlebt. Ich liebe diese Reisen mit dem Zug durch Europa über alles – die kleinen Hotels am Fluss oder am Bahnhof, die Buchläden, in denen ich literarische Schätze finde, die Begegnungen mit Leserinnen und Lesern und die Gespräche über Literatur, als gäbe es nichts Wichtigeres, ja vielleicht nichts anderes auf der Welt. Wer weiß, wann es wieder eine solche Reise geben wird? Wann wir wieder über Literatur reden werden?
Aber vielleicht ist ein Krieg ja noch zu vermeiden? Vielleicht hat es keinen Sinn, mit weiterer Gewalt die Katastrophe verhindern zu wollen, die sich bereits ereignet hat? Vielleicht sollten wir, anstatt anzugreifen und zu töten und denjenigen wehzutun, die uns wehgetan haben, jetzt einfach nur unseren Schmerz verarbeiten, und dann darüber nachdenken, wie sich die nächste Katastrophe verhindern lässt? Im Flugzeug von Toulouse nach Paris Charles de Gaulle entwerfe ich im Kopf einen Artikel gegen eine Entscheidung für den Krieg. Die ersten Zeilen schreiben sich wie von selbst:
»Vielleicht sollten wir Gaza nicht ausradieren? Nicht durch eine Bodenoffensive und nicht einmal aus der Luft. Es nicht dem Erdboden gleichmachen, nicht zerstören, keine Rache üben? Vielleicht sollten wir die Härte des Schlags, den wir erlitten haben, anerkennen, das Ausmaß des Schmerzes, sollten die Niederlage eingestehen und nicht versuchen, sie umgehend durch einen vorgeblichen Sieg zu tilgen, der in Wahrheit nur eine Fortschreibung des Leids wäre, seine Übertragung an einen anderen Ort, nach Gaza mit seiner Bevölkerung – und damit nichts anderes als seine Perpetuierung? Denn klar ist, dieses Leid wird aus einem zerstörten und ausgehungerten Gaza gestärkt zu uns zurückkehren, in ein, zwei oder fünf Jahren.
Vielleicht sollten wir zunächst bloß die Gefangenen, die Entführten und die Leichname nach Hause bringen, unsere Angehörigen und Liebsten? Sollten die palästinensischen Häftlinge aus den Gefängnissen holen, sie in Bussen zur Grenze fahren und der Hamas anbieten, sie unverzüglich auszuhändigen – im Austausch gegen unsere dort festgehaltenen Eltern, Brüder, Schwestern und Kinder? Und auch danach – nicht reingehen, nicht in Schutt und Asche legen, nicht zerstören, nicht vernichten, sondern trauern, Shiv’a sitzen, Wunden verbinden und verbinden lassen. Und dann nachdenken. Zuerst einmal nachdenken.
Nachdenken nicht nur darüber, wie wir angreifen sollen oder den nächsten Angriff verhindern können, sondern darüber, wie wir hier mit unseren Nachbarn leben wollen, auch mit unseren derzeitigen Feinden – was nicht alle sind, das dürfen wir nie vergessen –, mit unseren Feinden, die vielleicht eines Tages, wenn sie sich eine würdigere Führung als die Hamas gewählt haben, und wir selbst uns eine würdigere Führung als die derzeitige gewählt haben, wieder zu unseren Nachbarn in Frieden werden können. Darüber nachdenken, ob Zerstörung und Tod als Reaktion auf Zerstörung und Tod tatsächlich der einzige gangbare Weg sind und ob dieser Weg bis jetzt irgendwelche Früchte getragen hat.«
Ich will das Schwert über euch bringen. Am Flughafen Charles de Gaulle warten in langen Schlangen Israelis, die nach Hause wollen, zurück in die Hölle. Viele von ihnen haben ihren Flug vorverlegt, und andere, die kein Ticket haben, bestürmen das Bodenpersonal, sie dennoch an Bord zu nehmen. Einige haben einen Mobilisierungsbefehl erhalten und sollen sich innerhalb von Stunden bei ihren Reserveeinheiten einfinden, Uniform und Waffe erhalten und in den Krieg ziehen.
Im Flugzeug treffe ich einen Freund, Schriftsteller und Drehbuchautor, der übers Wochenende nach Paris geflogen ist. Er hat einen wehrpflichtigen Sohn, und unmittelbar, bevor wir unsere Telefone abschalten, erhält er die Nachricht, sein Sohn sei in den Süden verlegt worden. Mein eigener Sohn Benjamin wird erst in drei Jahren Militärdienst leisten, aber da die Kriege, die jetzt mein Bewusstsein fluten, verheerend und lang sind (der Zweite Weltkrieg, der Krieg in der Ukraine), denke ich angsterfüllt, dass auch er – dieser introvertierte Junge mit dem weichen Oberlippenflaum, der gerne kocht und backt und dessen fünfzehnten Geburtstag wir vor nicht einmal einem Monat gefeiert haben, zu Hause, mit einem mehrgängigen Menü, das er selbst gekocht hat – noch in diesem Krieg wird kämpfen müssen.
Auf dem Nachtflug ist es ganz still. Niemand schläft, aber Gespräche finden kaum statt. Wir alle sind von einem wohlvertrauten Ort aufgebrochen und wissen nicht, wie er sich bei unserer Rückkehr präsentieren wird. Ich versuche, einen Roman zu lesen, den ich auf dem Festival gekauft habe, schaffe es aber nicht. Er erzählt eine ausgedachte Geschichte über einen fiktiven Menschen, und die Sätze haben kein Gewicht, lösen sich in der dunklen Flugzeugkabine förmlich auf. Ich erinnere mich, dass ich Mitte September – vor Jom Kippur und damit lange vor dem Beginn dieses Krieges – wieder einmal im Buch Ezechiel gelesen habe, und spüre, das ist es, was ich jetzt lesen muss, die zornigen Weissagungen des Propheten, von dem Gott verlangt, das Unheil am eigenen Leib zu erfahren. Ich öffne die Heilige Schrift auf meinem iPad, und im Unterschied zu den Sätzen des Romans schwellen die Verse in mir an, dröhnen wie Luftschutzsirenen:
»Du Menschenkind, richte dein Angesicht gegen die Berge Israels und weissage gegen sie und sprich: Ihr Berge Israels, höret das Wort Gottes des HERRN! So spricht Gott der HERR zu den Bergen und Hügeln, zu den Gründen und Tälern: Siehe, ich will das Schwert über euch bringen und eure Opferhöhen zerstören, dass eure Altäre verwüstet und eure Rauchopfersäulen zerbrochen werden, und will eure Erschlagenen vor eure Götzen werfen; ja, ich will die Leichname der Israeliten vor ihre Götzen hinwerfen und will eure Gebeine um eure Altäre her verstreuen. Überall, wo ihr wohnt, sollen die Städte verwüstet und die Opferhöhen zur Einöde werden; denn man wird eure Altäre wüst und zur Einöde machen und eure Götzen zerbrechen und zunichtemachen und eure Rauchopfersäulen zerschlagen und eure Machwerke vertilgen. Und Erschlagene sollen mitten unter euch daliegen, und ihr sollt erfahren, dass ich der HERR bin.«
Der Flughafen, an dem wir ankommen, ist verwaist, als wären wir nach der Zerstörung gelandet, die der Prophet vorhergesagt hat, den Gott dann zwingt, die Schriftrolle mit seinen eigenen Prophezeiungen zu verspeisen. Menschenleer sind auch die Straßen. Aber bei uns zu Hause, morgens um vier, herrscht zärtliches, unsagbar teures Leben: Martha und Sarah sind wach und warten auf mich. Wenigstens geht es ihnen gut – und wir sind wieder vereint. Martha flüstert mir zu: »Gut, dass du wieder da bist. Sarah hat seit dem Schabbat kein Auge zugemacht. Vielleicht kann sie jetzt einschlafen.«
Benjamin dagegen schläft tief und fest, den Schlaf eines Heranwachsenden, und wacht nicht auf, als ich die Tür seines Zimmers öffne. Auf seinem Fernseher läuft ein Sportkanal.
Auch die Häuser, die noch stehen, werden zerstört werden. Am nächsten Morgen, Dienstag, drei Tage nach dem Massaker und dem Beginn des Kriegs in Gaza, sind die Straßen in Tel Aviv wie ausgestorben, und das nicht nur, weil die meisten Männer eingezogen sind. Die Schulen sind geschlossen und Kinder und Mütter zu Hause. Auch die meisten Geschäfte und Cafés sind zu. Nur die öffentlichen Luftschutzbunker, von denen es in unserem Viertel viele und geräumige gibt, sind geöffnet, obwohl die meisten Wohnungen eigene Schutzräume haben.