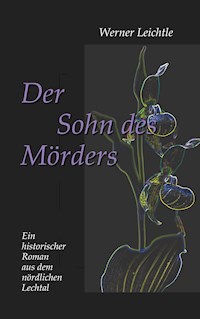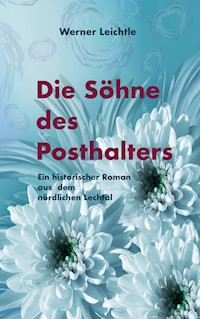
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der historische Roman nimmt uns mit auf die Reise nach Augsburg und München um 1859. Wieder steht im Mittelpunkt die Familie des Posthalters Dietrich mit seinen zwei Söhnen: Michael, dem leiblichen Sohn, und Johannes, dem Adoptivsohn, dessen Vater die Ehefrau erdrosselte und dafür hingerichtet wurde. Die beiden Brüder gehen völlig unterschiedliche Wege. Johannes erlebt in seinem Medizinstudium epochale Umbrüche in der Medizin wie die Lebensverlängerung durch die Hygiene. Er wird ein erfolgreicher Arzt. Nach einer Vorstellung im damals so beliebten Menschenzoo begegnet er einem Leichendieb, gerät mit diesem in einen Streit, der ihn und seine Familie nicht mehr loslässt. Michael dagegen kehrt nach einem Aufenthalt im fernen Brasilien und einem schweren Schicksalsschlag gebrochen zu seiner Familie zurück, die er Hals über Kopf verlassen hatte. Aber auch der so hochgeachtete Posthalter, mit besten Verbindungen zur Familie von Schaezler, trägt eine schwere Bürde mit sich. Ein Geheimnis, von dem niemand etwas ahnt und das erst nach seinem Tod offenkundig wird. Diese Enthüllung führt die Familie geradewegs in eine Katastrophe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine Enkel:
Elias, Niklas, Sophie, Charlotte, Constantin, Theresa, Leon und Ben.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Epilog
Kapitel 1
Der Koffer im Speicher hat mir keine Ruhe gelassen. Immer wieder habe ich ihn hervorgeholt und darin herumgesucht. Ich weiß nicht, wonach ich gesucht habe. Mir war langweilig, da meine Frau mit den Kindern zur Oma gefahren waren. Ursprünglich wollte ich eine Bergwanderung unternehmen, aber andauernde Regengüsse verhinderten dieses Vorhaben. Ich hätte auch die Buchführung in unserem bescheidenen Elektroladen auf Vordermann bringen können. Wie schon einige Male vorher fehlte erneut die Lust dazu. Lieber durchstöberte ich auf dem Dachboden diesen alten Koffer und schwelgte in früheren Zeiten.
Stets fand ich etwas Neues, konnte es aber nicht so recht einordnen. Was hatte das mit meiner Familie zu tun? Wie von magischer Hand kam mir ein ums andere Mal ein Zeitungsartikel unter die Augen, vergilbt und ausgefranst; ich konnte nicht erkennen, welche Zeitung ich in Händen hielt. Aber das Datum war gerade noch zu lesen: 3. März 1857, ein Datum, auf das ich mir im ersten Moment keinen Reim machen konnte. Da stand:
«Verwerfliche Machenschaften beunruhigen unsere Stadt: Düstere Gestalten stehlen frisch Verstorbene von den Gottesäckern. Wöchentlich erreichten uns Leserbriefe, die über Leichenraub von verschiedenen Friedhöfen der Stadt klagen. Alle fragen, wie lange die aufrechten Bürger in Augsburg derartigen Frevel noch dulden müssen. Und was noch alles geschehen muss, damit die Regierung mit starker Hand gegen die Frevler vorgeht. Da müssen härtere Strafen her.»
Wir sprachen mit einem Zeugen, seinen Bericht drucken wir in voller Länge, damit sie sich selbst ein Bild von diesen untragbaren Zuständen machen können. Er führt uns allen eindringlich vor Augen, wie beunruhigt die rechtschaffenen Bürger sind. Diese verwerflichen Umtriebe der Unholde bedrohen die Sicherheit der gesamten Bevölkerung:
«Es war am 9. Februar. Es schneite heftig, und die Straßen waren mit einer dicken Schneeschicht bedeckt. Der kreischende Lärm von den Kutschenrädern, der ansonsten die Nachtruhe stört, wurde von dem frischen, weichen Schnee erstickt. Eine unheimliche Ruhe hatte sich bei uns in den Gassen am mittleren Lech ausgebreitet. Wir machten es uns, wie alle rechtschaffenen Bürger in unserer Stadt, am wärmenden Ofen gemütlich, um den wohlverdienten Feierabend zu genießen. Plötzlich hörten wir ein Gefluche. Hinter der Barfüßerkirche, direkt unterhalb meines Stubenfensters, versuchten zwei vermummte Männer ungleichen Alters mit aller Kraft, einen Handkarren auf dem schmalen Weg zu halten. Ständig kamen die Räder ins Rutschen und drohten in den reißenden Bach abzudriften. Mit allergrößter Mühe schafften sie es, dass ihre Fracht nicht Opfer des mittleren Lechs wurde.»
«Pass auf, du Depp», herrschte der Jüngere seinen betagten Kumpanen an. Ich schätzte ihn auf 20 Lenze. Aber er sah mit seinen langen, zotteligen und ungepflegten Haaren um einige Jahre älter und zudem mit seiner Boxerfigur bedrohlich aus. Kommentarlos machte der in die Jahre gekommene Helfer eine Verbeugung vor dem Stärkeren und stemmte sich mit aller Kraft, die ihm verblieben war, gegen den Karren. Beide waren mit sich und ihrem Gefährt so beschäftigt, dass sie einen Herrn der besseren Gesellschaft mit seinen zwei Begleiterinnen nicht zu bemerken schienen. Der Herr war mit einem Zylinder und dickem Gehrock mit pelzbesetztem Kragen bekleidet, auf jeden Fall ein ehrbarer Bürger unserer Stadt. Und arm war er auch nicht. Einen solch wertvollen Gehstock mit silbernem Knauf kann sich nicht jeder leisten.
Ich öffnete leise das Fenster und konnte jetzt sogar hören, was draußen gesprochen wurde. Die Frauen blieben auf Geheiß ihres Begleiters stehen. Er schien argwöhnisch geworden zu sein. Er sprach leise, fast flüsterte er, ich konnte es gerade noch verstehen:
«Was treiben diese zwielichtigen Gestalten bei diesem abscheulichen Wetter? Das sind gefährliche Burschen. Die haben sicher Diebesgut geladen. Als anständiger Bürger muss man das unterbinden. Ich kümmere mich darum. Ihr haltet bitte Abstand und versteckt euch an einem geschützten Platz. Man weiß nie, was die alles im Schilde führen. Da gilt es aufzupassen.»
Er näherte sich forschen Schritts dem merkwürdigen Fuhrwerk. Ich hätte mich das nie getraut! Ich war froh, das Drama hinter schützenden Mauern beobachten zu können. Sofort versuchte der Herr, das Laken zu heben, das über die rätselhafte Fracht gebreitet war, und fragte, was sie geladen hätten. Die beiden Halunken bauten sich bedrohlich vor dem Fremden auf. Sie schienen für einen Moment ihre Zwistigkeit vergessen zu haben. Als Antwort auf die harmlose Frage nach ihrer geladenen Ware schlug der Jüngere und Kräftigere ohne Vorwarnung zu und traf seinen Widerpart an der Brust und im Gesicht. Der Herr taumelte ein wenig zurück, Blut tropfte aus der Nase. Aber er gab nicht auf. Jetzt schrie er:
«Was habt ihr da geladen? Hundspack! Schaut aus, als hättet ihr eine Leiche auf eurer Karre. Habt ihr die gestohlen?»
«Kümmre dich um deinen eigenen Mist und zieh Leine, hast du kapiert? Schleich dich, du Wichtigtuer!»
Mir wurde ganz Angst und Bange um diesen ehrbaren Herren. Der war aber nicht gewillt, einem solchen Befehl nachzukommen. Recht und Ordnung schienen ihm äußerst wichtig zu sein. Im Nachhinein muss ich sagen: Hätte er diese Aufforderung nur befolgt, es wäre ihm eine Menge Ungemach erspart geblieben. Aber er öffnete unbeirrt und ungeachtet der Warnungen das Bündel. Weit kam er nicht. Er hob einen Zipfel des Tuchs von seinem rätselhaften Inhalt hoch und sogar ich konnte den Schädel einer Leiche sehen. Da donnerten auch schon die Fäuste des Halunken unerbittlich auf ihn nieder. Sein teurer Zylinder fiel in den Schnee. Er wich einen Schritt zurück, hob ihn behutsam auf, klopfte den Schnee ab und herrschte die beiden an:
«Was fällt euch ein, einen ehrbaren Bürger ...!», weiter kam er nicht. Die Faust des Diebs traf mitten in sein Gesicht. Erneut landete der Zylinder im tiefen Schnee. Es drohte ein Desaster.
Doch das Glück war auf seiner Seite. Von der Gastwirtschaft «Grauer Adler» machte sich gerade in diesem Moment eine Männerrunde auf den Heimweg. An der Ecke zum Schleiffergässchen befanden sich die Männer nur wenige Schritte von der Rauferei entfernt. Angetrunken und launige Lieder singend, schwankten sie von einer Seite zur anderen. Sie konnten von Glück reden, dass keiner vom Weg abkam und in den mittleren Lech stürzte. Es wäre unweigerlich sein Ende gewesen, denn zu schwimmen vermochten die Männer sicher nicht mehr. Ungeachtet ihres Zustandes erkannten sie die gefährliche Lage des vornehmen Herren und warfen sich dazwischen. Der jüngere Leichendieb ließ sich aber keineswegs von der Übermacht seiner Gegner beirren. Er schien es gewöhnt, der Stärkere zu sein. Mit seiner Brutalität hätte er wohl jeden eingeschüchtert, der sich ihm in den Weg stellte. Jetzt vermutete er gewiss, dass es ja nur angetrunkene, von Grund auf biedere Handwerker und Fabrikarbeiter waren. Seine Fäuste trommelten weiterhin unerbittlich auf seinen Widersacher. Doch die Männer der bierseligen Runde waren nicht nur in der Überzahl, sie schienen gar nicht so harmlos, wie der Leichenschänder es sich vorgestellt haben mag. Auch sie waren kräftige Burschen, die mitten im Leben standen. Und sie schienen sich für Recht und Ordnung einzusetzen. Ohne zu zögern, griffen sie in das Geschehen ein.
Sie zwangen den nun völlig außer sich geratenen Dieb zu Boden und hielten ihn fest, bis zwei Gendarmen erschienen. Die kamen sicher vom Metzgplatz. Das ist hier die nächste Polizeiwache. Vermutlich hatte einer aus der geselligen Runde doch polizeiliche Hilfe herbeigeholt. Die Gendarmen legten den Burschen in Handschellen. Jetzt merkte ich, dass sich der ältere der Leichendiebe klammheimlich aus dem Staub gemacht hatte. Er war nirgends mehr zu sehen.
Als der jüngere der beiden Halunken gefesselt war, kamen auch die zwei Frauen aus ihrem sicheren Versteck auf die Straße. Die eine stieß einen schrillen Schrei aus, als sie das Gesicht des vornehmen Herren erblickte. Soweit ich es bei der Dunkelheit beurteilen konnte, war sein Gesicht voller Blut. Der Verletzte hatte alle Hände damit zu tun, mit seinem Schnupftuch das Blut abzuhalten, das den wertvollen Gehrock zu besudeln drohte.
Die andere Frau begann sogleich, seine Verletzungen mit Hilfe ihres Halstuchs zu behandeln, und auch die Erste half ihr nun ohne zögern. Dass sie nicht zum ersten Mal Wunden versorgten, erkannte ich sogar von meinem Fenster aus. Schließlich konnten sie mit ihrem Begleiter den restlichen Weg in Richtung Hunoldsgraben fortsetzen. Sie mussten sich ein wenig beugen, damit er sich auf ihren Schultern abstützen konnte. Ich hörte noch, wie die Ältere von beiden meinte: «Gottlob sind wir zu zweit, alleine hätte ich das alles nicht geschafft.»
Kaum hatten sie sich in Bewegung gesetzt, brüllte der wilde Bursche in Richtung der drei, trotz Fesseln und Bewachung durch die Gesetzeshüter «Dich finde ich! Keine Sekunde wirst du vor mir sicher sein. Zermalmen werde ich dich! Du bist schlimmer als eine Pestbeule! Und deine Begleiterin merke ich mir auch. Die hört noch von mir!»
Ganz genau weiß ich den Wortlaut nicht mehr, es war eher noch unflätiger. Man getraut sich ja solche Worte kaum in den Mund zu nehmen. So jung und schon dermaßen verkommen. Wohin soll das noch führen?»
Die Gendarmen hatten gewaltige Probleme mit dem Dieb. Er versuchte fortwährend, sich loszureißen. Auf dem Weg zur Polizeistation trafen sie gottlob auf einen Kollegen. Als der mit Stockschlägen drohte, sollte sich der aufmüpfige Unhold nicht der Staatsgewalt fügen, wurde es leichter. Angst schien der verwegene Leichendieb aber nicht zu kennen. Bestimmt hatte sein Kumpan den Chef benachrichtigt und dieser würde ihn dann innerhalb kürzester Zeit aus dem Knast freikaufen. Über diese unhaltbaren Zustände werden wir in einem gesonderten Artikel berichten.
Am nächsten Tag fand sich der Herr mit dem Gehstock auf der Gendarmerie ein. Seine Blessuren waren fachgerecht verbunden. Zu seiner Überraschung musste er erfahren, dass der Dieb auf höhere Weisung freigelassen wurde. Darüber war der feine Herr so sehr entrüstet, dass er um ein Haar vergessen hätte, die bei der Verhaftung ausgestoßenen Drohungen des Ganoven anzuzeigen. Wie viele andere Betroffene zuvor vermutete er aber, dass da höchste Kreise ihre Finger im Spiel hatten oder dass der Halunke von irgendeinem Gauner freigekauft wurde.
Am mittleren Lech bereitete sich wieder eine friedliche Stille aus. Der ununterbrochen fallende Schnee überdeckte alle Schandtaten. Vom Karren samt der Leiche gab es nicht eine Spur. Aus zuverlässiger Quelle erfuhren wir, dass sich der mächtige Anführer der beiden Diebe den Wagen mit der Leiche geschnappt hatte, nachdem die Gendarmen mit dem Verhafteten abgezogen waren.
Durch die schnelle Freilassung des Verbrechers, was wir übrigens schon öfter beklagt hatten, besaß bald ein Mediziner rechtzeitig seine bestellte Ware. Wie leider allzu häufig konnte er in seinem geheimen Zimmer neben dem Praxisraum die Leichenöffnung vornehmen, die er zur Vertiefung seiner Anatomiekenntnisse zu benötigen glaubte. Er wusste, dass Leichenöffnungen verboten waren und mit hohen Strafen belegt wurden. Dies schreckt aber nur die wenigsten Ärzte ab.
Die Patienten bemerken natürlich den Gestank, der sich danach im ganzen Haus verbreitet. Sie wissen aber nichts von einem geheimen Zimmer in der Praxis und schon gar nicht, dass der Arzt - und nicht nur er - diese Leichenuntersuchungen mit bloßen Händen durchführt. Auch nicht, dass er sie anschließend ungewaschen, mit Leichenresten an Händen und Kleidung, behandeln würde. Sie wären nie und nimmer hier aufgetaucht. Kein Mensch will beim Arzt mit Leichengift angesteckt werden. Denn eine danach nötige Krankenbehandlung wäre für Patienten eine teure Angelegenheit geworden.
Solche Ärzte sind es, die nicht nur Verbotenes tun, sondern auch die Halunken anstiften. Darüber hinaus gefährden sie ihre Patienten mit schwerer Krankheit.»
Kapitel 2
Den überraschend freigelassenen Halunken kannten die meisten im Milieu unter dem Namen Bepperl. Der hatte mit seinen 20 Lenzen schon eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Viele Menschen erinnerten sich noch genau an diese Zeit und an den Umbruch in Augsburg im Jahr 1846.
Die Stadt hatte durch die Industrialisierung erheblichen Zustrom von der Landbevölkerung erhalten. Darunter befand sich eine große Anzahl Frauen, die nun in den Fabriken Arbeit finden konnte. Wohnten im Jahr 1830 noch 29.000 Augsburger in der Stadt, waren es 20 Jahre später schon 51.000. Diese verlangten nach ausreichender Nahrung. So schossen an jeder Ecke Läden und Gastwirtschaften aus dem Boden, die dann händeringend Personal suchten.
Bepperl wusste diesen Umbruch für sich zu nutzen. Die Familie seiner Cousine hatte ihn aufgenommen, nachdem er nach dem Tod der Mutter eine Bleibe gesucht hatte. Sie besaß eine Kneipe im Lechviertel. Jetzt beabsichtigte die Cousine und ihr Mann, mit einer kleinen Metzgerei ihr Auskommen zu verbessern. Eine billige Arbeitskraft aus der weitläufigen Verwandtschaft kam da zum rechten Zeitpunkt. Es störte keinen, dass Bepperl gerade erst elf Jahre alt war und nicht besonders aufgeweckt erschien. «Bepperl, was treibst schon wieder, schlaf nicht ein! Du sollst das Blut rühren. Sonst gibt es nie und nimmer eine Blutwurst. Rühren, rühren und nochmals rühren. Nicht träumen. Schlafen kannst du in der Nacht! Wie oft soll ich dir das noch predigen, du Nichtsnutz. So wird nie etwas aus dir.»
Der Onkel war kein verträglicher Mensch. Wenn er Bepperl nicht mit Schimpfworten überhäufte, schlug er ihn mit allem, was ihm in die Finger geriet. Da war er nicht zimperlich.
Der schmächtige Bub schaute regungslos auf den Bottich, der vor ihm stand. Kaum hörbar versprach er, von nun an fleißig das Blut mit dem Holzlöffel umzurühren. Ihm gelang es nicht, sich in die Gedankenwelt der Erwachsenen hineinzuversetzen. Er hasste sie. Immer nur Beschimpfungen und Schläge. Er war hilflos und wütend und er schwor sich, es sämtlichen Leuten zu zeigen, später einmal, wenn er größer und stärker war. Die würden sich schon noch wundern, er würde sich an allen rächen.
Momentan musste er mit diesem tristen Leben auskommen. Er hatte an nichts Spaß, was anderen Kindern gefiel. War ohne Freunde und blickte meist missmutig ins Leere. Spielkameraden hatte er nie gefunden. Das tägliche Herummäkeln nagte an ihm, keinem im Haus konnte er es recht machen. Ihm blieb nichts anderes übrig, als sich weiter in sein Schneckenhaus zu verkriechen. Seit er denken konnte, wurde er herumgeschubst. Einzig seine Mutter hatte ihn gemocht und in den Arm genommen. Aber die war tot. Sie konnte ihm nicht mehr helfen, wenn er von anderen Kindern und Jugendlichen gehänselt wurde, und das kam häufig vor. War es seine Schuld, dass seine Haare einen Rotstich hatten, dass er spindeldürr war und nur sprach, wenn er unbedingt musste? Bepperl hatte einen Vorsatz. Er wollte stark sein, kräftiger als alle anderen. Er wollte seine Muskeln vergrößern. Dann konnte er der ganzen Welt zeigen: «Ich bin wer.» Jeder sollte sehen, dass er in der Lage war, sich zu wehren. Er wollte sich nicht mehr herumstoßen lassen. Die würden es früh genug noch merken, wenn seine Rache sie traf. Die Erniedrigungen und Einschüchterungen würde er sich nicht mehr lange gefallen lassen. Seinen Hass auf die Mitmenschen betrachtete er nicht als falsch oder gar niederträchtig. Nein, es war seine einzige Überlebenschance. Außer seiner Mutter gab es lediglich einen Menschen, den er von diesem Hass verschonte: Ein unschuldiges Mädchen, für ihn der Inbegriff von Schönheit. Er hatte sie in seinem Leben erst einmal gesehen. Sie war ebenso schweigsam wie er. Damals, als sie ihn im Heim mit ihrem Bruder besuchte. Diesen Bruder mochte er überhaupt nicht. Das war auch so einer, der ihn unablässig bevormundete, genauso wie die Schwestern in der Anstalt. Daran änderten auch die Geschenke nichts, die der Bruder immer wieder mitbrachte.
Niemandem in der armseligen Metzgerei war bisher aufgefallen, dass der belächelte Lehrling gerne Blut sah. Sobald er diese rote, dickflüssige Masse erblickte und rührte, fühlte er sich frei und kraftvoll. Er träumte von Schlachten und von Helden. Es kam nicht nur einmal vor, dass er in seinen Tagträumen vergaß, die aufgetragene Arbeit zu erledigen. Wenn er sich unbeobachtet wähnte, beugte er sich über den mit Schweineblut gefüllten Holzbottich und sog den Geruch des Blutes tief durch die Nase. Ein aufregender Duft für ihn und kein Gestank. Fließendes Blut war ein Symbol für den Sieg über seine verhassten Feinde. Hier in der Schlachterei war er der Herr des Blutes. Endlich auch einmal der Mächtige, der Sieger.
Wenn die Frau des Metzgers zum Essen rief und es Blutwurst mit Kraut und Pellkartoffel gab, fühlte sich Bepperl wie im siebten Himmel. Blut rühren und hinterher verspeisen, das erweckte in ihm kannibalische Vorstellungen. Der Genuss der Blutwurst war für ihn wie der Verzehr seiner Feinde. Er spürte die Kraft der Gegner, wie sie sich mit jedem Bissen in seinem Körper vermehrte.
Das Schlachthaus war für ihn der aufregendste Spielplatz. Das Schlachten einer Kuh bereitete ihm höllischen Spaß. Vor allem, wenn danach die Gesellen mit Kuhaugen Fußball spielten, hüpfte sein Herz vor Freude. Unvorstellbar, wie rasant diese Kugeln über den glitschigen Boden schlitterten. Ein ums andere Mal gab es dann blaue Flecken, wenn die Gesellen ihr Gleichgewicht nicht halten konnten. Ein mächtiger Spaß für alle.
Das geschah aber nicht oft, denn für gewöhnlich töteten sie Schweine. Ein Schlag mit der stumpfen Seite eines Beils auf die Stirnfläche einer Sau genügte, dass das sitzende Tier betäubt zusammenbrach. Wie gerne würde Bepperl über die Schwarte der erledigten Sau streichen. Aber er hatte Angst, von den anderen deswegen gehänselt zu werden. Sie wussten ja nicht, dass es nicht aus Mitleid geschah. Es gelüstete ihn danach. Er lechzte nach wohliger Erregung, die er sich bei der Berührung der noch warmen Schwarte der gerade verendeten Sau holte. Menschliche Berührungen kannte der junge Bepperl nur durch Schläge, Ansprache nur durch Beschimpfungen. Er lernte früh, dass es mit Gewalt und Erniedrigung immer noch besser zu leben ist, als gar nicht beachtet zu werden. Er kannte es nicht anders, es war sein Schicksal. Nach dem Schlag auf den Kopf der Sau war Eile geboten. Ein Geselle schob einen Holzbottich unter den Schädel und durchtrennte mit einem einzigen Schnitt die Halsschlagader. Für Bepperl bedeutete es den Höhepunkt der Schlachtung, wenn das Blut wie ein Sturzbach aus dem Hals sprudelte und damit alles Leben schwand. Seine Stunde war gekommen: Das warme Blut solange zu rühren, bis es erkaltet war. Danach erst konnte es weiter zur Blutwurst verarbeitet werden. Währenddessen bereitete sich der Metzger zum Abbrennen der Borsten vor. Er fackelte die Sau mit einem brennenden Strohbündel ab. Das war grundsätzlich die Arbeit des Meisters. Nur er beherrschte dies, ohne die Schwarte zu beschädigen. Das Abbrennen musste sich unbedingt im Freien abspielen und es durfte nicht regnen. Die Gefahr, das ganze Haus in Schutt und Asche zu legen, wäre zu groß gewesen. Regen hätte die Flamme zum Abfackeln der Sau gelöscht. Heute schien die Sonne, ein perfektes Wetter für ihr Vorhaben. Danach schlitzte der Metzger mit einem kurzen scharfen Messer hinter den Achillessehnen die Füße der Sau auf. Er führte ein dickes Seil durch die Öffnung und hängte mit zwei Gehilfen das Schwein an einen Balken, um es auszunehmen.
«Bepperl, wie lang willst du noch im Bottich rühren. Prüfe mal mit deinem Finger, ob das Blut schon kalt ist. Dann kommst her zu uns und hilfst beim Auswaschen der Därme. Und sau nicht so rum wie letztes Mal. Stinkst eh schon mehr als ein Mensch das aushalten kann.»
Bepperl schwieg wie immer. Innerlich aber kochte er vor Wut. Warum war ständig er das Ziel dieser hundsgemeinen Angriffe? Er hatte nie einem der Metzgergehilfen irgend etwas zuleide getan. Im Gegenteil, er versuchte jeden Tag, es allen recht zu machen. Seit er sich erinnern konnte, sah er sich stets in einer Ecke sitzen, kurz davor, von seinem maßlosen Zorn aufgefressen zu werden.
Später kamen Rachegelüste dazu. Dann war der Zorn schon leichter zu ertragen. Aber er fühlte sich ohnmächtig, er war ja dünn und schwach und konnte gegen die Metzgergesellen nichts ausrichten. Allein seine Träume von eigener Stärke und unbändiger Gewalt trösteten ihn – und gelegentlich noch der Gedanke an seine Mutter. Sie war die Ausnahme unter all den Menschen, mit denen er bisher zu tun hatte. Seiner Mutter hatte er blind vertraut. Aber sie war ja nicht mehr, war tot. Nur deshalb, weil sie mit so vielen Männern herumgemacht hatte. Über seinen Vater hatte er nie etwas erfahren. Weder die Mutter, noch andere aus seinem Umfeld, hatten je ein Wort darüber verloren. Ihn gab es einfach nicht. Die Schwestern im Waisenhaus hatte er auch nicht gemocht. Sie meckerten tagein tagaus an ihm herum. Bei seinen Halbgeschwistern wusste er nicht so recht, ob sie ehrlich zu ihm waren. Der Johannes hatte ihm nie Böses angetan, war ihm immer wohl gesonnen gewesen. Dennoch mochte er ihn nicht. Aber da gab es noch die Elisabeth. Sie war anders. Sie streichelte seine Seele. Seit er sie im Waisenhaus gesehen hatte, war sie Bestandteil in all seinen Träumen. Genauso stellte er sich seine Frau später einmal vor. Sie musste er haben, kostete es, was es wollte.
Bepperl war so intensiv in seinen Gedanken versunken, dass er nicht bemerkte, wie sich ihm von hinten ein Metzgergeselle näherte. Dieser abscheuliche Bursche fuchtelte mit dem Ringelschwänzchen der eben geschlachteten Sau schamlos vor seinen Augen herum. Damit nicht genug. Der fürchterliche Kerl nestelte auch noch an den Bändern der einzigen Hose, die er besaß, und versuchte, sie zu öffnen. Bepperl wurde jäh aus seinen Träumen gerissen. Was wollte diese ekelhafte Gestalt von ihm? Er wehrte sich mit aller Kraft. Das ging entschieden zu weit. Er verabscheute diese Intimität mit einem Mann. Er träumte von einer Frau. Von Elisabeth. Alles ließ er nicht mit sich geschehen. Doch der Metzgergeselle war stärker. Und wieder war er ohnmächtig und Spielball der Lust von solch widerlichen Gestalten. Nicht einmal seine intimsten Teile konnte er schützen.
Kapitel 3
Mit erhobenem Haupt und leuchtenden Augen standen Johannes und Michael in der Aula des Gymnasiums bei St. Stephan.
«Das hätten wir geschafft».
Beide strahlten um die Wette. Gerade war ihnen das Abiturzeugnis überreicht worden. Voller Stolz zeigten sie den Eltern das Ergebnis ihres jahrelangen Schuftens in der Schule. Dafür erwarteten sie Lob. Die Abiturienten blickten in die Augen des Adoptivvaters. Würde er reagieren? Bisher hatte er sich auffallend teilnahmslos verhalten. Hatten sie etwas falsch gemacht? Ihre euphorische Stimmung drohte zu kippen. Die vorzüglichen Noten lechzten doch nach Lob. Sie hatten dies ohne Frage verdient.
«Das ist eine beachtliche Leistung von Euch beiden. Herzlichen Glückwunsch. Seid ihr euch sicher, welchen Beruf ihr später ausüben wollt?»
«Du weißt ja, ich werde Medizin studieren. Und du Michi, hast du immer noch vor, Bauingenieur zu werden?»
«Ja, das möchte ich. Brückenbau würde mir gefallen.» Michael schaute zu seinem Vater, der nickte kurz und murmelte unverständliche Worte in seinen Bart. Dann antwortete er kaum vernehmlich: «Eure Mutter und ich werden uns verabschieden, wir sind müde. Es war ein aufregender Tag.»
Bevor beide Brüder antworten konnten, waren Mutter und Vater verschwunden. Sie hatten Johannes nach dem Tod seiner Eltern adoptiert. Aus Freunden waren Geschwister geworden. Elisabeth, die Schwester, lebte damals bei ihrer Freundin in einer Pflegefamilie und war erst seit dem Umzug der Familie des Posthalters nach Augsburg zu ihrem Bruder gezogen.
«Hannes, verstehst du den Vater? Was hat er denn?»
«Keine Ahnung, Michi, wir haben ihm nichts getan.»
«Es muss aber etwas passiert sein. Würde er sonst eine solche Reaktion auf unser tolles Abitur zeigen. Warum freut er sich nicht?»
Michael war verunsichert. Sein Vater war immer für ihn da gewesen. Er hatte stets dafür gesorgt, dass es ihm an nichts mangelte. Jetzt erwartete er Rat und Unterstützung bei der Suche nach einem Studienplatz. Doch der Vater hatte nur geantwortet, dass er müde sei und heimgehe. Mit einem Schlag fühlte er sich vom eigenen Vater im Stich gelassen. Er war plötzlich allein und einsam.
Kaum hatte der Posthalter die Aula des Gymnasiums verlassen, wandte sich seine Frau an ihn: «Kannst Du mir sagen, warum du zu den Buben so einsilbig und abweisend bist? Sie haben dir doch nichts getan. Im Gegenteil, mit dem ausgezeichneten Abitur wurden deine sehnlichsten Wünsche mehr als erfüllt. Ich verstehe dich nicht. In letzter Zeit wirst du immer griesgrämiger. Man kann dich bald nicht mehr aushalten. Bist du krank oder ist etwas Schlimmes passiert, von dem ich nichts weiß?»
Der Posthalter war irritiert. Er konnte sich nicht daran erinnern, dass seine Frau je in diesem Ton mit ihm gesprochen hätte. Da musste sich einiges in den letzten Jahren aufgestaut haben, dass sie sich derart empörte. Konnte sie in sein Innerstes blicken, sein Geheimnis lüften? Unmöglich! Nur zwei Menschen wussten Bescheid. Einer war tot und der andere würde sich hüten, darüber zu reden. Sein Geheimnis setzte ihm selbst immer mehr zu. Er konnte mit niemand sprechen und wurde immer wortkarger. Er ärgerte sich auch über seine Griesgrämigkeit. Schlummerte in ihm eine Krankheit? Diese Unsicherheit beschäftigte ihn mehr, als es ihm lieb war.
«Seit wann muss ich mich für mein Verhalten rechtfertigen? Soweit kommt es noch, dass ihr Frauen uns Männern vorschreibt, wie wir uns in der Familie benehmen sollen. Das ist alleine meine Sache und geht dich gar nichts an.»
Damit war für ihn die Diskussion beendet. Dass seine Frau noch mehr verärgert war, interessierte den Posthalter jetzt nicht. Er bemerkte es nicht einmal.
Johannes hatte im Gegensatz zu Michael mit seiner Freundin Marie einen festen Rückhalt. Sie war nach dem verheerenden Brand der elterlichen Mühle in Thierhaupten ins Augsburger Haus des früheren Postmeisters und Stiefvaters von Johannes gezogen. Dort wohnte sie mit Elisabeth, der Schwester ihres Freundes, in einem eigenen Zimmer. Mit Marie konnte Johannes seinen Kummer besprechen. Sie heiterte ihn auf, wenn er, wie jetzt nach der Abiturfeier, missgelaunt nachhause kam.
Johannes verbrachte nur noch einige Tage in Augsburg. Um in München Medizin studieren zu können, wollte er sich um eine Schlafgelegenheit in der Universitätsstadt kümmern. Er kannte München nicht und war etwas beklemmt bei dem Gedanken an ein Leben in einer ihm unbekannten Umgebung. Dazu kam noch die Sorge um die Trennung von seiner Marie. Mit der neuen Zugverbindung Augsburg nach München hatte er aber wenigstens die Möglichkeit, seine Freundin zu besuchen, wenn die Sehnsucht zu groß wurde.
Die Beziehung zwischen Michael und Elisabeth, der leiblichen Schwester von Johannes, war da wesentlich problematischer. Der tragische Tod seiner ersten Liebe Henriette ließ ihn nicht los. Elisabeth spürte das. Und sie hatte nicht vor, ewig zweite Wahl zu sein. In einem Zeitungsartikel hatte sie von Prostituierten in England gelesen, die sich gegen die männliche Dominanz stellten. Sie protestierten gegen ein Gesetz zu Zwangsuntersuchungen von Prostituierten zur Verhütung von Geschlechtskrankheiten. Sie fühlte sich auf der Stelle solidarisch mit diesen Frauen. Den Frauen zuhören und ihnen eine Stimme geben, das gefiel Elisabeth. Wenn sie und Michael ein Paar werden sollten, wollte sie ein gleichwertiger Partner sein. Denn die Zeiten würden sich ändern. Für die Eltern war es noch selbstverständlich, dass der Mann anschaffte und die Frau gehorchte. Elisabeth wollte das nicht mehr. Ihre Wünsche sollten Gehör finden. Und nicht nur bezüglich ihrer Rolle als Frau war sie einer Meinung mit Marie. Deshalb verstanden sic die beiden auch so blendend.
Michael akzeptierte ihren Standpunkt und zum Teil auch die damit verbundenen Erwartungen an ihren Partner. Es gelang ihm aber nur phasenweise. Seit dem frühen Tod seiner Freundin Henriette kämpfte er mit dem Problem der Nähe zu Frauen. Es war weniger die Angst vor Frauen als eine Hemmung, sich auf eine andere Person einzulassen. Er könnte sie ja wieder verlieren. In seinem Innersten wünschte er sich aber Nähe. Diesen Zwiespalt war er ausgeliefert, ohne eine Lösung zu finden. Er war ohne Orientierung und konnte es nicht zugeben. Das war auch der Grund, dass er sich tagtäglich weiter von seiner Familie und der Freundin entfernte. Er spürte in diesen Tagen die Einsamkeit und Betrübtheit, wie sie ganz allmählich, aber immer spürbarer in ihm hochkroch. Immer wieder plagten ihn Albträume. In ihnen erschien ihm seine geliebte Henriette, wie sie auf dem Totenbett liegt, geschwächt von unheilbarem Fieber. Er spürte die hitzige Hand des sterbenden Mädchens. Michael war verzweifelt. Die damaligen Geschehnisse ließen ihn nicht mehr los. Die Erinnerung daran war in den letzten Jahren nicht geringer geworden. Seine Familie und die Freunde versuchten vergebens, ihn abzulenken und zu beruhigen. Sie wollten ihn überzeugen, dass sein Schmerz mit der Zeit wieder weniger würde. Aber nichts wurde einfacher. Alles wurde nur noch schlimmer. Gab es überhaupt eine Lösung? Sollte er etwa mit seiner Familie brechen, die ihn an die Tragödie seines noch jungen Lebens erinnerte? Abstand, so fühlte er, war auf jeden Fall wichtig. Michael musste ohne fremde Hilfe sein weiteres Leben gestalten. War er aber dazu imstande? Am Verstand lag es nicht. Er hatte ja sein Abitur famos bestanden. Bisher hatte ihn die Schule und das viele Lernen von den trüben Erlebnissen abgelenkt. Der Wegfall dieser Aufgabe gab seinen Gedanken wieder Raum für die Erinnerungen an Henriette. Jede Nacht plagten ihn erschreckende Bilder in seinen wilden Träumen.
Johannes spürte die Verzweiflung seines Bruders. Es schmerzte ihn sehr, wenn er immer wieder feststellte, dass Michael alle Hilfe rigoros ablehnte. So verbrachte er die meiste Zeit mit seiner Freundin Marie, seiner Schwester Elisabeth und seinen Zukunftsplänen. Was