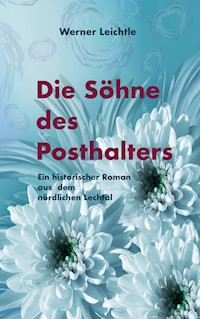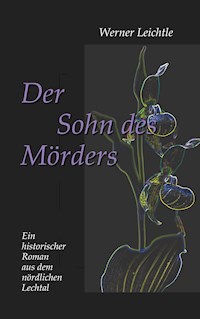Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Allgemeinarzt Dr. Werner Leichtle spürt auf dem Weg zu einer Hausgeburt kleine Veränderungen beim Schlucken. Bei einer späteren Untersuchung erfährt er, dass er Krebs hat. Nach mehreren Operationen, Chemotherapie und Bestrahlungen muss er sich über eine Sonde lebenslang ernähren. Essen und Trinken auf normalem Weg ist nicht mehr möglich. Fischen und Aquarellmalen füllen ihn nicht aus und so beginnt er eine Wanderung auf dem Jakobsweg von seinem Heimatort Meitingen über knapp 2600 Kilometer nach Santiago de Compostela. Ein sehr großes Wagnis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Siggi
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Ein jähes Ereignis bringt mich auf einen neuen Weg
Ein verheißungsvoller Beginn mit Alice
Neuland
Durch Orgelspiel finde ich Geborgenheit
Jähe Unterbrechung
Glück im Unglück
Alpenmilch und Schweigen
Ein junger Pilger will Rat
Ein Busfahrer hält mich zum Narren
Ein versöhnliches Ende
Die Reisevorbereitungen werden komplizierter
Fieber, kein Zimmer und kein Essen
Ungeahnte Hitze
Ein ekliges Paket
Hindernisse auf meinem Weg
Mein Schutzengel taucht auf
Gespräch ohne Worte
Plötzlich Winter
Der neue Schutzengel ist weiblich
Abschied
Vom Regen in die Traufe
Eine fürsorgliche Begleitung
Und schon wieder ein Abschied
Ein folgenschwerer Unfall
Herbergssuche
Abschied von Helmuth
Geht es auch alleine?
Ein technischer Defekt führt fast zum Knock Out
Unerreichbare Früchte
Hitze, Hitze und nochmal Hitze!
Ein Debakel
Zwei unerfreuliche und eine freudige Begegnung
Angriffslustige Hunde und Irrwege
Wenn der erste äußere Schein trügt
Unter baskischen Jägern
Endspurt zur spanischen Grenze
Die Pyrenäenüberquerung - ein Fiasko
Spektakel hinter Gittern
Der Sonne ausgeliefert
Besondere Begegnungen
Ein Bahnhofsplatz, der seinen Bahnhof verloren hat
Die Aschewolke
Schmerzen und Zweifel
Der Körper streikt
Cruz de Ferro
Die alte Frau und das junge Mädchen
Ein unterhaltsamer Aufstieg
Zudringliche Freundlichkeit macht wenig Freude
Eine schlaflose Nacht
Zu Dritt
Die Technik hält mich wieder auf Trab
Nach dem Irrweg ein freudiges Wiedersehen
Das Ziel - eine große Enttäuschung
Endlich angekommen!
Prolog
Warum schreibst Du ein Buch, das fragten mich viele, als ich ihnen erzählte, was ich vorhatte. Für sie war es völlig neu, dass ich mich literarisch betätigen wollte. Auch ich hätte es mir früher nie und nimmer vorstellen können, ein Buch zu schreiben. Meine Zensuren in Deutsch waren auf dem Gymnasium nie besser als durchschnittlich ausgefallen.
Aber jetzt nach meiner Erkrankung hatte ich ein großes Problem, das ich mit mir herumtrug. Dass ich auf normalem Weg nicht essen und trinken konnte, musste ich hinnehmen und das Beste daraus machen. Natürlich waren das große Einschränkungen in meinem Leben. Aber als schlimmer noch empfand ich es, dass mich, außer meiner Familie und ganz wenigen Freunden, die viel mit mir Kontakt hatten, niemand verstand. Die Stimme war einfach zu undeutlich und zu stark verändert.
Ich war nie eine Quasselstrippe, aber wenn es darum ging, meinen Standpunkt zu vertreten, konnte mich niemand davon abhalten, ihn auch zu artikulieren. Und es brachte mich in Rage, wenn ein Gegenüber die Unwahrheit verbreitete oder ich bemerkte, dass in einer Runde jemand ungerecht behandelt wurde. Jetzt musste ich untätig daneben sitzend mir alles anhören, ohne in die Diskussion eingreifen und meine Meinung äußern zu können. Ich versuchte zwar immer wieder mit zu diskutieren, indem ich meine Einwände schriftlich fixierte, aber das gelang nur sehr unbefriedigend. Wenn dann in großer Runde bei Freunden bei meinem Gegenüber auch noch Alkohol ins Spiel kam, war es für mich nicht mehr auszuhalten und ich verabschiedete mich oftmals vorzeitig. Das war dann für viele sehr ungewöhnlich, gehörte ich doch früher immer mit zu den letzten Gästen.
Ich aber wollte mich mitteilen. So viele Eindrücke, Erlebnisse, Gefühle, Ängste und Freuden, die ich erlebt hatte, konnte ich nicht für mich behalten. Ich könnte mir vorstellen, dass es einem ähnlich ergeht, wenn er den Jackpot im Lotto gewonnen hat und es niemandem erzählen kann. Oder wie es einem Kind ergeht, das morgens aufsteht und keiner gratuliert ihm zum Geburtstag, auf den es sich schon tagelang gefreut hat.
So war es nur zu naheliegend, alles in einem Buch schriftlich auszudrücken, was ich mit Gesprächen nicht schaffen konnte.
Ein jähes Ereignis bringt mich auf einen neuen Weg
Was, um Himmels willen, hat mich eigentlich dazu getrieben, mich auf diese Pilgerreise zu begeben. So beginnt Hape Kerkeling sein Buch: "Ich bin dann mal weg". Diese Frage habe ich mir auch oft gestellt.
Als mir einmal ein Kollege berichtete, er würde in seinem Urlaub alleine auf dem Jakobsweg in einer fremden Gegend in Nordspanien wandern, steckte mich seine Begeisterung sofort an. Ich konnte mir allerdings nur sehr schlecht vorstellen, meine Freizeit mit Pilgern zu verbringen, zumal ich zu diesem Zeitpunkt bereits krank war. Dass ich tatsächlich ein paar Jahre später selbst diesen Weg wandern würde, hätte ich nie gedacht.
Die Ursache war dann aber kein Burn-out oder die Suche nach Gott oder einem höheren Wesen. Es war auch keine Suche nach mir selbst. Es war einfach der Wunsch, nach einer schweren Krankheit und nach Beendigung meiner allgemeinärztlichen Tätigkeit mit einer Wanderung körperlich wieder fit zu werden. Ich wollte wissen, wie weit ich mich noch belasten konnte. Denn sportlich war ich schon immer. Basketball, Eishockey, Tennis, Fußball, Handball, überall fühlte ich mich wohl. Hauptsache, ich konnte viel laufen und war Teil eines Teams. Und eine gesellige Runde nach dem Sport gefiel mir schon immer.
Bis zu einem Tag Anfang Dezember 1985. Ich wurde zu einem dringenden Hausbesuch gerufen. Bei einer Hausgeburt war der Damm einer Erstgebärenden gerissen und musste genäht werden. Anscheinend wusste die Hebamme, dass ich im nahegelegenen Krankenhaus bei vielen Geburten mitgeholfen hatte. Obwohl die jungen Eltern nicht krankenversichert waren, fuhr ich sofort los. Auf dem Weg dorthin, auf der Fahrt vom Schwäbischen ins Bayerische. Direkt auf der Brücke über den Lech, der die Sprachgrenze ist, spürte ich beim Schlucken im Rachen ein Hindernis, als hätte ich einen Knödel verschluckt. Das Gefühl war schnell vorbei. Aber ich war alarmiert. Das musste abgeklärt werden.
Meinen Einsatz bei dieser jungen Mutter sehe ich heute noch deutlich vor mir: Den völlig überhitzten, abgedunkelten Raum. Den uralten Holzofen. Der Schäferhund, der aufgeregt zwischen der Mutter, der Hebamme und mir umher schlich. Die Stehlampe, die als Op-Lampe herhalten musste. Mich selbst, wie ich am Boden kniend die Mutter am Damm nähte. Die Schmerzen in den Knien, als ich mich nach erfolgreicher Arbeit wieder aufrichtete. Die dankbaren Eltern. Die Erleichterung in der herrlich frischen Luft, als ich nach der Schwüle im Zimmer wieder im Freien stand.
Mein Besuch bei einem Hals-Nasen-Ohrenarzt brachte nichts besonderes, ich musste ein Antibiotikum gegen die Entzündung im Rachen einnehmen. Ein Tumor konnte nicht festgestellt werden. Als nach den Weihnachtsfeiertagen die Beschwerden erneut auftraten, war ich mehr als beunruhigt. Ich ließ mir einen Termin in der HNO-Abteilung im Klinikum geben, um bei weiteren Untersuchungen die Ursache für meine Beschwerden zu erfahren. Da auch hier nichts Außergewöhnliches entdeckt werden konnte, wurde eine Computer-Tomographie angeordnet. Ergebnis: Ein wahrscheinlich gutartiger kastaniengroßer Tumor am Zungengrund. Zur Sicherheit wurde der Zunge eine Probe entnommen. Das Ergebnis sollte ich eine Woche später an einem Freitagabend nach meiner Sprechstunde erfahren.
Nach einer Woche wurde die Hoffnung zerstört, dass alles harmlos wäre und alles wieder seinen alten Gang nehmen würde. Am Abend erfuhr ich im Klinikum vom Chef der Abteilung und von seinem Oberarzt, dass der Tumor bösartig war und ich mit einer Chance von zehn Prozent meine Frau und meine drei Töchter im Alter von vier, elf und 13 Jahren noch 24 Monate erleben konnte. Gerade mal 39 Jahre war ich alt, als meine Welt zusammenbrach. Es brachen bei mir alle Dämme, ich weinte und es machte mir nichts aus, dass ich nicht alleine war.
Aber aufgeben kam nicht in Frage. Dem Professor hatte ich, nachdem ich mich wieder gefangen hatte, gleich gesagt: "Machen Sie mit mir, was medizinisch möglich ist, ich möchte überleben." Nach der Tumor-Diagnose waren wir alle am Boden zerstört. Die Feier zum 50. Geburtstag eines guten Freundes am selben Abend mussten wir vorzeitig verlassen, ich hatte keinen Bissen hinunter bekommen.
Eine Chemotherapie, die den Tumor verkleinern sollte, brachte nach vier Wochen keinen Erfolg. Und plötzlich musste alles ganz schnell gehen. Mein Vater, in der Zwischenzeit auch schon 70 Jahre alt, trat nach sechs Jahren wieder den Dienst in seiner ehemaligen Praxis an, um mich zu vertreten. Er wusste, was in mir vorging. Voraussichtlich viele Wochen oder sogar Monate würde ich nicht arbeiten können. Und danach? Daran wollte niemand denken. Bei einem Kurzurlaub in Ischia wollte ich binnen acht Tagen wieder fit werden für eine gewaltige Operation, die genau an meinem 40. Geburtstag stattfinden sollte. Einen Tag später als geplant war es dann soweit. Von jetzt an sollte nichts mehr so sein, wie es war.
Es folgten Operationen, Bestrahlungen. Dann wieder eine Operation, da der Tumor wieder zurückgekehrt war. Essen und trinken konnte ich nicht, alles musste über eine Nasensonde zugeführt werden. Außerdem konnte ich ausschließlich über einen Luftröhrentubus atmen. Nach vier Monaten konnte dieser wieder entfernt werden, ich konnte wieder normal atmen. Doch alles zeigte seine Spuren.
Die erste Operation hatte fast 14 Stunden gedauert. Dabei wurden der Tumor und viele Lymphknoten am Hals, die von Metastasen befallen waren, entfernt. Da der Defekt an der Zunge und dem Zungengrund so groß war, musste mit meinem Brustmuskel, der unter der Haut bis zur Zunge durchgezogen wurde, die Zunge neu modelliert werden. Als ich aufwachte, fand ich mich auf der Intensivstation wieder. Es dauerte, bis ich mich einigermaßen orientieren konnte. Bewegen konnte ich mich nicht. Ich war intubiert und wurde beatmet, Hals und Brust waren dick eingebunden und die Blase katheterisiert, alles war voller Schläuche und Kabel. Es waren nur kurze Momente des Wachseins. Ich war sehr unruhig und diese Unruhe verstärkte sich zusehends. Verständlich konnte ich mich nicht machen. Meine Unruhe wurde als Schmerz angenommen und die Therapie mit opiumhaltigen Schmerzmitteln ergänzt. Dies hatte wiederum zur Folge, dass ich fantasierte und schlimmste Alpträume durchlebte. Ich sah wilde Fratzen, die in Wäldern zwischen den Bäumen umherirrten und immer wieder auf mich zuflogen und versuchten, mich mit ihren langen Schnäbeln zu verletzen. Da ich an meinem Bett fixiert war, konnte ich auch nicht fliehen. Auch wusste ich bald nicht mehr, ob sich nicht doch alles in der Realität abspielte. Es war ein Horrortrip. Es dauerte lange, bis ich schriftlich klar machen konnte, dass ich die Opiate zur Schmerzbekämpfung nicht vertrug und mir diese starke Unruhe viel mehr zu schaffen machte als die Schmerzen. Eine knappe Woche verbrachte ich auf der Intensivstation, dann durfte ich wieder auf die allgemeine Station in die Welt, in der ich die Sonne wieder sah und auch selbst atmen konnte.
Zur Bestrahlung musste ich über sechs Wochen täglich zweimal in die Klinik. Aber ich merkte, dass es etwas aufwärts ging, aber auf sehr niedrigem Niveau. Dann der erneute Rückschlag. Der Tumor war wieder zurück. Da in Augsburg alle Möglichkeiten erschöpft waren, musste ich in die Universitätsklinik nach Erlangen. Zu meiner Freude erklärte mir mein Professor, dass er zur Op mit nach Erlangen komme und mich mit dem dortigen Kollegen zusammen operieren wolle. In dieser Operation sollten mir dann circa 60 Plastikröhrchen mit radioaktivem Material von außen durch den Hals in den Zungengrund gesetzt werden. Außerdem wurde der Kehldeckel entfernt und mir damit die Möglichkeit eines geordneten Essens genommen. Ferner wurde festgestellt, dass die Zungennerven ihren Dienst versagten und die Zunge nicht mehr bewegt werden konnte. Das alles nahm ich noch tapfer zur Kenntnis, aber es war nichts gegenüber dem, was dann kam.
Der Chef der Radiologie und Nuklearmedizin hatte sich viel Zeit genommen, um mit mir das weitere Procedere zu besprechen. Als ich ihm mitteilte, dass er es bei mir auch mit einer radikalsten Behandlung versuchen könnte, winkte er ab und gab mir zu verstehen, dass er dies bisher keinem seiner Patienten zugemutet hätte. Er sagte mir, ich müsste dann durch die Hölle gehen und das bei ungewissem Ausgang. Es bestünden keinerlei Erfahrungswerte, eine solch geballte Therapie wurde noch nie angewandt. Da ich Kollege war und so über die Konsequenzen Bescheid wusste, gab er meinem Drängen nach und veranlasste schließlich diese äußerste Behandlung. Und so geschah es, dass ich mich nach der Operation, gespickt mit den Röhrchen im Hals aussehend wie ein Igel, in einem winzigen Raum, nur mit Bett und großem Wandspiegel, wiederfand. Mit Katheter und Infusionen ausgestattet musste ich nun abgeschieden von der Welt in dem abgedunkelten Raum, der in der Klinik nur der Bunker genannt wurde, drei Tage lang still liegen und das strahlende radioaktive Material wirken lassen. Mir war da schon klar, dass dabei nicht nur die Krebszellen vernichtet wurden. Nach drei Tagen war ich am Ende. Bei meinem desolaten körperlichen Zustand kam jetzt noch diese Einsamkeit, die Verzweiflung und das Bangen um mein Leben dazu. Ich empfand es schlimmer als die Hölle, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Danach wurde mir eine Magensonde durch die Bauchdecke gelegt, durch die ich mich von nun an ernähren sollte. Die Hoffnung, dass dies nur vorübergehend wäre, währte nur kurz. Es wurden Jahrzehnte.
Alleine hätte ich diese Zeit in Erlangen nicht durchstehen können. Während dieser Zeit hatte ich immer meine Frau Siggi an meiner Seite, unterstützt von meiner Schwester Christa und meinen beiden Schwäger Günther und Manfred. Danach wurde ich im Klinikum in Augsburg weiter bestrahlt. Doch auch diese Zeit ging zu Ende. Am ersten Tag nach der Bestrahlung verfrachtete mich Siggi ins Auto und wir fuhren für sechs Wochen an die französische Riviera, wo ein befreundeter Kollege ein kleines Häuschen besaß, in dem ich mich erholen konnte. Das war bitter nötig. Ein Jahr vorher hatte ich bei einer Körpergröße von 187 Zentimeter immerhin noch 79 Kilogramm gewogen. Jetzt zeigte die Waage gerade einmal 51 Kilogramm an. Nun sollte die Magensonde dafür sorgen, dass ich ausreichend Kalorien und Nähstoffe zu mir nehmen konnte. Es war sehr gewöhnungsbedürftig. Mein ganzes Leben hatte ich immer gut und reichlich gegessen. Damit war nun Schluss. Nach all den Eingriffen war eine Ernährung über den Mund nicht mehr möglich. Das hatte ich ja schon vorher gewusst.
Aber statt einer Reha war ich nun mit Siggi an der Côte d’ Azur. Als sie in einem Restaurant eine Forelle in Mandelsplitter gebacken bestellte, roch diese so fantastisch, dass ich nicht widerstehen konnte. Ich nahm eine kleine Gabel mit etwas Fisch und führte sie zum Mund. Doch ich spürte nichts, ich schmeckte nichts. Noch bekam ich das Essen kaum aus dem Mund, weil die Zunge gelähmt war. Welch eine Enttäuschung.
Und an Enttäuschungen musste ich mich noch oft gewöhnen, denn ich konnte vieles nicht mehr so machen, wie ich es mir vorstellte. Zuerst war ich ungeduldig, doch bald musste ich einsehen, dass ich mit Geduld weiter kam und vor allem ein stressfreieres Leben haben konnte. Klingt ganz einfach, geduldig zu sein. War es nicht. Musste es aber.
Doch zunächst praktizierte ich wieder, schließlich hatte ich im Jahr meiner schweren Operationen und Behandlungen nichts verlernt. Meine Aussprache war sehr undeutlich geworden und hatte sich extrem verändert. Einige Patienten verstanden mich trotzdem problemlos. Ich ging langsam zu Werke, meine Arzthelferinnen und Siggi standen mir zur Seite, wenn es nötig war. Endlich wieder unter Menschen zu sein und ihnen helfen zu können, war eine große Befriedigung für mich. Es war eine göttliche Fügung, dass sich zu dieser Zeit ein junger Arzt nach dem Examen bei mir bewarb und in der Folgezeit eine große Hilfe wurde. Als wir dann auch noch eine Gemeinschaftspraxis gründeten, war ein großer Ballast von meinen Schultern gefallen.
Im Alter von 55 Jahren ging ich dann doch in Rente. Zu oft litt ich an bakteriellen Infekten, zu oft musste ich Antibiotika nehmen. Die Nähe und der intensive Kontakt mit kranken Menschen forderten ihren Tribut. Als ich dann nicht mehr praktizierte, reduzierten sich die Infekte zusehends. Und mein Partner wurde mein Nachfolger, er führte die Praxis fort, die ich von meinem Vater übernommen hatte.
Und so geschah es, dass ich mich nach einer Betätigung sehnte, die mir körperlich und geistig etwas von dem geben konnte, das mir durch den Wegfall des Berufes genommen worden war. Aquarell malen und Angeln genügten mir nicht mehr, ich brauchte mehr Bewegung. Ich erlernte das Golfspiel. Und das Golf spielen war wesentlich besser auf mich zugeschnitten als malen und angeln. Ein Entschluss, den ich nie bereute. Ich schaffte es sogar bis zu einem Handicap 16. Nachdem ich in Rente gegangen war, lernte ich Golfplätze auf der ganzen Welt kennen und spielte auf den schönsten Plätzen der Welt: An der Costa Brava, in Schweden, in Kapstadt, in Rom, in Südfrankreich, auf Hawaii und Mallorca. Aber nicht das Golfen, sondern das Spazierengehen mit meinem Hund führte mich auf die große Reise, die mein ganzes Leben verändern sollte. Schuld daran war ein Kollege.
Auch in der Rente wurde ich weiterhin zu den Dienstbesprechungen von den Kollegen eingeladen. Dabei erzählte mir ein befreundeter Arzt voller Enthusiasmus von seinem letzten Urlaub. Stets laufe er dabei ein paar Wochen auf dem Jakobsweg in Spanien, zu Ehren seines Namenspatrons Jakobus. Seine Begeisterung, alleine in fremder Umgebung zu laufen, steckte mich an. Besonders seine Schilderung, wie frei er sich nach den überstandenen Strapazen jedes Mal fühlte, weckte mein Interesse. Doch die Idee geriet völlig in Vergessenheit.
Als ich dann eines Tages mit meiner Retrieverhündin Alice unterwegs war, sah ich am Waldrand ein Wanderschild: Jakobsweg. Ich war wie elektrisiert. Dieses Schild ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Sofort fiel mir das Gespräch mit meinem Kollegen Jakob wieder ein und ich folgte diesem Wanderschild bis zur Burg Markt, in Gedanken schon auf einer Wanderung bis ins Allgäu. Zuhause angekommen, forschte ich im Internet nach der Route des Jakobswegs in Schwaben. Viel fand ich nicht, doch ich erfuhr, dass der Weg, den ich bereits ein Stück weit gelaufen war, über Augsburg, Bad Wörishofen, Ottobeuren und Weitnau nach Lindau führte. Als ich dann in einer Augsburger Bücherei eine Freizeitwanderkarte fand, in der der Jakobsweg eingezeichnet war, gab es kein Zurück mehr. An eine Wanderung nach Santiago di Compostela dachte ich zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch nicht. Doch das sollte sich noch ändern.
Das war genau das, was ich suchte. Für das Erste wollte ich mit Halbtagestouren von ein paar Stunden austesten, zu welcher Leistung ich überhaupt fähig war. Dabei stellte ich mir vor, fünf bis acht Kilometer, wenn es gut lief sogar zehn Kilometer zu schaffen. Ich hatte keine Vorstellung, wie viele Kilometer ich am Tag laufen konnte und wie lange ich dafür brauchen würde. Ich wusste nur, dass ich als Jugendlicher bei einem Schulwandertag auf den Thaneller (2340 Meter) in den Lechtaler Alpen bei Berwang 20 Kilometer gelaufen war. Danach war ich fix und fertig, obwohl ich jung und voll trainiert auf Bergsteigen war. Da gerade gutes Wetter herrschte, wollte ich am nächsten Tag mit dem Test meiner Fitness starten.
Ein verheißungsvoller Beginn mit Alice
Ich kann mich noch gut an diesen ersten Wandertag erinnern. Ich war furchtbar aufgeregt, wie dieser Tag wohl ablaufen würde. Bis zur Burg Markt war ich früher schon gelaufen, jetzt wollte ich von Markt nach Gersthofen durch das Schmuttertal auf dem Jakobsweg wandern. Ich überprüfte meine Nahrung. Ich hatte eine Gürteltasche um meinen Bauch geschnallt. Darin ein Beutel mit einer speziell auf künstliche Ernährung abgestimmten Mischung, die alle wichtigen Fette, Kohlenhydrate, Eiweise, Vitamine, Mineralien und Spurenelemente enthielt. Mittels einer Pumpe wurde diese Flüssigkeit durch eine durch die Bauchwand geführte Sonde in meinen Magen gepumpt. Auf diese Weise konnte ich in der Stunde ungefähr 200 bis 250 ml Nahrung und Flüssigkeit aufnehmen, gerade so viel, wie es mein Magen vertrug. Damals schaffte ich 2500 ml in zehn Stunden. Das waren 2500 kcal am Tag, die ich zu mir nehmen konnte. Damit musste ich auskommen. Ein Beutel fasste 500 ml. Eine Tagesration also vier bis fünf Beutel, jeder knapp ein Kilogramm schwer.
Problematischer war die Flüssigkeit. Ohne Schwitzen konnte ich gut mit der in den Beuteln enthaltenen Flüssigkeitsmenge leben, aber bei Hitze müsste ich zusätzlich Flüssigkeit zuführen. Aber hatte ich die nötige Zeit für den Transport durch die Sonde? Die Zeit war endlich, 250 ml - z.B. ein viertel Liter Apfelsaftschorle - in einer Stunde, das ging tagsüber maximal. Denn im Liegen konnte ich nichts zu mir nehmen, da bestand sofort die Gefahr, dass ich den Mageninhalt erbrechen musste. Dabei würde Magensäure in die Lunge gelangen. Die Konsequenz wäre eine fieberhafte Bronchitis, im schlimmsten Fall eine Lungenentzündung.
Was ich auch nicht wusste: Komme ich mit den Kalorien aus? Würde ich, wenn ich den ganzen Tag unterwegs war und große Hitze herrschte, meinen Flüssigkeitsbedarf decken können? Vom Golfspielen kannte ich diese Problematik, hier war ich oft an die Grenze des Machbaren gekommen. Das galt für einen halben Tag und ohne Rucksack, der bei einer mehrtägigen Tour mit meinem Essen über zwölf Kilogramm wiegen würde. Es waren viele Fragen, deren Antwort ich nicht kannte. Und das machte mich nervös. Ich musste besonnen mein Vorhaben starten und auch bereit sein, es jederzeit zu beenden, wenn es notwendig werden sollte. Meine Gesundheit, viel war ja nicht mehr vorhanden, musste oberste Priorität haben. Würde ich aber so vernünftig sein, die Tour abzubrechen, sollte es mir nicht so gut gehen? Fragen, Fragen, Fragen.
Die Strecke von Meitingen nach Markt war ich früher schon gelaufen, ich kannte sie gut und so startete ich am Vormittag an der Burg Markt in Richtung Augsburg. Als Begleitung hatte ich meine Retrieverhündin Alice dabei, die ganz aufgeregt die neuen Düfte aufnahm. Es war Sommer und mit der höher stehenden Sonne wurde es gegen Mittag immer wärmer. Da der Weg die Schmutter entlang führte, konnte sich Alice in dem kühlen Wasser erfrischen, während ich jeden noch so kleinen Schatten suchte, um Schutz vor der Sonne zu finden. Aber es gab hier wenige Bäume und so blieb es nicht aus, dass ich zu schwitzen begann und viel Flüssigkeit verlor. Auch Alice suchte immer öfter das kühlende Nass der Schmutter. Mit Fortdauer unserer Wanderung bemerkte ich, dass sie ebenfalls der Hitze Tribut zollen musste. Wir wurden immer langsamer und waren froh, nach über vier Stunden den mit Siggi vereinbarten Treffpunkt erreicht zu haben.
Zuhause angekommen, spürte ich jeden Muskel. Und ich hatte Durst. Ich wusste, dass ich jetzt warten musste, mindestens zwei Stunden, bis die 200 ml Wasser, die ich meiner Nahrung zugegeben hatte, ihre Wirkung zeigen würden.
Jeder weiß, wie schlimm Durst ist, vor allem, wenn reichlich Flüssigkeit vor einem steht, aber man nicht trinken kann, obwohl man es dürfte. Bei einem Verbot würde es vielleicht leichter fallen, nichts zu trinken. Aber damit musste ich zurechtkommen. Gewöhnen konnte ich mich nicht daran. Und so fiel es mir jedes Mal schwer, mich auf eine sportliche Belastung einzulassen, bei der ich schon vorher wusste, dass ich durch Schwitzen Flüssigkeit verlieren würde. Wie einfach und selbstverständlich war es früher, bei Durst einfach zur Flasche oder zum Glas zu greifen, und so lange zu trinken, bis der Durst vorüber war. Und nach ein paar Minuten fühlte man sich wieder gut. Alles war so selbstverständlich, als ich noch gesund war.
Am nächsten Morgen war zwar der Durst vorüber, jetzt spürte ich aber alle meine Muskeln und Gelenke. Aber ich hatte ein gutes Gefühl. Mich störten die Schmerzen nicht besonders, die waren ja nur vorübergehend. Und ich hatte vorher nicht trainiert. Mit einem Training sollte ich diese Beschwerden verhindern können. Ich nahm mir vor, mit Alice jetzt jeden Tag am Lech fünf Kilometer zu laufen und dadurch meine Muskeln aufzubauen und die Gelenke zu stabilisieren. Es war noch ein langer Weg vor mir, wenn ich mit schwerem Rucksack einen ganzen Tag bei Wind und Wetter unterwegs in fremdem Terrain bestehen wollte. Und ich träumte schon davon, zu Fuß auf dem schwäbischen Jakobsweg über Augsburg, Bad Wörishofen und Kempten nach Lindau zu wandern. An den gesamten Pilgerweg nach Santiago di Compostela dachte ich überhaupt nicht, das war für mich utopisch. Meine Wanderschuhe waren mindestens zehn Jahre alt und nicht wasserdicht. Da musste ich mir neue besorgen. Ich benötigte auch für größere Strecken einen anderen Rucksack, der das Gewicht schonend über den Rücken und Hüfte verteilte.
So hatte ich die folgenden Tage viel zu tun. Außerdem wollte ich den Wetterbericht verfolgen, um nicht wieder an einem heißen Tag zu laufen. Und so wartete ich auf kühlere Tage ohne die Gefahr, dass es gleich regnete. Da ich jetzt trainierte, hoffte ich, die nächste Etappe etwas länger ansetzen zu können. Weil es dann durch Augsburg ging, konnte ich jederzeit abbrechen, sollte es mir zu viel werden.
Es drehte sich alles nur noch um meine Wanderung. Alice fand dies herrlich, kam sie doch neuerdings täglich zu einem ausgedehnten Spaziergang. Die Etappe durch Augsburg schaffte ich schon besser. Zuerst entlang des Lechs und dann entlang der Wertach, es wäre eine herrliche Wanderung gewesen, aber die Strecke durch ganz Augsburg war fürchterlich. Schlechte Luft, harter Boden und dieser Lärm. Obwohl ich noch nicht viel gelaufen war, hatte ich mich schnell an diese Ruhe in der unberührten Natur gewöhnt. Das war es, was ich wollte. Die Spaziergänger, die mir begegneten, störten mich nicht so sehr. Aber ich merkte schnell, dass ich mich wohler fühlte, allein auf meinem Weg zu sein. Dieses Mal konnte ich fünf Stunden laufen und war nicht so müde und erledigt wie am ersten Tag. Ich spürte zwar am nächsten Tag noch meine Muskeln, aber lange nicht so intensiv. Das Training zeigte Wirkung. Jetzt wollte ich mit Rucksack einen ganzen Tag wandern. Wollte sehen, ob meine Kondition und meine Nahrung für solch eine Unternehmung ausreichend waren. Ich war zuversichtlich, dass ich das schaffte.
Und meine Freude war groß, als ich die Strecke vom südlichen Augsburg bis nach Konradshofen geschafft hatte. Ich war den ganzen Tag unterwegs, hatte im Rucksack meine Nahrung und die für Alice problemlos transportiert und war stolz wie ein kleines Kind, das zum ersten Mal auf einem Fahrrad fährt. Das waren ungefähr dreiundzwanzig Kilometer, die ich geschafft hatte. Ich kann mich nicht erinnern, jemals eine so weite Strecke an einem Tag gelaufen zu sein.
An diesem Tag bin ich wenigen Menschen begegnet und ich wanderte fast nur auf Naturwegen. Es war ein sehr abgelegenes Gebiet und Siggi hatte Probleme, mich zu finden, als sie mich abholte. Deshalb wollte ich nur noch einmal einen Tagesmarsch machen und dann über mehrere Tage mit Übernachtungen die weitere Strecke angehen.
Diese letzte Tagesetappe nach Bad Wörishofen hatte es dann in sich. 32 Kilometer mussten bewältigt werden. Ob ich das alleine wagen sollte? Ich überlegte und kam zu dem Entschluss, einen Freund, der auch gerne wanderte, zu fragen, ob er mich begleiten wolle. Ich hatte Glück, er freute sich darauf, mit mir diesen Streckenabschnitt zu wandern.
Und es wurde eine harte Etappe. Georgs Frau Uschi sollte uns an unserem Ziel in Bad Wörishofen abholen und nach Konradshofen zurückfahren, wo wir unser Auto abgestellt hatten. Der Weg wollte nicht enden. Meine Füße und Georgs Knie schmerzten. Dazu kam noch ein Zwischenfall. Ein Bauer fuhr mit einem Güllefass entlang des Weges und drohte uns mit Gülle zu besprühen. Nur durch einen kleinen Spurt konnten wir diesem Anschlag entrinnen. Aber Alice weigerte sich, schneller zu laufen, die Gerüche waren zu einladend. Dafür musste ich Alice anschließend in der nahen Wertach baden, um den größten Gestank zu beseitigen.
Von dieser Wanderung musste ich mich einige Tage erholen. Aber meine Ernährung war ausreichend gewesen, auch die Flüssigkeit hatte gepasst. Und Alice war auch froh, ein paar Tage Ruhe zu haben. Georg konnte ich aber nicht mehr zu einer weiteren Tour überreden, das alles war zu viel für seine Kniegelenke.
Beflügelt von der Wanderung über 32 Kilometer entschloss ich mich, das nächste Mal die Etappe auf drei Tage auszudehnen. Es bestand nur das Problem, nicht zu lange Tagesstrecken auszusuchen. An deren Ende sollte auch eine Unterkunft für eine Übernachtung sein. Außerdem sollte das Wetter nicht zu warm aber auch nicht zu sehr verregnet sein. Außerdem musste ich mich auch auf einen schweren Rucksack einstellen, da ich das Essen für mich und Alice für drei Tage transportieren musste. Für Alice benötigte ich auch ein Gefäß zum Fressen und Trinken, das nicht zu groß und zu schwer sein durfte.
Als ich dann den Rucksack auf die Waage stellte, wurde es mir ganz mulmig. Die Waage zeigte ein Gewicht von über zehn Kilogramm an. Und das fühlte sich schon sehr schwer an. Ob ich diesen Rucksack über drei Tage tragen konnte, schien mir plötzlich äußerst zweifelhaft. Mutete ich mir zu viel zu? Zum ersten Mal hatte ich Angst vor meiner Courage. Aber wenn ich es nicht ausprobierte, konnte ich nicht erfahren, was in mir steckte. Und das wollte ich unbedingt wissen, ohne mich gesundheitlich zu schädigen.
Neuland
Auch wenn ich mir immer wieder Mut machte, ich war schon noch etwas ängstlich. Johannes, der Sohn von Freunden, erklärte sich bereit, mich nach Bad Wörishofen zu fahren. Siggi wollte mich dann in Wiggensbach bei Kempten wieder abholen. Das Wetter war nicht gerade einladend, als wir starteten. Und in Bad Wörishofen begann dann ein richtiger Landregen. Sollte ich unter diesen Bedingungen überhaupt laufen? Ich entschied mich, keinen Rückzieher zu machen und machte mich mit Alice auf den Weg, der identisch mit dem Kneipp-Wanderweg war. Erschwerend zum Regen kam die Tatsache, dass ich von Osten nach Westen lief und damit immer wieder Flusstäler queren musste, die das Wasser von den Alpen zur Donau transportierten, dem einzigen Fluss in Alpenvorland, der von West nach Ost fließt. Und so musste ich ein ewiges Auf und Ab bewältigen. Alice machte das weniger aus. Freude kam auf, als der Regen nachließ und sich ab und zu die Sonne blicken ließ. Als dann der Markt Rettenbach vor uns lag, war schönstes Wetter, die Sonne schien von einem herrlich blauen Himmel. Wir steuerten einen schönen Gasthof an, in dem rege Betriebsamkeit herrschte. Ich fragte nach einem Zimmer, aber das Wirtshaus hatte keine Zimmer. Es gab im Ort nur ein Privatzimmer, aber dessen Wirtin war im Urlaub, wie ein Telefonat ergab. Die nächste Übernachtungsmöglichkeit gab es im über zwei Kilometer entfernten Engetried.
Normalerweise sind zwei Kilometer ein Klacks, aber nach 29 Kilometer zu Fuß und einer jetzt brennenden Sonne war es für mich eine große Herausforderung, die bewältigt werden musste. Aber auch die schafften Alice und ich.
Der Gasthof war bei ein paar Häusern im Dorf schnell gefunden und ich sehnte mich nach einer Bleibe, wo ich mich von den heutigen Strapazen erholen konnte. Als die Wirtin uns zwei sah, schüttelte sie erst einmal den Kopf und zeigte auf die schmutzige und nasse Kleidung sowie auf Alice, die tatsächlich von oben bis unten voller Dreck war. Ich bot der Wirtin an, Alice zu waschen. Daraufhin verschwand die schon ältere Frau hinter der Türe und stellte mir einen Kübel Wasser mit Bürste und Seife vor die Füße. Nach der Säuberung wollte sie mir ein Zimmer geben.
Dass ich im Gasthof nichts essen wollte, verstimmte erstmal die Wirtin. Als sie dann meine Geschichte erfuhr, wurde ich von ihr richtig umsorgt. Sogar Alice profitierte davon und bekam von der Küche überreichlich zu fressen. Trotz Müdigkeit und Kraftlosigkeit fühlte ich mich wohl, es war ein richtig schönes Gefühl, eine solche Leistung erbringen zu können. Würde es am nächsten Tag wieder so sein? Erneut Probleme mit dem Wetter und der Unterkunft geben?
Ich hatte mit dem Wetter Glück. Es war angenehm zum Wandern. Der Muskelkater verschwand nach kurzer Zeit und es machte Spaß, auf Wanderwegen die Natur zu genießen. Ich fand auch eine schöne Unterkunft, die nur einen kleinen Nachteil für Alice hatte. Sie war nur über eine Außentreppe aus Gitterrosten erreichbar. So konnte ich Alice nur mit einem Wiener Würstchen, das ich vor ihrer Nase hertrug, überzeugen, mir zu folgen.
Der Morgen des nächsten Tages zeigte sich von seiner schönsten Seite. Blauer Himmel, kein Wind und angenehme Frische. Dazu wunderschöne Wege entlang der Iller und vorbei an der Naturbühne in Altusried. Leider mussten wir den letzten Teil der Strecke auf geteerten Straßen laufen. Da es zwischenzeitlich sehr warm geworden war, heizte der Teer so richtig auf. Die Folge war, die Fußsohlen wurden nach jedem Schritt wärmer. Das spürte Alice ganz besonders und versuchte, so gut es ging, am Straßenrand im Gras zu laufen, zwischenzeitlich schon drei bis vier Meter hinter mir. Und ich war nicht schnell unterwegs. Es wurde Zeit, am Ziel anzukommen. Obwohl die Aussicht auf die Allgäuer Berge wunderschön war, freute ich mich auf das Ortsschild von Wiggensbach. Endlich war ich angekommen, nach drei Tagen und über 70 Kilometer zu Fuß, bei Regen und sengender Sonne, aber zutiefst zufrieden. Was wollte ich mehr. Jetzt war ich zuversichtlich, auch längere Strecken bewältigen zu können.
Auf Siggi, die uns abholen wollte, mussten wir noch etwas warten, sie hatte sich verfahren. So blieb Alice und mir noch etwas Zeit, uns von den Strapazen des heutigen Tages zu erholen. Am Marktplatz fanden wir ein schönes Plätzchen auf einer Bank, von der aus wir den vielen Urlaubern zusehen konnten, wie sie ihren Durst bei Eis und Fruchtsäften stillten. Bitter für mich, der nur zusehen konnte.
Ich musste noch etwa zwei Stunden warten, bis meine Ernährungspumpe die Flüssigkeit in meinen Magen pumpte und mein Durst wenigstens ein klein wenig gestillt war. Ob ich mich daran wohl gewöhnen konnte? Ich hatte meine Zweifel. Der Trubel mit den vielen Menschen und die Lärmkulisse in dem Ort irritierten mich etwas. Den ganzen Tag war ich alleine mit Alice, die ein perfekter Wegbegleiter war, da ich mich nicht unterhalten musste, besser gesagt, unterhalten konnte. So war es wie die Tage vorher eine schweigsame Wanderung, bei der mir immer mehr Dinge in den Sinn kamen. Unter Menschen waren wir nur am Ende eine Tages, wenn ich ein Bett für die Nacht suchte. Ich gewöhnte mich an diese ruhigen Stunden und genoss sie.
Mein nächstes Ziel würde nun von Wiggensbach über Weitnau und Weiler zum Pfänder bei Bregenz am Bodensee sein. Dann könnte ich bei meinem Schwiegervater in Weitnau übernachten und von dort meine Tagestouren starten. Das wollte ich aber erst im September angehen, wenn es nicht mehr so warm werden würde. So hoffte ich jedenfalls. Ich wollte so großer Hitze auf der immer bergigeren Strecke aus dem Weg gehen.
Wieder zuhause musste ich erst einmal regenerieren. Nach ein paar Tagen begann ich wieder mit meinem Training entlang des Lechs. Ich versuchte täglich, in einer Stunde fünf Kilometer zu laufen. Anfangs hatte ich dabei noch Rückenprobleme, die sich aber nach einer Woche gaben. Es war schon erstaunlich, wie schnell ich durch körperliches Training richtig fit wurde.
Dann war es wieder soweit. Bei schönem, nicht zu warmen Wetter wanderte ich von Wiggensbach über die Hochmoore nach Weitnau. Dabei musste ich über Rechtis auf die Hub aufsteigen, die in über 1100 Meter Höhe lag. Ein wunderschöner Weg, der hinter jeder Ecke neue Ausblicke auf die Allgäuer Alpen eröffnete. Links und rechts begleiteten uns die Schellen des Allgäuer Fleckviehs, es war einfach schön.
Der sich anschließende Höhenweg über dem Weitnauer Tal war dann der Höhepunkt dieser heutigen Wanderung, die beim Abstieg ins Tal nur durch die mit Glasscherben übersäten Wege getrübt wurde. Waldbauern hatten diese Glasscherben ausgebracht, um Mountainbiker abzuhalten, hier ihren Sport auszuüben. Ich hatte mit meinen festen Sohlen kein Problem, aber für Alice war es brandgefährlich. Dennoch kamen wir Gott sei Dank ohne Schaden in Weitnau an.
Bis zum Pfänder in Bregenz wurde das Gelände von Kilometer zu Kilometer immer bergiger und zugleich auch schöner. Dabei traf ich nur vereinzelt auch Menschen, die meiste Zeit war ich mit der Natur und Alice alleine. Ich wurde immer ruhiger. Hatte ich für mich vorher immer Zeitpläne gemacht, wann ich ein Ziel erreichen wollte, so wanderte ich jetzt nur auf den Weg achtend, bis ich mein Ziel erreicht hatte.
Nur einmal passte ich nicht auf und stand vor einem Weidezaun, der Weg war zu Ende. Als ich einen alten Bauern, der in der Nähe mit seiner Sense Gras für seine Tiere mähte, nach dem Weg zum Pfänder fragte, wurde es für beide problematisch. Da er mich nicht verstand, zeigte ich ihm auf der Karte mein Ziel. Dann verstand er mein Anliegen, aber ich nicht seine Antwort. Dieses allgäuerisch war mir völlig unverständlich. Zuletzt versuchte ich seinen wild gestikulierenden Armen zu folgen. Ich ahnte dann, in welche Richtung ich gehen sollte. Leider einen sehr steilen Hang hinauf, ohne einen richtigen Weg zu sehen. Der Hang war so steil, dass ich mich mit meinen Wanderstöcken teilweise hinaufhangeln musste. Alice hatte weniger Probleme, aber auch sie legte immer wieder Pausen ein. Die Mühe aber lohnte sich. Oben angekommen, fanden wir den offiziellen Weg zum Pfänder.
Anfangs wurde ich stark irritiert von den Zeitangaben auf den Wegweisern zum Gipfel des Pfänder. Obwohl Alice und ich bereits eine Stunde auf diesem Weg gelaufen waren, zeigten die vielen Hinweisschilder jedes Mal noch zwei Stunden bis zum Ziel. Sehr merkwürdig. Da man unterwegs den Gipfel nicht sehen konnte, war ich dann erstaunt, als wir plötzlich zusammen mit vielen Touristen, die von allen Seiten zusammenströmten, auf dem Gipfel standen. Dieser Trubel war mir doch zu viel. Der fantastische Blick auf den Bodensee, dessen Wasser am Horizont mit dem Blau des Himmels verlief, auf den Hafen und die Insel Lindau konnten mich nicht davon abhalten, in die Gondel zu steigen und nach Bregenz zu schweben. Ich kam mir vor, als würde ich in einer anderen Welt ankommen.
Dieses Mal war ich am Ziel weit weniger geschafft als die Tage zuvor. Das Training hatte sich also ausbezahlt und machte mich mutig, weiter durch die Schweiz zu laufen. Mir war dabei schon klar, dass es hier etwas anspruchsvoller war, wesentlich mehr Anstiege und Abstiege und weiter von zuhause entfernt, falls sich ein Zwischenfall ereignen sollte.
Ich war wie immer optimistisch, besonders nach dieser Wanderung und hoffte, dass ich nicht zu viel Respekt und Angst vor den Belastungen der nächsten Etappen haben würde. Außerdem kam noch hinzu, dass ich Anfahrt, Übernachtungen und die Organisation meiner Ernährung bis ins kleinste Detail planen musste. Denn darauf los zu laufen, wie ich es als Gesunder gerne getan hätte, kam ja nicht in Frage. Zu zerbrechlich war mein gesundheitlicher Zustand. Ich wollte mir nicht vorstellen, plötzlich ohne Nahrung da zu stehen und ich wusste auch nicht, wie sich die Menschen verhalten würden, wenn ich mit meiner nur schwer verständlichen Aussprache nach dem Weg fragen würde oder mit einem mit meinem Wunsch beschrifteten Zettel auf sie zukam. Bis jetzt hatte ich erst einmal fragen müssen, das war kompliziert genug, aber es hatte funktiotioniert.
Durch Orgelspiel finde ich Geborgenheit
Ich wartete im Herbst 2004 eine Schönwetterperiode ab und fuhr dann mit dem Auto nach Herisau nahe St. Gallen. Beginnen wollte ich meine viertägige Tour in Rorschach, dem früheren Stadthafen von St. Gallen. Herisau hatte ich als zentralen Ausgangspunkt für meine sternförmige Wanderung ausgewählt, da ich von hier aus mit dem Zug alle Ausgangs- und Endpunkte meiner Tagesetappen erreichen konnte.
Wohnen konnte ich bei einer Schneiderin für Berufskleidung, die nebenbei auch noch die Kartonagenfirma ihres verstorbenen Mannes weiterführte. Außerdem betrieb sie eine kleine Pension, hauptsächlich für Zeitarbeiter aus Deutschland, die bei einer Baufirma als Zimmerer arbeiteten. Hier in der Schweiz war ihr Verdienst um vieles höher und es war ihnen freigestellt, jederzeit in ein festes Arbeitsverhältnis zu wechseln. Ich hatte mir diese Pension nicht nur wegen der günstigen Zugverbindung ausgesucht. Dadurch, dass ich täglich heimkam, musste ich nur für einen Tag Verpflegung mit meinem Rucksack transportieren. Das sollte sich als äußerst vorteilhaft erweisen, da ich täglich viele Höhenmeter bewältigen musste.